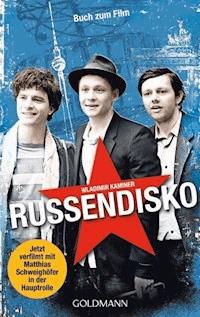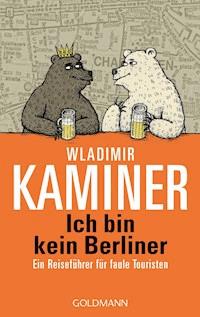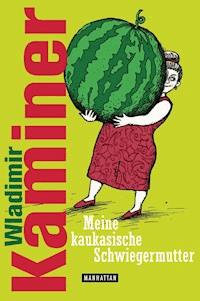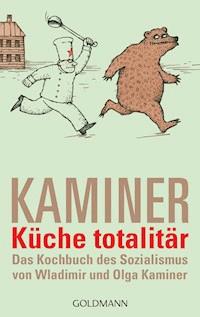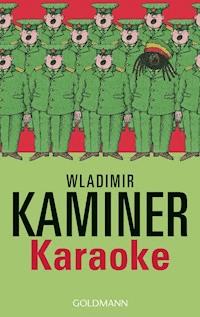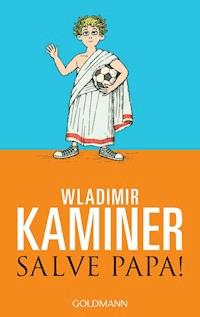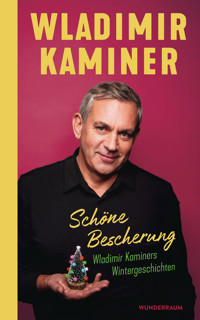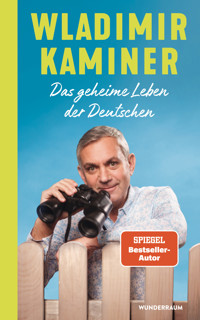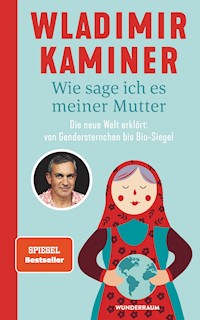9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was haben Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und Pilzsaison gemeinsam? Sie existieren gleichzeitig und schaffen damit eine Normalität, die vielen nicht ganz normal erscheint. Und doch haben wir uns irgendwie darin eingerichtet. Tatsächlich war die Sorge, der Himmel könne uns auf den Kopf fallen, hierzulande schon immer weit verbreitet. Dabei liegen die Herausforderungen des Lebens oft in der Suche nach dem Ladekabel oder einem Tenor mit neun Buchstaben. Ein Glück, dass es einen Chronisten gibt, der diese eigenartige Situation mit Humor beschreibt und mit unbeirrbarem Optimismus zu verstehen versucht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Was haben Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und Pilzsaison gemeinsam? Sie existieren gleichzeitig und schaffen damit eine Normalität, die vielen nicht ganz normal erscheint. Und doch haben wir uns irgendwie darin eingerichtet. Tatsächlich war die Sorge, der Himmel könne uns auf den Kopf fallen, hierzulande schon immer weit verbreitet. Dabei liegen die Herausforderungen des Lebens oft in der Suche nach dem Ladekabel oder einem Tenor mit neun Buchstaben. Ein Glück, dass es einen Chronisten gibt, der diese eigenartige Situation mit Humor beschreibt und mit unbeirrbarem Optimismus zu verstehen versucht …
Autor
Weitere Informationen zu Wladimir Kaminer sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches und unter www.wladimirkaminer.de.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Wunderraum-Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Originalveröffentlichung August 2023
Copyright © 2023 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung, Konzeption und Illustration:
Hafen Werbeagentur, Hamburg
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30399-0V002
www.wunderraum-verlag.de
Inhalt
100 Sekunden vor dem WeltuntergangDer Urlaub versaut
99 Sekunden vor dem Weltuntergang Hirn essen in Herxheim
98 Sekunden vor dem Weltuntergang Putin
97 Sekunden vor dem Weltuntergang Russenkorsos
96 Sekunden vor dem Weltuntergang Der Fluch der traditionellen Familie
95 Sekunden vor dem Weltuntergang Auf dem Weg zu anderen Galaxien
94 Sekunden vor dem Weltuntergang In der Kalahari
93 Sekunden vor dem Weltuntergang Gott sei Dank, Kasachstan
92 Sekunden vor dem Weltuntergang Die Russen trinken Tee
91 Sekunden vor dem Weltuntergang Der erste Schnee
90 Sekunden vor dem WeltuntergangTschaikowsky
89 Sekunden vor dem Weltuntergang Prinzen, Helden, Soldaten
88 Sekunden vor dem Weltuntergang Der Preis des Glücks
87 Sekunden vor dem Weltuntergang Friedenspflaster Berlin
86 Sekunden vor dem Weltuntergang Die Narren im Karneval des Krieges
100 Sekunden vor dem WeltuntergangDer Urlaub versaut
Die meisten Menschen in meiner Umgebung tragen Brillen, und sie teilen sich in Optimisten und Pessimisten. Die weitsichtigen Optimisten schauen gern in die Ferne. Sie glauben, dass die Welt sich unaufhaltsam verbessert, egal was passiert. Alles, was mit uns geschieht, ist ein Fortschritt. Mit jedem neuen Krieg, mit jeder Revolution oder jedem Aufstand erobert sich die Menschheit ein bisschen mehr Freiheit, mit jedem neuen Job entsteht mehr Wohlstand, und jeder Verlust schenkt einem zum Ausgleich ein Stück Weisheit und Gelassenheit.
Die anderen, die kurzsichtigen Pessimisten, sehen die Menschheit auf dem absteigenden Ast und die Vernunft als zur Neige gehende Requisite. In ihren Augen schwebt die Menschheit ständig über einem Abgrund. Sie balanciert auf einem dünnen Seil, gestrickt aus Eitelkeit und Neid – unmöglich, darauf die Balance zu halten. Jeder Versuch, das Zusammenleben einigermaßen vernünftig zu organisieren, ist vergeblich, jedes neue Projekt zum Scheitern verurteilt, und jeder neue Tag auf dem Planeten ist ein Geschenk, das wir nicht verdient haben. Diese Menschen tragen die Weltuntergangsuhr quasi am Handgelenk.
Ich bin der Meinung, wir tun es unserem Planeten nach: Wir drehen uns im Kreis. Dadurch ist es mal kalt und stockfinster, mal heiß und hell. Wir sind Pflanzen mit Beinen, auch unser Lebenslauf wird von den Jahreszeiten geregelt, zumindest bei Menschen in meinem Beruf. Die Rhododendren blühen im Mai, die Chrysanthemen im September, und die Bühnenkünstler tragen ihre Blüten im Winter auf die Bühnen. Traditionell sind die Wintermonate für Künstler die Hauptblütezeit. An zweiter Stelle kommt der Sommer, denn der ist in Deutschland immer ein »Kultursommer«. Doch am liebsten gehen die Menschen zu Lesungen und in Konzerte, wenn es draußen dunkel und kalt ist. Deswegen war ich die letzten Jahre im Dezember und Januar pausenlos unterwegs und machte dann im Februar reichlich Urlaub, am liebsten dort, wo es warm war.
Die Nachricht vom Krieg hat uns daher in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria, erreicht. Die russische Armee war über die ukrainische Grenze marschiert, und die Bevölkerung Russlands stand angeblich geschlossen hinter ihrer Führung. Sie begrüßte die »Spezialoperation«, wie der russische Präsident seinen Krieg nannte. In einer einstündigen Fernsehansprache versuchte er, die Gründe für den Einmarsch und seine Ziele zu formulieren.
»Der Krieg des Westens gegen Russland und die Sanktionen waren unvermeidlich. Um meine Entscheidung zu erklären, muss ich weit ausholen, in die Geschichte unserer Heimat«, begann er seine Ansprache. Menschen, die ihn kannten, wussten, dass das kein gutes Zeichen war. Wenn der Präsident ausholen muss, bedeutet das, dass er selbst von seiner Entscheidung überrascht ist. Er sorge sich um die Ausdehnung der NATO, wolle mehr Anerkennung für die russische Welt auf dem Planeten, mehr Autorität für sein Land in Europa erreichen und außerdem die russische Sprache in der Ukraine und die russischsprachigen Bewohner in der Ostukraine schützen. Es ginge darum, das ukrainische Volk aus der amerikanischen Knechtschaft zu befreien und die wirtschaftliche Kompetenz seines Landes auszubauen.
Der Anti-Midas war voll in seinem Element. Jedes Gold, das er anfasste, verwandelte sich beinahe automatisch in Scheiße. Schon damals ahnte ich, was mit seinen »Zielen« passieren würde. Er würde genau das Gegenteil erreichen: Finnland und Schweden geben ihre Neutralität auf und wollen der NATO beitreten, die sich noch enger um Russland schlingt. Die russische Sprache und Literatur werden aus den Unterrichtsplänen der Ukraine verbannt, und die russische Wirtschaft nähert sich dem Kollaps. Die Sanktionen des Westens schließen das Land aus jenem Ressourcenmarkt aus, an dem sich der Kreml jahrelang dumm und dämlich verdient hatte, und alle Männer in den russischsprachigen Gebieten von Donezk und Luhansk werden im Krieg als Erste verheizt. Ihnen bleibt nur die Wahl zwischen Flucht oder Tod. Wäre Putin ein CIA-Agent, könnte er in Langley stolz vermelden: Russland ist am Ende. Auftrag erfüllt.
Überall auf der Welt waren die Menschen über Russlands Kriegstreiberei empört. Von Neuseeland bis Norwegen befestigten sie ukrainische Flaggen an Balkonen und Hausfassaden und gingen auf die Straße, um zu demonstrieren. In Las Palmas hatte es zeitgleich mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine zu regnen begonnen, mitten im Februar, in der schönsten Urlaubssaison. Aber auch hier fand eine Antikriegsdemo statt, der sich meine Frau und ich anschlossen. Zwei Stunden lang hielten die Menschen im strömenden Regen Reden auf Spanisch und winkten mit ukrainischen Flaggen. Neben uns standen mehrere Ukrainer und Ukrainerinnen, die mitten im Urlaub vom Krieg überrascht worden waren.
»Was soll ich denn jetzt tun?«, fragte mich eine junge Frau, Swetlana, auf Russisch. Sie war klatschnass, eindeutig für den Strand angezogen, und trug ein Babytragetuch am Bauch, in dem ein ziemlich großes Kind hing. Swetlana aus Charkiw hatte zwei Wochen Urlaub gebucht, das Hotelzimmer war nur noch bis zum nächsten Tag reserviert. Jetzt hatte sie erfahren, dass ihre Stadt von der russischen Luftwaffe bombardiert wurde und russische Panzer an der Stadtgrenze standen.
»Komm auf gar keinen Fall zurück!«, befahl ihre Mama am Telefon. »Bleib, wo du bist!«
Swetlana wirkte verloren. Sie hatte doch bloß ein wenig Sonne tanken und am Strand liegen wollen. Stattdessen stand sie nun in Badelatschen und Bikini auf einer verregneten Antikriegsdemo mitten in Las Palmas.
»Was soll ich nur tun?«, wiederholte sie immer wieder.
Ich wusste es auch nicht. »Hören Sie auf Ihre Mutter, wir verlängern das Hotel«, riet ich fürs Erste.
Mein Telefon klingelte ununterbrochen. Innerhalb eines Tages bekam ich zwei Dutzend Anfragen von deutschen Medien mit der Bitte um einen Kommentar.
»Was ist mit den Russen los, Herr Kaminer? Warum wollen sie Krieg?« »Mit welchem Gefühl haben Sie die Nachrichten gelesen?« »Schämen Sie sich?«
Ich schämte mich. Im Lauf der 33 Jahre, die ich mittlerweile in Deutschland lebte, hatte ich so viel und lange über Russland und das Leben in der Sowjetunion geschrieben, dass die Geschichte meiner Heimat meine eigene Geschichte geworden war, ein wichtiger Bestandteil meiner Identität. Die Heimat und ich, wir waren verschmolzen. Insofern betrachtete ich auch meine eigene Auswanderung als eine Annäherung Russlands an Europa. Jahrzehntelang hatte ich Deutschland und die Welt bereist und überall erzählt, wie europäisch die Russen waren: ein kreatives, offenes Volk, ein lustiger Nachbar, der ab und zu vielleicht ein bisschen zu viel trank und laut wurde, aber seiner Natur nach herzensgut war. Ja, das Land machte gerade eine schwierige Phase durch und hatte vorübergehend Probleme mit der politischen Führung, aber wer hatte das nicht? Das konnte jedem Land und jedem Volk passieren.
Aber auf einmal griff meine Heimat ein Nachbarland an, weil dieses Land in die EU wollte, beschoss zivile Objekte, Kindergärten und Krankenhäuser, und im russischen Propagandafernsehen zeigte man Schlangen von Freiwilligen vor den Mobilisierungspunkten. Waren das alles etwa Schauspieler, oder wollten die Russen wirklich Krieg? Laut offiziellen Umfragen befürworteten zwischen siebzig und achtzig Prozent der Russen die »Spezialoperation« ihres Präsidenten. Man sollte diese Ergebnisse mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Immerhin wurde in Russland gleich am ersten Tag nach dem Einmarsch die Kriegszensur eingeführt. Jede kritische Meinung konnte als Heimatverrat und »Beleidigung der Streitkräfte« ausgelegt werden, wofür einem bis zu fünfzehn Jahre Knast blühten.
Je mehr aktuelle Berichte ich aus der Heimat las, umso klarer wurde mir, dass in einem unfreien Land jede soziologische Untersuchung mit ihren Umfragen scheitern musste. Die Menschen beantworten ungern Fragen, die ihnen von Fremden gestellt werden. Das ist auf der ganzen Welt so, und ich kannte es auch aus eigener Erfahrung: Selbst wenn die Deutsche Bahn in ihren Zügen eine Umfrage zum Komfort der Passagiere durchführen will, ducken sich die meisten weg, weil sie niemandem etwas erzählen wollen. Die Russen waren durch die »Spezialoperation« ihres Präsidenten zu Weltmeistern im Schweigen geworden. 95 Prozent wollten nicht reden, und von den restlichen fünf Prozent unterstützten die meisten bedingungslos alles, was ihr Führer vorhatte. Doch die schweigende Mehrheit stellte die angebliche Unterstützung der Bevölkerung für das Regime infrage.
Meine Landsleute verhielten sich wie die Anonymen Alkoholiker, nach dem berühmten Gelassenheits-Gebet: »Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.« Sie hatten keine Möglichkeit, sich in die politischen Angelegenheiten ihres Landes einzumischen, also taten die meisten so, als gäbe es diesen Krieg gar nicht. Das russische Fernsehen unterstützte sie in dieser Vogel-Strauß-Politik: Es wurden keine Leichen gezeigt, keine zerbombten Wohnhäuser, keine Flüchtlingsströme. Nur aufsteigende Flugzeuge und große Kanonen, die in die Luft feuerten, um die »Akzeptanz Russlands in der Welt zu erhöhen und die russische Sprache in die Schulprogramme zurückzubringen«.
Wir Menschen tun gerne »so, als ob«, wir halten am liebsten einen gesunden Abstand zur Realität. Wir wissen genau, dass die Erde krumm ist, laufen aber trotzdem nicht gebeugt, sondern mit geradem Rücken, als wäre sie flach. Wir leben, als ob wir niemals sterben, obwohl wir genau wissen, dass es nicht stimmt. Wir spielen Frieden mitten im Krieg. Das ist zutiefst menschlich, und trotzdem schämte ich mich fürchterlich für meine alte Heimat. Und ich schämte mich nicht dafür, dass ich mich schämte. Scham ist ein gutes, Leben rettendes Gefühl. Wenn wir als Spezies überleben wollen, dürfen wir uns nicht dem blinden Hass oder der Gleichgültigkeit hingeben. Wir sollten lernen, uns zu schämen. Gründe dafür gibt es mehr als genug.
Ich gab Interviews, versuchte, auf den Kanaren gestrandete ukrainische Geflüchtete unterzubringen, und packte die Koffer.
»Wie verrückt ist der russische Präsident wirklich? Wie weit würde er gehen?«, fragten mich die Journalisten. Ihre größte Sorge war, dass sich der Krieg ausbreiten könnte. Der russische Napoleon sprach stets davon, dass er gar nicht gegen die Ukraine, sondern gegen die NATO, gegen die USA und ihre europäischen Handlanger kämpfen wollte. Er stand kurz vor seinem siebzigsten Geburtstag, seine Interessen lagen also wie bei allen Rentnern hauptsächlich im Bereich der Geopolitik. Und er sagte, eine Welt ohne Russland als führende Kraft sei für ihn nichts wert. Dabei hatte sein Russland genug Atomraketen, um die ganze Welt in die Luft zu jagen. Wie weit also würde er gehen? Niemand hatte eine überzeugende Antwort auf diese Frage. Von diesem Mann war jede Missetat zu erwarten. Den Urlaub hatte er mir schon versaut.
In Berlin angekommen, kaufte ich als Erstes ukrainische Flaggen und befestigte sie an unserem Balkon. An jedem Bahnhof Deutschlands hingen »Willkommen!«-Plakate in ukrainischer und in russischer Sprache, obwohl man schnell feststellte, dass die meisten Geflüchteten aus der Ostukraine besser Russisch als Ukrainisch sprachen. Meine Kinder volontierten am Berliner Hauptbahnhof, wo sie den gerade angekommenen Menschen halfen, sich zurechtzufinden, oder Essen und Hygieneartikel verteilten. Meine Tochter war hauptsächlich für Shampoos zuständig und übersetzte den geflüchteten Frauen, was auf den Etiketten stand. War das Shampoo für trockenes oder fettiges Haar? Für schuppige oder empfindliche Kopfhaut? Sie konnte wunderbar übersetzen.
In der Volksbühne hatten wir im Roten Salon eine Begegnungsstätte für in Berlin gestrandete ukrainische Künstler eröffnet. Dort konnten sie deutsche Kollegen kennenlernen und vielleicht gemeinsame Projekte einfädeln. Nichts hilft besser in einer solchen Situation als Arbeit. Eine Beschäftigung lenkt von den Sorgen ab, dass dein Haus kaputt gebombt werden könnte, deine Liebsten in Gefahr sind und dein ganzes Leben möglicherweise futsch ist. Die ukrainischen Dichter, Maler und Musiker bevölkerten dieses Café von morgens bis abends, dazu kamen viele deutsche Kollegen, und alle versuchten einander zu erklären, was jetzt das Wichtigste wäre.
Mitten in diesem Durcheinander fiel mir eine Frau auf, die anscheinend überhaupt keine Lust hatte, irgendwelche Kontakte zu knüpfen oder künstlerische Projekte ins Leben zu rufen. Vollkommen desinteressiert saß sie in einer Ecke in einem tiefen Sessel und zeichnete mit einem Stück Kreide auf dem Parkett. Vor ihren Füßen krabbelte ein kleines Kind.
»Das ist die größte Expertin für sozialistische Hauswandmosaike«, erklärte mir mein Freund Juriy, der selbst aus Charkiw stammte und anscheinend alle ukrainischen Künstler kannte. »Sie ist in der Ukraine sehr berühmt«, erzählte er mir.
Diese Mosaike an Tausenden von Hausfassaden waren in der unabhängigen Ukraine nicht gleich als Kunst anerkannt worden. Die junge Republik wollte sich so schnell wie möglich von ihrer sozialistischen Vergangenheit, dem schweren Erbe der Sowjetunion, befreien. Hunderte Lenin-Denkmäler waren gestürzt und aus dem Stadtbild entsorgt worden, Straßen, Theater, Schulen und ganze Städte hatte man umbenannt. Die Mosaike aus der Sowjetzeit, all die strahlenden Arbeiter und Bauern mit Hammer und Sichel, die Roten Sterne, die Soldaten und Matrosen, Raketen und Kanonen und überernährten Friedenstauben, die selbst wie Bomben aussahen, hätten die Ukrainer am liebsten von den Hausfassaden gekratzt.
Doch die mutige Künstlerin hatte sie restauriert und katalogisiert, abfotografiert und ausgestellt, Bücher über sie geschrieben und die Öffentlichkeit aufgeklärt. Diese Mosaike seien aus der Geschichte des Landes nicht wegzudenken, sie seien ein Teil seiner Biografie und dürften nicht verloren gehen. Sie hatte den künstlerischen Wert dieser Arbeiten verteidigt und die Menschen davon überzeugt, die Bilder an den Fassaden zu belassen. Sie seien nicht nur ein Etikett des großrussischen Reiches, sondern ein Teil der ukrainischen Kunstgeschichte, behauptete sie. Nun wurden diese Mosaike zusammen mit den Häusern ausgerechnet aus russischen Kanonen beschossen. Sie wurden komplett zerstört – und damit war auch ihr Lebenswerk vernichtet.
Frau K. saß einfach da und malte mit Kreide auf dem Parkett geometrische Figuren. Kreise, Quadrate und Sterne.
99 Sekunden vor dem WeltuntergangHirn essen in Herxheim
Der Krieg beschleunigte den Lauf der Zeit. Auf einmal sahen meine Freunde und Bekannten um so vieles älter aus, als hätten sie auf einen Schlag fünf Jahre mehr auf den Buckel geritzt bekommen. Die Menschen waren verzweifelt, wütend, schockiert und verängstigt. Die sonst leichtsinnigen Zwanzigjährigen wirkten auf einmal so ernst und besorgt, als wären sie über Nacht erwachsen geworden, und die Fünfzigjährigen fühlten sich reif für die Rente.
Die Generation siebzig plus, die gottgesegneten Jahrgänge 1947 – 1952, diese Mensch gewordenen Friedenstauben und gut behüteten Kinder des Kalten Krieges, hatten Mitleid mit ihnen. Sie selbst hatten in der großen Geschichtslotterie das Glückslos gezogen, sich zwischen den Weltkriegen durchschmuggeln können, den Zweiten durch die Gnade der späten Geburt verpasst, vor dem Dritten hatten sie ein stattliches Alter erreicht und dazwischen jede Menge Spaß gehabt. Vom Marshallplan bis zum langen Marsch durch die Institutionen haben sie nebenher tapfer und bis zur völligen Erschöpfung auf den Barrikaden der sexuellen Revolution gekämpft, sich in Clubs und Discos abgehärtet, hatten Rock ’n’ Roll und Wiedervereinigung, Kreuzfahrten und Tangokurse, Gedächtnistraining und Yoga für Rentner mitgemacht. In der gesamten Geschichte der Menschheit musste man eine so dauerhafte Friedenspause lange suchen.
»Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei«, sangen sie auf Ibiza und Mallorca prophetisch. »Wir haben uns schon gewundert und auf die Uhr geguckt. Auf die Weltuntergangsuhr. Siebzig Jahre ohne Krieg – der nächste dürfte erst kommen, wenn wir nicht mehr da sind.«
Nun waren sie aber alle noch da, und das machte Hoffnung. Vielleicht war dieser Krieg nur ein halber Krieg, ein Viertelkrieg, ein kleiner regionaler Konflikt, der sich nicht ausbreitete. Vielleicht würde er nicht eskalieren, vielleicht würden die Russen vor den von der Bundesregierung versprochenen sieben deutschen Panzern Angst bekommen und die Ukraine verlassen. Mitte Mai gab es bereits Anzeichen für eine mögliche vorläufige Kriegspause. Der französische Präsident Macron telefonierte ununterbrochen mit dem Kreml, und nach Putins letztem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz hatte die russische Armee prompt weniger gebombt.
Eine merkwürdige Stimmung legte sich über das Land. Die Eisheiligen waren in diesem Jahr gar nicht gekommen, sondern hatten sich dem Klimawandel gebeugt. Die Sonne schien, und die Vögel zwitscherten, als gäbe es nur noch Frieden auf Erden. Ich tourte wieder durch das Land, von einem Kultursommer zum nächsten. Dabei erntete ich überall Mitleid und hörte die sorgenvolle Frage, ob ich mich als Russe diskriminiert fühlte. Die sich breitmachenden Gerüchte über Russophobie waren nicht nur in den russischen Medien ein großes Thema. Sogar meine Mutter träumte, ich sei bei einem der vielen Kultursommer vom Publikum zusammengeschlagen worden, weil die Menschen aus meinem Buch erfahren hatten, dass ich als Soldat in der sowjetischen Armee gedient hatte.
»Du musst nicht alles über dich erzählen«, meinte Mama. »Das ist gefährlich. Wo bist du überhaupt gerade?«, fragte sie mit besorgter Stimme.
Ich war gerade in einer Stadt, deren Namen ich nur schwer aussprechen konnte: Herxheim. Das kleine Städtchen im Süden der Bundesrepublik stellte für eine russische Zunge ein unüberwindbares Problem dar. Ein »X« auszusprechen, dem unmittelbar ein »H« folgt, ist für mich eine Herausforderung sondergleichen. Jeder Versuch, den Namen der Stadt sauber auszusprechen, hörte sich wie ein Hustenanfall an. Warum haben sie die Stadt nicht einfach Herzheim oder Hirnheim genannt? Das wären doch auch schöne Namen für eine Stadt und viel leichter auszusprechen.
»Ich bin in Rheinland-Pfalz«, berichtete ich Mama, um sie zu beruhigen. Hier sollte ich zusammen mit der Ministerpräsidentin, der Kultusministerin und etlichen Staatssekretären die Eröffnung des Kultursommers moderieren.
Die Rheinland-Pfälzer hatten vor langer Zeit beschlossen, ihre Kultursommer nach dem Wind zu richten. Im Jahr zuvor hatten sie den Nordwind wunderbare Künstler aus Norwegen, Schweden und Finnland zu sich wehen lassen. Für das Jahr 2022 hatten sie mit dem Ostwind geplant. Niemand konnte ahnen, dass dieser nach Blut, Schießpulver und Tod riechen würde, nach zerbombten Städten und geflüchteten Menschen. Zu spät erkannte man, dass es keine Planungssicherheit für Winde gab, besonders wenn sie aus dem Osten kamen.
Einige der eingeladenen russischen Künstler, Gruppen und Theaterkollektive konnten nicht mehr kommen, andere wollten nicht. Die Gastgeber wären beinahe mit ihrem Programm in Not geraten, aber zum Glück fanden sie mich als Last ManStanding, einen der letzten ansprechbaren Russen, die man nach Herxheim einladen konnte, ohne die Gefühle der Ukrainer und der deutschen Öffentlichkeit zu verletzen.
Ich konnte zwar den Namen der Stadt nicht aussprechen, mochte aber die Gegend sehr: Pfälzer Wein und gastfreundliche, gut gelaunte Einheimische, die schon am frühen Morgen leicht einen sitzen hatten. Vor allem faszinierte mich ihre überraschend unkonventionelle, sehr eigene Küche. Ich hatte vorher gar nicht gewusst, dass Tiere so viele Innereien besaßen, die man obendrein so fantasievoll auf einem Teller kombinieren konnte.
Obwohl die Schrift auf den Speisekarten durch den Klimawandel jedes Jahr kleiner wird, hole ich in einem Restaurant für gewöhnlich meine Lesebrille nicht aus der Tasche, sondern verlasse mich auf meine Erfahrung. Denn eigentlich kann man an den Silhouetten der Buchstaben das Gericht bereits erkennen. Diese Annahme hat mir in Herxheim einen bösen Streich gespielt. »Lauwarmes Saumagen-Carpaccio mit Hirn- und Beeren-Vinaigrette« las ich auf der Speisekarte und dachte, wow! Als hätten Kannibalen auf einmal beschlossen, Gourmets zu werden und sich gesagt, wir sollten Hirn nicht einfach als Hauptgericht essen wie immer, das ist noch keine echte Delikatesse. Wir verarbeiten es lieber zu einer köstlichen Vinaigrette.
»Und? Haben Sie schon gewählt?«, fragte mich der freundliche Kellner.
»Ja«, nickte ich. »Ich hätte gerne den Magen mit Hirn-Vinaigrette und Beeren.«
»Es handelt sich hier um eine ›Himbeeren-Vinaigrette‹«, rückte der Kellner meine Bestellung zurecht. Sein Gesichtsausdruck verriet jedoch, dass er glatt auch eine Hirn-Vinaigrette serviert hätte, die war aber wahrscheinlich für Einheimische reserviert.
Ganz unabhängig von den kulinarischen Highlights hatte ich ein großes Kulturprogramm für den Kultursommer »Ostwind« vorbereitet. Zusätzlich zu einer Moderation bot ich eine Lesung und eine Podiumsdiskussion zum aktuellen Anlass an: »Russland nach Putin« oder so ähnlich sollte das Thema lauten. Ich hatte sogar für das dortige Puppentheater ein Theaterstück verfasst, das allegorische Märchen »Der Wolf und die G7« über die Kommunikationsprobleme zwischen Russland und der EU. Die Gebrüder Grimm hatten die heutige Situation mit dieser alten Volkserzählung sehr treffend beschrieben. Der Wolf war nun der russische Präsident, die Mutti war Frau Merkel. Kaum war sie aus dem Haus – Gerüchten zufolge war sie sogar in einer Klinik gelandet, völlig fertig mit der Welt –, klopfte der Wolf an die Tür. Bevor Mutti gegangen war, hatte sie uns allerdings noch gewarnt, wir sollten niemandem aufmachen, egal wer käme. Die sieben Geißlein aber waren zerstritten und unsicher. Niemand konnte nachvollziehen, wieso das ungezogene russische Bärchen sich plötzlich einen Wolfspelz übergezogen hatte und den Verrückten spielte.
Leider wollten die Pfälzer mein Theatermärchen nicht, es war ihnen zu heiß. Stattdessen sollte ich in einem Herxheimer Jugendclub eine Ukraine-Disko veranstalten. Ich hatte das Ganze auf die leichte Schulter genommen und mich nicht auf eine lange Nacht vorbereitet. Immerhin hatte ich ukrainische Musik im Russendiskoprogramm schon immer zur Genüge im Angebot gehabt. Sie war wie russische Musik: schnell, laut und gut zum Tanzen geeignet – so wie ich Musik mag. Aber die pfälzische Jugend würde diese Auswahl womöglich nicht als ihre Lieblingsmusik erkennen, dachte ich, jede Generation hat schließlich ihren eigenen Geschmack. Und die Älteren würden nach all den Rieslingen und Saumägen wohl zeitig ins Bett gehen. Ich stellte mich daher auf eine sogenannte »Rollator-Disko« ein. Mein Sohn hatte mir diesen Begriff überlassen, nachdem er einmal in Berlin dabei war, als zu meiner Disko tatsächlich zwei Menschen mit Rollatoren erschienen waren. Ich fand das überhaupt nicht schlimm, man konnte mit diesem Gerät viel sicherer tanzen. Vielleicht hätte ich auch als DJ gut einen gebrauchen können nach einer Flasche Rosé. Aber mein Sohn hielt mich seitdem für einen Künstler der abdankenden Generation.
Um halb zehn sollte es losgehen. Ich war pünktlich und staunte nicht schlecht. Dem ersten Eindruck nach hatte sich das komplette Bundesland im Jugendzentrum Herxheim versammelt. Die Jungen und die Alten, die Nüchternen und Betrunkenen, die Einheimischen, die Gäste des Festivals, die ukrainischen Geflüchteten und ihre Gastgeber. Ich nahm die Sache ernst und konzentrierte mich auf ukrainische Musik, obwohl die weiblichen Geflüchteten mich permanent nach irgendwelchen russischen Popstars fragten. Sie hielten mir ihre Smartphones vor die Nase und zeigten mir Fotos von ihren Musikidolen: blonde Frauen mit dicken Lippen und am Kopf tätowierte Jungs.
»Kennen Sie die?« »Kennen Sie den?« »Was sind Sie für ein DJ, wenn Sie Loboda nicht haben?«, ärgerten sie sich.
»Heute nur ukrainische Musik!«, antwortete ich entschlossen.
»Aber Loboda ist doch Ukrainerin!«, bedrängten sie mich weiter.
»Gut möglich«, konterte ich. »Aber sie hat sich von der Annexion der Krim nicht eindeutig distanziert!« Ich blieb hartnäckig und radikal bei der Musikauswahl. Die letzten Tänzer gingen um vier.
Unausgeschlafen und voller Pfälzer Riesling fuhr ich am nächsten Tag weiter zur Premiere der Passionsspiele nach Oberammergau. Ich hatte unglaublichen Durst und las unterwegs die Zeitung, um mich von meinem Kater und der Kriegsangst abzulenken. Die Zeitung gab mir tatsächlich ein wenig Hoffnung. Die Reiter der Apokalypse saßen uns zwar noch immer im Nacken – die Seuche, die Dürre und der Krieg –, aber es gab auch gute Nachrichten:
In Russland hatte das Parlament den Einsatz schwerer Handschellen für Minderjährige und schwangere Frauen im Untersuchungsgefängnis ausdrücklich nicht empfohlen. Außerdem sollte der Klimawandel den Olivenanbau in Österreich ermöglichen. Wenn also unsere Vorräte an Sonnenblumenöl verbraucht waren, konnten uns die schlauen Österreicher mit ihrem Olivenöl versorgen. Außerdem waren die Pfälzer Rotweine deutlich besser geworden: Der Pinot Noir aus der Region hatte bei der letzten Verkostung viele Punkte bekommen. Die russische Angriffsarmee hatte neun Mal hintereinander versucht, einen kleinen Fluss im Osten der Ukraine an derselben Stelle zu überqueren, und war jedes Mal von der ukrainischen Abwehr zurückgeschlagen worden, bis sich der Fluss in einen Strudel aus kaputtem Militärgerät und Leichen verwandelt und sich das Wasser rotbraun gefärbt hatte. Die Ukrainer verfügten eindeutig über die besseren Waffen. Und die Amerikaner lieferten angeblich uneingeschränkt Militärgüter in die Ukraine, die schon bald den Frieden nach Osteuropa bringen würden.
Die beste Nachricht war jedoch, dass am Samstag Jesus im Allgäu wiederauferstehen sollte, auf der großen Bühne in Oberammergau. Das spektakulärste Theaterereignis Deutschlands, die Passionsspiele, sollten am Wochenende starten. Ich hatte bereits vor dem Krieg im Jahr 2020 für das deutsche Kulturfernsehen eine Dokumentation über die Passionsspiele drehen sollen, die dann allerdings wegen Corona verschoben worden waren. Damals waren die Menschen verzweifelt. Sie hatten sich seit zwei Jahren nicht rasiert, Tausende Kostüme per Hand genäht, und Judas hatte sogar sein Abitur verschoben, weil ihm im Dorf gesagt wurde, er könne nicht zwei Großprojekte gleichzeitig durchziehen: Jesus verraten und die Hochschulreife erlangen. Er hatte sich damals für seine Rolle entschieden und stand am Ende doppelt dumm da.
Damals herrschte eine ängstliche Stimmung im Ort. Es schien, als hätte der Lauf der Geschichte plötzlich Halt gemacht und ein schlauer Dieb der Menschheit ihre wertvolle Uhr des Lebens vom Handgelenk geklaut, um sie durch die billige Uhr der Apokalypse zu ersetzen. Eine Plastikuhr, die nur Sekunden anzeigte. Alle waren verunsichert. Wie würde es weitergehen? Ich war damals mit Jesus Weißwürste essen, und er meinte, er glaube nicht an die Verschiebung der Passionsspiele und daran, dass in Deutschland oder überhaupt irgendwo auf diesem armseligen Planeten noch jemals jemand gekreuzigt würde.
»Wir sitzen ab jetzt unter Hausarrest und warten, bis der Arzt mit der nächsten Spritze kommt. Und in zehn oder zwölf Jahren bin ich aus Altersgründen nicht mehr Jesus-tauglich, amen!«, prophezeite Jesus bedeutungsvoll.
Ich bin vor zwei Jahren allein durch den Ort gelaufen und habe die leeren Geschäfte besucht, aus denen mir Tausende von Jesusfiguren von ihren Kruzifixen traurig hinterherblickten, alle aus echtem Holz von Einheimischen geschnitzt. »Motivationsgeschenk für 92 Euro« stand darunter. Damals hatte die Seuche jede Motivation zunichtegemacht. Da war niemand, den man mit einem Holz-Jesus hätte motivieren können. Auch nicht mit einem echten aus Fleisch und Blut. Nun stand er aber doch wieder auf der Bühne und weinte fast vor Stolz. Ich freute mich sehr über Jesus und darüber, dass wir unsere Dokumentation trotz aller Missgeschicke, trotz aller Tragödien vollenden durften. Was lange währte, wurde endlich gut.
Der Premierentag begann mit einem roten Teppich und dem Eintreffen der Prominenz, darunter Ben Becker, Uschi Glas und der Bayerische Ministerpräsident Söder. Bereits um 11.00 Uhr startete der ökumenische Gottesdienst. Zwei Diener Gottes, ein Priester in weißer Albe und ein Pfarrer in schwarzem Talar, beteten für uns.