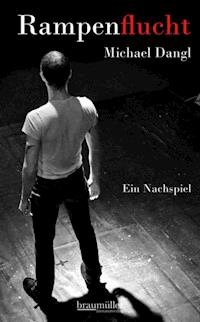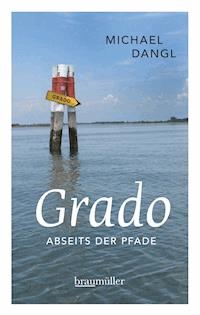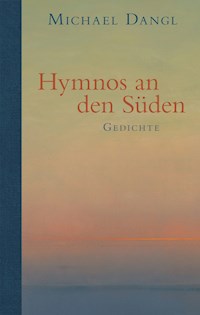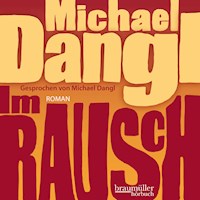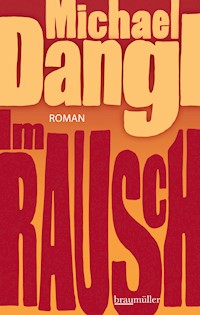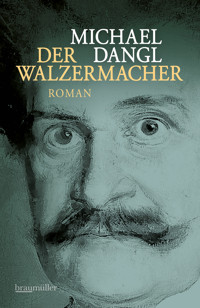
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johann Strauss (Sohn) verbrachte elf Sommer als gefeierter Kapellmeister im europaweit bekannten Musikzentrum Pawlowsk bei Sankt Petersburg. Die ersten Jahre waren geprägt von einer leidenschaftlichen Liebe zu der russischen Aristokratin und Komponistin Olga Smirnitzkaja. Obwohl Strauss um Olgas Hand anhielt, verhinderte die ablehnende Haltung ihrer Eltern und seiner Mutter die Heirat. Die gemeinsame Flucht scheiterte jedoch an seinem Zögern, für diese Liebe einzustehen. Fast dreißig Jahre später kehrt der inzwischen 60-jährige Strauss nach St. Petersburg zurück. In seinem Hotelzimmer schreibt er den Bericht seines Lebens, dessen Zentrum in der unerfüllten Liebe zu Olga und in seinem "eigentlichen" Leben in Pawlowsk liegt. Seine lebenslang wiederkehrenden Erkrankungen, Zusammenbrüche und charakterlichen Sonderlichkeiten erscheinen nun in einem neuen Licht – nicht als "Grillen", sondern als Spuren einer bislang geheime Ursache. "Nur einen Sommer habe ich wirklich gelebt" lautet das bittere Resümee dieser wütenden, komischen und schonungslosen Selbstanklage eines in vielerlei Hinsicht zerrissenen Künstlers. "Michael Dangl verwandelt Strauss zum Archetypus. Mit allem, was ich sonst in unserer Literatur vermisse: Leichtigkeit, Eleganz, Stil – und Witz." Michael Köhlmeier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Motto/Zitat
Der Walzermacher
Danke
Impressum
Motto/Zitat
Ein glücklicher Mensch
ist wie eine Fliege in der Sonne
Ivan Turgenjew
Der Walzermacher
Als Napoleon Toulon belagerte, wurde er beschossen und verwundet – als er Wien belagerte, gingen die Wiener Walzer tanzen. Ein Viertel der Bevölkerung, jeden Abend, bis zum Morgen. Das Element, durch das ich groß geworden bin, jagte mit Sonnenuntergang den Graben entlang, raste den Stephansdom auf und nieder, rollte wie eine perpetuummobilisierte Billardkugel die Nacht lang über die Basteien, umrundete die Stadt und fiel, heißgelaufen, erst am nächsten Tag zischend zurück in die trägen Wasser der schönen blauen Donau. Der Walzer beherrschte alles und riss jeden, der nur die Nasenspitze aus der Tür steckte, in seinen Wirbel aus Tanzen und Lachen und Lieben und Vergessen. Wenn man Walzer tanzen kann, ist alles gut, war ein Wiener Sprichwort. Aber ich bin kein Wiener. Weder vom Temperament noch von Geburt. Und jetzt, da ich noch einmal nach Russland gekommen bin, in dem wahnwitzigen Vorhaben, Olga, die einzige Liebe meines Lebens, die ich vor fast dreißig Jahren aus Feigheit in den Wind geschlagen habe, doch noch zu erobern – obwohl sie schon lange einen Anderen geheiratet und vier Kinder hat –, bin ich nicht einmal mehr Österreicher. Ich, der bekannteste Untertan des Habsburgerreiches, der Liebling der Wiener, ihr sogenannter Walzerkönig und als solcher bereits mit sechzig eine weltweite Legende, bin seit zwei Monaten Coburger. Und damit Deutscher. Ich habe mein Österreichertum aufgegeben, um die Lücke in meinem chronischen Eheleben, die mit der Trennung von meiner zweiten Frau entstanden ist, mit einer dritten Heirat schnell wieder zu schließen. Weil das einem Katholiken untersagt ist, musste ich deutscher Reichsbürger werden. Äußerlichkeiten wie nationale oder religiöse Zugehörigkeit sind mir unwichtig. Bald werde ich mich konfessionslos erklären, um zum Protestantismus übertreten und meine dritte Frau, Adele, heiraten zu können. Auch wenn diese dritte Frau, was ich mir aus tiefstem Herzen erhoffe, Olga heißt. Statt protestantisch könnte ich dann ja orthodox, statt reichsdeutsch russisch werden. Kein Österreicher und nicht katholisch zu sein, ist ein guter Schritt auch in diese Richtung. Im praktischen Denken bin ich, Alleininhaber der Walzerfabrik Strauss, die ich meinem Vater in einer Art Konzertputsch achtzehnjährig entrissen habe, geschult. Adele wird weiter die kokette Witwe sein, wie Schnitzler sie genannt hat und als die ich sie gefreit habe. Durch einen Brief, in das Verbindungszimmer unserer Schlafräume im Hotel gelegt, werde ich ihr alles auseinandersetzen und sie kann schon am nächsten Tag die Heimfahrt nach Wien antreten. Sie selbst war es ja, die meine Liebe zu Olga, von der ich nur ihr erzählt habe, während ich sie vor aller Welt geheim halte, mit der von Goethes Werther verglichen hat. Ich habe das Buch nicht gelesen, weiß aber, es ist kein Operettenstoff, vielmehr die tragischste Liebesgeschichte der deutschen Literatur, und der Held bringt sich darin um. Adele kann nicht wissen, wie recht sie damit hat, meinen russischen Roman – wie man noch in meiner Kindheit Liebesgeschichten auch abseits des Papiers genannt hat – in diese existenzielle Nähe zu rücken. Vielleicht hat sie deshalb die naheliegende Frage nie gestellt: warum ich mich nicht umgebracht habe.
Äußerer Anlass meiner Wiederkehr ist der dringlicheWunsch der Zarin, ich möge in Russland, wo ich so viele Jahre hindurch die höhere Gesellschaft in meinen Bann gegeigt habe, noch einmal spielen. An der Krönung ihrer Vorgängerin habe ich teilgenommen und für sie meine Cäcilien-Polka komponiert. Als sie den Zarinnennamen Olga annahm, taufte ich auch die Polka um und konnte damit meiner Geliebten eine heimliche Reverenz erweisen. Alles war heimlich zwischen uns, denn meine Geliebte war Aristokratin, und ich nur – Musikant. Polkas sind mir wesensfern. Walzer haben mich nie interessiert. Das Fieber, das sie in Wien ausgelöst haben, habe ich nie verstanden, geschweige denn, verspürt. Das Gehupfe und Gedrehe zu ihrem Takt und meinen Füßen war mir immer fremd. Ich selbst habe keinen Schritt auf dem Parkett dieser Rasereien getan. Nur in Pawlowsk hat, nur einmal, mein Herz getanzt. Das teilnahmslos geblieben war, als meine Töne die Welt in Tanz versetzten, berauschten und gewissermaßen in Brand steckten. Pawlowsk war mein Rausch, mein Feuer, mein Sommer. Wien: Ernüchterung, kalte Asche, ewiger Winter. Meine Schuld, mich aus dem Glück vertrieben zu haben. Und sie ins Unglück. Etwas getötet zu haben. Ich bin ein Mörder. Und kehre zwanghaft an den Ort meines Verbrechens zurück. Als ich eben, fast dreißig Jahre nach dem entscheidenden Sommer meines Lebens, zum ersten Mal wieder durch den Park von Pawlowsk ging, ist mir am Boden eine Kröte aufgefallen. Grau saß sie auf dem grauen Erdweg. Reglos, einen Fuß angezogen, wie im Lauf innegehalten oder angefahren, aber ohne sichtbare Beschädigung. Dennoch schien sie ohne Leben, so vollkommen war ihre Bewegungslosigkeit selbst in meinem Nähertreten. Die Augen aber standen weit offen, als wäre der Tod auf einen Schlag gekommen. Erst als ich mich hinunterbeugte, sah ich, dass der Mund, ein schmaler Strich im Gesicht, auf- und zuging – als redete er vor sich hin – und den leblos scheinenden Körper, der bei ungenauerem Hinsehen auch ein Häufchen Kot sein konnte, mit Luft versorgte. Wärmte sich das Tier in dem Flecken Sonne, der nach niedergegangenem Gewitterregen auf den nassen Weg, den nassen Leib fiel? Der nächste Donner ließ die Kröte drei schnelle Hüpfer vorwärts machen, noch einmal, und noch einmal, und im Gebüsch verschwinden. Ich erkannte mich selbst in dieser Erscheinung. Grau, ununterscheidbar von meinem Weg, wie versteinert und mit starrem Blick. Die Leute irren sich, wenn sie mich für lebendig nehmen. Ich bin schon lange tot. Ich atme noch, um Walzer und Polkas und Operetten schreiben zu können. Aber ich empfinde nichts mehr dabei. Würde ein Mensch bloß die Porträts und Photografien anschauen, die von mir gemacht werden, er sähe die Larve, den leeren Kokon, die wie im Erschrecken des Auslöschens versteinerte Fratze, die sich Strauss nennt. Auch ich rede hier vor mich hin. Ich muss mir bekennen, mir Bericht geben. Solange ich auf ein Zeichen von ihr warte. Bekomme ich es nicht, verschwinde ich wie die Kröte mit drei Sätzen, bestehend aus jeweils drei Hüpfern, von denen der erste der stärkste, der betonte ist, im Gebüsch – oder im kalten Wasser eines Kanals. Eins-zwei-drei, eins-zwei-drei, eins-zwei-drei, weg. Unumstößlich notiere ich auch diese letzte Bewegung zu meinem Tod hin im Dreiertakt.
Das Zarenhaus bestimmte mein Leben, von früh an. Um endlich einmal vor meinem Wiener Kaiser spielen zu können, bin ich ihm mit fünfundzwanzig ins russische Warschau nachgereist, wo er Zar Nikolaus treffen sollte. Für die Zarin – die Vorgängerin der Vorgängerin der jetzigen – schrieb ich, während die Herren über Krieg und Frieden diskutierten, die lustige Warschauer Polka, erhielt von ihr dafür einen Brillantring und gab den Herrschern brillante Konzerte. Dem russischen Statthalter in Polen schrieb ich einen Festmarsch und bekam acht Kisten Krimsekt. Nach Warschau war ich auch in Wien von den Familien des Hochadels akzeptiert. Aber meinem Kaiser Franz Joseph, der seine Regentschaft zugleich mit mir begann und jetzt mit mir dahinaltert, dem unmusikalischsten aller Habsburger, der mir nach der Fledermaus und dem Zigeunerbaron immer zu meinen Opern gratulierte, habe ich zum ersten Mal – wenn auch als ungeladener Gast – in Konzerten für den russischen Zaren aufgespielt. Und wurde daraufhin eingeladen, im sommerlichen Zentrum der russischen Musikwelt ein Orchester zu führen. Mein Leben zerfällt in zwei Teile: vor Pawlowsk und nach Pawlowsk. Das eine war ein rascher, mühevoller Aufstieg, das andere ist ein langsamer, qualvoller Niedergang. Beide Teile sind uninteressant. Denn nur scheinbar hat sich mein Leben in ihnen abgewickelt. Es hat sich hinentwickelt, zu Pawlowsk, es hat sich wegentwickelt, abgespielt hat es sich nur dort, in Pawlowsk, nur dort, in der vergleichsweise kurzen, die aller Welt bekannten Teile verbindenden wie trennenden Spanne dazwischen habe ich wirklich gelebt. Ein Geist bin ich, der durch Pawlowsk und Petersburg durch den Schauplatz einstigen Lebens und Glücks geht. Lebens weil Glücks. Wie ich als Geist seit Jahrzehnten durch Wien gehe, nur dass es dort kein Leben gibt, kein Leben, weil kein Glück. Das Außenleben hat bei mir schon lange aufgehört zu existieren. Mit dem Wiederbetreten der Welt, die die einzige ist, die in mir existiert, die einzige, in der ich weiterexistierte, wenn auch als Geist, lebt all das Vergangene wieder auf und drängt zur Mitteilung. Leider kann das bei mir, wie es sich für einen Komponisten geziemte, nicht in Tönen geschehen. Ich bin kein Tschaikowskij. Den ich als Erster der Welt in Pawlowsk aufgeführt habe und der die Welt erobert mit seiner seelenvollen Musik. Ich kann mich, kann Menschliches nicht in Musik fassen wie Schumann, noch Übermenschliches wie Wagner. Mich selbst, mein Menschliches, oder wenigstens mein Menschenähnliches, denn ich weiß nicht, ob ich diese Bezeichnung verdiene: Mensch, kann ich nur aufschreiben. In Worten, nicht in Noten.
Pawlowsk hat begonnen, mich zu rufen, da war ich elf oder zwölf. Johann Strauss, noch unangefochten mit diesem Namen ohne den Zusatz I oder Vater, mein Vater, wurde eingeladen, dort erster Musikdirektor zu werden und lehnte ab. Seit damals ging das Wort Pawlowsk durch die Räume des Hirschenhauses, in das wir gerade gezogen waren und in dem Vater einen abgesonderten Teil bewohnte. Innerhalb von zwei Monaten waren ihm zwei Kinder geboren worden. Eduard von meiner Mutter, die noch seine Frau, und Emilie von der Modistin Trampusch, deren Bettgeher er war. Vor diesen doppelten Vaterfreuden floh er auf Konzertreisen oder, konzertierte er in Wien, ins Wirtshaus. Die russische Einladung wurde in den folgenden Jahren immer wieder erwähnt, erörtert und verworfen. Das Wort Pawlowsk, das mein Vater aussprach wie kein anderes – mit einer gewissen Scheu nämlich und einem nicht unfeierlichen Ernst und doch auch mit der Süffisanz, die dem Wiener bei der Erwähnung etwas weit außerhalb seines Gesichtskreises Liegenden durchs Gemüt und über die Lippen geht –, bekam für mich etwas Exotisches, Märchenhaft-Geheimes, und wurde mir mit der Zeit zu einem Sinnbild für etwas unerreichbar Fernes, das zu erreichen man sich aber nur selbst verwehrt, aus Angst vor dem Unbekannten, Angst aber auch davor, in ihm vielleicht eine Erfüllung zu finden, einen Schatz, irgendetwas Großes, Unerhörtes, das einem, ohne der Verführung nachzugeben, für immer verschlossen bleiben würde. Wenn ich vom riesigen, mächtigen Zarenreich reden hörte, verband sich das mit Pawlowsk. Dort war in meiner Vorstellung immer Winter, aber ein weicher, freundlicher, den man vom Kaminfeuer aus betrachtet, und galante Damen reichten aus Equipagen Süßigkeiten an Kinder am Wegesrand. Die Verführung in diesen nebelhaften Bildern war außer der zum Abenteuer auch die zu einer Geborgenheit. Die mein Vater zu hassen schien und die er mir und allen um sich zertrümmerte mit seiner ständigen Abwesenheit, mehr mit seiner sporadischen Anwesenheit. War er fort, fühlte man sich verlassen, gleichzeitig befreit, denn war er da, war er als nicht viel mehr da als ein fremder Nachbar, der im selben Haus wohnte, und man fühlte sich ungewollt und ungeliebt, und das tat mehr weh als das Verlassensein. Man hatte nur die Wahl zwischen Schmerz und Schmerz. Vater war ein Tyrann, ein Familien- und Walzertyrann, der sich außer zwischen zwei Familien oft zwischen vier Orchestern zerriss, ein von der Stimmung des Publikums und der Gastwirte, bei denen er auftrat, Abhängiger, der lieber als in Sievering oder Hernals in England oder Frankreich gastierte, weil er dort frei von der Last war, als die er seine Ehe und Vaterschaft empfand. Wenn alle Musiker Grüße von den Reisen schickten: er nicht. Wenn sie froh waren, zu Weihnachten zu Hause zu sein, saß er am Heiligen Abend im Beisl und verspielte unser Schulgeld. Und dennoch: Kein Strauss, kein Leben! riefen die walzersüchtigen Wiener dem zu, mit dem das Leben kein Leben war, sondern ein Kampf auf Leben und Tod. Meine Kindheit fiel in seinen Aufstieg vom Bratlgeiger in Vorstadtlokalen zum Herrscher über ein musikalisches Riesenreich, und obwohl diese Kindheit durchzogen war von Klängen und Harmonien, war der Ton rau, die Atmosphäre die unharmonischste und ich von dieser Welt, die meinen Vater so ganz erfüllte, verstoßen und ausgesperrt.
Natürlich wird es für Adele schrecklich sein, im Morgengrauen und – so wäre es mir am liebsten – ohne mich noch einmal zu Gesicht zu bekommen, aus unserem eleganten Hotel auszuziehen und zum Bahnhof zu fahren, wo man uns erst vor wenigen Tagen mit Pomp empfangen und ihr einen Kamillenstrauß überreicht hat, wie das für russische Brautpaare üblich ist. Alle Welt sieht uns auf Verlobungsreise. Ich kann darauf keine Rücksicht nehmen. Ich bin, was die Wahl meiner Ehefrauen betrifft, immer rasch und überraschend verfahren. Aus Verzweiflung über das unwiderrufliche Ende meiner Hoffnungen auf Olga wurde ich krank, reiste damals schon im August aus Pawlowsk ab und griff wie ein Ertrinkender nach Jetty, einem Rettungshalm, wenn auch mit den Ausmaßen eines jahrhundertealten Baumstamms, sieben Jahre älter als ich, eine zweite Mama und ideale Pflegerin, als Mutter von sieben unehelichen Kindern geschult im Umgang mit Unmündigen, meine getreue Sekretärin, Notenkopistin, Reise- und Leibesorganisatorin. Als sie nach sechzehn allem Anschein nach glücklichen Ehejahren der Schlag traf, war ich ein paar Tage untröstlich, warb keine Woche nach der Grablegung, bei der ich nicht anwesend war, um die Nächste und war vier Wochen später in den zweiten Ehehafen eingefahren, wo sich nun eine Lilli um meine Socken und Noten kümmern sollte. Die aber war ein Luder und setzte mir mehr Hörner auf, als in einem steirischen Jagdschloss hängen. Schon Monate vor der Trennung (ich wurde auch in dieser Hinsicht immer ökonomischer) schrieb ich glühende Eroberungsbriefe an die Dritte, die ich in meiner Ehefirma anzustellen gedachte. Die Formulierungen entnahm ich dem Repertoire meiner Briefe an Olga, wo mir Ergüsse der Sehnsucht und Zuneigung noch ehrlich aus dem Herzen gingen, ähnlich wie ich für meine Amerikaeroberungsreise kein einziges Stück neu komponierte, sondern Motive aus bestehenden zu einem scheinbar neuen zusammenschusterte. Amerika wie Adele fielen darauf herein. Nun schleppt sich die Legalisierung des Bundes schon über drei Jahre hin, aber Adele zeigt Avancen, eine noch tüchtigere Geschäftsfrau zu sein als Jetty, und ich freue mich darauf, dass die Welt sich mit einer peniblen Verwalterin meines Nachlasses wird herumschlagen müssen. Wenn es zu dieser Ehe kommt. Letzte Nacht bin ich fünfmal (!) zum Portier hinuntergefahren, um zu fragen, ob eine Nachricht für mich da wäre. Obwohl ich vor dem Liftfahren Angst habe, weil ich von Stockwerk zu Stockwerk fürchte, jetzt und jetzt stecken zu bleiben. Aber Treppensteigen kann ich schon lange nicht mehr. Die letzten Male schaute ich nur mehr aus der offenen Lifttüre hinüber zur Rezeption und empfing das müde, zunehmend besorgte Kopfschütteln des würdigen Mannes wie ein Hund Schläge, die ihn zurück in seine Hütte jagen. Ich kann an nichts denken als an diese immerhin mögliche – wenn auch mit jedem Tag unwahrscheinlichere – Antwort auf einen Brief, von dem ich gar nicht weiß, ob ihn die Adressatin bekommen hat, weil ich ihn, wie damals oft, ihrer Freundin Pauline zur üblicherweise verlässlichen Weitergabe geschickt habe. Die mir versprochen hat, ihn vor ihrer Abreise (sie ist jetzt im Ausland) Olga in die Hand zu geben. Ich bitte in diesem Brief um nichts als eine kurze Begegnung, in der ich ihr alles auseinandersetzen würde. Tatsächlich verwendete ich dieses sachliche Wort für ein Gespräch, an dem mein Leben hängt, weil ich mir keine andere Rettung weiß, weil ich nicht weiterleben kann ohne die noch so kleine Chance, an ein Glück wiederanzuknüpfen, das ich vor Jahrzehnten zerrissen habe. Um dem einzigen Menschen gegenüberzustehen, der je in mein Herz geschaut hat und mich versteht und meinen Wahnsinn, den zu verdecken ich mein nach außen normales, geradezu krankhaft langweiliges Leben zu führen ich mir angewöhnt habe. Jeder Künstler ist auf seine Art wahnsinnig. Andere Komponisten packen ihren Wahnsinn in Musik, ich backe Walzertörtchen drumherum und Polkakrapferl und hin und wieder eine Operettentorte. Aber der Wahnsinn glüht weiter und zerschmilzt all die süßen Backwerke, und sie ertränken mich in ihrem unerträglichen Melodiensirup und erschlagen mich mit ihrer unbarmherzigen Gefälligkeitsglasur. Ich würde der Welt so gerne einmal mein ganzes aufgestautes, unverdautes Innenleben, das, was auf meinem Backwerkeverzeichnis zwischen den Zeilen steht, vor die walzertanzwilligen Füße speiben, diese grausliche Magenmelange aus Verdrängtem und Verkümmertem, dieses Eiterbeuschel aus Verlogenheit und Überdruss, diese Blutfrittatensuppe meines zerfetzten Herzens. Und zur Nachspeise die Gallenbuchteln meiner verlorenen Illusionen.
Illusionen hatte ich, in Pawlowsk, und doch nicht, denn Illusionen, das heißt doch: Täuschungen. Und nie habe ich so klar gesehen. Und bin, indem ich meinen Gefühlen nachgab, der Wahrheit so nahe gekommen wie dort. Illusion war das andere, das Wiener Leben, meine Lebensillusion, für die ich die Wahrheit, die mir die Hände entgegengestreckt hat, aber nicht zum Tanz, eingetauscht habe. Pawlowsk hat mir den grauen Schleier meiner Kindheit, den ich noch als Dreißigjähriger um die Augen trug, vom Gesicht gerissen mit einem Lachen, dem unbekümmerten Selbstverständnis in Freiheit Geborener, die einen Sträfling aus seinem Gefängnis tapsen sehen. Illusion war doch, was ich bislang als das Normale geliefert bekommen, und das erfüllen zu müssen ich geglaubt habe. Illusion war, einen Kampf zu führen, der, im Letzten, nicht mein eigener war. Meine Mutter hat mich als Kampfmittel gegen ihren Mann eingesetzt. Am Tag ihrer der Scheidung reichte ich mein Gesuch zum ersten Konzert ein. Als Revanche für die Jahre der öffentlichen Demütigung, das mittellose Sitzengelassenwerden vom erfolgreichsten Musiker der Gegenwart, drehte sie den Spieß um, und der Spieß war ich. Ich musste zum erfolgreichsten Musiker der Gegenwart werden, ich brachte nichts mit als mein Talent und den vom Vater unterdrückten Drang zu musizieren. Den Kampf auf des Taktstocks Schneide hat meine Mutter daraus gemacht. Die Säle, die meines Vaters Platzhirschenschaft und seine Intrigen gegen mich übrig ließen, waren oft klein, stickig, das Publikum, das sich zwischen Fressen und Tanzen nicht recht entscheiden konnte, drängte an die kleine Bühne, auf deren Pult ich, hoch über allen, im schweren, engen Frack stand, die Geige gegen die Hüfte gestemmt wie ein Gewehr vor dem Feind, den Geigenbogensäbel über den Kriegern hinter mir, den Musikern, zum Einsatz schwingend, ein General vor der Schlacht, dann die Waffe unters Kinn klemmte und losfeuerte, anriss, wie man in Wien sagt, immer notwendigerweise dynamischer als die anderen, präsenter, lauter, gewahr,