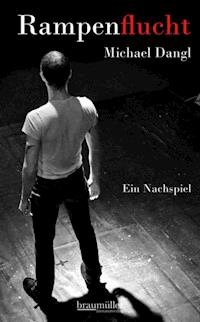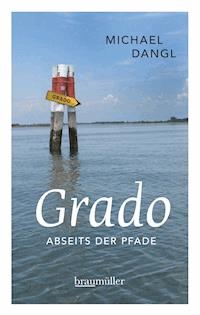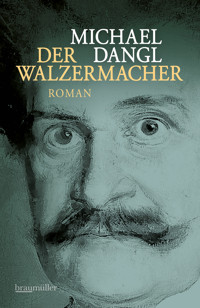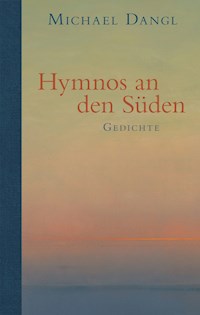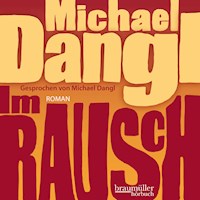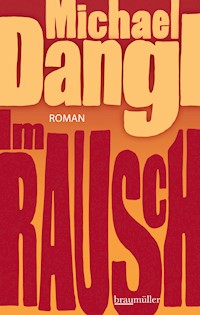
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann wirft sich ins Leben und setzt es – im wahrsten Sinn – aufs Spiel. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und in der Welt, die ihm zur Bühne wird für seine Lebens- und Liebesabenteuer. Gerade eingezogen, verwüstet er das Haus seiner Vermieter bis zur Unbewohnbarkeit, irrt im Bademantel durch fremde Gassen, stiftet Liebeswirren und feiert gleichzeitig Erfolge mit seiner Arbeit, in der er die Wahrhaftigkeit sucht, die im Leben Schmerzen bereitet – und tragikomische Situationen ohne Ende. Der "junge Held" gerät in einen aberwitzigen Rausch des Spielens, der Verwandlungen, der Ekstase, und gefährlich nahe an den Abgrund. Eine paradiesische Mittelmeerinsel, die auf einem Esel zu überqueren er sich aufmacht, wird ihm zu Purgatorium und möglicher Erlösung. Mit Witz und Sprachkunst zieht Michael Dangl den Leser, indem er ihn lachen und schaudern lässt, ins rauschhafte, ungesicherte, junge Leben einer sehnsüchtigen Spielernatur, die, man fühlt es, nur die Liebe wird retten können. "Michael Dangl ist nicht nur ein großartiger Schauspieler – er kann auch schreiben. Und wie! Immer ist man mittendrin, immer spürt man seine Leidenschaft fürs Menschliche, meist Allzumenschliche, immer lebt und leidet er mit den Leidenden und Suchenden, Verwirrten und Hoffenden." Konstantin Wecker "Ich habe IM RAUSCH von Michael Dangl gelesen und finde das Buch ergreifend! Zudem ist die Sprache großartig und der Text höchst amüsant!" Adele Neuhauser "Michael Dangl erzählt von den Wunden des Lebens mit der Maske des Komödianten." Peter Turrini
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2019
© 2019 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
ISBN 978-3-99200-226-9
eISBN 978-3-99200-227-6
Für Petra und Tony
Immer spielt ihr und scherzt? ihr müßt! o Freunde! mir geht dies In die Seele, denn dies müssen Verzweifelte nur.
Friedrich Hölderlin
Am liebsten würde ich in einer Einsiedelei leben.Aber diese Einsiedelei müßte auf einer Bühne stehen.
François-René de Chateaubriand
Das Schnapsglas schlägt Millimeter neben der gerahmten Photographie, die den Intendanten in seiner Paraderolle zeigt, in der Kantinenwand ein und zerspringt in tausend Splitter. Ein Aufschrei der Nahesitzenden, ein Wegducken, kurz ist es still in der vollbesetzten und eben noch brodelnden Stadttheaterausschank, Sänger, Choristen, Schauspieler, Tänzer, alle richten ihre Blicke auf mich und halten den Atem an.
Ich stehe am Tresen und muss lachen, weil das Glas so schön geflogen ist, fünf Meter durch die Luft und zwischen lachenden, trinkenden Köpfen genau auf den Punkt, den ich anvisiert habe, ein Geschoss, mit voller Kraft des rechten Arms abgefeuert, eine Übersprungshandlung, in der Sekunde geboren noch vor einem Gedanken daran, und doch kontrolliert, ich wollte das Bild nicht treffen, ich wollte an es treffen, an seinen Rand und zwar nur haarbreit daneben, damit man versteht, dass das Bild sehr wohl gemeint ist, dass das Glas nicht zufällig in seine Richtung fliegt, ohne doch das Bild zu zerstören, die Glasabdeckung, den lachenden Intendantenmund, und zudem war es mir, während ich warf, als hätte die Handlung in diesem Moment zu geschehen, ich vollzöge nur eine notwendige Tat, die schon längst hätte ausgeführt werden müssen.
Aber warum? Der Intendant hat mir nichts getan, im Gegenteil, auch in meiner dritten Flußfelder Spielzeit überhäuft er mich mit großen Rollen, jetzt ist Mai, ich bin im neunten Monat der Saison und hochschwanger, abzuhauen. Doch um zu verstehen, was zu diesem Eklat geführt hat, muss ich genau diese drei Jahre zurückgehen.
Ich war einundzwanzig und ein recht höflicher, manchmal beinahe schüchterner, wenn auch Rebellionen und Exzessen nicht abgeneigter junger Mann, als mir mein damaliger Chef nahelegte, das „behagliche Nest“ meiner Geburtsstadt zu verlassen, und ich mich in dreißig Städten in Deutschland bewarb.
Einzig die Stadt Flußfeld zeigte Interesse und sandte ihre „Spielerkäufer“. Wir waren uns bald einig, und es wurde ausgemacht, dass ich zur Vertragsunterzeichnung zu ihnen kommen würde. Spät nachts rief ich meine Eltern an. Der Anruf weckte sie, und dass sie nach meiner kurzen Mitteilung „Ich habe eine neue Stelle für nächste Saison. In Deutschland. In Flußfeld“ wach geblieben sind, ist sicher. (Meiner damaligen Freundin erzählte ich nichts, aus Furcht vor ihrer Reaktion; sie musste es kurz vor meinem Umzug von Bekannten erfahren). Auch ich wachte noch lange und schlug den großen Reader’s Digest Weltatlas auf. Der errechnete Abstand zu dieser Stadt im mittleren Westen Deutschlands machte mir klar, dass mein unbestimmtes Gefühl, ein großes Abenteuer komme in Gang, berechtigt war. Vor mir weitete sich der Horizont, und noch in derselben Nacht ritt ich im Traum in eine ungeheure Ebene, über der die Sonne aufging.
Zwei Wochen später fuhr ich zum ersten Mal die siebenhundert Kilometer nach Flußfeld, traf den Direktor und verabredete, den Vertrag nach dem Besuch der Vorstellung seines Menschendarstellerinstitutes unterschrieben in das Postfach des Bühnenportiers zu werfen. Die Aufführung fand ich langweilig, nachgerade schlecht, und sie hat mich in Hinblick auf die fast schon getroffene Entscheidung total verunsichert. Vor Mitternacht saß ich am (wie ich dachte) Rheinufer, die Kellnerin brachte den bestellten Weißwein in einem furchteinflößenden grünstämmigen Humpen und wartete mein Trinken ab.
„Isch weiß“, sagte sie, „der erste Schluck ist scheußlisch, aber man gewöhnt sisch.“
Ob das auch für den hiesigen Dialekt gilt?, dachte ich. Und für das „hiesische“ Theater?
Wie um das Kellnerinnenverdikt zu überprüfen, trank ich noch mehrere Humpen und fuhr am nächsten Tag mit ununterschriebenem Vertrag nach Hause.
Dafür schickte ich einen Brief: „Sehr geehrter Herr Direktor, da ich es beim Eindruck des einen Abends nicht belassen möchte, bitte ich um Zusendung Ihres Dezemberplans, um mir einen weiteren Besuch in Flußfeld zu organisieren und dann auch den Vertrag unterschreiben zu können. Hochachtungsvoll …“
Postwendend kam ein Anruf von der Sekretärin: „Schöne Grüße, und wenn Sie den Vertrag nicht sofort unterschrieben schicken, bekommt ihn ein anderer.“
Drei Monate vor Beginn meines Engagements in Flußfeld begleitete mich mein Vater zur Wohnungssuche, gemeinsam fuhren wir wenig einladende Vorstadtlandschaften ab und querten zig Male einen von diesen zwei Flüssen, die dauernd im Weg herumlagen und die ich nicht auseinanderhalten konnte. Flußfeld war bis vor Kurzem noch größte Garnisonsstadt Europas gewesen, alles war voll von Wehren und Forts und modernen bis mittelalterlichen Befestigungen, vielem hatte das Militär sein hässliches Gesicht aufgeprägt. Eine Agentur hatte uns Adressen von zur Untermiete angebotenen Wohnungen zusammengestellt.
Unsere Chance, als Mieter in Betracht gezogen, ja überhaupt eingelassen zu werden, war dadurch erschwert, dass wir, ohne uns darüber abgesprochen zu haben, beide T-Shirts in der gleichen Farbe trugen, einem knalligen Pink, und beide dunkle Jeans, sodass jeder uns die Tür öffnende potenzielle Vermieter erst einmal erschrak und dachte, wir wären Vertreter einer Telefongesellschaft oder Ankünder eines Wanderzirkus. Fiel dann noch das Wort „Schauspieler“, fiel auch die Mehrzahl der Türen ins Schloss, und wir standen im Vorgarten, pink und perplex. Das war mir neu, in Österreich öffnete meine Berufsbezeichnung Tore und Herzen.
Mancher Gral wurde uns aufgetan, wobei als Erstes immer die Rollbalken demonstriert wurden und damit stolz, wie kühl und dunkel die Räume im Sommer blieben, was mir Hitze- und Sonnenhungrigem jedes Mal einen Schauer über den Rücken jagte. Ähnlich ratlos standen Vater und Sohn in den kühlen Grüften, bedankten sich betreten und gingen.
Über Bekannte von Bekannten haben sich dann Bekannte von Leuten aufgetan, deren Bekannte ein Haus in Flußfeld hatten. Ich verbrachte eine Probenacht und konnte zufrieden sein: Das Einfamilienhaus befand sich in grüner, ruhiger Lage auf einem Klosterberg genannten Stadthügel, der gesamte erste Stock stand mir zur Verfügung, ich hatte Platz, Luft, Licht, einen Balkon und niemanden über mir. Natürlich sah ich auch schon mögliche Gefahren voraus: Um zu meinem ersten Stock zu gelangen, musste ich den allgemeinen Eingang nehmen und die Wohnung des Hausbesitzerpaares queren, Untermieter der Bürgerlichkeit wäre ich, Anpassung würde vorausgesetzt werden, die Frau wollte einmal die Woche putzen und gucken, das beklemmte mich am meisten, gucken wollte sie. Gucken und stöhnen, gucken und klagen, gucken, drohen, gebärden? Da wird noch etwas klarer gestellt sein müssen, dachte ich, denn mein Beruf, nicht meine Natur war es, anguckbar zu sein. Immerhin war ich mit achtzehn aus der elterlichen Wohnung ausgezogen und hatte nun schon drei Jahre alleine gelebt.
In den nächsten Wochen fuhr ich die Strecke nach Flußfeld und zurück so oft und kannte sie so gut, dass es mir zulässig erschien, wenn mir in der letzten Stunde vor Müdigkeit die Augen zufielen. Noch spielte und probte ich ja in meiner Geburtsstadt. Einmal, es war kurz vor der Rheinbrücke und ich war mit dem holzgezimmerten Anhänger unserer Theaterreisen unterwegs, rettete mich das Bild eines frei laufenden Bisons einen Autobahnkilometer vor mir vor dem Einschlafen, ich schrak auf und sah, dass es nur ein grauer Puch war, der die sonst leere Fahrbahn wechselte. Bebenden Herzens hielt ich und drückte, wie oft in den letzten Stunden, in die Doppelliterflaschen Most, die ich mir von der Jodleralm mitgenommen hatte und die in Säcken am Boden hinter den Frontsitzen standen, die Korken wieder hinein, die der durch die Fahrtvibration heftig in den Flaschen arbeitende alkoholische Obstmost hinausgepresst hatte.
Als ich auf der Rückfahrt am Tresen der Raststätte Frauenaurach stand und kaffeetrinkend auf mein draußen geparktes Auto schaute, sah ich, dass dem Anhänger das Dach fehlte. Sauber abgetrennt, musste es mir irgendwo auf den letzten zweihundert Kilometern davongeflogen sein, ich hatte nur bemerkt, dass der leere Anhänger furchtbar hüpfte und rumpelte, und es fiel mir ein, dass mir ja gesagt worden war, ich solle mit dem leeren Anhänger nicht schneller fahren, als ich es mit dem vollen tags zuvor hätte tun sollen und auch nicht getan hatte. Im Weiterfahren wartete ich vergeblich auf eine Radio-Verkehrsnachricht wie „Achtung Autofahrer, auf der A3 zwischen Kleinlangheim und Randersacker liegt ein Holzdach auf der Fahrbahn“. Auch wurde ich an der damals noch heftig sich gebärdenden Grenzstation nicht, wie die letzten hundert Kilometer zunehmend befürchtet, festgenommen.
Schließlich waren meine gesamten Habseligkeiten in der neuen Wohnung, Bücher hauptsächlich, Schallplatten, meine Stereoanlage, aber auch eine erstaunliche Anzahl von Kochutensilien, große schwere Kartons voll Töpfen, Pfannen, Tellern, Tabletts, Koch- und Schöpflöffeln, Messern in allen Größen, Quirlen und Schälern, Pressen und Reiben, Küchentüchern und Kochschürzen, Kochbüchern und Rezeptemappen, man konnte glauben, ich wäre zum Kochen hergekommen, zum Kochen und Lesen.
Meine Küche im ersten Stock war bald eingerichtet, und ich kaufte eine Kofferraumladung Grundlebensmittel. Ich hatte die Gewohnheit, viel zu große Portionen zu kochen und zu viele Gänge für mich allein, und da ich spätestens beim Auflegen, Waschen und Schnipseln der ersten Zutaten heftig aperitifisierte, war ich bis zum Garwerden all der Braten, Kapaune und Lammkeulen so illuminiert, dass ich keinen Appetit mehr verspürte. Erschöpft saß ich rauchend am Balkon, und der Dampf und Dunst einer Großküche zogen in den Klosterberger Abendhimmel. Im ganzen Haus muss es an solchen Festabenden des neuen Mieters nach Öl, Zwiebel, Knoblauch, Rosmarin und flambiertem Cognac gerochen haben, ich sah es am Blick der Vermieter, an denen vorbei ich meine prallen Einkaufssäcke (dort sagten sie: -tüten) von der Haustür zur Treppe tragen musste.
Unser Verhältnis war von Anfang an gespannt, um nicht zu sagen verkrampft. Mein Unabhängigkeitsbedürfnis war so stark, dass mir jede harmlose Frage als unverschämte Verletzung meiner Intimität erschien, und ich verschanzte mich kochend und lesend über ihnen. Dabei waren sie nichts als anständige Menschen, deren Ein und Alles, Versammlung all ihrer Wünsche und Hoffnungen dieses Haus war, zweier Leben Arbeit steckte in diesem Haus in der Meisengasse, einem Einfamilienhaus mit Garten und Garage neben anderen Einfamilienhäusern mit Garten und Garage in der Meisengasse und in all den nachbarlichen Straßen, Amsellauf und Drosselzeile, eine rechte Vogelgegend. Gemeinsamer Hauptstolz all dieser Hausbesitzer war der Rollbalken, der verlässlich zwischen sechs und sieben am Abend, im Sommer noch früher, hinunterdonnerte, es war das Geräusch der Abendstunde, wo an anderen Orten Glocken läuteten oder der Muezzin rief, rasselten dort Rollbalken Fenster und Türen hinab, wo anderswo Sektkorken knallten und Serenaden erklangen, schlugen die Klosterberger dem Leben die Rollbalken vor der Nase zu, die Wucht, mit der sie es taten, ließ Erleichterung vermuten. Wieder einen Tag geschafft, schien mir das auszudrücken. Zufriedene Gefängniswärter ihrer selbst.
Die Kühle zwischen „ebener Erde und erstem Stock“ steigerte sich zur Eiszeit, seit ich den Wunsch nach einer Geschirrspülmaschine für meine Küche geäußert hatte und von ihm nicht heruntergestiegen war, das letzte Gespräch darüber sogar mit einem recht herrschaftlichen „Ja wenn das nicht geht, muss ich ausziehen“ beendet hatte, eine frühe Drohung nach drei Tagen Aufenthalt.
Ich raffte mich zu einer Aussprache auf und stieg zu meinen Vermietern hinab. Da saßen sie im Dunkeln hinter sommerlich früh heruntergelassenen Rollbalken, sie auf der Couch, er in seinem Lehnstuhl mit einem Bierkrug vor sich, der einen Zinndeckel hatte und auf dem „Vati“ stand. Die Luft war schlecht und gewürzt von meiner abendlichen Kocherei. Der Vorstand der Vermietergruft, der zu jedem Schluck den Zinndeckel aufmachte und ihn gleich wieder beamtisch schloss, als könne das Bier ihm aus dem Krug davonfliegen, sah mich von unten herauf an und schwieg. Auch seine Frau. Von irgendwo aus dem Dunkel tickte militärisch eine Uhr. Ich räusperte mich und ließ den, wie ich hoffte, begütigenden Satz fallen: „Wir leben doch unter einem Dach.“
Es schien zu wirken, denn der Vermieter nickte. Seine Frau atmete tief. Ich erklärte dann, wie sehr ich die Geschirrspülmaschine von zu Hause gewohnt sei, faselte noch etwas von „schwer, so allein in der Fremde“ (das war für sie bestimmt, die auch gleich mütterlich schmerzvoll lächelte) und versprach, dass die Maschinen doch heute „so gut und sicher“ seien (dies, kumpelhaft zu ihm, Männer, Handwerker unter sich), das war nämlich ihr Haupteinwand gewesen, der Parkettboden in der Küche oben, der Parkettboden im ganzen ersten Stock, dass da etwas mit dem Wasser passieren könnte. Ich verließ den Vermieterbunker mit der halb unter Tränen gegebenen Zusage des Bierkrugvatis, einen Installateur zur Beurteilung zurate ziehen zu dürfen. Wie zum Dank ließ ich oben den Rollbalken meine Balkontüre hinunterknallen und öffnete ihn gleich darauf leise, um draußen eine Kerze zu entzünden und einen ganz wunderbaren Chianti Classico aus dem „Möhr-Center“, wo in Flußfeld einkaufte, wer etwas auf sich hielt, zu trinken.
Ohne zu klopfen, trat am nächsten Tag mein Vermieter in mein Zimmer. Ich war gerade bei einer meiner unspektakulären Freizeitbeschäftigungen: Ich bügelte. Ich bügelte damals alles, was mir in die Finger kam, lange und schwelgend und am liebsten zu Bruckner. Ohne ein Wort durchmaß der Vermieter das Zimmer und ging auf meinen Balkon. Ich bügelte weiter. Er rief mich. Stumm wies er mit dem Blick auf einen kleinen schwarzen Fleck an der Holzabdeckung neben dem Tisch, Ruß meiner Kerze. „Wollt’ste mir das Haus anstecke’?“, zwang er sich zu einem Scherz. Ich lachte und bedauerte. Irgendein Nachbar musste mich von hinter seinen Rollbalken beobachtet und diffamiert haben. Ab jetzt herrschte Kerzenverbot.
Drei Kollegen kamen zu Gast, und ich kochte groß auf. Es gab Pastete, Schnecken in Knoblauchbutter, Salat, Pasta mit Steinpilzen, Kaninchen in Rotwein-Schokoladensauce, Kartoffelgratin und Zucchini, zu Beginn Prosecco, dann Bier, Weißwein und den Rotwein, in dem auch das Kaninchen zwei Stunden geköchelt hatte, Brunello di Montalcino. Schließlich Käse und Portwein, Tiramisu und Grappa, während in der Küche die neue, vom Fachmann als unbedenklich eingestufte Geschirrspülmaschine arbeitete. Fröhlich rumpelten die Gäste gegen Morgen die Stiegen hinunter und am Vermieterschlafzimmer vorbei ins Freie.
Als ich nach der glücklich verlaufenen ersten Premiere gegen Mittag erwachte, machte ich mir Kaffee und schaltete die Spülmaschine ein, in der sich Überbleibsel der Endprobenkochungen angehäuft hatten. Mit meinem Kaffee setzte ich mich an den Schreibtisch. Ein freier Sonntag lag vor mir, ich war allein im Haus, die Vermieter auf einem Klosterberg-Volksfest, zu dem sie mich eingeladen hatten, alle seien dort, ja, alle außer mir. Ich saß recht gelöst vom Erfolg und im Studium meiner nächsten Rolle (dem Beaumarchais in Goethes „Clavigo“) im grünen Frottee-Bademantel, darunter nackt, ein Kammerorchester spielte für mich Couperin, als ich ein ungewohnt dumpfes, mahlendes Geräusch aus der Küche hörte. Witternd wie ein Hund stellte ich mich vor die Spülmaschine und diagnostizierte, dass sich das nicht gut anhörte. Ich drückte die Stopptaste, öffnete das Gerät und sah, dass es sich ohne Wasser abmühte, alles voll Spülsalz auf schmutzigem Geschirr. Also rückte ich die schwere Maschine schnaufend von der Wand ab und sah auf die recht ausführliche Ansammlung von Hähnen, Schläuchen und Anschlüssen. Ich merkte auf einmal, dass ich Kopfweh hatte.
Du bist kein Handwerker, dachte ich, geh kein Risiko ein, dreh das Wasser vorsichtshalber ab. Gedacht, getan, nahm ich den Hahn, der offenbar zur Spülmaschine gehörte, in die Hand, und, die Sprache weiß schon voraus, ich drehte ihn nicht zu, sondern hatte ihn auf einmal wirklich in derselben, in der Hand!, und das Wasser schoss mir auf den grünen Bademantel und gerade auf den Schritt.
Porca miseria. Ich versuchte, den Hahn wieder aufzudrücken, keine Chance, der Druck des Wasserstrahls, der Wasserfontäne war so stark, als hätte das Haus, als hätte die Meisengasse, endlich, einen Wasserwerfer gegen mich eingesetzt. Ruhig bleiben, dachte ich, ruhig bleiben, auch wenn das Wasser bereits erste Lacken am Parkettboden der Küche bildet, ruhig bleiben, der Haupthahn. Irgendwo muss der Haupthahn sein, den drehe ich ab und dann gehe ich zurück zu Couperin und Beaumarchais und immerhin hatte ich gestern Premiere. Wo ist der Haupthahn? Die Vermieter sind nicht da, die sind am Volksfest, alle sind dort, ja, alle außer mir, darum stehe ich auch da im grünen Bademantel und schaue zu, wie sich Massen von Wasser auf den Parkettboden des ersten Stocks des Klosterberghauses ergießen, das ist jetzt eigentlich ein Alptraum, dachte ich, was mach ich bloß, irgendjemand muss doch wissen, wo der verdammte Haupthahn ist, so was gibt es doch in jedem Haus, vielleicht ein Nachbar, dachte ich und rannte die Stufen hinunter und auf die Straße, die leer war, ausgestorben, natürlich, es sind ja alle am Volksfest und amüsieren sich, wahrscheinlich trinken alle, das Wetter ist schön, ich trinke ja eigentlich tagsüber nicht, und läutete bei den Nachbarn: bei zweien, bei dreien, bei sechsen!, immer das Gleiche, niemand zu Hause. Während ich aus dem ersten Stock eines gewissen Hauses Wasserrauschen in die sonntägliche Klosterbergstille hörte, rannte ich wie ein Irrwisch im grünen und vorne schwarzen, weil nassen Bademantel von Vorgarten zu Vorgarten, von Klingel zu Klingel, was für eine Komödie, dachte ich und musste kurz an Louis de Funès und an die außerirdischen Kohlköpfe denken, aber im Grunde war mir das Lachen vergangen und die Not stieg und ich hatte begriffen, dass ich in einer schrecklichen Situation war!, da öffnete – endlich – ein Mensch eine Tür: eine alte Frau.
Und ich war ihr so dankbar. Dass sie öffnete – und dass sie sich nicht über meinen Bademantel wunderte, vielleicht sah sie auch schlecht. Ich erklärte so sachlich wie möglich die Umstände und bat sie, mit mir zu kommen. „Einen Moment“, sagte sie und verschwand eine als Ewigkeit gefühlte halbe Minute, jede halbe Minute, wusste ich, war eine Katastrophe, das Wasser schießt!, sie hatte ihren Stock geholt, schloss ihre Tür ab und schlurfte neben mir die Straße zum nach außen noch unversehrt aussehenden Haus. Mühsam stieg sie die Treppen zum Eingang hinauf, mühsam stieg sie die Treppen zum Keller hinab – ha!, dachte ich, von Kriegszeiten her weiß sie das noch, und schlurfte die muffigen, feuchten Gänge entlang und fand endlich den Haupthahn und ich drehte ihn ab. Ich rannte nach oben, und das Wasser schoss nicht mehr, warum auch, stand es doch schon fast wadenhoch in der Küche und wahrscheinlich im ganzen ersten Stock. Ich watete durch meinen persönlichen Katastrophenfilm und verabschiedete die Nachbarin und dankte ihr und tauchte Küchentücher, als wäre damit irgendetwas zu trocknen, in die Flut.
„Heinz!“, das war ihr erstes Wort. Als die Vermieter etwa zwei Stunden später mit Lebkuchenherzen und einem Luftballon vom Volksfest zurückkehrten, war das Wasser bei mir im ersten Stock versiegt. Aber dass es damit nicht weg war, verstand sogar ich als Nichthandwerker gut. Zudem hatte ich mich schon vor einer Stunde davon überzeugen müssen, dass es im Vermieterschlafzimmer unter meiner Küche – tropfte. Von der Decke. Auf den Vermieterspannteppich, auf das Vermieterbett. Und so hatte ich ihre Rückkehr erwartet wie Rodins Denker ohne Gedanken, aber, immer noch, im grünen Bademantel.
„Heinz!“
„Wat?“
„Det tropft.“
„Wat?“
„Det tropft.“
„Wat det tropft?“
„Von der Deck! Da is’ Wasse’!“
„Wie Wasse’?“
Und so fort. Die komplette in die Vermieterköpfe im wahrsten Sinn des Wortes einsickernde Erkenntnis musste ich mir anhören. Es nützte nichts, den Bademantel fest zugeschnürt und hinab in den tropfenden Vermieterorkus (oben war das Problem eigentlich beseitigt). Erklärung, Zusammenbruch. Klischeehafte Inszenierung eines bürgerlichen Trauerspiels: die Frau, die gestützt werden muss und aufs Bett sinkt; der Mann, der seinerseits taumelt und sich ans Herz greift, was sie wiederum aufschreckt: „Heinz!“
Irgendwann kam der Abend, und ich hatte mir eben eine Flasche Rotwein aufgemacht (zu kochen traute ich mich denn doch nicht), als sie mich nach unten riefen. Fast ganz Flußfeld war ja im Krieg zerstört worden, eine Ahnung davon lag auch jetzt in der Luft. Mit Regenschirmen standen die Vermieter in ihrem Lebenswerk, und das militärische Ticken der Uhr hatte eine muntere Konkurrenz des Glucksens und Tropfens bekommen. Die Vermietergruft hatte sich in eine Tropfsteinhöhle verwandelt. Der Deckel am Bierkrug hatte nun sein Gutes. Aber Heinz trank nicht. Heinz schwieg. Sie stammelte Vorabendserientaugliches, das ich, innerlich Schäfchen zählend, überstand. Doch die brachte ich diesmal nicht ins Trockene, im Gegenteil.
Ich hatte eine veritable Katastrophe angerichtet. Das Wasser, ergab das Gutachten, würde zum Teil weiter durchsickern und abtropfen, zum Teil aber in der Zwischendecke bleiben und dort nicht trocknen, wie ich hoffte, sondern – schimmeln. Die komplette Zwischendecke des Hauses inklusive Plafond des Unter- und Parkettbodens des Obergeschosses musste erneuert werden, das hörte sich nach einer Großbaustelle über Monate an, und ich fürchtete als Erstes um meine Ruhe. In Kürze begannen die Proben zu „Clavigo“. Und mein Kochen? Es war klar, ich würde auf keinen Fall bleiben, auch eine Rückkehr nach der Generalsanierung konnte ich mir nicht vorstellen. Zum Glück hatten wir irgendeine Versicherung, die für alles immerhin finanziell aufkam. Atmosphärisch war es ein Schlamassel, und jetzt, im viel späteren Nachhinein, tut es mir aufrichtig leid.
Einzig ich selbst zog einen ungeheuren Vorteil aus der Sache, denn ich fand, wieder mit Vaters Hilfe, eine sehr schöne neue Wohnung. Ohne lustige T-Shirts kamen wir mit einer Maklerin überein, die eine Riesenprovision verlangte, und ich zog, wie um meine endgültige Ankunft in Deutschland zu besiegeln, in die Rheinstraße. Das Haus war ein ehemaliges Hotel und die Wohnung im fünften, obersten Stock mehr ein Apartment, ein großer Wohnraum, dessen vierte Wand zur Gänze aus einer aufschiebbaren Glasscheibe bestand, durch die man auf den zehn Meter langen Balkon kam. Vom Balkon und durch das Glas vom ganzen Wohnraum, sogar von der Küchenzeile blickte man auf den Rhein und auf eine gewaltige Wehranlage am anderen Ufer. Dreiundvierzig Monatsmieten lang sollte ich dort wohnen. Einmal im Jahr gab es Hochwasser und der Rhein stieg über die Uferstraßen bis in die Hausflure. Doch nach der Geschichte vom Klosterberg konnte mich in dieser Hinsicht nichts mehr erschüttern.
So schwer ums Herz.
Wie viel wurde versäumt!
Ich hab meine Stadt
fast geräumt,
und, wie ich auch litt,
ich zweifle,
und Zweifel (samt Trauer)
säumt diesen Schritt.
Wie schwer geht sich’s fremdwärts!
Wie schwer mir ums Herz.
In den ersten Wochen in Flußfeld schaute ich mir eine Vorstellung in den Kammerspielen, der zweiten Spielstätte des Theaters, an, eine Komödie, hauptsächlich, um meinen Intendanten einmal auf der Bühne zu sehen. Leider sah ich nur die erste Hälfte, und das kam so: Die Vorstellung war ausverkauft und die Sekretärin hatte organisiert, dass ein Stuhl für mich ins Parkett gestellt wurde (dort sagten sie: Stuhl; unter „Sessel“ verstanden sie gleich „Lehnstuhl“ oder „Ohrensessel“ und erschraken, als ich diese Möglichkeit vorschlug: „Können Sie mir nicht einen Sessel hineinstellen?“).
Da saß ich also sehr prominent im ansonsten freien Mittelgang. Die Aufführung war amüsant, ich wunderte mich etwas über das einfache Gemüt des Publikums und war am meisten von einer jungen, sehr ausdrucksstarken und attraktiven Schauspielerin in einem knappen, sehr ausdrucksstarken Kostüm fasziniert. Zur Pause ging ich auf einen Drink in ein Lokal direkt über dem Ausgang. Ein Glas an der Bar. Ich hätte, als ich das Läuten aus dem Pausenfoyer des Theaters hörte, kein zweites bestellen dürfen, denn als ich zurück zur Vorstellung wollte, rüttelte ich an einer von innen verschlossenen Tür. Auf ihr prangte der Titel des Stückes, das drinnen weiter gegeben wurde und dessen zweiten Teil ich nun für immer versäumt haben würde, und erst jetzt passte er wirklich: „Endlich allein“.
Am Tag meiner ersten Premiere traf ich zu Mittag den Intendanten beim Einkaufen im Supermarkt, er sprach mich, irgendetwas kauend, von der Wursttheke her an. Ich dachte, er wollte mir für mein Debüt Glück wünschen, doch seine Lippen, sah ich im Näherkommen, waren weiß, und sie waren es auch, woran er kaute. Nur ein Satz: „Wenn S’ das nächste Mal in der Pause gehen, nehmen S’ Ihren Sessel mit.“ – Ich erklärte etwas von einem dringenden Telefonat, das ich in der Pause zu führen gehabt hätte, er sagte nur „Na ja“ und ging weiter. Er hatte, fiel mir erst jetzt ein, den ganzen zweiten Teil von der Bühne aus meinen leeren Stuhl im Blick gehabt. – Und er hatte „Sessel“ gesagt, er war ja Österreicher.
Natürlich habe ich eine starke Neigung, meine Anfangszeit in Flußfeld als Erfolgsgeschichte zu betrachten. Interessant wäre, es einmal umgekehrt zu sehen. Bereits nach den ersten Wochen hatte ich meine erste Liebesbeziehung verspielt (im wahrsten Sinn), das Herz eines Flußfelder Mädchens, einer Statistin, angeknackst, meinen Intendanten zumindest vorübergehend verärgert und ein Haus bis zur Unbewohnbarkeit verwüstet. Keine schlechte Bilanz.
Und bevor irgendjemand anderer sich berufen fühlt, es zu sagen: Ich war zu jener Zeit ein recht anmaßender, rücksichtsloser, selbstsüchtiger Kerl. Das war ich – auch. Ich war aber auch: schüchtern, unsicher, zweifelnd, hilfsbereit und haltlos liebend. Ich war in der Arbeit gewissenhaft und in den Nächten disziplinlos, und beides bis zum Umfallen. Alles andere wäre mir als ein Verrat erschienen, ein Verrat an meinem Reservoir an Sehnsucht und Kraft, die beide unerschöpflich waren, ein Verrat am Leben schlechthin, das ich als ufer- und grenzenlos im Wesentlichen noch vor mir und nach oben hin offen sah.
Für alle Anmaßungen bezahlte ich mit Selbstvorwürfen und Verzweiflungen. Ich trug schwer an mir, auch deshalb verlor ich mich so gerne an den Rausch: den Rausch des Spielens, den Rausch der Verwandlungen, den Rausch des Alleinseins, der Ekstase und, auch, der Trunkenheit.
Vor vielen Monden war ein Euro vierzehn Schilling und ich einundzwanzig. Diese Abwandlung des Eröffnungssatzes von Joseph Brodskys „Ufer der Verlorenen“ beschreibt nicht nur, wie lange das hier Erzählte zurückliegt, sondern grundsätzlich mein Verhältnis zu mir wie zur Welt: Es ist zutiefst „romantisch“. Und zwar nicht im kitschigen, sondern im Novalis’schen Sinn – poetisierend, traumwandlerisch, theatralisch und rauschhaft. Ich bin die Primaballerina meines inneren Staatsballetts und der Protagonist meiner persönlichen Königsdramen. Doch wie zum Ausgleich bin ich auch der am Straßenrand meiner oft hochfahrenden emotionalen Knausrigkeit dahockende Intrigant, der vernichtend und zynisch und vor allem gleichgültig am Zipfel seiner eigenen Leistungen nagt.
Von kleinst auf spielte ich Rollen (erstmals mit vier), wuchs nebenbei auf, pubertierte, maturierte, und mit achtzehn hatte ich mein erstes Engagement und spielte weiter, nur ab jetzt hieß es „Beruf“ und um mich waren lauter Leute, die das auf Schulen gelernt hatten und viel älter waren als ich. Durch mein frühes Beginnen am Theater war ich so lange der Jüngste, dass ich es heute manchmal nicht glauben kann, wenn ich im Ensemble eines Stückes in die Runde schaue und feststellen muss, dass ich der Älteste bin. „Das ist ein Mensch, der nie jung gewesen ist“, wurde einmal über mich in der Kantine meines Geburtsstadttheaters gesagt, ein Versäumnis, das – wenn es denn zutraf – der Anfang Zwanzigjährige, von dem hier die Rede ist, gründlich nachholen sollte.
Vor allem in der ersten Phase am Klosterberg, als mein altes Leben abbröckelte und ein neues sich noch sträubte, zweifelte ich manchmal an allem. Die ewigen Organisationsfahrten nach und von Flußfeld zermürbten mich, hatte ich doch „dort“ keinen Menschen, hingegen „da“ nicht wenige, die meinem Schritt skeptisch gegenüberstanden. Ich hätte ja auch bleiben und am Theater meiner Geburtsstadt weiterspielen können. Wie zum Zerreißen fühlte ich mich aufgespannt auf Fahrstraßen quer durch Deutschland liegen und wollte endlich auf der einen Seite loslassen können, um irgendwohin zu schnellen.
Denn nach dem Alleinsein hatte ich ein für einen jungen Menschen vielleicht unerklärliches Verlangen, immer schon gehabt, und mir schien armselig, wie ich es dann trug. Telefonieren war damals noch teuer, Kurznachrichten oder E-Mails gab es nicht, ein Brief brauchte leicht eine Woche – und zwei dauerte es, bis vielleicht einer zurückkam. Ich schrieb viele Briefe, lange, reflexive, alberne, an meine Eltern, an meine zurückgelassene Geliebte. Ich konnte mich schriftlich besser ausdrücken. Ich verstand nicht, was die Menschen auch miteinander zu reden hatten, wir wurden geboren, jeder für sich, wir würden sterben, jeder allein – alles dazwischen, ob Arbeit, selbst Liebe, schien mir Behauptung. In meinen schwarzen Momenten.
Es war eine Art spätpubertärer Verzweiflung, die ich mir da in den Umzugskisten mit hereingeschmuggelt hatte. Einer Biene oder Fliege das Fenster zu öffnen etwa und sie hinaus ins Freie zu geleiten, war mir eine sinnvolle, im Moment der Ausübung beglückende Handlung. War das Tier frei und davon, stürzte ich, das Fenster schließend, dann in tausendmal tiefere Tiefen zurück.
Ich war sehr streng. Meinen Eltern, zu denen ich auch durch unsere gemeinsamen Arbeiten und Reisen das beste Verhältnis hatte, erteilte ich Premierenbesuchsverbot, ich wollte ohne jegliche Ankettung zu meinem früheren Leben aufspielen. Selbst meine Freundin geruhte ich erst Tage nach der Premiere zu empfangen.
Einen ganzen trüben Oktobersonntag verbrachte ich in Todesahnung, weil ich mir einbildete, eine aus meiner Kokospalme gekrochene Vogelspinne habe mich gebissen – dabei hatte ich nur Kopfweh. Ich streunte hinter den letzten Gleisen des Bahnhofs umher, nicht an den prominenten Intercitygleisen, sondern hinten, wo Gras aus den Bahntrassen wuchs und vielleicht nur Draisinen oder höchstens Güterzüge aus Rhens oder Güls bewegt wurden, dorthin führte ein Weg, an dem einem sofort die schrecklichsten Verbrechen in den Sinn kamen, ein Ort, der das Verbrechen geradezu anzog, dachte ich, akustisch geschützt durch das Brausen und Anfahren und Ankommen all der Züge, die ja immer alles, was nicht mit ihnen in Bewegung ist, durchstreichen und auslöschen und bedeutungslos machen, und sei es die große Liebe oder das große Leid, und gelangte so von hinten zum Bahnhof, durchschritt und verließ ihn an der Vorderseite und wanderte dann etwa zwei Stunden durch sonntagsverlassene Wohn- und Einkaufsstraßen, die sich meiner Erinnerung verweigern, weil ich den gesamten Text der neuen Rolle durchging, vor mich hin und in mich hinein sagte, immer wieder dazwischen mein Kopfweh überprüfend und an meine Krankheit denkend und daran, ob ich den Montag abwarten oder heute schon ein Unfallkrankenhaus aufsuchen solle, aber was kann schon ein Unfallkrankenhaus gegen Hirnhautentzündung machen, dachte ich, die Krankheit ist längst im Gang, und so ging ich weiter mit meinem Text und meiner Traurigkeit, dass nun alles vorbei wäre, obwohl ich mir sagen musste, dass mein Ende, wenn ich es nun, mit einundzwanzig erreichte, seine Folgerichtigkeit hätte.
Dann stand ich auf einmal wieder am Bahnhof, am Intercitybahnsteig, wo ein Zug sich anschickte, nach Rom zu fahren, morgen früh um acht würde er dort sein, Stazione Termini stand auf den Waggons, aus denen es, fand ich, nach Italien roch, italienische Hände gestikulierten hinter den Scheiben, italienische Schuhe stiegen auf und nieder, italienische Paare verabschiedeten sich und italienische Kinder raunten einer langen Zugfahrt entgegen, an der ich so gern teilgenommen hätte, und ich wartete, bis der Zug abfuhr, und wer mich stehen sah, musste glauben, mein Liebstes sei mit ihm weggefahren, und für immer.
Das große Blättertreiben hatte längst begonnen, und die Regentropfen blieben punkthaft wie kleine Kristalle am Glas und schauten neugierig in mein Zimmer. Fenstergedanken waren mir Herbstgedanken zumeist. Aber ich mochte den Wind, ich konnte mit ihm treiben und erstarrte weniger leicht.
Wunderschön war es, im Stadtwald spazieren zu gehen und die Herbstfarben zu sehen. Am „Rindskopf“ zumal, wo man stundenlang umherschweifen und seine Texte auswendig den Blättern zuwerfen konnte. Schön auch, des Nachts noch einmal auf den Balkon zu treten und, den Kopf nach hinten, die Augen in den Himmel zu versenken, bis die Sterne nahe waren.
Meine letzte Nacht am Klosterberg bestand aus leeren Wänden, leeren Regalen, Trauer und Angst.
Liebe Eltern!