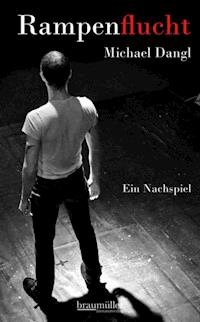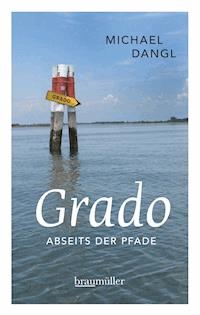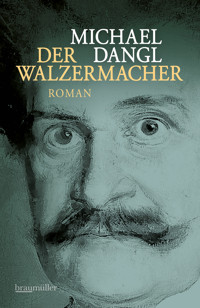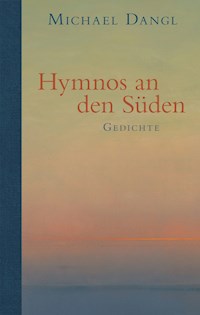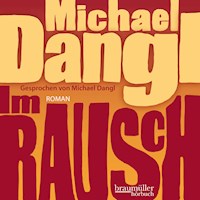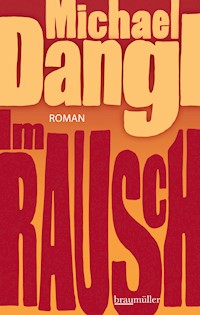21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Fjodor M. Dostojewskij zum ersten Mal Venedig besucht, ist das die Erfüllung eines Kindheitstraums. Doch ist er bereits 40, im Westen unbekannt und in einer beruflichen wie privaten Krise. Die Schönheit und Lebendigkeit Venedigs erreichen ihn nicht. Da widerfährt ihm eine phantastische Begegnung: mit dem Komponisten Gioacchino Rossini, 70, weltberühmt, eine Legende. Der barocke Genussmensch, Inbegriff mediterraner Leichtigkeit und Allegria, verzaubert ihn mit Lebensfreude und stellt den grüblerischen, schwermütigen Asketen in drei Tagen sozusagen vom Kopf auf die Beine. Die Gegensätze sind die größten – und doch erleben wir die Annäherung zweier hochsensibler Künstlerseelen, in teils grotesken, komischen und an die Grundfragen des Menschlichen rührenden Situationen und Gesprächen. "Ich habe Venedig noch mehr geliebt als Russland", findet sich in privaten Notizen Dostojewskijs. Der Roman spürt möglichen Ursachen dieser Liebe nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MICHAEL DANGL
Orangen fürDostojewskij
ROMAN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2021
© 2021 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Cover Montage: © Shutterstock/Nick Tempest, © Shutterstock/Steve Bruckmann
Druck: EuroPB, Dělostřelecká 344, CZ 261 01 Příbram
ISBN 978-3-99200-297-9
eISBN 978-3-99200-298-6
Für Lia, Maria und Anfisa
Ich habe Venedig noch mehr geliebt als Russland
Fjodor M. Dostojewskij
Inhalt
TEIL I
Kapitel 1
Kapitel 2
TEIL II
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
TEIL III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
TEIL IV
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
TEIL V
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Epilog
Dichtung und Wahrheit
I
1
Anfang August, gegen Mittag, bei großer Hitze, fuhr ein Zug der lombardisch-venezianischen Eisenbahn mit hoher Geschwindigkeit auf Venedig zu. Am Fensterplatz eines vollbesetzten Sechserabteils saß in Fahrtrichtung ein Mann mit bleichem, unausgeschlafenem Gesicht, ein Schriftsteller, der einmal als literarische Hoffnung seines Heimatlandes Russland gegolten hatte und manchen noch galt, wiewohl seine ersten Erfolge nun schon einige Zeit zurücklagen, er im Westen völlig unbekannt und nicht mehr ganz jung war. Er war vierzig und hieß Fjodor Michailowitsch Dostojewskij.
Den Alleinreisenden mit ordentlich frisierten, an der Stirn sich lichtenden und an den Ohren widerspenstig abstehenden Haaren und krausem Vollbart plagte schon seit Längerem ein Hustenreiz, dem er durch wiederholtes Hüsteln in die Faust Herr zu werden suchte, und er lechzte danach, auszusteigen und etwas zu trinken. Der Tee am Mailänder Bahnhof war so heiß gewesen, dass er ihn aus Angst, den Anschlusszug zu versäumen, stehen gelassen hatte. Bahnreisen waren ihm langweilig, und am liebsten wäre er hinausgesprungen und seitwärts neben dem Waggon einhergelaufen. Die Fahrt von Florenz bis Mailand und nun hierher war umständlich gewesen, doch trotzdem und trotz der stickigen Hitze war sein weißer Kragen hochgeschlossen, saß die halstuchartige kurze Krawatte, wo sie zu sitzen hatte, waren graue Weste und schwarzer Gehrock zugeknöpft und wirkte die helle Hose an den korrekt übereinandergeschlagenen Beinen wie frisch gebügelt.
„In Omsk die Sonne geht auf um vier Uhr.“ Überflüssige Bemerkungen seiner Reisegefährten über die Fülle der Sonnenstunden in Italien hatten ihn zu diesem Satz veranlasst, seinem ersten auf der mehrstündigen Fahrt, den er, um besonders dem Berliner Ehepaar ihm gegenüber eins auszuwischen, auf Deutsch formulierte. Trotz langen vorhergehenden Nachdenkens und des Durchspielens verschiedener Varianten wusste er, dass irgendetwas an der Wortstellung falsch war, wie immer, wenn er sich zu einem Satz im Deutschen, das er nur schlecht beherrschte, aufschwang. Im Russischen war alles möglich: „In Omsk um vier Uhr geht die Sonne auf“, „Um vier Uhr in Omsk die Sonne geht auf“, sogar „Aufgeht die Sonne um vier Uhr in Omsk“ war möglich, doch das Deutsche verlangte wie alles in Deutschland Pünktlichkeit und Genauigkeit, und es gab nur eine Lösung, und wer die nicht traf, war blamiert und hatte verloren.
Er wusste nicht, ob die Stille, die dem Satz folgte, dem Inhalt oder der Grammatik galt, und zum Glück wurde sie durch einen lauten Pfiff des Zuges beendet. „Venezia-Mestre“ stand draußen; „Mestre“ bedeutete sicher so etwas wie „Zentrum“, dachte Dostojewskij, sprang als Erster auf, nahm seinen Koffer aus dem Gepäcknetz und verließ das Abteil, wobei er einem Engländer, der an der Tür saß, auf den Fuß trat. Auf dem Perron musste er feststellen, dass niemand außer ihm aus-, vielmehr einige in den schon vollen Zug einstiegen, und er wandte sich an einen neben ihm stehenden Uniformierten.
„Venezia?“, fragte er heiser und zu leise, denn der Beamte musterte ihn argwöhnisch und antwortete mit einer Gegenfrage, überraschenderweise auf Deutsch und noch dazu mit einer seltsamen Vokalfärbung:
„Wos?“
„Venezia?“
„Venezia-Mestre.“
„A Venezia?“
Der Uniformierte, der, wie er jetzt sah, kein Bahnbeamter, sondern ein Polizist war, da er einen Säbel an der Seite trug, zeigte in die Richtung, in die der Zug weiterzufahren sich eben anschickte, und stieß dazu ein „Do!“ aus. Dostojewskij sprang im letzten Moment wieder auf. Die neu Eingestiegenen, allesamt Herren in dunklen Anzügen, entpuppten sich als Polizisten in Zivil und forderten von den Reisenden Einsicht in deren Pässe. Auch der leise vor sich hin schimpfend in den Zug zurückgekehrte Russe musste seinen vorweisen, ehe er das Abteil wiederfand, den Koffer schwer atmend ins Netz hob und etwas Unverständliches in sich hineinbrummend Platz nahm. Beim Betreten des Coupés war er dem Engländer erneut auf den Fuß gestiegen, und nun konnte man nicht ausschließen, dass es ihm nicht nur nicht entgangen, sondern – und schon beim ersten Mal – Absicht gewesen war.
Mürrisch blinzelte er auf die sonnenfunkelnden Wasserflächen, die sich bald rings um den Zug auftaten. Während die Anderen sich die Hälse verdrehten, in Begeisterungslauten ergingen und die zwei Deutschen sich mit dem Wissen großtaten, dass es in Venedig seit drei Wochen nicht geregnet hätte und das Wasser knapp würde, blieb er die ganze Fahrt über den Damm regungslos und dachte an die vergangenen zwei Monate seiner Reise, seiner allerersten nach Westeuropa, die mit Venedig ihre letzte Station erreichte. Am siebten Juni von Petersburg nach Berlin gekommen, war er erst wie besessen durch Deutschland gerast, jeden Tag in eine andere Stadt, bis sich seine Aufenthalte in Paris, London und Genf verlängerten und er erst vor eineinhalb Wochen Italien betreten hatte. Dabei war die ganze Zeit, verstand er beim Schauen auf die Sandbänke der seine Augen blendenden Lagune, Venedig als geheimes Ziel vor ihm gestanden, und jetzt, da es immer näher kam, schien es, als habe er der Sehnsucht nach diesem Ort, die von frühester Jugend, ja seit seiner Kindheit in ihm gewesen war, einen Verweis erteilen wollen mit den neun Wochen des Kreuz-und-Quer durch Europa, um ihr nicht die Macht zuzugestehen, die sie vielleicht in ihm hatte, und um bei sich selbst nur ja den Verdacht nicht aufkommen zu lassen, sie, die Sehnsucht nach Venedig, sei der eigentliche Antrieb, der heimliche Grund dieser ersten Auslandsreise seines Lebens. Die Hinauszögerung hatte ihm sogar einen gewissen Kitzel bereitet, eine kleine wollüstige Selbstbestrafung war es gewesen, als er nach dem Grenzübertritt aus der Schweiz den Umweg über Florenz genommen hatte, statt geradewegs auf Venedig zuzurasen. Nun bereute er fast, sie – da die Stadt auch im Russischen „Venezia“ hieß, hatte er seit je wie an etwas Weibliches an sie gedacht – für den Schluss aufgehoben zu haben, denn es war gut möglich, dass die vielen schlechten Eindrücke und Enttäuschungen aus vier Ländern und mehr als einem Dutzend Städten, in denen noch dazu fast ständig schlechtes Wetter gewesen war, wie eine dicke Schicht Staub zwischen ihm und dem heimlichen Höhepunkt der Reise seinen Blick trübten, ja verunmöglichten.
Zudem war jede letzte Station einer Reise von den Bekümmernissen um die Heimkehr beschwert. Privat und beruflich hing der streng wirkende zugeknöpfte Herr mit dem sacht ausufernden Bart nämlich völlig in der Luft. Sein sogenannter literarischer Durchbruch, der Roman „Arme Leute“, lag sechzehn Jahre zurück, und nach dem Veröffentlichungsverbot, Teil der zehnjährigen Haftstrafe in Sibirien, war es schwer gewesen, an diesen Erfolg wieder anzuschließen. Immer wenn er daran dachte, verschlimmerte sich das Stechen in seiner Seite, das von der Leber kam und ihn daran erinnerte, dass es gesundheitlich mit ihm in mehrfacher Hinsicht im Argen stand. Abrupt und mit einer Energie, dass alle fünf Augenpaare im Abteil zu ihm sprangen, zog er ein dünnes Heft aus der Rocktasche und schlug es auf. Vor einem guten Jahr hatte er begonnen, über seine epileptischen Anfälle Buch zu führen. Dauer und Heftigkeit waren verzeichnet (leicht/mittel/schwer) sowie die Abstände zwischen ihnen, die von einem halben Tag bis zu einem halben Jahr reichen konnten. Jedem Anfall ging eine längere Phase der Niedergeschlagenheit voraus, den schweren folgte tagelange Arbeitsunfähigkeit. Der letzte Eintrag („mittel“) nannte den einunddreißigsten Mai, eine Woche vor der Abreise. Schon vor Jahren, noch in Sibirien, hatte ihn der Arzt, der die Erkrankung zum ersten Mal diagnostizierte, gewarnt, bei einem der Anfälle werde er an dem Schaum, der ihm aus dem Mund stieg, am Rücken liegend ersticken. Inzwischen hatte er eine gewisse Übung darin bekommen, das Aufsteigen einer neuen Eruption in sich zu verspüren und sich, vor allem wenn er alleine war, wie immer möglich darauf vorzubereiten.
Der Zug hatte die Lagune überquert und fuhr in den Bahnhof ein. Unter großem Rascheln und Poltern rafften die Reisenden ihre während der Fahrt um sich verstreuten Gegenstände zusammen, und Dostojewskij dachte daran, wie ihm der Schaffner in Mailand dieses Coupé, in dem nur ein junges, sehr hübsches Mädchen gesessen war, zugewiesen und sich dafür Trinkgeld erhofft hatte. Da hatte er sich getäuscht. Und das Mädchen war an der nächsten Station ausgestiegen. Diesmal ließ er den Anderen den Vortritt, nickte zu ihren Verabschiedungen und blieb in Gedanken verfangen sitzen, als ginge die Fahrt für ihn allein weiter. Sein Reisegeld, Vorschuss auf einen ungeschriebenen Roman, war längst aufgebraucht, und als Erstes, dachte er, würde er nachsehen müssen, ob auf der Post schon der nächste Wechsel seines Bruders Michail lag. Der deutsche Ehemann kam noch einmal zurück, vom Korridor aus krähte er durch die offene Tür: „Ich weiß, warum die Sonne dort so früh aufgeht.“ Er machte eine kleine Kunstpause und sagte belehrend: „Weil es so weit östlich liegt.“
„Ja“, gab der Russe zur Antwort und schaute ernst zu Boden. Womit der einzige Dialog seiner Bahnfahrt zu Ende war.
Italien kannte er bislang nur aus Zügen und Equipagen heraus. In Florenz hatte er sich schlecht gefühlt und war wenig ausgegangen, außerdem war es regnerisch und seltsam kühl gewesen. Sodass ihm nun, als er aus dem Bahnhof Santa Lucia auf den Vorplatz trat, zum ersten Mal in seinem Leben die volle Glut eines mediterranen Sommertags entgegenschlug. Und die war anders als jede andere bisher, ein weiches, freundliches Meer, in das man eintauchte, ein alle Sinne vereinnahmendes Spektakel aus Farben und Licht, Stimmen und Bewegung, als wäre man in ein zum Leben erwecktes Gemälde getreten und zum ersten Mal nicht mehr dessen Betrachter, sondern Akteur. Und wie es den Augen war, als hätte man ihnen einen Schleier abgenommen, schienen die Ohren von Pelzklappen befreit und wunderten sich über die Symphonie von Rufen, Reden, Singen und Schreien in einem Dutzend von Sprachen, aus denen das Italienische herausklang und -schmetterte wie eine fröhliche Trompetenmelodie aus aufgeregtem Orchesteraccompagnement.
Noch hatte der Angekommene keinen Faden der Anknüpfung an dieses bunte Gewebe gefunden und stand starr in der um ihn wehenden, ihn schubsenden Menge von Händlern, Wasserträgern, Reisenden und spielenden, herumlaufenden Kindern, hielt den Griff seines Koffers fest umklammert, schaute mit schmalem Blick auf den breiten Kanal, der sich um den Bahnhofsvorplatz schlängelte und Boote mit roten und schwarzen Segeln auf seinem unverschämt leuchtenden Blau trug, und fühlte sich so schwach, dass er am liebsten umgekehrt und in irgendeinen Zug gestiegen wäre, Hauptsache weg. Richtungslos, nur, um einen Anfang zu machen, bewegte er sich ein paar Schritte nach links, wo ihm ein Lokal in den Blick kam, das scharenweise Menschen ausspuckte und einsog und ihm seinen dringenden Wunsch nach etwas zu trinken erfüllen würde. An einen Laternenmast vor dem Lokal gelehnt, stand ein kleiner Mann mit kugeligem Bauch, in dem zwei Arme und Beine steckten, und kugelrundem kahlen Kopf, aus dem zwei lebendige, feurige Augen blitzten.
„Ciao!“, rief er, und der auf ihn Zugehende drehte sich halb um, um den Freund hinter sich zu sehen, der offenbar mit diesem Ruf begrüßt wurde, doch da war niemand, „Ciao!“ kam es dafür noch einmal und nun ganz unzweifelhaft auf ihn hin und schon sprang der Fremde mit einem „Benvenuto a Venezia!“ auf ihn zu und griff nach seinem Koffer. Vor Diebstählen in Italien mehrfach gewarnt, legte Dostojewskij auch die zweite Hand um den Griff und sah den Angreifer finster an, als wollte er ihn kraft seines Blicks in die Flucht schlagen. Doch der hob beide Arme weit über die Schultern und gab mit dieser Gebärde und einem lauten Ausbruch von Vokalen, die aus seinem Mund quollen, seiner guten Absicht Ausdruck. Die Suada kam offensichtlich mit einer Frage zu Ende, der ein Schulterzucken folgte. „Indirizzo“, wollte der Kugelmensch wissen und „Albergo“, und der Russe, der sicher war, dass der Andere Geld forderte, sah sich betreten um. „Address“, verstand er nun endlich, und zugleich, dass der Kleine ihm den Koffer tragen und ihn führen wollte. Er zeigte ihm einen Zettel, auf dem Name und Anschrift des Hotels geschrieben standen. Das ermutigte den Fremden zu einer neuen Koloraturarie von Vokalen, mit der er den Reisenden so verblüffte, dass er ihm geschwind den Koffer aus den Händen nehmen konnte und schon, heftig mit dem freien Arm bedeutend, ihm nachzukommen, davonlief. Der vielleicht nicht Ältere, aber ungleich Schwerfälligere, der zudem von der Reise ganz steife Beine hatte, protestierte und sah doch keine andere Möglichkeit, als dem flinken neuen Besitzer seines Koffers nachzugehen. Da blieb der unvermittelt stehen und drehte sich um.
„Scusate, Signore“, sagte er und verneigte sich leicht, „sono Pepi.“
„Pepi?“ Da erhellte sich das blasse, bis dahin ausdruckslose Gesicht, auf dem die Sonne zuvor unsichtbare Sommersprossen aufblühen hatte lassen, und die grauen, tief liegenden Augen bekamen einen seltsamen weichen Glanz.
„Beppo!“, rief er nun fast, und der Andere, wie um nicht kleinlich zu sein und seine gute Laune nicht zu verlieren, stieß lachend und schulterwerfend aus „Pepi … Beppo …“ – und erklärte sich mit der Namensveränderung einverstanden.
„E lei?“, zeigte er auf den Herrn.
„Je m’appelle Dostojewskij.“
Beppo/Pepi schickte mit den Augen ein Stoßgebet zum Himmel und sagte etwas, das wahrscheinlich „Das merke ich mir nie“ hieß, lachte wieder herzlich und setzte seinen Weg fort.
Dostojewskij warf einen Blick auf das Lokal, in dem er Menschen mit Getränken sitzen sah, doch da lief sein Kofferträger schon über die ersten Stufen der Steinbrücke über den Kanal. – Beppo! Dostojewskij schüttelte den Kopf. Dieses Sinnbild seiner venezianischen Sehnsucht, der Name des Byron’schen Gedichts, das ihm die ersten Phantasiebilder seiner jugendlichen Schwärmerei eingegeben hatte, hier war es Fleisch und Blut, sprang ihm auf den ersten Metern vor die Füße, trug sein Gepäck, wurde sein Cicerone … die „Steine aus ‚Beppo‘“ hatte er, so lange er denken konnte, zu sehen, zu berühren begehrt, und folgte nun einem leibhaftigen Nachfahren dieser literarischen Erfindung auf Stufen aus Stein, die sicher auch Byron betreten hatte.
Auf der Anhöhe der Brücke hielt er kurzatmig an und ließ Beppo aus den Augen. Sein Name – und sein Lachen – hatten ihm Vertrauen gegeben. Die Brise, die hier oben in sein Haar fuhr, war um nichts kühler als die stehende Luft und dennoch oder deswegen wohltuend, als streichle jemand mit zärtlicher Hand sein Haupt. Er schaute auf den Kanal. Bunter waren die ihn säumenden Häuser als in Petersburg, vielfarbiger, mit rötlichen Dächern. Die Pfähle im Wasser waren rot-weiß oder blau-weiß bemalt wie in einer italienischen Theaterkomödie, von den Balkonen wehten Fahnen, alles ergab ein heiteres Bild, als wäre irgendein Festtag.
Ein Hustenanfall schüttelte ihn, und er hielt sich an der Steinbrüstung fest, weil ihn schwindelte, und er kurz befürchtete, vornüber in den Kanal zu stürzen. Wahrscheinlich wäre er auf einem Bootsdeck zerschellt oder ein Segelmast hätte ihn aufgespießt, und das wäre dann das Ende gewesen. Dostojewskij starrte auf das munter bewegte Wasser wie auf den Eingang zur Unterwelt, bis Beppo ihn vom Fuß der Brücke her anrief: „Signore!“ Und als dieser zu ihm sah, machte er eine wiegende Geste mit dem Kopf, die unmissverständlich „weitergehen“ hieß.
Sie gingen eine lange, gerade Gasse entlang, in die, ausgerechnet, senkrecht die Sonne fiel. Dostojewskij sah nach oben und schimpfte. Beppo lief fünf Meter vor ihm, er war so klein, dass der Koffer fast am Boden streifte, und so rund, dass der Koffer vielleicht das Einzige war, das ihn daran hinderte, zu kugeln statt zu gehen. Dabei drehte er unentwegt den Kopf zurück und rief Italienisches über die Schulter zu seinem neuen Herrn, der aber dadurch wirkte, als wäre er der Knecht und nähme Befehle zur Eile entgegen. Rechts und links waren Läden und Geschäfte, Handwerker saßen davor und arbeiteten, aus allen Türen, die durchwegs offen standen, drangen Lärm und verschiedenartigste Gerüche. An einer Ecke, wo es penetrant nach Katzenurin stank, bog Beppo überraschend nach links in eine noch schmalere Gasse ab, noch länger als die erste, und nun schien die Sonne den beiden auf den Hinterkopf. Eine Bettlerin hielt Dostojewskij eine offene Blechdose hin. Er blieb stehen und griff in seine Hosentasche, aber da kam Beppo sogleich angelaufen, rief etwas offenbar Unanständiges zur Bettlerin – denn die wurde rot –, hielt den ausgestreckten Arm zwischen sie und den verhinderten Wohltäter und machte mit der Zunge einen schnalzenden Laut wie ein Kutscher zu seinem Pferd. Weitergehend hauchte der Zurechtgewiesene ein „Pardonnez-moi!“ zurück, mehr durfte er der Armen nicht geben. Sie gingen über eine kleine Brücke und einen sehr langen Kanal entlang, an dem ein Gondoliere auf Kundschaft wartete. Schon von Weitem krakeelte Beppo ihm entgegen, sodass dieser seinen Versuch, den Reisenden zu einer Fahrt einzuladen, schnell aufgab und dafür aus vollem Hals auf den mit dem Koffer Dahinstrebenden losfluchte. Kennen die einander?, dachte Dostojewskij. Die anderen Fußgänger achteten weder auf den Streit noch darauf, dass der Kleine im Weitergehen seinen Monolog über die Schulter nach hinten fortsetzte, ohne im mindesten verstanden zu werden. Immer liefen sie in praller Sonne. Auf menschenleeren Balkonen wehten Markisen. Wieder querte Beppo den Kanal über eine kleine Brücke. Ob er etwas essen wolle, fragte er den zusehends Erschöpften hinter sich mit einer Geste. Auf die Pantomime einsteigend, antwortete er mit einer Trinkbewegung, worauf Beppo zum Himmel jauchzte, als hätte er in der Lotterie gewonnen. Und den Marsch im Laufschritt fortsetzte. Durch enge, verwinkelte Gassen, der von ihm Geführte konnte ihm kaum folgen, verlor ihn immer öfter aus den Augen, und schließlich tat sich hinter einer Ecke eine menschenleere Sackgasse auf, die an einem Kanal endete. Oben wehte Wäsche im Wind, es war vollkommen still.
Der Friede des Orts ergriff Dostojewskij mehr als der Schreck, möglicherweise gerade sein Hab und Gut verloren zu haben. Da schnellte eine glänzende Kugel von unten aus einer Hauswand, Beppos schweißnasser Glatzkopf lugte aus einem niedrigen Durchgang, der nicht zu sehen war, bis man direkt davorstand. Der Dichter bückte sich und ging dem Wiedergefundenen nach, der wie zum Hohn über seinen eigenen Kleinwuchs in die Höhe sprang und, trotz Koffer, die Hacken seiner Pantoffel in der Luft aneinanderschlug. Genau an einer Lokaltür kamen sie in eine breitere Gasse. Doch der fragende Blick des Einen bekam nur ein „No, no, no!“ mit erhobenem Zeigefinger zur Antwort, denn der Andere schien ein bestimmtes Ziel zu haben.
Sieben Gassenecken und drei Brücken weiter standen sie vor einer großen Kirche auf der anderen Seite eines Kanals. „Santa Maria Assunta“, stieß Beppo aus und bekreuzigte sich, aber nicht ohne Ironie, denn er ermunterte Dostojewskij feixend, dasselbe zu tun – wenn er jedoch dessen Gesicht bis dahin als ernst empfunden haben mochte, wurde er eines Besseren belehrt, denn nun verfinsterte es sich sprichwörtlich, und was ihn anblickte, war kein ernstes Gesicht, sondern die Personifikation des Ernstes, wenn auch, wie ihm schien, ohne Vorwurf. Mit einem Lachen erlöste Beppo die Situation und wies mit großer Geste auf eine offene Tür hinter ihnen.
Es war eine Gaststätte, von außen kaum als solche erkennbar und innen nachtdunkel. Es roch stark nach Wein und Schnaps. Der Italiener wurde von zwei Männern hinter der Theke, Hünen mit zerfurchten, zerschnittenen Gesichtern, laut begrüßt wie nach Jahren der Abwesenheit, dabei war er vielleicht nur ein paar Tage weg gewesen, gar nur Stunden, dachte der Ortsfremde und ließ sich dankbar auf einem harten Stuhl nieder. Die Gesellschaft von Männern wie diesen, Lokale wie dieses waren ihm vertraut. Das Spasskij-Viertel in Petersburg rund um die größte Geschäftsstraße, die Sadowaja, wo er in verschiedenen Wohnungen gelebt hatte, war die Gegend der Märkte, der Fuhrknechte, Bauern und Kaufleute. Die wilden Jaroslawler lebten dort, Nachfahren der tatarischen Steppenvölker. Es wimmelte von Taschendieben, zwielichtigem Gesindel, billigen Prostituierten. Die Gassen waren voll Betrunkener und Obdachloser, die Häuser schmutzig und überfüllt. Menschen aus allen Teilen Russlands und jeder Nationalität Europas konnte man dort finden. Einer der Riesen stellte sich vor ihm auf, er reichte fast bis zur Decke. Beppo, am Tresen stehend, hatte schon ein Glas Weißwein in der Hand, klein und bauchig, als wäre es seiner Figur zugeschnitten. Dostojewskij bestellte auf Französisch ein Bier. Keine Minute später stand es vor ihm.
Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, erkannte er, dass die Wände zur Gänze mit Darstellungen von Rokoko-Idyllen bemalt waren. Ausgelassene Gesellschaften junger Menschen in leichten, sommerlichen Kleidern tanzten auf Wiesen, lagen, spielten und musizierten an Bachufern, neckten sich, scherzten, gaben sich verschwiegene Stelldicheins in Gondeln und Gärten … sie erinnerten ihn an Szenen aus Stücken von Goldoni und Büchern von Goethe und de Laclos, in denen er als Kind in Moskau zum ersten Mal eine Ahnung von Venedig bekommen hatte, und einen Auslöser seiner Sehnsucht. Vorrevolutionäre Szenen, wie ihm jetzt auffiel – die in seiner eigenen revolutionären Jugend in Sankt Petersburg von den Freiheitsgedanken in den Stücken Schillers, der mitreißenden Aufbruchsenergie in den Opern Rossinis abgelöst oder transformiert wurden und zusammen mit den Werken von Hugo, Flaubert, Balzac einen so zauberischen Eindruck in ihm hinterließen, dass es war, als rufe dieses Westeuropa nach ihm, dem Russen, dem die Heimat alles war und dem doch schien, als wäre alles, was es in Russland an Entwicklung, Kunst, Bürgersinn und Menschlichkeit gab, von eben dort hergekommen, aus Westeuropa, aus Europa eigentlich, denn Russland war nicht Europa, Russland war Russland, aus Europa also, diesem „Land der heiligen Wunder“, wie er es früher gerne genannt hatte. Früher, und definitiv vor seiner ersten Reise dorthin.
Im Sitzen, im Dunkeln, im Kühleren war es in ihm friedlicher geworden. Und bei den ersten Schlucken Bier. Das musste er sich für seinen Roman – dessen Pläne er schon lange in sich trug und für die er auf seiner Reise nichts zustande gebracht hatte als Skizzen –, für den Roman „Die Trinker“ merken: Im ersten Schluck lag’s. Bis dahin hatte jeder, auch der gewohnheitsmäßigste Trinker, immer wieder eine Chance. Danach nicht mehr. Der erste Schluck Bier, Wein, Wodka verwandelte dich und zog dich in seine Macht. Als das Glas leer war, befiel ihn bleierne Müdigkeit und eine unangenehme Mischung aus Hunger und schlechter Laune. Was hatte diese Herumreiserei für einen Sinn? Was tat er in dieser lauten, unübersichtlichen Stadt? Die Woche in Florenz war er die ganze Zeit in einer Lesehalle gesessen und hatte russische Zeitungen studiert. War die Lesehalle zu, hatte er sich in seine Pension, eine muffige Absteige mit dem prätentiösen Namen „Suisse“, gesetzt und „Les Misérables“ gelesen. Eine literarische Neuerscheinung, die ihm gefiel, weil sie ihn an seine eigenen „Erniedrigten und Beleidigten“ erinnerte. Dessen Honorar längst aufgezehrt war. Strachow, ein Freund, den er in Genf getroffen und der ihn nach Florenz begleitet hatte, war im Duomo gewesen, auf dem Ponte Vecchio, in den Boboli-Gärten, beim Abendtee hatte er davon erzählt und nur einmal Dostojewskij in die Uffizien geschleppt, ein in dessen Augen unfassbar hässliches Gebäude, mehr Amt als Museum, er war davongelaufen, noch bevor sie zur Venus von Medici gekommen waren. Danach hatten sie auf der Piazza della Signoria Eis gegessen und gestritten.
„Du bist ein schlechter Reiser“, (Strachow) „dich interessieren weder die Natur – als wir an den Schweizer Seen vorbeigefahren sind, hast du nicht einmal aus dem Zugfenster geschaut –, noch historische Sehenswürdigkeiten, noch Kunstwerke.“
„Vielleicht.“ (Dostojewskij.) „Mein Interesse geht im Wesentlichen auf den Menschen. Was gibt es Faszinierenderes? Was Widersprüchlicheres?“
Im selben Moment war ein Buckliger an ihrem Tisch vorbeigegangen, und Strachow hatte gelacht, und Dostojewskij war böse geworden und hatte Strachow angeschrien, dass er ihn nicht ernst nähme, außerdem sei das Eis ihm zu kalt und er ziehe es vor, ins Hotel zu gehen und „Les Misérables“ zu lesen. Jetzt war er froh, wieder allein zu sein. Strachow war wohl schon in Russland. Der hatte es gut.
Beppo und die zwei Hünen hielten in ihrem „Gespräch“ – das daraus bestand, dass sie einander in bester Laune anschrien – inne und prosteten vom Tresen her dem stummen Gast zu, der aber betreten zu Boden sah. Schon immer, selbst in seinen ausgelassensten Stunden, war es ihm unangenehm gewesen, wenn Gläser gegen ihn gehalten wurden, und auch er selbst führte die Bewegung ungern aus. Welche Gottheit wurde da hochgehalten und hofiert? Und auch in der katholischen Kirche, wenn der Priester den Kelch hob, um das „Blut Christi“ zu preisen – und damit sozusagen seiner Gemeinde zuprostete –, empfand Dostojewskij das als verunglücktes Ritual, eine peinliche Äußerlichkeit eines im Wesen tieferen Gedankens.
Am Kirchenvorplatz schoss ihm das Bier aus allen Poren. Zum Glück bogen sie jetzt in schattige und gleich erfrischend kühlere Gassen ein. Aus den Häusern hörte man das Klappern von Geschirr, Fetzen von Tischgesprächen, Babyweinen, Lieder, gesungen von Frauen aus wer weiß welcher Freude, wer weiß welcher Not. Auf der Anhöhe einer der unzähligen Brücken war es dann, dass ihm auf einmal Salzluft in die Nase stieg, vom Wind hergetragen aus der Lagune oder vom Meer. Das Meer hatte er in Europa zweimal, auf der Überfahrt nach und von England kennengelernt. Doch wie hier der Salz- und Tanggeruch in die Stadt wehte, das kannte er nur von einem Ort: von Sankt Petersburg. Je näher sie nun ihrem Ziel und damit dem Wasser kamen, desto mehr stieg ihm dieser Duft nicht nur in die Nase, sondern ins Gemüt und schürte, zugleich mit dem tieferen Eintauchen ins Venezianische, Fremde, mehr als je zuvor in den zwei Monaten seiner Reise die Sehnsucht nach Zuhause.
Das Hotel Belle Arti war ein eleganter Palazzo mit Garten, und sofort ärgerte sich Dostojewskij, dass ihn seine Pariser Bekannten, die er um Empfehlung für ein „günstiges Quartier“ in Venedig gebeten hatte, hierher schickten. Doch der Rezeptionist erklärte ihm in schlechtem Französisch, dass sich seine Reservierung auf das „andere Gebäude“ beziehe, und das hieß auf ein schlichtes Wohnhaus auf der anderen Straßenseite, wo das Hotel einfachere Zimmer vermietete. Den Schlüssel händigte er ihm mit den Worten aus: „Benvenuto, Signor Dostojewitsch!“ Dieser korrigierte sachlich und fragte nach dem Postamt, der Beschreibung hörte er nach dem sechsten à gauche und à droite zu folgen auf, außerdem winkte Beppo, der mit dem Koffer an der Tür zwischen Garten und Foyer wartete, heftig fuchtelnd ab, was heißen sollte, er würde ihn hinführen. Die Frage nach einer „Lesehalle“ fiel auf Unverständnis, die Umschreibung „wo man hier Zeitungen lesen“ könne, beantwortete der Portier mit einem verlegenen Deuten auf ein Fauteuil. Beppo ließ es sich nicht nehmen, den Koffer auch über die Straße und in den ersten Stock zu tragen. Als er ihn abgestellt hatte, sich den Schweiß von der Stirn wischte und anfing, sich im schlichten, doch praktikabel eingerichteten Zimmer umzusehen, fand Dostojewskij, dass es Zeit zum Abschied wäre. Mit der Bezahlung des Weins vorhin war es nicht getan, aber mit der venezianischen Währung, die er in Mailand eingetauscht hatte, kannte er sich nicht aus, sodass er ihm nur zu wenig oder zu viel geben konnte, und Protest gäbe es wahrscheinlich nur im ersten Fall. Er zog die erstbeste Münze aus der Tasche und hielt sie ihm hin. Beppos Gesicht lief rot an, er streckte beide Arme von sich und stieß aus: „Ma no!“ – Natürlich, zu wenig. „Ma è uno Svanzica!“, rief Beppo und zeigte auf Dostojewskijs Hosentasche. Der holte alle Münzen heraus und präsentierte sie in der flachen Hand. Beppo stocherte darin herum und pickte sich die zwei, drei heraus, die ihm für seine Dienste angemessen schienen, wies noch einmal auf die erste Münze und sagte lachend und mit drohendem Finger: „Ma non uno Svanzica!“ Ging zur Tür und statt hinauszugehen, hielt er sie mit einer leichten Verbeugung auf: „Alla Posta?“
Der Gedanke, dem unermüdlichen Spaßvogel, der ohne Koffer sicher noch schneller wäre, gleich wieder hinterherzulaufen, war dem erschöpften Reisenden unerträglich und er schickte ihn mit einem „plus tard“ eilig weg. „Plus tard“, wiederholte Beppo, „va ben.“ Und bevor die Tür hinter ihm im Schloss war, machte er sie noch einmal einen Spalt weit auf, steckte seinen Kopf durch und sang: „Ah che più tardi ancor?“, opernhaft klang es, als wäre er ein ganzer Chor, und fügte hinzu: „In Italiano: più tardi. Plus tard – più tardi.“ Und mit einem breiten Lachen beendete er seinen Auftritt, doch hörte man ihn noch lange singen, „Ah che più tardi ancor“ – am Korridor, die Stiegen hinab, bis er aus der Haustür war.
Dostojewskij ging zum einzigen Fenster an der Längsseite des Bettes. Es stand halb offen, und als er es ganz öffnete, überflutete ihn eine Welle heißer Luft. Er sah in einen begrünten Innenhof mit Palmen, Olivenbäumen und einem kleinen Gemüse- und Kräutergarten. Nach der Hektik der letzten Stunden tat die Stille gut. Nur zwei Tauben scharrten auf einem Fensterbrett und gurrten ihr internationales Lied. Die Fenster der anderen den Hof umfassenden Häuser trugen die Zeichen gewöhnlicher Wohnungen: Blumen, an einem eine Katze, Wäscheleinen. In Petersburg hatte der Dichter stets in Eckhäusern gewohnt. Warum, wusste er nicht. Auf jeden Fall waren sie an Straßenkreuzungen und mehr oder weniger laut. Auf der Reise hatte er mit blindem Geschick sowieso die lautesten Zimmer bezogen. In Paris ausgerechnet über einer Schmiede. Um vier Uhr früh, als er sich nach qualvollen Stunden über seinen Skizzen ins Bett legte, fingen sie unten gerade an, an einem Rad zu hämmern. In Dresden wurde die ganze Zeit die Fahrbahn gepflastert, ab fünf war an Schlaf nicht mehr zu denken gewesen. Ein wenig verunsichert sah sich Dostojewskij um, von wo hier Störungen zu erwarten waren. Er fand nichts. Seufzend ging er zu seinem Koffer. Das Schloss war verbogen, und erst nach langem Hantieren brachte er ihn auf. Ordentlich verteilte er seine Sachen im Raum: Das frische Tageshemd und den zweiten Rock hängte er in den Schrank, die Zugstiefel stellte er daneben, Wäsche, Handschuhe und Halstücher kamen in die Schubladen, das Nachthemd legte er aufs Bett, Papiere, Federn, Tinte, Aschenbecher und sein Zigarettenetui hatten ihren Platz auf dem Schreibtisch, die Bibel legte er auf die Kommode, die Flasche Emserwasser stellte er daneben. Dann entnahm er dem Koffer die Kleiderbürste, zog den Rock aus, entstaubte ihn gründlich und hängte ihn auf. Drehte den Schlüssel zweimal in der Tür und stellte sich wieder ans Fenster. In den wenigen Minuten war die Sonne so über das Dach gewandert, dass sie jetzt einen Teil des Kräutergartens beschien. Der Ausblick erinnerte ihn an die Kindheitswohnung in Moskau. Vom Vorraum weg hatte es da einen Korridor mit Fenster zum Hinterhof gegeben. Im hinteren Teil des Ganges, abgetrennt durch eine Bretterwand, lag das finstere Kinderzimmer. Eng und arm hatten sie gelebt in der Dienstwohnung des Marienspitals, wo der Vater als Arzt angestellt gewesen war. Der niedere Adel, der Familie seit dreihundert Jahren von Vaterseite inne, hatte nur mehr auf dem Papier existiert. Und in den Genen vielleicht. Ihn schwindelte und er gab dem leichten Druck, den er vom Bett in den Kniekehlen spürte, nach und setzte sich. Nun musste er sich strecken, um über das Fensterbrett hinunter in den Hof zu sehen. Eng sollte der Held seines neuen Romans leben, eng und dunkel, wie in einem Sarg, dachte er. Er sah zum Schreibtisch und überlegte, sich an die Arbeit zu setzen. Doch da überkam ihn die Müdigkeit erst recht, und in einer wie ihn selbst überrumpelnden schnellen Bewegung legte er die Beine auf das Bett und den Kopf auf das Kissen. Er wollte nicht schlafen, nur ruhen und nachdenken. Sommer musste sein, am Beginn des Romans, ein schwüler, drückender Sommerabend, an dem der Student, um den es ginge, ziellos durch die Gassen und über die Brücken Petersburgs wandert. Oder die Venedigs? Warum nicht. Den „venezianischen Roman“ zu schreiben, hatte er schon mit fünfzehn vorgehabt.
Er schloss kurz die Augen. Nicht um zu schlafen, nur um besser nachzudenken. Ah che più tardi ancor. Nun hatte er Beppos Melodie im Kopf. Immer wieder klang sie in seinem Inneren, wuchs und schwoll an zu dem Chor, den er die Arie wirklich schon einmal auf einer Bühne hatte singen hören. Ihm fiel nicht ein, aus welcher Oper sie war noch von welchem Komponisten. Wahrscheinlich Rossini, dachte Dostojewskij und schlief ein.
Im Traum lief er wieder durch Venedig. Aber er selbst trug den Koffer, und Beppo war hinter ihm und trieb ihn an, immer schneller, brückauf, brückab, bis die Stadt sich in eine ländliche Gegend verwandelte, die Brücken zu Hügeln wurden, die Plätze zu grünen Wiesen, über die Dostojewskij, auf einmal nicht mehr mit Koffer, sondern mit einem Birkenzweig als Speer bewaffnet rannte, der kleine Fjodor, ein zehnjähriger untersetzter Junge mit hellem blonden Haar, rundem Gesicht, hoher Stirn und vorstehender Nase, denn irgendwo, wusste er, hielt sich der Feind versteckt, der weiße Mann, der ihn Indianer töten wollte. Da sprang er aus einem Gebüsch, sein zwölfjähriger Bruder Michail, und hielt den Haselnussstecken als Gewehr auf ihn. Geschickt ließ sich der kleine Fjodor fallen und rollte eine Böschung hinab, wo ein Kanu, bestehend aus zwei aneinandergebundenen Holzlatten, ihn aufnahm. Er stieß sich vom Ufer ab, und als Michail nachkam, war er schon in die Mitte des Teichs gerudert. Trotzdem legte der andere das Gewehr an, markierte einen Schuss, und Fjodor ließ sich in einer großen theatralischen Bewegung rücklings ins Wasser fallen. Da trieb er dann reglos als „toter Mann“, und die Sonne schien auf sein blasses Gesicht mit den vielen Sommersprossen und auf seine geschlossenen Augen. Als er sie aufschlug, blinzelte er ins Licht, aber er lag dreißig Jahre später in einem Zimmer weit von seiner Heimat in einem Hotelbett und die Sonne schien ihm mitten ins Gesicht. Sie war während seines Schlummers über die Kante des gegenüberliegenden Dachs gerückt und schaute nun direkt durch sein offenes Fenster auf ihn.
Dostojewskij dachte an Darowoje. So arm die Familie am nördlichen Stadtrand von Moskau gelebt hatte, war es dem Vater nach einer Beförderung und Nobilitierung – mit der die Familie ihren angestammten Adelsstatus wiederbekam – gelungen, zwei ganze Dörfer südlich der Stadt zu kaufen, wo sie fortan die Sommermonate auf einem Gut verbracht hatten, die einzigen wirklich unbeschwerten Perioden seines Lebens bisher. Wie zur akustischen Untermalung dieser Erinnerung drängten sich nun russische Laute in die Nachmittagsstille, Stimmen vom Hof her. Dostojewskij setzte sich auf. Langsam bewegte er den Kopf nach vorne, streckte ihn ins Freie, drehte ihn nach rechts und blickte in die Gesichter von zwei Frauen, Mutter und Tochter offenbar, die an einem halb offenen Fenster an der Querseite des Hauses – in dem das Hotel vielleicht auch Zimmer hielt – standen und verstummten, als sie den bärtigen Mann sahen, der nur über das Fensterbrett zu reichen schien und für sie, da sie nicht wussten, dass er saß, wie ein Zwerg wirken musste. Schnell zog der den Kopf zurück. Direkt nach dem Aufwachen angeschaut zu werden, war ihm immer schon peinlich gewesen, als ob sein Gesicht vom Schlaf noch irgendwie „offen“ wäre und die Leute in ihn hinein- oder ihm gar alles „wegschauen“ könnten. Nach ein paar Sekunden nahmen die Russinnen ihr Gespräch (es drehte sich um die Frage, welche von beiden vergessen hatte, zu Hause die Marmelade in den Koffer zu packen) wieder auf. Und er erhob sich, wusch sich, kleidete sich an, diagnostizierte Herzflimmern und Kopfschmerzen und ging aus.
2
Draußen bereute er, seinen wärmeren Abendrock angezogen zu haben, denn die Hitze hatte um nichts nachgelassen. Er musste als Erstes etwas trinken gehen. An einem Baumstamm gegenüber saß Beppo, sprang auf, als er seinen neuen Herrn sah, klopfte sich den Staub von der Hose und lief los, mit groß einladenden Gesten nach hinten wie ein Fischer, der sein Netz einholt. Automatisch ging Dostojewskij in die andere Richtung. Beppo rief ihn an: „Signore!“ Der Signore erschrak und ging weiter. Beppo rief lauter. Dostojewskij ging schneller.
„Si – gno – re!“
Er blieb stehen und drehte sich um, nur um dem Rufen ein Ende zu machen, die Leute schauten schon.
„La Posta!“, schrie Beppo aus der Ferne und bewegte die Arme wie ein Albatros seine Flügel. Mit einer kleinen eckigen Handbewegung verneinte Dostojewskij. Es musste auch noch etwas anderes in Venedig geben, als hinter dieser Kugel herzulaufen. Er kannte die Anhänglichkeit solcher Dienerseelen, wie er sie bei sich nannte, gut. Wenn er jetzt nicht hart blieb, hätte er ihn die nächsten zwei Tage am Hals. Zerhackte noch zweimal verneinend mit der Hand die Luft und ging weiter. Doch da hatte ihn Beppo schon eingeholt und redete auf ihn ein, etwas von der Uhrzeit und chiusura, da blieb Dostojewskij stehen, schaute ihn so streng wie möglich an und sagte in seinem besten Italienisch: „No.“
Beppo duckte sich weg, als wiche er einem Hieb aus und fragte, die Hände ineinander verschränkend wie zum Gebet: „Più tardi?“
„Demain“, brummte Dostojewskij und ließ ihn stehen.
„Deh, pensa che domani!“, sang Beppo in seinem Rücken im Falsett und winkte, als der Weitergehende kurz zurückschaute, wehmütig wie eine zurückgelassene Geliebte.
Dostojewskij bog die nächste Straße links ab, um aus seinem Blick zu sein. Nach fünfzig Metern kam er an einen Kanal, an dessen noch sonnenbeschienenen Ufer Männer vor einem Lokal in Gruppen Schlange standen. Sie hatten alle Gläser in der Hand. Doch sie standen nicht an, sah er nun, sie waren der aus dem Lokal sozusagen herausquellende Teil einer darin noch viel größeren Menge, und sie taten nichts als debattieren, trinken und rauchen. Einige lachten auch, doch die Stimmung war gespannt, geladen wie bei einer politischen Versammlung oder gar dem Treffen von Aufwieglern, wie er sie gut kannte. Aber auf der Straße? Es waren allesamt Italiener. Als er näher kam, verstummten die ersten, als er fast an der Türe war, über der Schiavi stand, schwiegen die meisten und sahen ihn prüfend an. Er fand es besser, sie nicht herauszufordern und seinen Durst zu unterdrücken, brummte eine Entschuldigung und ging den langen Kanal hinunter in die Richtung, aus der er Segel in der Sonne blitzen sah. Am anderen Kanalufer lagen Gondeln im Trockenen wie gestrandete schwarze Wale, und er staunte, wie groß sie außerhalb des Wassers waren. Es mochte ein Dock oder eine Werkstatt sein, ein Mann stand im Unterhemd und trug Farbe auf. Das Haus daneben wirkte eher wie eines in den Schweizer Bergen.
Der Kanal mündete in einen ungleich größeren, der eine Hauptwasserstraße Venedigs sein musste. Das Ufer war eine breite Promenade, auf der es zuging wie in einer deutschen Kleinstadt am Sonntag: Offiziere saßen in langen weißen Mänteln an Tischchen im Freien, aßen Kuchen und Eis und tranken Likör, andere Uniformierte patrouillierten steif Freizeit spielend auf und ab. Die meisten sprachen Deutsch in langgezogenen, irgendwie gepressten oder geknautschten Vokalen und mehr durch die Nase als durch den Mund. Das waren wohl die Österreicher. Dostojewskij wusste, dass Venedig seit Längerem zu deren Monarchie gehörte und staunte, welch andere Welt sich hier behauptete als einen Kanal weiter vor dem Lokal der Italiener. Aber gespannt war die Atmosphäre auch hier, obgleich sie von der selbstgefälligen Sicherheit einer generationenalten Herrscherdynastie überdeckt war. Wie lange schon war Venedig nicht mehr frei? Und war nicht das übrige Italien seit einem Jahr geeint? Tatsache war, dass Russland den Österreichern gegen die Aufständischen geholfen hatte. Dafür hatte sich dann Österreich im Krimkrieg gegen Russland gestellt. Und aus der Freundschaft der beiden Staaten war etwas Feindseliges geworden. Er hatte keine Lust, in dieser Gesellschaft, die ihn an eine der von ihm verabscheuten Operetten erinnerte, etwas zu trinken und ging auf die Sonne zu.
Die brannte, wenn auch tiefer stehend, unvermindert auf die Boote und Gondeln der breiten Wasserstraße zwischen Venedig und einer großen Insel, von der nicht klar war, ob sie noch dazugehörte. Schutz suchend, bog Dostojewskij in eine Gasse und ging, wieder weg vom Wasser, stadteinwärts. Aber gab es hier überhaupt ein Zentrum? Irgendwo musste der berühmte Markusplatz sein. Einmal abgebogen, war man sofort allein mit den „Steinen von Venedig“, über die er bei Ruskin so viel gelesen hatte. Für dessen Satz, dass die schönsten Dinge auf der Welt die nutzlosesten seien, würde er ihm ewig dankbar sein. Passend dazu schickte eine Lilienhecke ihren betörenden Duft voraus, noch bevor er sie sah. Vor einem Haus saßen alte Frauen und schnitten Gemüse. Dostojewskij grüßte sie stumm. Sie erwiderten mit verhaltenem Staunen. Dann wieder stille Kanäle, fragile Brücken, Wäsche, Lichtreflexe in Fensterscheiben. Eine Kirchenglocke von weither. In einem winzigen Geschäft, in dem es nach Schokolade roch, kaufte er Kerzen, Streichhölzer, Zucker und Tee. Und, dem Geruch nachgebend, eine kleine Tafel Schokolade. Ein Trupp Soldaten kündigte ihm den Eintritt in eine belebtere Gegend an. Vielleicht würde er hier etwas zu trinken bekommen. Ein weiter Platz öffnete sich vor ihm, doch konnte das nicht der Markusplatz sein, den kannte er von Darstellungen, auch fehlte der Dom. Der „Campo Santa Margherita“ – diesen Namen las er nun auf einer Tafel – war weniger repräsentativ als volkstümlich und schien eher den Italienern zu gehören. Es gab weniger Uniformierte, dafür viele Kinder, die mit zu Bällen gebundenen Lederfetzen spielten oder Scharen von Tauben nachliefen, sie fütternd und verjagend in einem. Die Menschen hatten alle Stimmen wie Sänger, mit dem Zwerchfell gestützt und selbst auf Abstände von zwei, drei Metern so „gesendet“, als müssten sie damit den vierten Rang eines Opernhauses erreichen. Da sie das von klein auf taten – die Kinder schrien ihre Eltern so an, dass sie in Russland dafür Ohrfeigen bekommen hätten –, waren ihre Stimmen offen und sangesrein und zugleich rau, rau wie es die Stimmen der Russen vom ungestützten, im Rachen sitzenden Reden und, manchmal, vom Wodka wurden.
Obgleich sein Durst inzwischen schwer erträglich war, ging Dostojewskij an den nicht wenigen Lokalen vorbei, über den Platz hinaus und über eine Brücke und stand auf einmal vor dem Portal einer vollkommen schmucklosen Kirche. Vergeblich drückte und zog er an der Tür, sie war verschlossen. Und würde es wohl zumindest für heute bleiben. Außer, es gäbe später noch eine Messe. Er beschloss, sich den „Campo San Pantalon“ einzuprägen und wiederzukommen. Von einem Heiligen dieses Namens hatte er noch nie gehört, Pantalone kannte er bloß als eine Figur aus der italienischen Komödie. Und es war das französische Wort für „Hose“. Er ging zurück auf den großen Platz. Ein herrenloser Fußball kam ihm entgegengerollt. Als er sich bereits freute, ihn zu den spielenden Kindern in zwanzig Meter Entfernung, die ihn verschossen hatten, zurückzubefördern, ja schon stehen blieb und sein Gewicht auf das linke, das Standbein verlegte, rannte ein Junge schnell auf ihn zu, als liefe er um sein Leben, um den Ball nur ja nicht der Berührung durch den fremden Mann preiszugeben, und im allerletzten Moment stoppte er die Kugel mit der Schuhspitze und versetzte ihr gleich darauf, als Dostojewskij schon den rechten Fuß zum Schuss gehoben hatte, einen Stoß mit dem Absatz und brachte ihn so zu den Mitspielern zurück und Dostojewskij, der durch die fehlende Schussbewegung das Gleichgewicht verlor, ins Taumeln und fast zu Fall. Eine Gruppe junger Mädchen ging vorbei, alle schwarzhaarig und hübsch, eine sagte etwas auf Italienisch und alle lachten. Nun war es genug. Er musste einkehren. Da er in Florenz ein einziges Mal gut gegessen hatte und das in einer Osteria gewesen war, trat er in ein Lokal dieser Bezeichnung auf der Schattenseite des Platzes.
Es war noch früh, und das Gasthaus fast leer. An der Schank stand ein alter Mann mit Klappe über einem Auge. Mit dem anderen schaute er den Gast neugierig an. Der fragte, ob er Tee bekommen könne. „Tè“, wiederholte der Alte ohne Ausdruck. Und wies mit einem Spültuch auf die langen ungeschmückten Holztische, die parallel zueinander, von lehnenlosen Bänken getrennt, vom Fenster neben dem Eingang bis in die Tiefe des Lokals aufgestellt waren wie zu einem Volksfest. Dem Fenster zugewandt saß ein Mann alleine mit einer Flasche und einem Glas. Ein Zopf geflochtener Haare fiel ihm über den Rücken. Dostojewskij setzte sich drei Tische dahinter und schaute an dem Mann vorbei auf die milchige Scheibe, die keinen Blick durchließ und wenig Licht. Das kleine Päckchen aus dem Geschäft legte er neben sich. Er fühlte sich schwach und fürchtete, seine Schlaffheit könne einen neuen Anfall ankündigen. Morgen musste er zur Post. Den Markusplatz besuchen und übermorgen nach Hause abreisen. „Ich eile aus den Alpen in die Ebenen Italiens“, hatte er vor ein paar Wochen Strachow geschrieben. „Ach! Ich werde Neapel sehen, nach Rom gehen, eine junge Venezianerin in der Gondel liebkosen …“ Diese von Puschkin gestohlenen Aussichten hatten den Freund wohl veranlasst, sich der Reise anzuschließen. Von der Euphorie war wenig übriggeblieben. Herrgott, dachte er, und wie viel ich mir von dieser Reise versprochen habe. Auf den Tee wartend, trommelte er leise mit den Fingern auf der Tischplatte.
„Die Kirche bleibt heute geschlossen“, hörte er eine Stimme auf Russisch sagen. Er erstarrte. Sie konnte nur von dem Mann vor ihm kommen, der regungslos mit dem Rücken zu ihm saß. „Trinker haben Augen nach hinten“, hatte er vor Wochen in London notiert (wo es mehr als genug Anschauungsmaterial gegeben hatte). Der Mann drehte sich abrupt um. Das längliche Gesicht war vollkommen weiß mit roten, glühenden Backen und schwarzen, glasigen Augen. Der wie zu einer Fratze verzerrte grinsende Mund trug kaum Zähne, und die waren beinahe schwarz, einer golden. Die zum Zopf geflochtenen Haare entsprangen den letzten bewachsenen Stellen über den Ohren, ansonsten war der Schädel kahl.
„Woher wissen Sie …?“
„Man kennt sich doch“, sagte der Mann nur. Der Tee kam. Dostojewskij hatte längst gelernt, dass in Europa keine Samoware benutzt wurden. Der Tee, das merkte er gleich, war dünn und lauwarm, die Kanne nur wenig über halbvoll. Dafür konnte er den schlimmsten Durst sofort stillen. Der Mann hatte sich wieder seiner Flasche zugewandt.
„Die Verpflegung in Gefängnissen ist nicht besser“, sagte er jetzt zum Fenster hin, doch wieder so, dass es für den hinter ihm gemeint war. Sein Russisch war gut, nur die zu deutliche Artikulation verriet den Italiener.
„Vor allem, wenn die Herrscher keine Kultur haben.“ Er schenkte sein Glas voll. „Haben sie Kultur? Nein. Die Deutschen haben die Kartoffel, sonst nichts.“ Er kicherte und trank einen kleinen Schluck Wein. Dostojewskij schaute ernst, was bei ihm vieles heißen konnte, viel Gegensätzliches, manchmal, dass er etwas zum Lachen fand. Auch in Russland war die Kartoffel Synonym für deutsche Küche und deutsches Wesen. „Fad wie eine Kartoffel“ war eine beliebte Redewendung.
„I tedeschi“, deklamierte der Mann. „Ein Trauerspiel in keinem Akt.“ Und kicherte wieder. „Die Totengräber Venedigs“, sagte er auf einmal sehr ernst. „Die Schergen Napoleons. Napoleon hat Venedig umgebracht, die Deutschen begraben es. Noch nie haben sie eine so schöne Kulisse für ihre schrecklichen Pompes funèbres gehabt. Haben Sie gewusst, dass sie Venedig beschossen haben?“, damit drehte er sich wieder um. „Venedig beschossen“, wiederholte er mit der italienischen Geste, die drei Finger jeder Hand wie zu einer Blüte formt, um das Gesagte hervorzuheben. „Auch aus der Luft!“ Eine Hand fuhr in die Höhe. „Natürlich erst von der terraferma aus, von Mestre, dreiundzwanzigtausend Geschosse, drei Wochen lang. Bumm – bumm! Auch die Rialto-Brücke: bumm – getroffen. Aber dann kamen sie aus der Luft. Das hat es noch nie in der Geschichte gegeben. In der Weltgeschichte! Ein Luft-Angriff! Auf einmal zogen am Himmel, am heitersten venezianischen Himmel wie von Canaletto gemalt, Ballone auf mit Flammen, sichtbaren Flammen, hundert Heißluftballone, die Brandbomben mit Zeitzündern über die Stadt trugen, Bomben für die Kirchen von Palladio, für die Bilder von Tintoretto, Bomben! Was für Barbaren! Und rechnen können sie auch nicht. Sie haben die Explosionszeit falsch eingestellt. Keine einzige der hundert Bomben wollte über der Stadt zerplatzen. Sie flogen über unsere Köpfe dahin ins Meer, und einige nach Osten aufs Festland und da fielen sie auf ihre eigenen Leute. Che farsa!“ Er klatschte in die Hände wie zu einem gelungenen Schauspiel. „Werr andern aina Gruba gräbt“, sagte er in gespreiztem Deutsch und lachte. „Trotzdem haben sie Venedig erobert. Und wie?“
Dostojewskij schaute verloren in die verlebte Gesichtslandschaft.
„Sie haben uns ausgehungert. Belagert und ausgehungert. Alte Frauen haben angefangen, ihre Katzen zu essen. Im Arsenale hat man von Menschen angefressene Leichen gefunden. Was sollten wir tun? Der Hunger und die Seuchen hätten uns alle getötet. Also haben wir uns der ‚Kulturnation‘ ergeben. Die schöne Utopie von achtundvierzig war vorbei, der Aufstand niedergeschlagen und Venedig wieder in Ketten.“
Er kehrte sich zu seinem Wein, hob das Glas und rief ein deutsches „Prost“ mit rollendem „r“ und durch die Nase gepresstem langen „o“ dem Fenster zu und trank sein Glas leer.
Dostojewskij hätte gerne noch Tee bestellt, aber der Einäugige war in einem Nebenraum verschwunden und er allein mit dem zornigen Mann, der sich nun wieder ganz seinem Wein hinzugeben schien. Während seiner Erzählung hatte er ihn an Petraschewskij erinnert, den Anführer jenes Petersburger Zirkels, mit dem er wegen „antizaristischer Umtriebe“ verhaftet und verurteilt worden war. Zar Nikolaj hatte Angst gehabt, dass die revolutionären Strömungen Europas von achtzehnhundertachtundvierzig auf Russland übergreifen könnten und war mit aller Härte gegen Gruppierungen wie die Petraschewskijs vorgegangen, wo man verbotene Bücher und Zeitungen las und Ideen einer sozialeren, humaneren Gesellschaft diskutierte. Manchmal war Dostojewskij einer der hitzigsten gewesen. Als er gefragt worden war, was geschehen solle, wenn etwa die Bauern nicht anders als durch einen Aufstand befreit werden könnten, hatte er gerufen: „Dann eben durch einen Aufstand!“ Und war dabei so erregt gewesen, dass er mit einer roten Fahne hätte auf die Straße rennen können. Später erfuhren sie, dass ein Spion ein Jahr lang alles mitgeschrieben hatte, Wort für Wort, in langen Berichten, auch die harmlosesten Schülerscherze. Aber natürlich waren ihre Zusammenkünfte nicht harmlos gewesen. Die Abneigung der russischen Intellektuellen jener Zeit gegen die bestehende Ordnung war radikal gewesen. In den Theatern sahen sie „Die Räuber“ und „Wilhelm Tell“ und trugen den Freiheitsruf auf die Straßen und in die Paläste und an die Ohren des um seine Macht fürchtenden Zaren. Und aus dem Kadetten der Pionieroffiziersschule Fjodor Michailowitsch Dostojewskij war erst ein bummelnder Student, dann ein freier Schriftsteller und revolutionärer Freidenker und schließlich ein Gefangener in der Peter-und-Paul-Festung geworden, der acht Monate auf seine Verurteilung wartete.
„Tausend Jahre!“ Der Zopfträger vor ihm war wieder so weit, dass sein offenbar fortwährender innerer Monolog nach außen schwappte. „Tausend Jahre Glanz und Glorie. Beherrscherin des Mittelmeers. Weltmacht. Dabei hat Venedig Politik im Grunde nie interessiert. Ja, unsere Flotte war stark, aber im Wesentlichen dachten wir: Sollen die anderen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, die Waren, die wir aus der Welt holten und umverteilten, brauchen diese und jene. Venedig handelte mit allen, die zahlen konnten, immer schon, und es war ihr völlig egal, ob es um Pfeffer, Safran, Baumwolle, Perlen, Käse, Stockfisch oder Sklaven ging, das Geschäft blühte, und die Gesellschaft blühte mit. Alle hatten Arbeit, alle hatten zu wohnen, zu essen, zu trinken, Venedig war der reichste und zugleich humanste Staat der Welt! Und regiert wurde sie … von uns!“
Damit drehte er sich wieder zu Dostojewskij – der überlegte, gegen die Bezeichnung „human“ für eine Gesellschaft, die mit Sklaven handelte, Einspruch zu erheben – und zeigte zum ersten Mal eine reine Schönwetterphase seines Gesichts, das dadurch ohne Falten war, glatt, strahlend und heiter wie die Geschichte der „Heitersten“, der „Serenissima“, von der er erzählte. „Wir waren Venedig. Die Nobili. Eine Handvoll adeliger Familien. Unsere palazzi prägten die Stadt, wir holten die besten Baumeister für unsere Kirchen, die größten Künstler, sie auszuschmücken. Und eigentlich gab es etwas, das uns wichtiger war als der Handel mit Indien, China und der uns immer weit entfernten, fremden ‚Neuen Welt‘, wichtiger selbst als das enorme Geld, das aus unseren Geschäften floss: das Vergnügen! Wofür arbeitest du, außer um dich mit dem Verdienten zu vergnügen. Etwas, das die Deutschen nie verstehen werden. Sie werden, je reicher sie sind, umso noch griesgrämiger. Wir hatten die ersten Kaffeehäuser – sie waren die ganze Nacht offen –, mehr Theater als in Paris, Karneval von Oktober bis zur Fastenzeit, und mehr Spieltische als in jeder anderen Stadt. Il banco und Il casino – beide in Venedig entstanden. Aus dem Tisch zum Geldwechseln wurden die großen Bankhäuser, aus dem „kleinen Haus“ der Adeligen für private Plaisirs die prächtigen Spielhallen. Und die schönsten und gelehrtesten Frauen wurden als Kurtisanen geachtet und verehrt – und bezahlt. Oh, es war so, wie es mein Großonkel Charles aus Vincennes einmal betont hat: Wer nicht vor der Französischen Revolution gelebt hat, weiß nicht, was Glück ist.“
Dabei hielt er beide Handflächen offen vor sich, als habe er nicht mehr zu bieten als diese schlichte Weisheit – oder als wolle er seinen Zuhörer zum Tanzen einladen.
„Im Karneval war alles erlaubt“, fiel er auf einmal in ein verschwörerisches Wispern, „Männer in Frauenkleidern, Frauen in Männerkleidern … samt den dazugehörigen Konsequenzen …“
Dostojewskij sah betreten in seine leere Teetasse und dachte wieder an Petraschewskij, der einen Gottesdienst in der Isaakskathedrale in Frauenkleidern besucht und kichernd Kerzen entzündet hatte – er selbst konnte bei aller revolutionären Gestimmtheit solchen Spott nicht dulden und hatte sich sehr darüber geärgert.
„Fünfzig Jahre haben gereicht, um alles zu zerstören. Erst kam Napoleon und hat den Karneval verboten. Die Aristokraten entmachtet, den Dogen vor Gericht gestellt und das prächtige Staatsschiff, auf dem dieser sich symbolisch mit dem Meer vermählt hatte, verbrannt. Als die Österreicher anrückten, atmeten viele auf, aber es kam noch schlimmer. Sie schlugen die Menschen mit der Wehrpflicht und rigiden Steuern. Und da der Karneval schon abgeschafft war, verboten sie das Glücksspiel. Anders als Napoleon brachten sie ihre Gegner einfach um. Venezianische Intellektuelle waren verdächtig und wurden reihenweise zum Tod verurteilt. Und wie sich Folterknechte abwechseln, um dem Delinquenten keine Ruhe zu geben, schritt daraufhin wieder Napoleon ans Werk. Kastrierte den Adel noch mehr, machte aus Kirchen Exerzierplätze und schloss die scuole, die wohltätigen Häuser der Bruderschaften. Damals konnten die Venezianer ihre Stadt noch ohne österreichischen Pass verlassen, Häuser und Paläste verfielen, die meisten Geschäfte wurden geschlossen, dafür stand die Statue des kleinen Korsen groß auf dem Markusplatz. Er selbst überließ uns, nachdem er alles vernichtet hatte, wieder den Deutschen. Er hatte Wichtigeres zu tun. Er ging Russland abschlachten.“
Mit einer dramatischen Pause ließ er das auf seinen russischen Zuhörer wirken. Der nickte. Der Feldzug, zehn Jahre vor Dostojewskijs Geburt, der rund eine Million Russen das Leben gekostet hatte, saß tief im Bewusstsein. Die Familie seiner Mutter war durch den Brand von Moskau völlig verarmt. Dennoch hatte der Name Napoleon für ihn, wie für jeden Russen, einen unerklärlichen Nimbus.
„Dritter Akt, Rückkehr der Kartoffelgesichter. Die Deutschen räumten die Statue weg und gaben uns die Jesuiten zurück. Nun ja.“
„Die Deutschen?“
„Deutsche … Österreicher … allesamt tedeschi. Die Deutschen haben nur die Kartoffel, die Österreicher haben noch den Walzer dazu. Und sie lächeln mehr.“ Er schenkte sich Wein nach und schüttelte den Kopf. „Ihr Lächeln ist nur eine Maske. Mit Masken kennen wir uns aus. Hinter den lachenden steckt oft Angst, hinter den freundlichen Brutalität. Ja, sie haben auch Goethe und Mozart. Aber dem gewöhnlichen Frankfurter oder Salzburger merkt man das nicht an. Genies sind kein Maßstab für eine Nation. Die Österreicher tun ihr Bestes, um Europa mit ähnlichem Schrecken zu überziehen wie Napoleon. Eines Tages wird es ihnen vielleicht gelingen. – Hat man Sie kontrolliert?“
„In Mestre.“
„Würde mich nicht wundern, wenn Sie schon einen Spitzel auf den Fersen hätten.“ Er sah sich im Lokal um, aber da war nur der Wirt, der gerade ein Weinfass hereinrollte. „Die Ordnung“ – das Wort kam auf Deutsch – übersieht keinen. Venedig ist ein Überwachungsstaat geworden. Viele kleine Teufel liefern ihre täglichen Berichte an den Beelzebub in Wien. Und wieder wandern ein paar ‚subversive Objekte‘ in die Bleikammern. Es heißt, dass sich der Polizeidirektor schon einmal gezwungen sah, sich selbst zu denunzieren.“ Er trank, und der Finger, den er zum zuletzt Gesagten an die Stirn gelegt hielt, wurde so zu einem grotesken Trinkgruß.
„Achtzehnachtundvierzig. Der Aufstand. Österreichische Soldaten wurden auf dem Markusplatz mit Steinen beworfen. Im Arsenale revoltierten die Arbeiter, verschafften sich Waffen und Munition. Tapfere Männer. Giaccopo!“, rief er zum Wirt, der aufschaute, und prostete ihm zu: „Viva San Marco!“ Der antwortete leise, fast mechanisch: „Viva San Marco!“ und arbeitete weiter. „Die tedeschi kapitulierten, und auf der Piazza wehte die tricolore. Aber dann kamen die Belagerung, der Luftangriff, das Aushungern. Dreizehn Jahre ist es nun her, es war ein Augusttag, heiß wie dieser, dass zwei Vertreter der neuen ‚Repubblica di San Marco‘ in einer Gondel nach Mestre fuhren und die nun ihrerseitige Kapitulation unterschrieben. Doch die Belagerung hielt an bis vor sieben Jahren. Wissen Sie, was es für einen Gefangenen bedeutet, wenn er kurz die Freiheit gesehen, die Freiheit gekostet hat – und dann wieder eingesperrt wird?“
Dostojewskij reagierte nicht. Er wusste es. Der Andere redete weiter. „Es ist schlimmer als vorher. Du weißt: Jetzt haben sie dich wirklich.“
Plötzlich stand er auf, wodurch zum ersten Mal seine altertümliche, geradezu höfische und erbarmungswürdig abgerissene Kleidung sichtbar war, setzte sich aber sofort wieder und sprach leise auf sein Glas hinunter, das er in den feinen, langfingrigen Händen hielt wie eine Kerze im Gebet: „Meine Familie reicht weit zurück und über den ganzen Kontinent, von den Pyrenäen bis an den Ural. Unsere palazzi waren die festlichsten am Canale. Heute siehst du meinesgleichen als Gondolieri arbeiten. Gräfinnen verdingen sich als Putzfrauen. Um uns irgendwie bei Laune zu halten, schenkt uns der Kaiser in Wien täglich zwei ‚Svanzica‘, diese neue Habsburger Währung in Venedig. Gnadenbrot für die Nobili! Eine Schande!“
Dostojewskij verstand nun Beppos Reaktion auf die Münze. Sie war nicht zu wenig, sondern zu viel gewesen. Und vor allem: ein falsches Symbol.
„Wir hassen die Österreicher aus vollem Herzen.“ Nun schaute der Redende gerade vor sich hin, weniger eine Mitteilung als ein Bekenntnis formulierend. „Sie sprechen kein Italienisch. Wir kaum Deutsch. Es gibt keinen Austausch zwischen uns und den Kroaten, Ungarn, Böhmen, aus denen ihre Garnisonen bestehen. Keine Berührung. Sie leben in derselben Stadt, aber als unsere Herrscher. Jeden Tag, jeden Moment begegnen wir ihnen auf den Plätzen und streifen an sie in den engen Gassen, aber wir sind getrennt von ihnen wie der Sträfling von seinem Kerkermeister. Wir hassen sie. Kein Venezianer, der nicht den Tag ersehnt, an dem Venedig wieder frei wird. Eine italienische Stadt.“
Nun drehte er sich um, seiner Flasche zu, dem milchigen undurchsichtigen Fenster, seinem Alleinsein. Dostojewskij nahm an, dass er ihn wahrscheinlich jetzt schon vergessen hatte. Doch da schickte er ihm noch einen Satz über die Schulter: „Schafe und Wölfe sollen nicht aus einem Fluss trinken“, sagen wir in Italien. Und kichernd wie zu Beginn schenkte er den Rest aus der Flasche in sein Glas, roch daran, als wäre es sein erstes und nippte wie ein Mann, der Maß zu halten gewöhnt ist.
Als Dostojewskij in die Hitze des Abends trat, befielen ihn Übelkeit und Magenschmerzen. Im nächstbesten Restaurant, in das ihn ein draußen paradierender Kellner nötigte, aß er ein Stück Fleisch mit goldbrauner Ummantelung, das aussah wie eine unter Wagenräder gekommene Kiewer Hühnerbrust ohne Füllung, einen ungenießbaren Pudding und ein Stück schimmeligen Käses und trank ein Glas zu warmen Weißwein. Zudem unterhielten sich die Gäste an den Nebentischen derart laut, dass er sich fortwährend ärgerte und die ganze Zeit nur darauf wartete, wieder wegzukommen. Die Rechnung war unverschämt hoch. Schimpfend verließ er das Lokal.
Am Platz, der noch immer voll Menschen war, sah er sich automatisch nach einem Wagen um, der ihn hätte nach Hause bringen können. Natürlich gab es keinen. Also ging er los in die Richtung, aus der er gekommen war. Dostojewskij ging nicht gerne zu Fuß. Was ist hier nur los?, dachte er. Es ist zehn Uhr, und das Leben tobt in den Straßen so ausgelassen wie in Petersburg in den weißesten Nächten nicht. Als keine Ausnahme nämlich, sondern als etwas Grundsätzliches, das keinen Widerspruch und keine Infragestellung duldet. Auf einmal fand er sich auf der anderen Seite des Kanals, an dem sein Abend begonnen hatte, gegenüber dem Lokal Schiavi