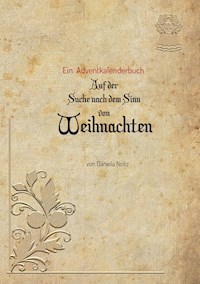Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lange schon träumte ich davon, nach Irland zu reisen und das Land zu entdecken. Endlich bot sich die Gelegenheit zu einer Pilgerreise - und ich ergriff sie, ohne zu wissen was auf mich zukam, worauf ich mich einließ. Ich trat sie an, kehrte wieder zurück - aber ich war nicht mehr die, die ich zuvor war. Der Weg ist das Ziel ist der Weg - ist ein Erfahrungsbericht, einer, die auszog das Fremde zu erleben, um doch letztlich wieder auf sich selbst zurückgeworfen zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
ZUFALL?
DER NÄCHSTE MORGEN
BEIM NAMEN NENNEN
ES IST GUT, ZEIT ZU HABEN
DIE EWIGE UNTERWERFUNG
VON DER KUNST
MACHT ES SINN?
WENN ENGERLN REISEN
RAUHE SEE
ANKUNFT
VON SCHAFEN UND FUCHSIEN
VON DER WEITE UND GELBEN TÜCHERN
TRADITIONEN
DIE ERSTEN SCHRITTE
ES IST GUT, ZU SPÜREN
UND DAS MEER RAUSCHTE
KOMM ZU MIR
DER SCHLÜSSEL PASST NICHT
TRAUMHAUS
IM REGEN
ES BEDARF SO WENIG
MAHL-ZEIT
MIT-EINANDER
DIE VIELEN ZUGÄNGE ZUM GLÜCK
HOCH HINAUS
DAS ERFAHREN IST IMMER DAS GERINGE
DAS VERIRRTE SCHAF
BIS ZUR OBERSTEN KANTE
DIE ANDERE SEITE
DER ABSTIEG
DAS HAUS AUS MEINEM TRAUM
ES KOMMT NICHTS BESSERES NACH
DAS FREMDE
DER ESEL VON NEBENAN
EIN BERG VOLLER ERIKA
DER BERG VOR MEINER HAUSTÜRE
WO SOZIAL NOCH OFFLINE STATTFINDET
EINE INSEL AM ENDE EUROPAS
DEM UNTERGANG ÜBERANTWORTET
DAS MEERESUNGEHEUER
EIN ERSTER ABSCHIED
ANDENKEN
EIN TREUER BEGLEITER
FUCHSIENHECKEN SÄUMTEN IHREN WEG
SPRACHBARRIEREN
BEINAHE WIE IM MÄRCHEN
DERSELBE WEG, EIN NEUES ERLEBEN
DER TOD MACHT KEINEN UNTERSCHIED
TOD UND NEUBEGINN
WO GOTT WOHNT
STELL DIR VOR, ES SOLL KRIEG GEBEN
AUFSTIEG IN DEN NEUEN MORGEN
THE BOOK OF KELLS
VERLOREN GEGANGEN
EINES KURZEN TAGES REISE IN DIE IRISCHE LITERATUR
JOYCE IRRFAHRT DES LEOPOLD BLOOM
EIN BERLINER IN DUBLIN
VON DER INSEL ZUR INSEL ZUM FESTLAND
RÜCKKEHR
1. Zufall?
Es war nun gut zwei Jahre her, dass ich begann mich für Irland zu interessieren. Mein Zugang war – wie so oft – die Literatur und die Frage warum es so viele Schriftsteller auf die grüne Insel verschlug, einerseits und andererseits, wie ein vergleichsweise kleines Land so viele Literaturnobelpreisträger hervorbringen konnte. Natürlich wäre es möglich die Begründung an den besonderen Umständen, an sozialen, geschichtlichen oder religiösen Besonderheiten festzumachen, doch ich bin mir auch sicher, dass das Land einen Menschen gerade in seinem kreativen Schaffen beeinflusst. Also sah ich mir Bilder an, viele, viele Bilder, las Reiseberichte und Bölls „Irisches Tagebuch“. Umso mehr ich las, umso mehr ich sah, desto mehr wusste ich, ich muss mir das ansehen. Immer öfter kreisten meine Gedanken um das erstrebte Ziel, bis mir eine Zeitschrift in die Hände fiel, eine Zeitschrift mit dem Titel „Welt der Frau“.
Im ersten Moment dachte ich, nicht schon wieder eine dieser Zeitschriften, die sich mit sogenannten Frauenthemen beschäftigen, oder zumindest vorgeben es zu tun, denn wenn man nach Woman, Madonna und ähnlich schwachsinnigen Machwerken der Medienindustrie geht, dann dreht sich das Leben der Frau um nichts weiter als um Kosmetik, Schönheit, Mode, High-Society und Abnehmen, doch bereits die ersten Seiten überzeugten mich, dass es sich um eine Zeitschrift handelte, die viele interessante Themen abhandelte, konstruktiv und dennoch einfühlsam, eine Zeitschrift mit Niveau, die sich zwar mit dem wahren, weiten Spektrum des Lebens von Frauen auseinandersetzt, aber sicher nicht nur für Frauen interessant ist. Und so verfolgte ich von nun an jede einzelne Ausgabe, las sie tatsächlich von vorne bis hinten, weil es kaum etwas darin zu lesen gibt, was nicht wert wäre gelesen zu werden.
So stieß ich eines Tages auf ein Inserat für eine Pilgerreise nach Irland, aufgegeben von Weltanschauen, einem kleinen, aber sehr interessanten österreichischen Reiseveranstalter. Die Reisen, die hier angeboten werden zielen nicht auf seichtes Entertainment, nach dem Motto „Ich will so weit weg wie möglich, um meine Nachbarn zu beeindrucken, aber mein Schnitzel soll es trotzdem geben und um Gottes willen keine Einheimischen.“
Ganz im Gegenteil, diese Reisen waren bewusst so gestaltet, dass man einen offenen, unverstellten und unverzerrten Blick auf Menschen und Land gewinnen konnte, wo es möglich war auch hinter die Kulissen und die Klischees von Hochglanzprospekten zu blicken. Offenheit und das Zugehen auf Andere wird hier möglich und gelebt.
Ich wusste mit einem Mal, dass mir das nicht umsonst so in die Hände gefallen war, sondern dass ich diese Gelegenheit aufgreifen musste, so wie sie sich mir präsentierte.
War es Zufall gewesen? Oder Schicksal? Wie auch immer man es bezeichnen will, es sollte offenbar so sein, dass ich darauf stieß, also auch, dass ich die Gelegenheit wahrnahm und an dieser Reise teilnahm. Doch konnte ich es wirklich wagen, mich einfach so davon zu stehlen, aus der Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde? Es gehörte alles erst geklärt, und es ließ sich klären, so dass ich mich anmelden konnte. Sechs Monate vor dem Abreisetermin.
Ab und an stiegen wohl noch Zweifel in mir auf ob ich es wirklich wagen sollte, doch ich war angemeldet. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Also ließ ich die Zweifel Zweifel sein und entschied mich dafür mich zu darauf zu freuen. Es war auch nicht schwer, denn eigentlich war ich überzeugt davon, es sollte so sein, es hatte sich gefügt, einfach so. Ich hatte nichts weiter zu tun, als die Welt um mich wahrzunehmen, so wie sie sich mir zeigen wollte.
Und ist es denn nicht immer so? Mit offenen Augen und offenen Gedanken sich dem sich Zeigen Wollenden zuzuwenden?
2. Der nächste Morgen
Unaufhaltsam rückte der Tag der Abreise näher. Der Sommer war schon beinahe vorüber. Während ich letzte Besorgungen machte, einpackte, abwog ob ich dies oder jenes wirklich mitbrauchte, denn schließlich würde ich alles selber tragen müssen, kam mir der Gedanke ob es wirklich gut wäre einen Traum zu verwirklichen, den ich allzu lange gehegt hatte, ob da eine Enttäuschung nicht vorprogrammiert ist.
Es ist, wie wenn man eine Person lange heimlich verehrt. Man träumt von ihr und durch diese Träume wächst sie. Man schmückt Erlebtes aus und traut dieser Person plötzlich Dinge zu, die kaum möglich sind, und dann, wenn sich diese langgehegte Sehnsucht plötzlich erfüllt, ist man enttäuscht, weil man feststellen muss, dass es sich letztendlich doch um einen ganz normalen Menschen handelt.
„Du bist mir seit Monaten, ja Jahren nicht aus dem Kopf gegangen, und jetzt, jetzt bist Du ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Du bist eine Enttäuschung“, muss man dann eigentlich sagen, was man höchstwahrscheinlich nicht tut, bloß denkt. Damit hat man auf einen Schlag zweierlei verloren, den Traum und die Person.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten dem zu entkommen. Sich entweder strikt an die Wirklichkeit halten und nur das zuzulassen, was wirklich erlebt wurde oder im Zustand der Sehnsucht verbleiben und den Traum behalten, ohne diesem je Erfüllung anzutun.
So hatte ich die Befürchtung, dass ich feststellen musste, letztendlich, dass Irland zwar schön, aber ansonsten ein ganz normales Land wäre. Damit hätte ich diesen Traum verloren, für immer und ich müsste mir zwangsläufig einen neuen suchen. War es also ein Fehler gewesen, dass ich mich auf dieses Rendezvous einlassen wollte? Vielleicht war der Verführer an mich herangetreten, als mir das Inserat unterkam? Aber es war zu spät, ich musste es darauf ankommen lassen. Doch das normale Leben ging weiter, so dass ich mich mit solchen Gedanken nicht weiters belastete.
Und dann war es soweit, der Tag der Abreise war gekommen. Kurz nach 5 Uhr morgens traf ich am Wiener Westbahnhof ein. Es war also noch genug Zeit mir einen Kaffee zu holen und in Ruhe eine zu rauchen. Jetzt würde ich lange darauf verzichten müssen. Was ich mir dachte? Gegenfrage: Wer verlangt von mir, dass ich denke, um die Zeit? Nein, ich dachte mir nicht viel, so sehr war ich damit beschäftigt meine Augen offen zu halten und den richtigen Bahnsteig zu finden. Abgesehen davon, auch wenn ich mal gerade nicht zu tiefsinnigen Gedanken fähig bin, habe ich es mir doch zur Gewohnheit werden lassen, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, geschehen zu lassen und mal – nur als Arbeitshypothese – davon auszugehen, dass es sich in eine positive Richtung entwickeln wird.
Diese Arbeitshypothese kann ich übrigens jedem empfehlen, wobei es sich wirklich um eine Empfehlung handelt, nicht um einen Rat-Schlag. Manche fühlen sich einfach wohler, wenn sie – wiederum als Arbeitshypothese – das Schlimmste erwarten und dann regelmäßig positiv überrascht werden.
Jedem sein Zugang zur Welt und zum Kommenden. Meiner ist auf jeden Fall der positive, selbst um halb sechs in der Früh, was ja nun ganz und gar nicht meine Zeit ist. Und während ich meinen Kaffee schlürfte und den bösen, sehr, sehr bösen Zigarettenrauch inhalierte, entdeckte ich jemand mit einem Rucksack, der dem meinem sehr ähnlich war, zumindest an Umfang und Gewichtung. Ich heftete mich sofort an die Fersen der Rücksackträgerin. Meine Annahme, dass sie mit zur Reisegesellschaft gehörte, stellte sich als richtig heraus.
Hände wurden geschüttelt, Namen genannt. Ich versuchte mich darauf zu konzentrieren, so weit das mit der Konzentration um diese Zeit überhaupt möglich ist. Und dann fuhr der Zug los. Kein Dampf, mangels Dampfmaschine, sondern nur ein leises Ruckeln zeigte an, dass sich der Zug in Bewegung setzte.
3. Beim Namen nennen
Insgesamt waren es dreißig Menschen, die sich an diesem Morgen auf den Weg machten, sich gemeinsam auf eine Reise begaben, dreißig mir unbekannte Menschen. Also eigentlich nur 29 Unbekannte, denn mich selbst kannte ich doch, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich mich selbst auch immer verstehe oder gar mit mir verstehe, was auch nicht unbedingt leicht ist, wenn man gezwungen ist eigentlich Tag und Nacht miteinander auszukommen. Nicht, dass ich etwas gegen mich hätte, aber das ist auch eine andere Geschichte und ich musste mich konzentrieren.
Hände wurden geschüttelt, Namen genannt. Alles folgte dem konventionellen Muster. Man reicht sich die Hand, nennt wechselseitig die Namen, und lässt die Hand wieder los. Es darf nicht zu lange und nicht zu kurz sein. Es ist gut so. Es fühlt sich richtig an, und doch war es einfach zu kurz sich all die Namen zu merken. Wahrscheinlich, so sagte ich mir, würde ich die Namen während der nächsten Tage noch öfter hören, so dass ich weitere Chancen bekam sie mir einzuprägen. Ich müsste einfach immer nur gut zuhören. Mit den Namen ist das überhaupt so eine Sache.
Es gibt bestimmte Namen, mit denen man von vornherein ein Gesicht oder vielleicht nur eine kurze oder längere Begegnung verbindet. Namen, die quasi im Denken bereits besetzt sind mit einer Vorerfahrung, und es bedeutet da mal wieder Platz schaffen zu müssen. Dann gibt es Namen, die man einfach mag, einfach so, ohne so recht sagen zu können warum. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich Namen mag, weil sie für sich einmal klingen oder weil die Person dazu passt, intuitiv. Ja, sage ich mir dann, da kann es gar keinen Zweifel geben, die Person gehört zu diesem Namen, oder umgekehrt. Dann gibt es Namen, die sich ein wenig sperren im eigenen Empfinden, die erst durch eine Person zum Klingen gebracht werden und sich erst nach einer Weile fügen. Und zuletzt gibt es Namen, die man vielleicht mit einer unangenehmen Vorerfahrung verknüpft. Wenn sie aber jetzt mit einer positiven Erfahrung überlagert wird, dann bekommt auch der Name eine eigene Bedeutung.
Nicht der Name an sich hat Bedeutung, sondern die Erfahrungen, die wir damit verknüpfen, die Menschen, an die wir denken können, wenn wir einen bestimmten Namen hören. Das macht den Namen einzigartig. Auch wenn es den Namen noch so oft gibt, so kann doch die individuelle Persönlichkeit diesen herausheben aus allen anderen.
Es ist der Name, der es mir ermöglicht Dich anzusprechen, Dir zu versichern, dass ich Dich meine und niemand anderen. Dich meinend spreche ich Dich mit Deinen Namen an. Dich meinend setze ich mich mit Dir auseinander, so wie Du mit mir. Der Moment, in dem ich das begriffen hatte, war auch der Moment, in dem ich mich mit meinem eigenen Namen aussöhnte, der Moment, in dem er für mich zu klingen begann. Seitdem höre ich ihn gerne, weil ich gemeint bin und niemand sonst.
So setzte man sich zusammen, 29 Menschen um mich, die für mich gerade eben noch Unbekannte waren und die ich nun mit Namen ansprechen konnte. Sie waren wohl immer noch Unbekannte, weil ich außer dem Namen nichts wusste, und doch war es der Anfang eines Gesprächs, das nur möglich ist, wenn es mit einer Ansprache beginnt.
So werden wir ins Leben gerufen, weil Gott selbst uns Du nennt, so werden wir in die Welt gesetzt, indem uns unsere Eltern einen Namen geben, um uns ansprechen zu können. So beginnen wir ins Miteinander zu wachsen, indem wir uns auf Begegnung einlassen, in der wir zunächst nichts weiter preisgeben als unseren Namen, um dem anderen die Möglichkeit zu geben uns anzusprechen, mir die Möglichkeit gegeben wird den anderen anzusprechen.
Das ist der erste Schritt und die erste Tag des InBegegnung-Tretens, wobei dieser erste Schritt oftmals der zu einer Reise ist.
So traten wir diese Reise an, mit diesem ersten Schritt.
4. Es ist gut, Zeit zu haben
Der Zug erreichte Stuttgart, und damit unser erstes Zwischenziel. Mittlerweile hatten wir die Möglichkeit uns über die erste Ansprache hinaus, mehr zu erzählen. Mehr voneinander zu erfahren, erfahren zu wollen, trägt mehrere Aspekte in sich.
Der Mensch, den man kennenlernt, von dem man nichts weiß als den Namen, mit dem man ihn ansprechen kann, steht sozusagen im luftleeren Raum. Da gibt es noch keine Anknüpfungspunkte, keine Möglichkeit zu verstehen. Woher kommst Du? Was machst Du? Wer bist Du? All das sind Fragen, die wir uns stellen, und umso weiter wir sie beantwortet bekommen, desto genauer ist das Bild, das wir uns zu machen vermögen.
Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die ein oder zwei Stichworte hören, die ihnen genügen um das Bild zu vervollständigen, genügen, um den anderen in eine Schublade zu stecken. Doch wenn ich dieses Aufeinander-zu ernst nehme, so lasse ich mir den Hintergrund, das Eingebettet-sein des spezifischen Menschen von ihm selbst erzählen, lasse ich ihn selbst zu.
Nehmen wir an, dieser bestimmte Mensch lebt in der Stadt, so können wir nun diesen betreffenden Menschen nehmen und ihn mit all den anderen, die wir aus der Stadt kennen in einen Topf werfen, denn diese sind alle gleich. Es sei nur nebenbei bemerkt, wenn man bestimmte Aspekte mit bestimmten anderen verknüpft sieht, so wird man auch nur diese sehen, weil man von vornherein alle anderen Aspekte, die nicht in ein vorgefasstes, geschlossenes Menschenbild passen, ausblendet. So behaupten wir mal beispielsweise, dass Städter laut sind. Dann werden wir auch nur Städter kennenlernen, die laut sind. Die anderen werden wir gar nicht sehen. Das nennt man übrigens ein Vorurteil.
Es hat schon so seine Vorteile, solch ein geschlossenes, in sich abgekapseltes Weltbild. Es vereinfacht so vieles, aber es nimmt einem die Chance die Menschen als solche kennenzulernen, was dazu führen muss unsere eigene Meinung auch ab und an zu revidieren. So versuche ich solche Verbindungen erst gar nicht aufkommen zu lassen, was gar nicht so leicht ist, so sehr wird es uns immer wieder eingebläut und vorgekaut, und dennoch, wenn es gelingt diese Verknüpfungen wegzulassen, wenn wir uns den Menschen als sich selbst erzählen lassen, dann entsteht etwas Neues, etwas, das wir bisher noch nicht kannten, entsteht Erweiterung und Erfahrung.
Und zu den Namen trat ein Bild und zu dem Bild eine Geschichte, zuerst nur skizzenhaft, doch mit jedem Gespräch kamen weitere Striche hinzu. Es ist gut, Zeit zu haben. Es ist gut, sich Zeit zu nehmen. Zeit zu reisen. In ein anderes Land. Die Landschaft noch zu sehen, auch wenn sie im TGV rasch vorüberzieht.
Zeit zum Miteinander. Nicht in einem kurzen Wortwechsel nebenbei abzutun, sondern sich einzulassen, zu sehen, zu hören, zu erleben. Es ist gut, Zeit zu haben. Es ist gut, sich Zeit zu nehmen um sich kennenzulernen. Es lässt sich nicht zwingen, nicht in vorgefasste Strukturen packen. Es lässt sich weder das Aufeinander-zu noch das Verstehen erzwingen. Es ist ein Geschehen-lassen, ein Zu-lassen, das geschehen kann oder auch nicht. Hier geschah es, das Tempo, das der Einzelne brauchte akzeptierend. Mancher ist forscher, redseliger. Andere müssen sich erst einfinden in die Situation, sind zunächst eher Hörende als Sprechende. Erst wenn sie sich aufgehoben fühlen, dann kann es gelingen.
Es ist gut, Zeit zu haben. Es ist gut, sich Zeit zu nehmen um jedem sein Tempo zuzugestehen, denn das bedeutet letztendlich Respekt. Dich in Deiner Eigenart anzunehmen, vorurteilsfrei, Bereitschaft sein ohne zu erdrücken.
Es ist gut, Zeit zu haben. Es ist gut, sich Zeit zu nehmen.
Und so kamen wir an diesem Nachmittag in Paris an. Bereits am Bahnhof wurden wir von unserer Führerin im Empfang genommen und ins Hotel gebracht. Hier würden wir die erste Nacht verbringen. Noch heute morgen war ich in Wien, und jetzt schon in Paris. Eine Reise, die fast einen ganzen Tag gedauert hatte. Es ist gut, Zeit zu haben. Es ist gut, sich Zeit zu nehmen.
5. Die ewige Unterwerfung
Ich hatte mein Zimmer bezogen, ein kleines, behagliches Zimmer in einem Hotel mitten in Paris, mit einem malerischen Ausblick auf einen Innenhof. Hier würde ich doch gut schlafen, dachte ich, doch noch galt es den Weg fortzusetzen, und der hieß in dem Fall eine kleine Führung durch Paris.
Wir gingen zu Fuß. Es tat gut die Stadt zu ergehen. Nein, nicht langsam, denn dazu wollte uns unsere Führerin zu viel zeigen. Ganz in der Nähe unseres Hotel war eine Skulptur, bestehend aus vielen Uhren. Jede einzelne dieser Uhren zeigte eine andere Zeit an.
Es war das erste was mir auffiel, und es war sicher nicht von ungefähr, dass diese sich in der Nähe unseres Hotels befand oder unser Hotel in der Nähe der Skulptur, wie man will. Ich betrachtete sie kurz.
Zeit, symbolisch dargestellt mittels der Uhr. Zeit, ein Phänomen, das unser ganzes Leben strukturiert und begleitet, das uns begrenzt und einzwängt.
Beobachtet Euch mal selbst, wie oft seht ihr an einem Tag auf die Uhr? Wird wohl nicht viel fehlen auf hundert Mal. Entweder schauen wir auf die Uhr, weil wir einen Termin vor uns haben oder weil wir uns beeilen müssen oder auch weil die Zeit mal wieder nicht vergehen zu wollen scheint. Aber immer sind wir abhängig von der Zeit, wann wir aufstehen, wann wir essen, wann wir etwas Bestimmtes machen, wann wir schlafen gehen.
Wir stehen auf, obwohl wir noch müde sind. Warum? Weil es Zeit ist.
Wir essen, obwohl wir nicht hungrig sind. Warum? Weil es Zeit ist.
Wir erledigen Dinge, die wir eben zu dem Zeitpunkt meinen erledigen zu müssen, auch wenn die Witterung oder die Gegebenheiten etwas anderes präferieren lassen sollten. Warum? Weil es Zeit ist.
Wir gehen schlafen, obwohl wir nicht müde sind. Warum? Weil es Zeit ist.
Aber wir finden offenbar nicht mehr die Zeit vor die Haustüre zu gehen und zum Nachbarn Hallo zu sagen. Warum nicht? Weil der Nachbar auch keine Zeit hat.
Wir finden nicht mehr die Zeit hinaus zu gehen und durch das herbstliche Laub zu gehen. Warum nicht? Weil keine Zeit dafür vorgesehen ist.
Wir finden keine Zeit zuzuhören, auch wenn den Partner oder das Kind oder die beste Freundin gerade etwas bedrückt. Warum nicht? Weil keine Zeit dafür vorgesehen ist.
Wir finden keine Zeit mehr uns anzusehen, und zu denken, gut, dass es Dich gibt, vom sagen ganz zu schweigen. Warum nicht? Weil keine Zeit dafür vorgesehen ist.
Aber wir finden Zeit uns zu wundern, wenn wir über Essstörungen oder Süchte oder Suizide hören oder lesen. Dann fragen wir uns, wie so etwas denn passieren kann. Ja, wie kann es nur sein? Die Antwort überlasse ich jetzt Eurer Phantasie, falls gerade Zeit dafür ist.
Wir essen ohne Hunger. Und wissen nicht mehr was eine Mahlzeit ist, ein Stück Brot oder ein Schluck Wasser, das auch gut sein kann fürs Herz, wie uns der Kleine Prinz lehrt.
Wir schlafen ohne Müdigkeit. Und wissen nichts mehr über die erquickende Erholung ohne flimmernde Fernsehkiste, vom Träumen und seinlassen.
Wir kommunizieren auf diversen sozialen Plattformen ohne etwas zu sagen zu haben. Und wissen nichts mehr über einen personalen Austausch im Dialog.
Wir leben ohne Notwendigkeit. Und wissen nichts mehr über unsere Ziele, Hoffnungen, Träume, wissen nichts mehr vom Sinn.
Sie funktioniert tadellos, die ewige Unterwerfung unter die Zeit, die uns doch erst so kurz begleitet. Eigentlich erst seit der Industrialisierung. Letztendlich haben wir die Taktung des Fließbandes im Kopf.
Viele Uhren, die alle eine andere Zeit anzeigen. Viele Uhren, die uns sagen, dass es auch so etwa wie eine innere Uhr gibt, die uns unseren eigenen Rhythmus lehren könnte, wenn wir es zuließen, ab und zu, aber natürlich nur, wenn Zeit dafür ist.
Und der Gang durch Paris, der brachte viel Neues, Eindrücke und Informationen, und ich muss gestehen, ich habe mir wohl das Wenigste gemerkt, doch ich habe die Stadt gehend erlebt, einen kleinen Teil, aber den Weg fände ich wieder, da er erlebt war.
6. Von der Kunst
Die letzte Sehenswürdigkeit, derer wir an diesem späten Nachmittag oder frühen Abend – je nach Auslegung – in Paris ansichtig wurden, war der Eiffelturm.
Dann kehrten wir ins Café Malakoff ein. Bei der Schreibung bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da ich bei meinen Recherchen über die verschiedensten Schreibweisen stolperte, doch von Vorne.
Wir kehrten also ein um das Souper einzunehmen. Der Duden behauptet, bei Souper handelt es sich um ein festliches Abendessen mit Gästen, aber ihr könnt mir glauben, wenn man den ganzen Tag so gut wie nichts zu essen bekommen hat, dann ist ein banales Abendessen plötzlich ein Souper – was jetzt nicht die Qualität dieser Speisen mindern soll, doch es gilt, Hunger ist der beste Koch.
So war es nicht durch die Umstände festlich, aber doch durch das Miteinander, denn wir soupierten gemeinsam, um mich nochmals einen diesem wunderschönen Wort zu erfreuen. Erst als der gröbste Hunger gestillt war, und das war nicht so leicht, nachdem er wirklich sehr groß war. Auch wenn es mir erst wirklich bewusst wurde, als ich einen leeren Teller vor mir sah, doch das blieb es nicht lange, denn die Franzosen haben die liebenswerte Eigenschaft gleich zu Beginn Brot, Butter und Wasser zu kredenzen. Ich stillte also meinen Hunger und begann dann über den Namen des Cafés nachzudenken, Malakof.