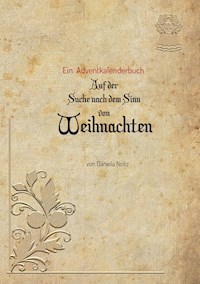6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zoe schließt ab, mit ihrem bisherigen Leben und einer fragwürdigen Wohlanständigkeit, von der sie sich in Ketten legen ließ. Wie ein junger Morgen, unberührt und jungfräulich, liegt ihr neues Leben vor ihr. Es gibt für sie keinen vorgegebenen Weg mehr, sondern nur den, den sie für sich ebnet und der sie zu ihrer Berufung und zur Liebe führt, zu Begeisterung und Leidenschaft, zu einer Art der intensiven Lebensbejahung, die sie bisher nicht kannte. Dabei stellt sie Regeln und Vorgaben in Frage und lässt nur mehr jene gelten, die dem Sinn des Lebens dienen, lebendig zu sein. Zahlreiche Begegnungen lassen sie wachsen, schenken ihr neue Einsichten und Erkenntnisse. Ihr Abschluss geht nahtlos über in einen Neuanfang, der ihr zeigt, wie viele, bisher sorgfältig versteckte, Kräfte in ihr schlummerten. Wir dürfen Zoe auf ihrem Weg vom kleinen, braven Mädchen hin zu einer starken, selbständigen Frau begleiten, die sich ihrer selbst und ihrer Fähigkeit zu leben nicht nur bewusst wird, sondern sie auch umsetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
01. Eine Tür fällt ins Schloss
02. Der Ballast der frühen Jahre
03. Keine halben Sachen
04. Der rote Strich
05. Meisterklasse
06. Die Schnüre zu durchschneiden
07. Die Rettung der Welt und ein paar andere Kleinigkeiten
08. Das Leben zu leben
09. Wer setzte den Menschen in die Krone der Schöpfung
10. Vögel mit amputierten Flügeln
11. Erlebte Freuden und solche, die es erst werden
12. Fliegen lernen
13. Den Schmerz zu sehen
14. Ein kleiner Ausflug mit weitreichenden Folgen
15. Der Umzug
16. Verantwortung
17. Die Vernissage
18. Wohin uns unsere Füße tragen
01. Eine Tür fällt ins Schloss
„Das Leben ist ein Spiel“, dachte Zoe, als sie die Türschnalle mit der Hand umschloss, immer noch unsicher, „Entweder wird mit Dir gespielt oder Du spielst selbst. Das ist der einzige Unterschied.“ Wenn sie jetzt diese Schnalle drückte, die Türe öffnete, dann würde sie – darüber war sie sich im Klaren – die Rolle der Spielfigur verlassen und in die der Spielleiterin schlüpfen.
Der säuerliche Geschmack, der den Gedanken daran, Opfer zu sein, immer begleitete, machte sich in ihrem Mund breit. Doch Opfer kann es nur geben, wenn es auch Täter gibt. Jemanden, der bestimmt, was geschieht, und jemand anderen, der es geschehen lässt. Begriffe, denen der Nimbus von Gewalt anhaftet. Ersetzt man das Wort Opfer jedoch durch Schützling und das Wort Täter durch Beschützer, so klingt es gleich viel positiver. Der Effekt ist derselbe.
Weder das Opfer noch der Schützling haben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. In beiden Fällen wird der Wunsch nach Eigenständigkeit im Handeln, Denken und Fühlen durch Repression unterdrückt, wobei sich nur die damit verbundenen Adjektive voneinander unterscheiden. Obsessiv oder liebevoll. Das Ergebnis ist identisch. Selbst die Vorgehensweise, die in der Herabwürdigung der Person und in der Unterminierung des Selbstvertrauens besteht, ist in beiden Fällen deckungsgleich.
„Ohne mich bist Du nichts“, heißt es, „Du kannst nichts, Du hast nichts, Du weißt nichts. Nur mit mir kannst Du leben“. Das lässt sich natürlich auch positiv formulieren, „Schau, ich meine es doch nur gut mit Dir. Ich entlaste und beschütze Dich, sodass Dir nichts passieren kann. Dazu musst Du nichts weiter tun, als dem Folge zu leisten, was ich sage, denn ich will ausschließlich Dein Bestes.“ Und das wird so lange wiederholt, bis das Opfer oder der Schützling gar nicht mehr wagt, auch nur darüber nachzudenken, ob es denn anders möglich wäre. Geschweige denn, danach zu fragen.
Man erkennt solche Menschen sofort. Sie ziehen den Kopf ein wenig zwischen die Schultern. Um ihn zu schützen. Sie wagen es kaum, den Blick zu heben, ohne sich vorher zu vergewissern, ob es denn gestattet sei. Eltern verfahren so mit ihren Kindern. Geschwister untereinander. Oder auch Personen in einer Paarbeziehung, egal wie diese aussieht. Es gibt Menschen, die andere freisetzen und welche, die andere einkerkern. In Abhängigkeit setzen. Gefügig machen. Es bedarf weder Gitter noch Ketten. Zumindest keiner äußerlichen. Die Gitter und Ketten, die sich in den Köpfen finden, genügen vollauf. Um von der einen Seite zur anderen zu gelangen, die Türe zu durchschreiten und die Repression hinter sich zu lassen, bedurfte es nur eines einzigen Schrittes vorwärts. Dann war es möglich, die Türe zu öffnen.
„Ich will nicht, dass Du länger mit mir spielst“, wiederholte Zoe einmal, zweimal, dreimal und noch viel öfter, während die Türe sich öffnete, sie sie öffnete und der Raum, in dem sie bis jetzt gelebt hatte und den zu verlassen, sie sich nun endgültig anschickte, mit milchiger Helligkeit durchflutet wurde, alles, was sich darin befand, und dieses alles war das, was sie bisher ihr Leben genannt hatte.
Diese Helligkeit wirkte wie eine warme, weiche Decke, die sie aufforderte, sich hineinzukuscheln. Sie war verführerisch, diese Aufforderung. Bequemlichkeit und Sicherheit und Vertrautheit versprach sie. All die Dinge, die Zoe nur allzu gut kannte. Doch Bequemlichkeit und Sicherheit und Vertrautheit hatten ihren Preis, wie sie ebenso gut wusste. Unterwürfigkeit und Gehorsam und Fremdbestimmtheit hieß er. Schließlich wird einem nichts geschenkt. Die Frage ist nur, ob es mir das wert ist. Ob ich es mir wert bin. Freiheit kann lästig sein. Der goldene Käfig hat etwas Verlockendes. Zoe kannte es nur allzu gut. Nein, gewollt hatte sie es nicht und sich auch nicht wirklich entschieden. Es war nicht in einem Moment nicht gewesen und im nächsten schon, was eine Entscheidung implizieren würde. Vielmehr handelte es sich um eine Entwicklung. Langsam, schleichend und beinahe unmerklich, bis sie endlich erwachte, sich umsah und ihre Lage erkannte.
Doch an welcher Stelle ihres Lebens war Zoe falsch abgebogen? In welchem Moment war es, dass sie sich an der Hand nehmen und einfach nur mehr führen ließ? Es war verlockend, und Zoe war müde, von all den Kämpfen, auch Erkenntnissen, die so schmerzten und so wütend machten, ausgefochten und zugelassen während der letzten ... Waren es Tage, Monate, oder vielleicht sogar Jahre gewesen? Zoe würde sich nicht mehr verlocken lassen, wandte den Blick vielmehr ab von der betörenden, benebelnden, einlullenden Annehmlichkeit und dem gleißend hellen Licht zu, das ihr von der anderen Seite der Türe entgegenschlug, die sie gerade geöffnet hatte. Es brannte in den Augen, weil sie die Weite und Offenheit nicht gewohnt waren.
„Wie ein Schwein, das in einem Stall großgeworden war, in dem es seit der Geburt kein natürliches Licht gesehen hatte, also eigentlich ganz normal“, dachte Zoe mit der ihr eigenen Stringenz, um dann ein wenig resigniert hinzuzusetzen, „Nur, dass das Schwein niemals eine Wahl gehabt hatte. Hätte man ihm die Türe geöffnet, es hätte keinen Moment darüber nachgedacht, ob es an die Sonne wollte oder nicht, Bequemlichkeit und Abwesenheit von Stress hin oder her, es will hinaus. Ich jedoch, ich habe mich freiwillig in diese Lage begeben.“
Es hatte eine Zeit gegeben, irgendwann in ihrem Leben, da lag die Welt in ihrer ganzen Größe und Schönheit offen vor ihr. Sie hätte den Rucksack schultern und die Welt erobern sollen. Hätte sollen. Aber da waren diese Stimmen, die sie begleiteten, um sie, in ihr, flüsternd, sirenengleich, dass es doch so schön sei, sich sesshaft zu machen, ein Heim, eine Familie, die Freunde und festen Gewohnheiten. Zumal in einem Staat, in dem es sich gut leben lässt. Die Sicherheit, umgeben von lieben Menschen, die einen unterstützen und es gut mit einem meinen. Die Krönung all dessen war die Ehe, und ehe sie es sich versah, hatte sie sich versprochen und damit die Türe hinter sich geschlossen, die erste, sodass alle anderen Möglichkeiten draußen blieben. Denn eine Entscheidung, so war sie sich bewusst und hätte es nicht anders gewollt, war eine, die alles einschloss, was diese betraf. Zunächst war es durchaus spannend, den Raum zu erkunden. Er leuchtete im schönsten, glattesten, jungfräulichsten Weiß. Zarter, blumiger Duft umwehte, betörte sie, doch sobald sie ein wenig an der Oberfläche kratzte, bröckelte die Fassade ab, ließ Moder und Schimmel erkennen, während die Mauern sich immer enger um sie zogen.
Wie lange konnte man das ertragen, wenn man es einmal erkannt hatte? Wie lange konnte man die Augen schließen und so tun als ob? Sie hatte sich schließlich entschieden und um dem Vorwurf zu entgehen, wankelmütig zu sein, verteidigte sie ihre Entscheidung, so lange und so gut es ging, auch und vor allem vor ihr selbst.
„Du hast gewusst, worauf Du Dich einlässt“, wurde ihr gesagt. Hatte sie es denn gewusst? Konnte sie es gewusst haben? Niemand weiß, wie das Leben ist, bevor man es lebt. Doch erst, als sich die Wände so eng um sie geschlossen hatten, dass sie nicht mehr atmen konnte, die modrige Luft so komprimiert war, dass sie fürchtete, ersticken zu müssen, erst da entdeckte sie die Türe, durch die sie gerade ging, hinaus in das gleißende Licht einer Freiheit, die sie mehr ängstigte, als anzog, noch.
„Musst Du eigentlich jedes Mal, wenn Du atmest eine Erlaubnis von Deinem Mann einholen, oder hast Du dafür eine Generalvollmacht?“, fiel ihr ein. Celina, Zoes allerbeste Freundin, hatte ihr diese Frage kurz nach ihrer Hochzeit gestellt. Oder war es schon am selben Abend gewesen? Zoe hatte die Frage unbeantwortet gelassen, weil sie es vorgezogen hatte, sich beleidigt abzuwenden, trotzdem, oder wahrscheinlich gerade, weil sie gewusst hatte, wie recht Celina hatte. Nie wieder würde Zoe mit ihrer Freundin sprechen, hatte sich Zoe in diesem Moment vorgenommen. Wie schnell sind wir bereit, eine Wahrheit, die wir nicht sehen wollen, mit Aggression zu beantworten, nur um eine Illusion aufrechtzuerhalten. Natürlich war es überspitzt formuliert gewesen, fasste aber Zoes Lebenssituation ziemlich genau zusammen. Energisch tat sie einen weiteren Schritt vorwärts, sodass sie die Türe hinter sich zuzog.
„Jetzt gibt es kein Zurück mehr“, dachte Zoe, als sie hörte, wie das Schloss einrastete und merkte, wie die Klinke nach oben ging, weil der Druck nachließ. Doch noch umfasste ihre Hand die Schnalle, als müsste sie sich an etwas festhalten. In ihrem Kopf drehte sich alles. Das gleißende Licht der Freiheit schien sie zu durchbohren, aufzuspießen. Sie war die Freiheit nicht gewohnt, auch die Offenheit. Eingefahrene Bahnen, Wiederholungen und letztlich Stillstand, aber nicht diesen Ansturm an Möglichkeiten, der sie zu überrollen schien wie ein Sturmwind, ein Hurrikan, ein Tsunami, von dem Zoe meinte, dass er ihr den Boden unter den Füßen wegzog und die breite Treppe, die von der Türe wegführte, in unerreichbare Ferne rückte. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Der Weg, den sie gekommen war, war versperrt, und den, den sie gehen würde, gab es noch nicht. Zwischenzustand. Eine unendliche Leere tat sich vor ihr auf. Es war ihr, als würde sie direkt in das Nichts starren. Einfach ins Nichts.
„Freedom’s just another word for nothing left to lose“, schoss es Zoe in Anbetracht ihrer Situation noch durch den Kopf, bevor das Licht immer schwächer, ihr schwarz vor Augen wurde und sie in das Nichts, das sie umgab, fiel. Manchmal kann eine Ohnmacht eine Gnade sein, die einen dem Bewusstsein enthebt, wenn auch nur für eine kurze Weile.
Ein herber, männlicher Duft war das Erste, was sie wahrnahm, als sie sich langsam wieder aus der seligen Umarmung ihrer Ohnmacht befreite, sich von ihr verabschiedete wie von einer alten, guten Freundin, die sie schon allzu lange nicht mehr heimgesucht hatte. Noch hielt Zoe die Augen geschlossen und ließ diesen Duft wirken. Er hatte etwas Vertrautes, auch wenn sie nicht zu sagen gewusst hätte, wo sie ihn einordnen sollte, und war gleichzeitig so aufregend neu, beinahe elektrisierend. Könnte sie nicht einfach bleiben und sich von dem Duft tragen lassen? Respektive von dessen Träger, denn sie wurde sich bewusst, dass sie in starken Armen lag, die sie umfassten, die sie aufgefangen haben mussten, bevor sie im Nichts verschwand.
Verdammt, woher war dieser Typ gekommen? War er aus dem Nichts aufgetaucht? Wie kam er dazu, sie mir nichts Dir nichts aufzufangen? Und wenn ihr neues Leben so begann, sollte das ein Zeichen sein? Konnte sie denn gar nichts alleine bewältigen? War es so weit um ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bestellt, dass sie nicht einmal eine verdammte Türe schließen konnte, ohne gleich die Besinnung zu verlieren? Aber dieser Duft beschwichtigte sie, ein wenig. Sie spürte, wie dieser Mann ein paar Schritte mit ihr ging, um sie dann sacht auf einer Bank abzulegen. Langsam kam sie wieder zu sich, zaghaft wohl noch, doch immerhin, ihre Neugierde hatte die Oberhand gewonnen. Sanft waren diese Augen, die sie fand, ganz nahe bei den ihren, sanft und grau. Besorgnis sprach daraus. Das verwirrte sie zusätzlich. Es war lange, sehr, sehr lange her, dass sich jemand um sie gesorgt hatte, so lange, dass sie nicht einmal mit Gewissheit hätte sagen können, ob es tatsächlich geschehen oder nur ein Produkt ihrer Phantasie gewesen war.
„Alles in Ordnung?“, fragte eine tiefe und zugleich weiche Stimme. Sie gehörte zu dem Mann, der sie aufgefangen und getragen hatte. Nun war ihm bewusst geworden, dass Zoe wieder zu sich gekommen war.
„Ja, ja, natürlich. Alles bestens“, beeilte Zoe, sich zu sagen, während sie sich automatisch von den Armen freistrampelte, die sie noch immer so warm und fürsorglich umschlossen. Aber es passte nicht zu ihrem neuen Ich, gehalten zu werden, schon gar nicht mit Wärme und Fürsorge. Er ließ es sich ohne Wenn und Aber gefallen. Vielleicht war er es auch gewohnt, denn sie hatte den Eindruck, dass ein feines Lächeln seine Lippen umspielte, während sie sich aufrecht auf die Bank setzte.
„Ja, natürlich. Und deshalb bist Du auch in Ohnmacht gefallen“, merkte er an, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, den süffisanten Unterton zu verbergen. Es könnte auch Sorge sein, aber selbst davon wollte Zoe nichts wissen.
„Das kann schon mal vorkommen, Du weißt schon, niedriger Blutdruck und so, und überhaupt, ich muss mich vor Dir nicht rechtfertigen“, erklärte sie schroff, zu schroff, wie sie sich endlich auch selbst eingestand, „Entschuldige, Du wolltest ja nur helfen. Danke also für Deine Hilfe, aber es geht mir wirklich gut.“
„Ok“, sagte er bloß, „Und wenn Du Dich ein wenig aufregst, dann lässt das den Blutdruck steigen. Ich habe kein Problem, wenn Du da ein wenig Gas gibst. Mädchen sind eben so. Genau genommen finde ich es sogar charmant.“
„Ach ja?“, fragte Zoe bloß, der vor aufsteigendem Ärger, die Luft wegblieb. „Mädchen sind eben so!“, purzelte es durch ihre feministisch geschulten Gedanken, was nichts anderes bedeutete, als dass es ihm zwangsläufig an Respekt mangelte. „So ein chauvinistischer Macho“, drehten sich ihre Gedanken weiter.
„Jetzt bekommst Du richtig Farbe im Gesicht“, erklärte er, „Das steht Dir.“
„Ach ja?“, war wieder das Einzige, was sie zwischen den Lippen herauspressen konnte. Dann atmete sie drei Mal tief ein und aus, so wie sie es gelernt hatte, bis sie sich so weit beruhigt hatte, dass sie ihrer eigenen Stimme wieder über den Weg traute, um dann so bestimmt wie möglich zu sagen: „Ich danke Dir, dass Du mich aufgefangen hast, in einem Moment der Schwäche.“
„Es war mir ein Vergnügen. Ich helfe immer gerne, besonders bei Mädchen, die so adrett und nett sind“, meinte er, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt.
„D.h. wenn ich jetzt nicht adrett und nett gewesen wäre, wie Du es so männlich despektierlich meinst, ausdrücken zu müssen, dann hättest Du mich fallen lassen?“, fragte sie, sich in Rage sprechend.
„Natürlich. Ich meine, es ist auch eine Frage des Gewichts. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste, aber bei Dir war das kein Problem“, sagte er, betont lässig.
„Ich danke schön!“, fuhr sie ihn grimmig an, „Da habe ich großes Glück gehabt, dass ich die letzten Wochen so unglücklich war und ein paar Kilo verloren habe.“
„Durchaus, auch wenn ich nicht glaube, dass Du vorher dick gewesen bist. Ein bisschen was auf den Rippen könntest Du schon vertragen“, merkte er an, während er seinen Blick betont langsam über ihren Körper gleiten ließ, was sie dazu veranlasste, die Arme vor der Brust zu verschränken, „Apropos mehr auf den Rippen, wollen wir was essen gehen. Ich hätte gerade Hunger?“
„Aber ich nicht“, fauchte sie zurück, „Mädchen müssen ja dünn sein bei Dir, und wahrscheinlich bei all den anderen verfluchten Männern auf dieser gottverdammten Welt.“ Und noch bevor er etwas erwidern konnte, sprang sie auf, richtete sich zu ihrer vollen Größe empor, warf ihren Kopf so energisch, wie es ihr möglich war in den Nacken und schritt die große, breite Treppe hinunter, mitten hinein in ihr neues Leben.
„Freedom’s just another word for nothing left to lose“, wiederholte sie stumm für sich, doch nun war sie endlich in der Lage diesen Satz mit „And everything to gain!“ zu vollenden. Nie wieder würde sie auf irgendjemanden angewiesen, nie wieder ein schwaches, verletzliches, hilfloses Mädchen sein. Und vor allem, und das war das Wichtigste, nie wieder würde sie sich emotional so engagieren, dass es ihr wehtun konnte.
Und während Zoe vor allem, was sie hinter sich gelassen hatte, zu fliehen schien, so sehr beschleunigte sie ihre Schritte, als hätte sie Angst, ihr bisheriges Leben würde sie verfolgen und einholen, sah ihr der Mann, der sie aufgefangen und vor einem Aufprall bewahrt hatte, sinnend nach.
„Sie muss noch viel lernen, bevor sie sich eingestehen kann, dass sich Stärke und Gehaltenwerden nicht widersprechen“, dachte er, „Wäre gespannt, ob es ihr gelingt oder ob sie dort stehen bleibt, wo sie jetzt ist, frustriert und eingezwängt in all die alten Gedanken und Muster und Klischees, die sie noch immer nicht losgeworden ist. Aber ich werde es erfahren.“ Er war ein Mann der Tat, wie sich in seiner blitzschnellen Reaktion gezeigt hatte, als Zoe in Ohnmacht gefallen war, aber er wusste ebenso gut, wann man sich in Gelassenheit üben musste.
02. Der Ballast der frühen Jahre
Anklänge und Verheißungen. Gerade eben hatte Zoe noch gedacht, sie wäre stark genug, alles hinter sich zu lassen, ein völlig neues Leben zu beginnen, als hätte es davor nichts gegeben, oder besser, als könnte sie alles, was bisher gewesen war, auslöschen und quasi von Null beginnen. Aber dieser Nullpunkt war das Nichts, in das sie geblickt hatte und sie schwindlig machte. Das war ein toller Start gewesen, an dem sie sofort wieder jemanden gebraucht hatte, der ihr auf die Beine half. Würde es jetzt immer so bleiben? War das ein Wink des Schicksals gewesen?
„Du wirst Dir bald wieder einen Mann suchen, denn ohne Mann kann eine Frau nicht sein“, vernahm sie die mitleidige Stimme einer älteren Dame, als wäre es ein Makel, dieses Ohne-Mann-Sein, der nun wie ein Kainsmal zwischen ihren Augen prangte.
„Nie wieder tue ich mir das an“, hatte Zoe im Brustton der Überzeugung geantwortet.
„Das sagen sie alle“, erwiderte jene Dame achselzuckend und ging ihrer Wege.
Aber was Zoe noch mehr zu schaffen machte, waren diese mitleidigen Blicke, die sie unverhohlen trafen, als hätte sie sich mit einer schweren Krankheit infiziert.
„Geht es Dir eh gut?“, wurde sie vorsichtig gefragt.
„Klar geht es mir gut“, konterte sie regelmäßig, und mit der Zeit schon voller Überdruss, „Warum soll es mir nicht gut gehen?“
„Na ich meine ja nur“, wurde ausweichend erwidert, „Aber wenn Du was brauchst, Du weißt schon ...“
Ja, Zoe wusste schon, sehr genau sogar. Gut möglich, dass sie vor einiger Zeit noch genauso reagiert hätte, weil es schlimm war, wenn ein Leben zerbrach. Zumindest hätte sie das so interpretiert, weil sie es ebenso wenig geschafft hätte, aus ihrer kleinen Box hinauszudenken, denn dann hätte sie bemerkt, dass ein Ende auch immer einen Anfang bedeutet, etwas Verlorenes Raum schafft für Neues. Aber man ist lieber mit dem Gewohnten unglücklich, bevor man sich auf eine Ungewissheit einlässt, die zwar die Möglichkeit impliziert, wieder glücklich zu sein, aber letztlich zu vage ist, um es sich wirklich zuzutrauen. Bis es ihr selbst geschah. Da fühlte es sich plötzlich so leicht an. Und so schwer. Leicht, weil sie den Ballast abgeworfen und die Steine, die sie mitgeschleppt hatte, auf die verteilte, denen sie wirklich gehörten. Schwer, weil sie wusste, dass sie Erwartungen enttäuscht hatte.
„Nicht mein Problem“, war einer der wichtigsten Sätze, die sie während der letzten Monate gelernt hatte, doch bis zu „Es ist mein Leben, das ich nach mir ausrichte und nicht nach Erwartungen von außen“, hatte sie sich noch nicht durchgerungen. Zu verschlungen waren die Erwartungen in ihr noch, als dass sie hätte unterscheiden können, welche von ihr stammten und welche sie sich hatte einreden lassen. Durch all die Jahre. Durch all die Lebensstadien. Sie hatte noch einen weiten Weg vor sich, dachte sie verdrossen.
„Ich habe noch einen weiten Weg vor mir“, sagte sie halblaut vor sich hin, die Verdrossenheit bei Seite schiebend, sodass sie neugierig nach vorne sah.
„Ich habe noch einen weiten Weg vor mir“, wiederholte sie ein weiteres Mal, noch ein wenig lauter, sodass sich die Passanten kopfschüttelnd zu ihr umwandten, nur dass es ihr nichts ausmachte, denn sie erkannte das Potenzial und die Möglichkeiten, die dieser Satz eröffnete. Von nun an würde es nicht nur ein weiter Weg sein, sondern vor allem, es würde ihr Weg sein, genuin und originär, ihr Weg, der sie vorerst, völlig unspektakulär, nach Hause führte. Sie öffnete die Türe, wieder einmal eine Türe, zu den wohlbekannten Räumlichkeiten. Und sie schloss dieselbe auch, wieder einmal, hinter sich.
Es war ein Ankommen. Dachte sie, und während sie sich eine Kleinigkeit kochte, sah sie sich um. Da war noch so vieles, was sie an ihr früheres Leben erinnerte, an das, was sie hinter sich gelassen hatte, oder von dem sie meinte, sie hätte es hinter sich gelassen. Doch es ist zu wenig eine Türe zu schließen. Sie trug noch so vieles in sich, und das, was sie in sich trug, das fand Ausdruck in Äußerlichkeiten. Energisch stellte sie den Topf zur Seite. Essen würde sie noch oft genug in ihrem Leben, aber es galt, abzuschließen, so lange der Mut und der Wille noch da waren. Nein, das traf es nicht ganz, den Mut und den Willen, den würde sie so schnell nicht verlieren, aber es war gerade der richtige Moment. Nie wieder, so hatte sie sich vorgenommen, würde sie die Zügel schleifen lassen und sich denken, was nicht heute geschieht, geschieht eben morgen. Es musste sein, und es musste jetzt sein.
„If you never try, you will never know“, stahl sich einer von Celinas Lieblings-, fast schon Standardsätzen, in Zoes Kopf, und wiederum musste sie ihrer Freundin zustimmen. Zoe wollte es wissen, alles wollte sie wissen. So lange sie sich zurückerinnern konnte, wollte sie schon immer alles wissen, ganz genau wissen. Nur während der letzten Jahre, da hatte sie sich in ein kuscheliges Nichtwissen zurückgezogen, das ihr angenehmer schien, als die Wahrheit. Zumindest für eine gewisse Zeit, jene, in der sie sich selbst verleugnet, verloren hatte, an eine zweifelhafte Wohlanständigkeit. Wie es alle machen. Wie schön die Fassaden in der Sonne glänzen. Wie die frischgeputzten Scheiben. Doch wenn man dahinter sieht, dann stößt man auf Gewalt und Zwietracht und Neid und Missgunst und Gier. Am Anfang, so stellte sie emotionslos fest, steht letztlich immer der Wille zu besitzen, ganz gleich, ob es sich um ein Ding oder ein Lebewesen handelt. Wir vergewissern uns dessen, indem wir es in Besitz nehmen und mit Zähnen und Klauen verteidigen. Schockgefroren. Es muss so bleiben, wie es ist. Alles andere ist Verrat, vor allem am Eigentümer, auch an der Eigentümerin. So gestalten wir unsere Beziehungen nach unseren Kaufgewohnheiten. Mein Auto, mein Haus, mein Hund, mein*e Partner*in, genau in dieser Reihenfolge, auch im Sinne der Wertigkeit.
Dennoch wundern wir uns darüber, dass die Begegnung so kalt ist wie die Berührung einer Leiche. Aber was ist es denn anderes?
Leichenstarre. Kühl genug gelagert ändert sich auch nichts. Wir verhindern die Lebendigkeit ebenso wie die Verwesung.
„Wenn Du es nicht probierst, wirst Du es niemals wissen“, wiederholte Zoe für sich, während sie, mit großen Müllsäcken bewaffnet, die Wohnung vom Ballast der frühen Jahre befreite. So vieles hatte sich angehäuft und war geblieben. Niemand brauchte es, und dennoch wollte man sich nicht davon trennen, wie Grabbeigaben, die man in früheren Zeiten mitgegeben hatte. Jetzt sammeln sie sich in den Eigenheimen, den Gräbern mitten im Leben, das sie nun dadurch zu würdigen gedachte, indem sie einfach tun wollte, was das Leben ausmacht, es zu leben. Nichts weiter. Es konnte so einfach sein, viel zu einfach wohl, denn sonst hätte sie es nicht so unendlich lange übersehen.
„Wenn Du es nicht probierst, das Leben zu leben, dann wirst Du niemals wissen, wie es sich anfühlt, lebendig zu sein“, komplettierte Zoe den Satz in ihrem Kopf, während sie Sack neben Sack in ihrem Vorzimmer aufreihte. Und mit jedem Sack, den sie abstellte, fühlte sie sich ein kleines Stück leichter. Am Schluss würde sie alles in ihr Auto einladen und zum Müllplatz führen. Das Grab der modernen Konsumgesellschaft. Wände zeigten endlich wieder ihre Originalfarbe, Kästen ächzten nicht mehr unter dem Gewicht unnötiger Dinge, und der Staub ließ sich viel leichter entfernen, wenn nicht alles mit Krimskrams verstellt war.
Selbst die Vorhänge fielen ihrer Entrümpelungskur zum Opfer, zumindest diese komischen Seitenteile, die bloß als Zierde in der Gegend herumhängen und die im Grunde genommen niemand braucht.
Aber was benötigt man wirklich? Wie viel ist nötig, notwendig? Sie merkte, dass sie es nicht wagte, den Gedanken stringent zu Ende zu führen. Noch nicht. Aber sie musste nicht alle Schritte auf einmal gehen. Die ersten waren getan. Weitere würden folgen, wenn sie so weit war. Verschwitzt und erschöpft beschloss sie, dass es genug wäre, für diesen einen Tag. Die Sonne war schon längst untergegangen. Es war Zeit, ins Bett zu gehen.
Im Badezimmer drehte sie den Heizstrahler auf, weil sie es gerne warm hatte, vor allem, wenn sie nass aus der Dusche stieg. Dann erst schlüpfte sie aus ihren Kleidern. Zum ersten Mal seit langem betrachtete sie sich im Spiegel. Nicht, dass sie sich nicht angesehen hätte, auch in der Zeit davor, aber nur aus einem bestimmten Grund. Wie saß die Frisur oder waren die unverschämten, dunklen Härchen im Gesicht wieder nachgewachsen und mussten gezupft werden, oder lugten schon wieder dreist graue Haare durch, sodass es angebracht war, sie wieder frisch zu färben.
Eigentlich war es nicht ihr Blick gewesen, der sie bisher im Spiegel wahrnahm, sondern der, aus dem die Erwartungen ihrer Umgebung sprachen.
Doch nun betrachtete sie ihren Körper, als würde sie ihn just zum ersten Mal sehen, voller Offenheit und Neugierde.
„Es ist, was es ist, sagt die Liebe“, wiederholte Zoe beim Betrachten ihrer selbst einen Satz aus ihrem Lieblingsgedicht von Erich Fried, gerade weil es so schlicht und einfach und authentisch das sagt, was es sein soll. Es ist nicht mehr notwendig.
War es auch nie. Es ist jedoch zu wenig für eine Haltung, die uns jeden Moment suggeriert, es muss noch mehr sein, noch besser, noch schöner, und was es da noch mehr an Nochs gibt. Und genau dies versuchte sie jetzt bei Seite zu lassen, den Vergleich mit einem Schönheitsideal, das irgendjemand kreiert hatte, um es zu einer Norm werden zu lassen, an er sich alles zu messen hat.
Es geschieht einfach, so unmerklich, dass wir nicht mehr wahrnehmen, dass es nicht unsere Meinung ist, sondern eine, die von irgendwoher in uns eingepflanzt wurde. Weitergegeben, in der Erziehung, in den Medien, im Flüsterton von einer Frau zur anderen.
„Schau Dir die an“, wird da geflüstert, den Mund verschwörerisch nahe am Ohr der anderen. Die Angesprochene blickt sich nur kurz um, nickt verstehend, um dann zu antworten.
„Hat die keinen Spiegel zu Hause?“, oder „Wie kann man sich nur so in die Öffentlichkeit wagen?“, oder etwas Ähnliches. Einigkeit ist hergestellt. Aber es ist ja nicht so, dass nur wir es mit den anderen machen, die anderen machen es auch mit uns. Es scheint zu einer Art Volkssport geworden zu sein.
Ein Blick, eine Beurteilung, eine Verurteilung.
Wir wissen es und verhalten uns entsprechend.
Und so fand auch Zoe nicht ihren Blick auf sich gerichtet, sondern den der anderen. Nur den der anderen. Aber sie hatte einmal einen gehabt, einen, der so unschuldig und unberechenbar war, wie sie es gerne wäre. Vom Blick ausgehend hatte sie sich vergiften lassen, mit Fremdheit, die die Eigenheit, auch das eigene Denken, das eigene Fühlen, verdrängte, so sehr, dass es ihr nicht mehr zugänglich war. Fröstelnd schlang sie die Arme um ihren nackten Körper. Es war so ungewohnt, auch die Körperlichkeit. Das Nahe-sein mit sich selbst.
Vorsichtig schloss sie die Augen. Vielleicht wäre es möglich, sich heranzutasten, ganz sacht, ganz langsam, wie bei einem ersten Kennenlernen, bei dem sie sich vorgenommen hatte, es sich nicht vergiften zu lassen. Aber es ist so schwer, diese unvoreingenommene Neugierde wiederzufinden, nach Jahrzehnten der Verschwörung. Auch gegen sich selbst, da sie sich zum Objekt der Außensicht gemacht hatte, über die sie gewohnt war, sich zu sehen. Die Augen zu schließen half.
Es war wieder wie eine Türe, die sie schloss.
Körperlich und metaphorisch waren sie geworden, diese Türen, beginnend bei jener, die sie an diesem Tag zu ihrem Bisher geschlossen hatte. Es wurde ihr bewusst, dass das noch lange nicht genug war, dass da noch so viele Türen waren, die es zu schließen galt, aber auch immer andere, die es zu öffnen galt, die sie entdeckte, entdecken konnte, wenn sie die anderen schloss. Wie die zu ihrer selbst, und sei es nur in ihrer Körperlichkeit.
Doch was bedeutete „nur“ in ihrer Körperlichkeit?
Sollte ihr Körper nicht Ausdruck sein? Das Innen spiegelt sich im Außen.
„In Deinen Augen meine Seele sich spiegelt Deine Seele in meinen Augen“, wiederholte Zoe einen Satz, den sie sich vor langer Zeit auf ein Kleid hatte drucken lassen, weil sie davon so angetan gewesen war, vor allem wohl von der Symmetrie.
Erreicht hatte er sie nicht. Er blieb äußerlich, noch viel äußerlicher, als es ihre Körperlichkeit je sein könnte. Doch als sie jetzt in ihrem Badezimmer mit geschlossenen Augen vor dem Spiegel stand, begann dieser Satz, sie zu berühren, sich von der bloßen Äußerlichkeit, der Abschiebung in die ästhetische Frigidität, nach innen zu bewegen. Und während ihre Hände die Haut entlangstrichen, der sie sich bisher so fern gefühlt hatte, die Wärme aufnehmend und die Beschaffenheit, war sie bei sich, ohne ein Dazwischen, ohne etwas Vorgefasstes oder Vorgegebenes. Einfach eine Berührung, die nichts weiter sein wollte, als eine Berührung, die entdeckte und wahrnahm und das Entdeckte für wahr nahm. Annahm. Vielleicht auch. Doch so weit war sie noch nicht. Weit davon entfernt, behaupten zu wollen, sie begriffe, war sie im Be-greifen dem Sein schon ein Stück näher gerückt, auch der Begrifflichkeit und der im Begriff immer kastrierten Wirklichkeit. Doch was war schon Wirklichkeit? Jetzt war es ihr Hier-sein und Herantasten. Eine Art der Verbindung herzustellen, die sich als Ursprünglichkeit verstand, ohne um ein Verstehen ringen zu müssen, weil es dieses erst gar nicht einforderte.
Das unbekannte Land, das sie betreten hatte, durch eine neu entdeckte Türe, war ihr mit einem Mal zugänglich. Jetzt. Hier. Weich und warm fühlte es sich an. Hügel und Täler. Dazwischen Dellen und Narben. Verwundungen, die sie trug, die das Leben geschlagen hatte, wie man so schön sagt. Es amüsierte sie, dieses, „Wie man so schön sagt“. Sie war noch weit davon entfernt, sich dieser allgemeinen Aussagen zu entledigen, aber sie sah sie bereits weitaus entspannter. Sie wollte gnädig sein und großmütig, auch sich selbst gegenüber.
Die Geduld, die sie mit aller Selbstverständlichkeit anderen angedeihen ließ, hatte sie sich ebenso verdient. Immer hatte sich ihr Denken um die anderen gedreht. Jetzt ging es, ganz ausnahmsweise, ausschließlich um sie selbst.
Sodass das Spüren echt war. Authentisch. Sodass sie die Augen wieder öffnete. Ihr Blick fiel auf den Körper, den der Spiegel wiedergab, ihren Körper, den sie sah, wie sie ihn schon lange nicht mehr gesehen hatte. Vielleicht noch nie. Sie fragte nicht, ob die Proportionen stimmten, die Brüste zu klein oder zu groß, die Hüften zu schmal oder zu breit seien, sondern nur, ob sie eine Verbindung fand.
Ihr Körper, der ihr zu Hause, der ihr Ausdruck und tonlose Stimme war und der sie trug.
Und wiederum war es eine Türe, die sich öffnete. Diesmal zu ihr selbst, in sie und was sie sah, war sie selbst, nicht einfach nur ein abtrennbarer Teil, der eben auch da war, sondern tatsächlich sie selbst. Es war ihr, als hätte sie eine Verbundenheit wiedergefunden, die sie schon lange verloren hatte. Wenn sie sie denn je gehabt hatte. Es war an ihr, Wert zu legen auf die Verwobenheit von Geist und Körper.
Möglicherweise auch Seele. Wenn man daran glauben mag. Oder ein Anhängsel der Zirbeldrüse.
Wie man früher annahm. Oder einfach das Lebenselixier. Immer wieder wanderte ihr Blick vom Hals bis zu den Zehen und wieder zurück. Von allen Seiten, sich drehend, auch zu spüren, nicht nur zu sehen, in der Bewegung sich neu entdecken. Das lange schwarze Haar, das ihr bis zur Hüfte reichte, umgab sie wie ein Vorhang.
Spielerisch legte sie es um ihre Brüste. Zu verstecken. Zu entblößen.
„Das Haar einer Frau ist ihre schönste Zier“, ging es Zoe durch den Kopf. Sie bildete sich ein, das irgendwo einmal gelesen zu haben. Es kommt nicht von ungefähr, dass es auch in unseren Breiten lange Zeit als unschicklich galt, zumindest für Frauen, das Haar offen zu tragen. Mehr noch, sie mussten es verstecken. Nonnen tun es, um ihre Weiblichkeit einzupacken. Musliminnen werden dazu gezwungen, um die Triebe der Männer nicht anzustacheln. Was für ein Armutszeugnis für die Männer, wenn sie jemand anderen zwingen, sich zu verhüllen, um ihre eigene Triebhaftigkeit unter Kontrolle zu bringen. Nur bei den Kelten, bei den Germanen, da trugen Frauen wie Männer ihr Haar lang und offen. Und kämpften Seite an Seite. Aber das ist lange her. Und nun ist es nur mehr ein Zeichen der Verführungskünste der Frau, Symbol der Weiblichkeit. Allerdings einer stillen, biegsamen, passiven Weiblichkeit. Sie ist da, umgibt sich mit ihrem Haar und lässt sich ansehen.
Und erobern. Mehr noch, sie sieht ruhig zu, wenn um sie gekämpft wird. Helena saß da und ließ Troja in Schutt und Asche legen. Kein Gedanke an all die Toten, Verwundeten und Heimatlosen.
Doch Zoe wollte weder taten- noch weniger gedankenlos sein. Aber wie konnte sie das, so lange sie diese zweifelhafte Zier mit sich herumtrug?
Entschlossen holte Zoe die Schere aus der Lade und schnitt die Haare ab. Das erste Büschel, das sie in Händen hielt, betrachtete sie noch kurz, bevor sie es achtlos fallen ließ. Eines ums andere gesellte sich dazu. „A woman who cuts her hair is about to change her life“, soll Coco Chanel dereinst gesagt haben, und sie hatte recht. Zoe änderte alles, und dazu gehörte auch ihre Wirkung nach außen. Sie wollte nicht mehr wie ein kleines, passives, liebliches, nettes, freundliches Frauchen wirken, sondern wie ein Mensch. Einfach nur ein Mensch.
So sollten sie die Leute sehen. Geschlechtslos, zumindest in der Begegnung. Vorurteilsfrei, wie sie meinte. Die Begegnung wäre eine andere, würde sie nicht sofort in eine Schublade gesperrt werden.
So jedenfalls stellte sich Zoe das in ihrer Naivität vor. Zuletzt griff sie noch zum Rasierer, und als sie endlich mit der Hand über die drei Millimeter langen Stoppeln strich, die nun ihren Kopf zierten, da fühlte sie tatsächlich eine Art von Befreiung, eine Rückkehr zu einer paradiesischen Unschuld.
Bei genauerer Betrachtung entdeckte sie zwischen den dunklen, auch graue Haare. Sie beschloss, diese ab jetzt so zu lassen wie sie waren. Alles an ihr sollte echt und unverfälscht sein. Sie wollte sich nicht länger verstecken, weder hinter dem falschen Bild einer Weiblichkeit, die nicht die ihre war, noch hinter einer Maske aus Kosmetika. Neben den Haaren warf Zoe Make-up, Rouge, Lippenstift, Nagellack, Wimperntusche, Eyeliner und was sie sonst noch alles fand, in den nächsten großen Sack, bereit entsorgt zu werden.
Da wanderte ihr Blick abermals zum Spiegel. Was sie sah, das war sie selbst. So wie sie war, ohne Putz und Tand, ohne Verjüngungs- und Vertuschungsmaske, einfach nur sie selbst. Und sie merkte, dass sie sich genau so sehen und gesehen werden wollte. Das war das Bild ihrer Selbst, das nach Außen wirken sollte. Es war ein erstes Selektionskriterium, denn entweder nahm man sie so, wie sie war, oder man ließ es. Und wer sollte um die Kraft von Bildern besser Bescheid wissen, als eine Künstlerin wie sie. Zuletzt wusch sie sich noch den Staub und die Verkrustungen des Tages, vielleicht sogar eines halben Lebens, vom Körper.
Getragen von diesem neuen Körpergefühl, einem veränderten Bewusstsein ihrer Selbst, ging sie beschwingt durch ihr Atelier. Unvermittelt hielt sie inne. Auf ihrer Staffelei befand sich eine leere Leinwand, eine leere, jungfräuliche Leinwand.
Einige Momente stand Zoe nur da und sah die Leinwand an, die war wie ihr Leben, frisch, jung und unberührt, ihr neues Leben. Doch es gab auch dieses alte, an das sie nun nicht dachte, aber von dem sie spürte, dass es da war, und versuchte sich wieder an die Oberfläche zu kämpfen, ihr Unsicherheit suggerieren wollte.
„Es war doch alles so gut“, flüsterte es Zoe ein, „Gut, weil es ruhig war und alles geregelt. Nicht so unsicher, ungewiss wie jetzt. Du hast keinen Job und niemanden, an dem Du Dich festhalten kannst.“ Beinahe höhnisch klang diese Stimme.
„Willst Du das wegschmeißen? Willst Du es herausschneiden?“, fuhr sie drohend fort.
Und endlich hatte Zoe eine Antwort, angesichts der leeren, jungfräulichen Leinwand und der drohenden Stimme. Ja, sie wollte das Bisher durchtrennen, abschneiden, sodass sie den Pinsel in die Hand nahm, ihn in die rote Farbe tauchte und, beginnend in der linken oberen Ecke, einen roten Strich setzte, zunächst breit, sich jedoch gegen die rechte untere Ecke immer mehr verjüngend, sodass er diese nicht mehr erreichte.
Es blieb durchlässig. Irgendwann würde sie es integrieren, irgendwann akzeptieren, dass es war.
Im selben Rot schrieb sie „ZA“, ihre Signatur, ihre neue.
„Zoe Artist“, legte sie sich als Bedeutung dieser Abbreviation zurecht. Von Z bis A, statt von A bis Z, wie es üblich ist, denn sie hatte beschlossen, dass in ihrem Leben nichts mehr üblich sein würde. Bis jetzt hatte sie peinlichst alle Konventionen und Vorgaben eingehalten. Nun war es nicht mehr notwendig. Eine Erkenntnis, die in ihrem Kopf zwar bereits präsent war, aber doch noch ein Schattendasein führte. Es würde eine Weile dauern, bis sie diese gänzlich begriffen haben würde, und nicht nur begriff, sondern auch umsetzte. Dafür forderte sie Geduld ein, Geduld mit sich selbst, was ihr alles andere als leichtfiel.
Zuletzt trat sie einen Schritt zurück, das Gemälde in seiner Gesamtheit zu betrachten. Sie wusch den Pinsel sorgfältig aus, legte ihn zu den anderen, fotografierte die ins Bild gesetzte Erkenntnis, bevor sie weiter ins Schlafzimmer ging und zufrieden unter die Decke schlüpfte. Das letzte, was ihr ihre Erinnerung zeigte, bevor sie in das unendliche Reich der Träume entwischte, war ein Paar Augen, sanfte, graue Augen, in denen sie diese Besorgnis fand.
03. Keine halben Sachen
Zoe saß in ihrem Lieblingscafé und genoss die Strahlen einer immer stärker werdenden Frühlingssonne. Mit jedem Tag konnte man intensiver spüren, wie ihre wärmespendenden Kräfte zunahmen. Es war wie ein Wink des Schicksals, dass der Beginn ihres neuen Lebens in die Jahreszeit des Erwachens und Erblühens fiel, wobei sie die Redewendung vom „Wink des Schicksals“ sehr gerne im Munde führte, sie diese ansonsten nicht weiters ernst nahm, denn wenn ihr Leben erwachte und erblühte, so nicht, weil sie sich hinsetzte und wartete, bis die Sterne richtig standen oder die Jahreszeit dem Projekt entsprach, sondern weil sie daran arbeitete und das ihre dazu beitrug. Natürlich kamen auch immer wieder Dinge zum Tragen, die man landläufig als Zufall oder Glück bezeichnete, doch was war das letztlich anderes, als ein Ausdruck dafür, dass wir viel zu wenig Einblick haben in die Auswirkungen, die unsere Taten und Worte nach sich ziehen. Wie die Wellen auf dem Wasser breiten sie sich aus, und Zoe wollte diejenige sein, die den Stein warf, um die stille Oberfläche in Bewegung zu setzen. Nicht länger Opfer, sondern Täterin, auch ihres eigenen Lebens sein.
„Hallo Süße“, riss sie eine wohlbekannte Stimme aus ihren Gedanken, „Du siehst verdammt gut aus.
Fast nicht wiederzuerkennen oder eigentlich endlich zu erkennen.“ Celinas Kommentar war ebenso ehrlich wie treffend. Seit Zoe Celina kannte, und das war immerhin seit dem Kindergarten, zeichnete sich ihre Freundin dadurch aus, dass sie nicht nur mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hielt, sie fasste sie darüber hinaus auch kurz, prägnant und knackig zusammen.
„Formschön“ würde sie es nennen, oder „ästhetisch“. Natürlich gab es viele Menschen, die damit nicht zurechtkamen. Das hatte Celina aber noch nie gestört. Ihre Mutter hatte in den in der Frauenrechtsbewegung mitgekämpft und sich nie irgendwelchen Konventionen unterworfen. Celina war von Anfang an dabei gewesen. Diese Erfahrungen waren nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Kraft, Mut und Entschlossenheit zeichneten sie aus. Dementsprechend hatte ihre Freundschaft auch viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Jedes Mal, wenn Zoe sich verliebte, zog sie sich zurück. Celina nahm es gelassen hin und blieb entspannt.