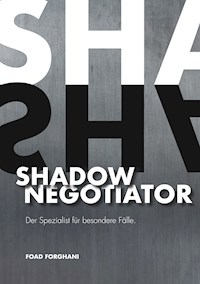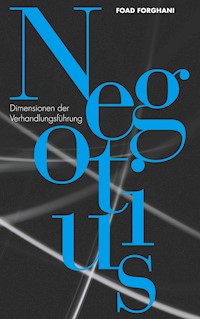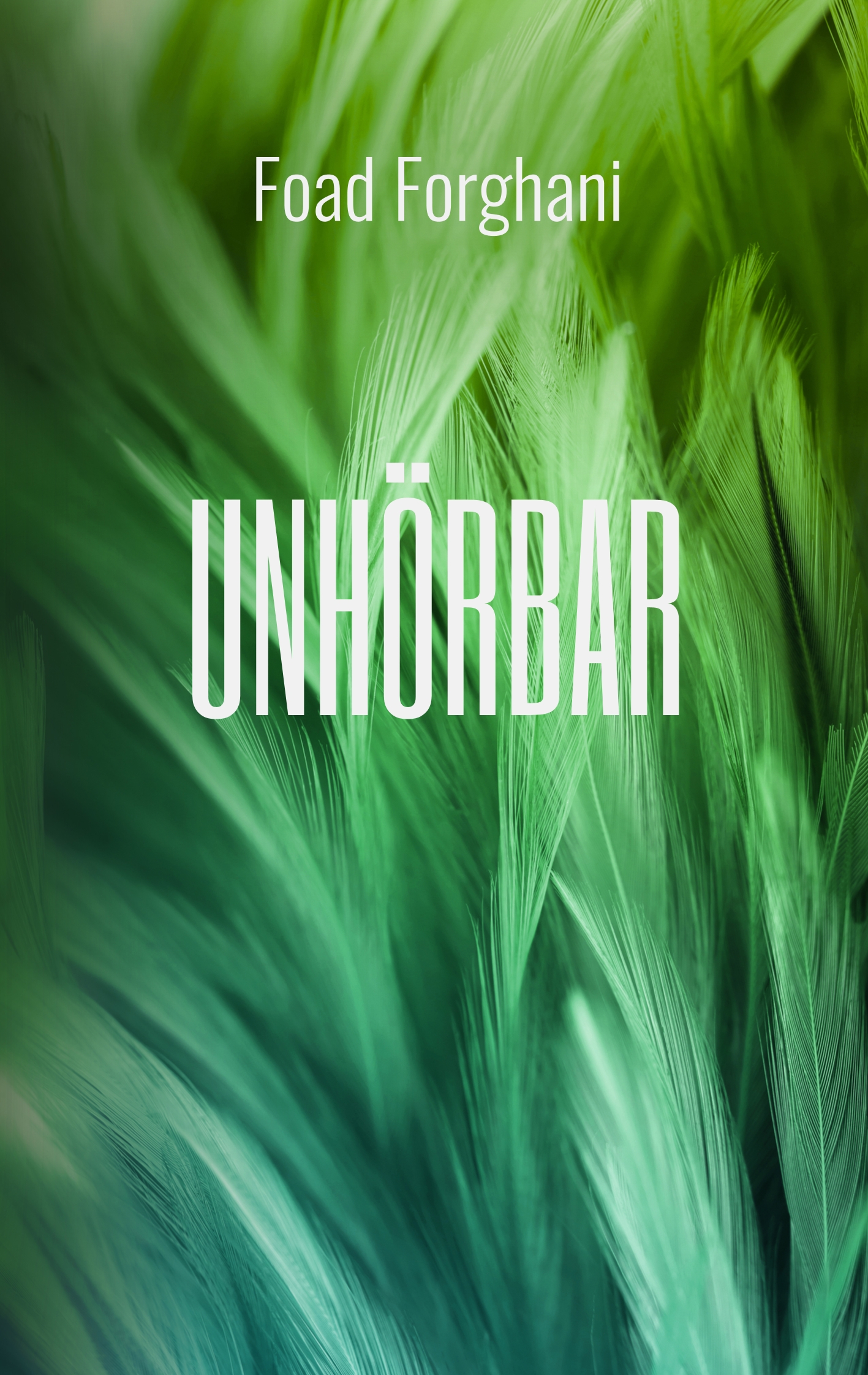Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Verhandeln heißt leben, denn jeder von uns verhandelt jeden Tag. Ob im Business, im privaten Umfeld oder im stillen Dialog mit uns selbst: Wer die Mechanismen der Verhandlung versteht, gewinnt Klarheit, Stärke und Einfluss. Dieses Buch zeigt anhand zahlreicher Beispiele aus Wirtschaft und Alltag, wie Sie psychologische Dynamiken erkennen, Strategien entwickeln und Techniken gezielt einsetzen, um jede Verhandlung souverän zu gestalten. Es ist weit mehr als ein Ratgeber. Dieses Werk ist ein Leitfaden, um Ihre Interessen klar zu vertreten, Beziehungen konstruktiv zu formen und in allen Lebensbereichen überzeugend aufzutreten. Der Autor arbeitet als Verhandlungsberater, weithin bekannt als Shadow Negotiator. Sein Wissen ist nicht aus Lehrbüchern entstanden, sondern aus echten Verhandlungen, oft in extremen Situationen. Damit eröffnet er seltene Einblicke in die verborgenen Kräfte, die unter der Oberfläche wirken und den Ausgang von Gesprächen und Entscheidungen maßgeblich bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Pakt zwischen Faust und Mephistopheles
Alles im Leben ist eine Verhandlung
Verhandeln mit sich selbst
Die wichtigste Fähigkeit beim Verhandeln
Setzen Sie sich durch!
Das Motiv des Verhandlungspartners
Strategisch und taktisch richtig agieren
Macht
Die Aufstellung auf dem Schachbrett
Preis- und Positionskämpfe
Die Gesprächsführung
Umgang mit der Angst
Komplexe Verhandlungssituationen
Nachwort
Unser Wachstum hängt davon ab, wie viel Wahrheit wir bereit sind, über uns selbst zu akzeptieren.
- Foad Forghani
Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird im Buch meist nur eine Geschlechtsform verwendet. Gemeint sind selbstverständlich gleichermaßen Frauen wie Männer.
Der Pakt zwischen Faust und Mephistopheles
Faust, unzufrieden mit seinem irdischen Dasein, sucht nach tieferer Bedeutung und Erfüllung und will das Leben in all seinen Facetten erfahren. Aus seiner Verzweiflung heraus ruft er den Teufel, woraufhin Mephisto als dessen Verkörperung erscheint. Mephisto verspricht, alle Wünsche Fausts auf Erden zu erfüllen und ihm die weltlichen Freuden und Erfahrungen zu bieten, die ihm bisher verwehrt waren. Sollte Faust jedoch einen Moment als so vollkommen empfinden, dass er ihn festhalten möchte, muss er den Satz „Verweile doch, du bist so schön!“ aussprechen. Laut dem Pakt würde dies bedeuten, dass Mephisto seine Verpflichtungen erfüllt hat und Fausts Seele von diesem Moment an ihm gehört. Faust stimmt zu, und die Vereinbarung wird durch einen Blutsvertrag besiegelt.
Schließlich äußert Faust in einem Moment tiefster Zufriedenheit den Satz: „Verweile doch, du bist so schön!“
Nach dem Pakt mit Mephisto müsste dies bedeuten, dass seine Seele verloren ist. Doch durch göttliche Gnade wird er gerettet, und zwar aufgrund eines Vorhabens, das dem Allgemeinwohl dienen soll.
Diese Rettung lässt sich nur verstehen, wenn man Fausts innere Wandlung im Verlauf des Werkes betrachtet. Zu Beginn ist er ein unzufriedener Gelehrter, getrieben von tiefer innerer Leere und der Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung. Im Laufe der Handlung jedoch wandelt sich sein Streben: Aus selbstbezogenen Wünschen entsteht der Wille, für die Allgemeinheit tätig zu sein. Diese edle Ausrichtung wird von den göttlichen Mächten anerkannt und führt schließlich zu seiner Erlösung.
Der Pakt zwischen Faust und Mephisto entsteht aus einer Verhandlung, in der Faust weltlicher Zufriedenheit und Erfüllung einen ebenso hohen, wenn nicht sogar höheren Wert beimisst als seiner eigenen Seele. Überzeugt von der Richtigkeit seiner Einschätzung und im Glauben, dass Mephisto ihn nie in den Zustand der völligen Zufriedenheit und Erfüllung versetzen könne, tritt Faust mit einem gewissen Hochmut in die Verhandlung ein. Mephisto hingegen nutzt geschickt Fausts Fehleinschätzungen und Übermut aus, um ihn in die Falle zu locken, sodass Faust dem nachteiligen Pakt zustimmt.
Am Ende triumphiert Faust dennoch, obwohl sich die äußeren Umstände nicht geändert haben. Was sich verändert hat, ist jedoch das, was in Faust selbst geschah – die Veränderung seiner Absicht. Diese Wandlung ließ alles in neuem Licht erscheinen und ermöglichte es Faust, als Sieger aus dieser Verhandlung hervorzugehen.
Alles im Leben ist eine Verhandlung
Unser ganzes Leben besteht aus Verhandlungen, aus Momenten, in denen wir etwas von anderen wollen. Dieses ‚Etwas‘ kann die Aufmerksamkeit eines Lebenspartners, die Zustimmung eines Kindes zum frühen Zubettgehen oder eine Gehaltserhöhung im Beruf sein. Es kann die Zusage eines Geschäftspartners für einen Deal betreffen, die Zustimmung eines Verkäufers auf dem Flohmarkt für den Preis, den wir bereit sind, für eine begehrte Vase zu zahlen, oder die Einwilligung von Geiselnehmern, die Geiseln für einen angebotenen Gegenwert freizulassen.
Während wir uns in einigen Verhandlungen, wie etwa dem frühen Zubettgehen eines Kindes, oft ohne ein Gegenangebot durchsetzen wollen, basieren die meisten Verhandlungen auf dem Prinzip des gleichwertigen Ausgleichs. In diesen Fällen streben wir danach, unterschiedliche Ressourcen von vergleichbarem Wert auszutauschen. Ein wesentlicher Punkt der Verhandlungsführung liegt somit darin, welchen Wert wir einer Ressource beimessen und ob der Verhandlungspartner diesen Wert anerkennt und ebenfalls als angemessen betrachtet.
Es versteht sich von selbst, dass wir niemals exakt dieselben Ressourcen gegeneinander austauschen, da nur der empfundene Mangel an einer Ressource den Wunsch auslöst, diese zu erhalten. Gelegentlich scheint es jedoch, als ob wir dies tun, zum Beispiel wenn wir unserem Lebenspartner Aufmerksamkeit schenken, um im Gegenzug selbst Aufmerksamkeit zu erhalten. Auch in diesem Fall tauschen wir allerdings nicht dieselben Ressourcen aus, da es nicht um die Aufmerksamkeit selbst geht, sondern um die Aufmerksamkeit des anderen, die sich von der eigenen Aufmerksamkeit unterscheidet.
In der Wirtschaft besteht das Dilemma des Austauschs identischer Ressourcen nicht. Hier lautet die Devise: Geld gegen Ware.
Der Wert der verschiedenen Ressourcen für beide Verhandlungspartner ist somit ein zentraler Punkt jeder Verhandlung. Dieser Wert hängt einerseits vom Motiv der anfragenden Person ab, andererseits von den Alternativen des Anbieters, also der Gesamtheit potenzieller Käufer, die wir im wirtschaftlichen Kontext als Markt bezeichnen.
Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein altes T-Shirt verkaufen, das Sie nicht mehr tragen. Sie stellen das T-Shirt in einem Online-Shop ein und geben einen Preis von 210.000 Euro an. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Käufer findet ist gering. Wenn Sie jedoch in der Beschreibung angeben, dass dieses T-Shirt einst Michael Jackson gehörte, erhöht sich Ihre Chance, das Produkt für diesen Preis zu verkaufen – vorausgesetzt, die Information ist zutreffend. So geschehen im Jahr 2019: Ein T-Shirt, das der Popsänger Michael Jackson bei seinem legendären „Bad-Konzert“ trug, wurde bei einer Auktion für 225.000 Dollar versteigert, was etwa 209.250 Euro entspricht.
Dennoch würden Sie wahrscheinlich keine 210.000 Euro für ein Michael-Jackson-T-Shirt bezahlen, selbst wenn Sie das nötige Kleingeld dafür hätten. Es sei denn, Sie sind ein eingefleischter Fan oder ein Sammler seltener Erinnerungsstücke – oder beides. Wenn Sie jedoch 210.000 Euro für eindeutig zu viel halten und versuchen, dem Verkäufer einen deutlich niedrigeren Preis vorzuschlagen, wird er nicht darauf eingehen, da er andere Interessenten und damit Alternativen hat, die bereit sind, den höheren Preis zu zahlen.
Diese Dynamik gilt für alle Verhandlungen unabhängig davon, ob es um den Preis einer Ware, der Aufmerksamkeit des Partners oder der Zustimmung einer attraktiven Person zu einem gemeinsamen Drink, geht. Die Wertigkeit einer Ressource hängt einerseits von Art und Intensität des Motivs der anfragenden Person ab und andererseits von den Alternativen, die das Gegenüber zur Verfügung hat. Wobei Alternativen immer potenzielle Interessenten sind, die auch eine Bewertung im Einklang mit ihren Motiven vornehmen.
Wir müssen somit die Motivation der Beteiligten in einer Verhandlung verstehen, denn nur so wird nachvollziehbar, welche Bedeutung und Wertigkeit das Verhandlungsobjekt für sie hat.
Kauft eine Person ein Kleidungsstück, um dieses bei einer anstehenden Feier zu tragen oder ist kein konkreter Bedarf vorhanden und die Marke des Kleidungsstücks gibt dem Käufer ein Gefühl von Erhabenheit? Beauftragt ein Unternehmen Prozessberatung, da man die internen Prozesse verbessern möchte oder ist die Prozessberatung ein Vorwand, um Abteilungen zu schließen? Buhlt jemand um die Gunst des Lebenspartners, um Macht über den anderen zu gewinnen und sich dadurch Vorteile zu verschaffen oder ist es die Verlustangst, die die Person treibt?
All diese Momente der Interaktion sind durch eine Grundstruktur geprägt: Jemand möchte etwas von einem anderen, und der Wert des Verhandlungsobjekts hängt von den Motiven des Anfragenden ab. Er entsteht somit durch die Interaktion.
Den Wert einer Ressource zu verstehen, deren Wahrnehmung zu beeinflussen und einen passenden Gegenwert anzubieten – all das sind Teilbereiche der Verhandlungsführung. Sie sind aber auch Teilbereiche des Lebens. Denn diese Prozesse sind unvermeidbar, wenn wir etwas im Leben wollen, egal was! Damit ist das Verhandeln ein Grundelement des menschlichen Zusammenlebens und fundamental für den Erfolg im Leben. Denn Erfolg bedeutet, zu bekommen, was man will, und das geht nur mit anderen Menschen, indem wir mit ihnen verhandeln.
Verhandeln mit sich selbst
Jeder von uns identifiziert sich mit seinem bewussten Anteil, seinem Bewusstsein. Wir glauben, das bin ich – der Teil, der alles bewusst wahrnimmt, Informationen verarbeitet, denkt, abwägt und Entscheidungen trifft. Dennoch stammen 95 % unserer Entscheidungen aus dem Unterbewusstsein. Das ist eine enorm hohe Zahl. Im Kern sind wir also unser Unterbewusstsein. Der bewusste Teil in uns hat einen weitaus geringeren Einfluss auf unsere Entscheidungen und damit auf unser Leben. Wenn überhaupt, kann sich der Einfluss unseres Bewusstseins eher mittel- und langfristig auf unsere Entscheidungen auswirken, da es Zeit benötigt, um Kenntnisse und Informationen an das Unterbewusstsein weiterzugeben.
Wir lesen ein Buch, beispielsweise über Verhandlungsführung, und erwarten, dass wir entsprechend dem neu gewonnenen Wissen handeln. Dennoch wissen wir, dass das oft nicht der Fall ist. Häufig entscheiden wir nach unseren alten Mustern und wiederholen die gleichen Fehler. Obwohl das neue Wissen im Bewusstsein vorhanden ist. Doch Entscheidungen werden aus dem Unterbewusstsein heraus getroffen.
Solange bewusst aufgenommene Informationen nicht direkt vom Bewusstsein an das Unterbewusstsein weitergegeben und dort verankert werden, ist es notwendig, zwischen diesen Instanzen und ihrem Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung zu unterscheiden. In diesem Zusammenhang macht es auch keinen Sinn, sich ausschließlich mit dem bewussten Teil des eigenen Selbst zu identifizieren. Das wäre ein Verkennen der Gesamtheit, die uns ausmacht.
Wir sind somit die Summe all dessen, was in uns lebt und agiert. Im Grunde fungiert unser Bewusstsein als Beobachter und Verhandler, der ständig mit dem Unterbewusstsein verhandelt, eine Verhandlung, bei der das Unterbewusstsein in der Regel die Oberhand gewinnt.
Das Unterbewusstsein trifft eine Entscheidung und übergibt die Instruktion zur Umsetzung an das Bewusstsein. Dieses prüft die Entscheidung anhand von Normen und Grundsätzen, wägt ihre Vereinbarkeit ab und gibt sie entweder zur Umsetzung frei oder verweigert sie. Oft jedoch, insbesondere wenn die Gefahr besteht, dass das Bewusstsein keine Freigabe erteilt oder bereits eine Ablehnung ausgesprochen hat, wird die Instruktion getarnt. Wenn beispielsweise Neid das Motiv für die Entscheidung ist, das Bewusstsein dies aber ablehnt, wird der Neid als Fürsorge maskiert und an das Bewusstsein weitergegeben. In der Regel durchschaut das Bewusstsein die Maskierung nicht und glaubt, aus Fürsorge zu handeln, obwohl der wahre Grund Neid war.
So setzt sich das Unterbewusstsein mal verdeckt, mal mit offenen Karten durch, eben in etwa 95 % der Fälle, wobei die wahren Motive, wie bereits beschrieben, meist verborgen bleiben.
Unsere Gedanken und damit auch das, was wir für den Grund unserer Entscheidungen halten, sind selten der tatsächliche Antrieb dahinter. Vielmehr dienen sie dazu, ein unliebsames Motiv zu rationalisieren und zu tarnen, um die Zustimmung des Bewusstseins zu erhalten. So glauben wir, stets bewusst gehandelt zu haben, obwohl unsere Entscheidungen in den meisten Fällen auf unbewussten Beweggründen basieren.
Die Beziehung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ist folglich ein zentraler Knotenpunkt, wenn es darum geht, Einfluss auf die inneren Entscheidungsfindungsprozesse zu gewinnen und die innere Verhandlung mit sich selbst gut zu führen. Einerseits geht es darum, die Motive und Beweggründe, die das Unterbewusstsein an das Bewusstsein weiterleitet, zu durchschauen. Andererseits stellt sich die Frage, wie diese Beweggründe, Glaubenssätze und Konfliktlösungsmuster im Unterbewusstsein verankert wurden und wie sie geändert werden können.
Das Unterbewusstsein ist wie ein Aufnahmegerät, ein Recorder! Es nimmt auf, was sich wiederholt. Es nimmt auf, was mit Gefühlen und Emotionen assoziiert wird. Je stärker das Gefühl, desto stärker die Assoziation. Es nimmt auf, was mit Ängsten verbunden ist und somit entsprechende Emotionen erzeugt, oder was mit Interessenfeldern verknüpft ist, die ein gutes Gefühl erzeugen.
Im Kern wird das Unterbewusstsein in den ersten Lebensjahren „programmiert“. Häufig ist von der Phase bis zum sechsten oder siebten Lebensjahr die Rede. Zwar kann das Unterbewusstsein auch in späteren Jahren programmiert und umprogrammiert werden, doch die grundlegenden Charakterzüge lassen sich dann nur schwer dauerhaft verändern.
Eine Möglichkeit, Wissen aus dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein zu übertragen oder bestehende Muster zu verändern, ist die Wiederholung. So lernen wir Autofahren: Schalten, Kuppeln, Schulterblick und alle weiteren Schritte üben wir so lange, bis das Unterbewusstsein übernimmt. Erst dann, wenn die Handlungskette unbewusst durchgeführt werden kann, erhalten wir den Führerschein. Das Bewusstsein wäre für die Durchführung dieser Handlungen im Straßenverkehr viel zu langsam.
Die Erkenntnis der (Um-)Programmierung des Unterbewusstseins durch Wiederholung wurde im Kontext des Aufsagens von positiven Glaubenssätzen bereits in unzähligen Büchern erwähnt und von vielen Menschen, oft vergeblich, ausprobiert. Der ausschlaggebende Punkt hierbei ist, dass das Unterbewusstsein zwischen Handlungen und Gedanken unterscheidet. Handlungen können durch Wiederholung verankert werden, Gedanken hingegen nicht! Einem Gedanken muss zusätzlich Leben eingehaucht werden, durch Gefühle und Emotionen. Ist das nicht der Fall, sind sie für das Unterbewusstsein Schall und Rauch, und jeder Versuch in dieser Richtung ist nichts anderes als vergebene Liebesmüh. Gelingt es, die Gedanken mit Gefühlen oder Emotionen zu assoziieren, sodass der Inhalt einer Aussage auch gespürt werden kann, hat der Gedanke eine Chance, durch Wiederholung an das Unterbewusstsein weitergegeben zu werden. Je stärker das Gefühl, desto weniger Wiederholungen sind notwendig.
An dieser Stelle sollten die Begriffe ‚Gefühl‘ und ‚Emotion‘ zuerst voneinander unterschieden werden, um die folgenden Erläuterungen besser nachvollziehbar zu machen.
Emotionen sind eher intensiv und von kurzfristiger Natur. Sie sind in Bewegung und oft die Reaktion auf einen Reiz oder ein Ereignis. Der Begriff ‚Motion‘, was Bewegung bedeutet, verdeutlicht das Wesen einer Emotion. Beispiele für Emotionen sind Wut, Ekel, Überraschung, Verachtung und Schrecken.
Gefühle hingegen haben eine Stetigkeit; sie sind nicht in Bewegung, sondern einfach präsent. Sie sind weniger intensiv und können länger anhalten. Beispiele für Gefühle sind Dankbarkeit, Zufriedenheit, Schuld, Einsamkeit und Hoffnung.
Ein Gefühl kann zugleich eine bewusste Wahrnehmung oder Interpretation einer Emotion sein. Wenn wir beispielsweise Angst verspüren, könnten wir diese Emotion als Gefühl der Nervosität, Unsicherheit oder Besorgnis interpretieren. Gefühle können also aus der Reflexion über die Emotion entstehen. Dies wiederum bedeutet, dass wir in der Lage sind gefühlsbasiert - nicht emotional - abzuwägen. Auch Sachverhalte können gefühlsbasiert abgewogen werden, und wir tun das auch oft, indem wir in Bezug auf Entscheidungen, die Sachverhalte betreffen, sagen, dass wir ein gutes oder schlechtes Gefühl haben.
All die erläuterten Aspekte in Bezug auf Bewusstsein und Unterbewusstsein sowie die Rolle von Gedanken, Gefühlen und Emotionen lassen uns das eigene Leben in einem ganz neuen Licht betrachten – ein Leben, das jeder von uns in bestimmten Bereichen verändern möchte. Das Leben zu ändern bedeutet, sich selbst zu ändern. Denn das Leben ist nur eine Projektion der Entscheidungen, die wir treffen. Sich selbst zu ändern bedeutet wiederum vor allem, das Unterbewusstsein zu verändern und die Entscheidungsfindungsprozesse, Glaubenssätze und Leitgedanken, die dort verankert sind, umzuprogrammieren.
Aus dieser Perspektive betrachtet wird es nachvollziehbar, warum gewisse Nachrichten in den Medien so häufig wiederholt und mit Bildern und Aufnahmen, die Emotionen wecken, untermauert werden. Es geht darum, das Unterbewusstsein zu erreichen. Wenn das Unterbewusstsein eines Menschen einmal erreicht und eine Information dort verankert wird, beginnt der Mensch fortan, an die Richtigkeit der verankerten Information zu glauben. Denn das Unterbewusstsein prüft nicht, ob eine Information richtig oder falsch ist, sondern nimmt sie gemäß den erläuterten Mechanismen einfach auf. Die Prüfung, ob eine Information richtig oder falsch ist, kann nur im Bewusstsein stattfinden. Geschieht dies nicht, ist das Unterbewusstsein schutzlos gegenüber der Außenwelt. Folglich wird die Person konditioniert, ohne dies zu merken.
Wenn wir müde von der Arbeit nach Hause kommen, in Gedanken versunken sind und nebenbei das Radio läuft, wenn wir uns zu Hause entspannen, während der Fernseher läuft, oder wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind und scrollend ein Bild nach dem anderen sowie einen Kurzfilm nach dem anderen konsumieren, sind das Momente, in denen unser Unterbewusstsein erreicht wird, selbst wenn unser Fokus nicht direkt auf das jeweilige Medium gerichtet ist. In solchen Momenten beschäftigen wir uns nicht prüfend mit jeder Information. Auch wenn wir uns dem Medium mit Interesse und Fokus widmen, überprüfen wir nicht immer jede Aussage und jedes Detail, insbesondere dann nicht, wenn wir emotionalisiert sind.
Die Verhandlung mit der Masse hat zwar ihren Ursprung lange vor unserer Zeit, doch sie basiert stets auf einem tiefen Verständnis der menschlichen Psyche und ihrer Entscheidungsfindungsmechanismen.
Wiederholungen, Gefühle und Emotionen sind somit wichtig, wenn es darum geht, den Zugang zum Unterbewusstsein zu ermöglichen. Damit wird Schmerz, insbesondere psychischer Schmerz, zu einem entscheidenden Aspekt, denn er löst Emotionen aus. Wer Schmerz meidet, verhindert einen wichtigen Lernprozess.
Um den Umgang mit Schmerzen zu verdeutlichen, können wir ein Verhandlungsbeispiel heranziehen. Nehmen wir eine Person, die ein Auto kaufen möchte. Sie hat sich fest vorgenommen, über den Preis zu verhandeln und einen Rabatt herauszuschlagen. Doch im Gespräch mit dem Verkäufer überkommt sie plötzlich die Verlustangst. Der Verkäufer erwähnte zuvor Lieferengpässe und betonte, dass das angebotene Auto das letzte Fahrzeug dieses Modells im Autohaus sei. Zudem fügte er hinzu, dass man auf Nachlieferungen mehrere Monate, vielleicht sogar bis zu einem Jahr warten müsse. Der Käufer verliert sein Ziel, den Preis zu verhandeln, aus den Augen. Stattdessen spürt er einen inneren Drang, das Auto sofort zu kaufen, aus Angst, mit leeren Händen davonzugehen.
Es kommt zum Abschluss. Das Auto wird ohne Preisnachlass gekauft.
Nach diesem Termin beschleicht den Käufer immer wieder ein Gefühl. Er muss ständig an die Interaktion mit dem Verkäufer denken und stellt sich gedanklich vor, wie er doch noch verhandelt und eine ordentliche Preisreduktion erzielt. Er glaubt, es handele sich lediglich um Gedankenspiele und versucht, diese zu stoppen. Tatsächlich geht es aber weniger um die Gedanken selbst, sondern vielmehr um das Gefühl dahinter. Dieses Gefühl entstand während der Interaktion mit dem Verkäufer, wurde jedoch verdrängt, da die Verlustangst für den Käufer dominanter war. Nun meldet sich das Gefühl zurück und möchte diesmal angenommen werden, nachdem es zuvor verdrängt wurde. Doch die Annahme dieses Gefühls ist für den Käufer schmerzhaft, da sie auch die Anerkennung der Niederlage in sich birgt, nämlich der Niederlage, keinen Preisnachlass erzielt zu haben. Um diesen Schmerz zu vermeiden, beginnt der Käufer, sich die Situation so auszumalen, dass er doch noch als Sieger hervorgeht und eine Preisreduktion erzielt.
Alternativ rationalisiert er die Niederlage, indem er sie mit Ausreden rechtfertigt, etwa: „Ich war an dem Tag sehr müde“, „Die paar Tausend machen keinen großen Unterschied“ oder „Die Lieferzeit war mir wichtiger“.
Wenn es um Rationalisierungen geht, sind Menschen äußerst einfallsreich. Die Liste möglicher Rechtfertigungen ist daher nahezu endlos.
Statt den Schmerz zu meiden, sollte der Käufer diesen einfach annehmen. Um das zu verdeutlichen, können wir eine Metapher verwenden: Wenn der Wind in großer Höhe weht, kämpft ein Adler nicht dagegen an. Stattdessen nutzt er den Wind, um nahezu regungslos in der Luft zu gleiten. Er lässt sich von den Aufwinden tragen und segelt ruhig, ohne große Anstrengung. Der Wind ist keine Bedrohung für ihn, sondern gibt ihm den Auftrieb, um lange Zeit in der Luft zu bleiben.
Seien Sie wie der Adler, wenn Sie mit Schmerzen konfrontiert werden. Nehmen Sie diese an, anstatt dagegen zu kämpfen. Das bedeutet, in solchen Momenten einfach präsent zu sein. Der empfundene Schmerz ist letztendlich ein unangenehmes Gefühl oder besteht aus unangenehmen Emotionen. Setzen Sie sich dem Schmerz aus. Sie sind da und der Schmerz ist da. Sie denken nicht, lenken sich nicht ab, sondern warten, bis der empfundene Schmerz von selbst vergeht. Manchmal dauert das nur 2–3 Minuten, manchmal ein paar Minuten länger, aber er verschwindet. Genauer gesagt: Er wird einverleibt und in Sie aufgenommen. Diesen Prozess sollten Sie nicht umgehen, denn andernfalls entgeht Ihnen die wertvolle Lernmöglichkeit, die Ihnen im Leben Auftrieb gibt. Der nicht angenommene Schmerz und die dahinterliegenden Gefühle und Emotionen haben uns etwas zu sagen. In ihnen steckt mehr Intelligenz als in bloßen Gedanken.
An diesem Punkt trennt sich die Spreu vom Weizen: Menschen mit psychologischer Leidensfähigkeit verfügen über das Durchhaltevermögen, sich dem Schmerz auszusetzen und daran zu wachsen. Ohne diese Fähigkeit wird der Schmerz hingegen vermieden, wodurch die gefühlsbasierte Intelligenz ungenutzt bleibt und die Person sich nicht entfalten kann, da der Schmerz umgangen wird.
Der Schmerz ist somit eine weitere Sprache, die das Unterbewusstsein spricht. Durch den Schmerz kann Veränderung stattfinden.
Lassen Sie uns betrachten, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, mehr bewussten Einfluss auf unsere Entscheidungen auszuüben.
Wenn wir die Rolle des Unterbewusstseins bei unseren Entscheidungen betrachten und erkennen, dass es einen Großteil unserer Entscheidungen trifft, kann ein Gefühl der Machtlosigkeit aufkommen. Unweigerlich stellt sich die Frage, wie wir unser Wissen im gegenwärtigen Moment nutzen können, um bewusstere Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, den größtmöglichen Einfluss auf unsere Entscheidungen auszuüben, den Anteil bewusster Entscheidungen zu steigern.
Der erste Schritt dazu ist die Langsamkeit. Langsamkeit im Denken und im Handeln. Mit Langsamkeit sind ein bis zwei Sekunden gemeint, also eine Sekunde langsamer agieren als gewöhnlich und diese Zeit nutzen, um zu erkennen, welche Gedanken und Gefühle uns bewegen. Langsamkeit bildet die Grundlage für Achtsamkeit. Sie ermöglicht es, viel achtsamer durch das Leben zu gehen, und Achtsamkeit ist notwendig für gezielten Veränderungen. Denn um etwas zu verändern, müssen wir zuerst den Status quo verstehen und ihn wahrnehmen. Dafür benötigen wir Achtsamkeit.
Das Ziel der Achtsamkeit besteht darin, Bewusstheit für die eigenen Entscheidungen zu entwickeln, die Motive dahinter zu erkennen, sie bei Bedarf zu hinterfragen und das Motiv zu wählen, das wir als richtig erachten. Achtsamkeit bezieht sich deshalb nicht nur auf die Gedanken, sondern auch auf die Gefühle und Emotionen.
Die Motive hinter einer Entscheidung zu erkennen und das richtige Motiv zu wählen, ist trotz aufmerksamen Beobachtens mehr als schwierig. Wenn jemand beispielsweise darüber nachdenkt, einigen Freunden von einem aktuellen Geschäftsvorhaben zu erzählen, um deren kritische Meinung dazu zu erfahren, die Erzählung jedoch unbewusst so gestaltet, dass die kritikwürdigen Aspekte nicht vorrangig erwähnt werden und die Freunde überwiegend mit positiven Aspekten konfrontiert werden, war das eigentliche Ziel des Erzählers die Anerkennung der Freunde und nicht deren Kritik. Der Erzähler denkt jedoch wirklich, dass er sich mit den Freunden abstimmen und deren Kritik erfahren wollte. Dieser Gedanke existierte tatsächlich in seinem Kopf, und er hatte sich dies auch bewusst vorgenommen. Doch im Moment des Agierens dominierte ein unbewusstes Motiv die bewusste Absicht. Dieses unbewusste Motiv war, die Anerkennung der Freunde zu sichern und sie nicht zu verlieren. Diese Triebkraft war mächtiger als die bewusste Absicht, die Freunde nach deren Kritik zu fragen, weshalb die Person, vor den Freunden sitzend, anders agierte, als sie ursprünglich vorhatte.
In diesem Fall beeinflussen die zeitlich versetzten Prozesse von Beabsichtigung und Ausführung ebenfalls die Diskrepanz zwischen der ursprünglichen Absicht und der tatsächlichen Motivation.
Ein weiteres Beispiel zur Verdeutlichung der erläuterten Dynamik: Eine Gruppe von Personen plant, den Universitätsabschluss eines Freundes zu feiern. Die Hauptperson, die ihren Abschluss gemacht hat, schlägt eine Bar vor. Auf dem Weg dorthin meldet sich jedoch plötzlich einer der Freunde und meint, die Bar sei nicht gut besucht, weshalb er eine andere Location vorschlägt. Die Hauptperson ist eigentlich gegen einen Wechsel, doch als sie etwas sagen möchte, schießt ihr der Gedanke durch den Kopf: „Ist doch egal, wir wollen einfach nur zusammen sein.“ Deshalb sagt sie nichts und stimmt damit dem Wechsel zu.
Am Abend, als sie zu Hause ist, denkt sie über die Situation nach. Der Grund, warum sie den Drang verspürt, nachzudenken, die treibende Kraft, ist ein Gefühl. Das Gefühl, das zuvor durch den Gedanken „Ist doch egal, wir wollen einfach nur zusammen sein“ verdrängt wurde, möchte nun verstanden und angenommen werden, weshalb es wieder emporsteigt.
Wichtig ist, dass die Motive hinter dem Gedanken „Ist doch egal, wir wollen einfach nur zusammen sein“ und dem verdrängten Gefühl unterschiedlich sind. Das Motiv des Gedankens ist, den Gruppenfrieden zu bewahren, wofür das individuelle Interesse, nämlich die Präferenz für eine Location, unterdrückt wird.
Warum schoss aber der Gedanke „Ist doch egal, wir wollen einfach nur zusammen sein“ der Hauptperson durch den Kopf?
Im Moment der Interaktion, als der Freund sich für eine andere Location aussprach und die Hauptperson darauf reagieren wollte, entstand innerhalb von Millisekunden eine Emotion in ihr. Diese basierte auf der unbewussten Annahme, dass die Gruppenmitglieder eine Widerrede und das anschließende Tauziehen um die Location als negativ empfinden würden. Damit verbanden sich eine Empfindung von Scham mit der Sorge, die Beziehung zu den Gruppenmitgliedern zu belasten und von ihnen nicht mehr gemocht zu werden. Der Gedanke „Ist doch egal, wir wollen einfach