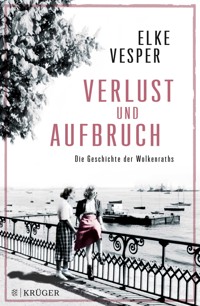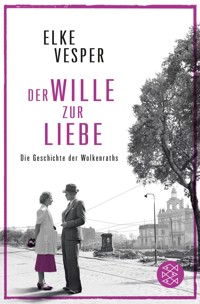
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geschichte der Wolkenraths
- Sprache: Deutsch
Von der Liebe in Zeiten des Krieges - der vierte Teil der großen Saga um die Hamburger Familie Wolkenrath "Von jetzt an kommt es nur noch darauf an, dass ihr diesen Staat überlebt." Diesen Satz gibt die über hundertjährige Tante ihren Nichten Lysbeth und Stella mit auf den Weg, bevor sie im Oktober 1941 stirbt. Bruder Eckhardt und seine Frau Cynthia sind überzeugte Nazis, Stellas Mann Jonny ist als Kapitän im Kriegseinsatz während sie versucht, trotz heftigster Bombenangriffe durch die Engländer die Gefühle für ihre große Liebe, den englischen Schriftsteller Anthony zu bewahren. Bruder Dritter nutzt geschickt die Möglichkeiten, die der Krieg für findige Geschäftsleute bereithält. Aaron, Lysbeths Mann, ist Jude, und sie setzt alles daran, ihn vor der Deportation zu bewahren - unterstützt von ihren Geschwistern. Wird der Zusammenhalt der Familie Wolkenrath stark genug sein, unbeschadet durch diese schwierigen Zeiten zu kommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1314
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Elke Vesper
Der Wille zur Liebe
Roman
Impressum
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Paar: GEORGE MARKS / gettyimages. Stadt: akg images
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402814-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Widmung
Handelnde Personen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Leseprobe
1. Kapitel
Das erste Mal in meinem Leben erfahre ich die Wahrheit dessen, was so viele Denker als der Weisheit letzten Schluss aus ihrem Leben herausgestellt und was so viele Dichter besungen haben: die Wahrheit, dass Liebe irgendwie das Letzte und das Höchste ist, zu dem sich menschliches Dasein aufzuschwingen vermag. Ich erfasse jetzt den Sinn des Letzten und Äußersten, was menschliches Dichten und Denken und – Glauben auszusagen hat: die Erlösung durch die Liebe und in der Liebe!
Viktor E. Frankl: … trotzdem Ja zum Leben sagen
Dieses Buch widme ich meiner Mutter, Henrika Jacobsen, mit tiefem Dank für ihre Liebe. Sie war für mich eine wichtige Zeitzeugin der Jahre, über die ich hier schreibe. Aber sie ist viel mehr als das. Sie zeigt mir, wie eine Frau altern kann: mit Humor, Geist, Schönheit und einem Herzen voller Wärme.
Und ich widme es meinen Enkelinnen Mira Eliana Vesper und Sophie Eileen Bruckner mit Dank dafür, dass es sie gibt. Sie sind noch so neu auf der Welt, aber irgendwann in der Zukunft werden sie vielleicht dieses Buch lesen und etwas über die Zeit erfahren, in der ihre Urgroßmutter lebte.
1
Der alte Leichenwagen wurde von zwei kriegsuntauglichen, ausgemergelten Gäulen gezogen. Sie stemmten sich schwer ins Geschirr, die Last wog doppelt so viel wie sonst, denn im Wagen lagen gleich zwei Särge. Der Totenprunk der Wagen zog die Aufmerksamkeit einiger Schaulustiger auf sich. So aufwendiges Gewese um den Tod war seit mindestens zwanzig Jahren aus dem Stadtbild verschwunden; neuerdings gehörte es wieder dazu. Alles, was Auto hieß, war für den Krieg eingezogen worden.
Die Gruben für die beiden Särge waren nebeneinander ausgehoben worden. Nach der Trauerzeremonie in der Kapelle 3, die inmitten des parkähnlichen Friedhofs Ohlsdorf lag, warteten die Angehörigen, bis die Särge in die Gruben gehievt worden waren. Regenschirme überdachten die Menschen wie ein breiter schwarzer Pilz mit vielen Auswölbungen. Als es so weit war, löste sich einer nach dem anderen aus dem Menschenpilz, trat vor und warf eine Schaufel voll dunkler Erde zuerst in die eine Grube, bückte sich, um die Schaufel ein zweites Mal zu füllen, und schüttete die Erde über der zweiten Grube auf den nächsten Sarg. Ohne auf den eigenartig satten Klang von feuchter Erde auf hölzernem Hohlkörper zu lauschen, rückte jeder schnell wieder zurück unter den Schutz eines der Regenschirme.
Die Frauen, deren Füße in hochhackigen leichten Pumps steckten und deren Beine nur von dunklen Seidenstrümpfen umhüllt waren, tippelten auf der kalten Erde verstohlen auf und ab. Obwohl sie über ihren schwarzen Kostümen Wintermäntel trugen, zitterten sie vor Kälte. Die Männer hielten ihre Hüte in den Händen, und man sah ihnen an, dass sie ungeduldig darauf warteten, sie endlich wieder aufsetzen zu können. Ihre verbleibenden Haare boten nur wenig Schutz für die nackte Kopfhaut. Es war der 7. Oktober 1941. Vom Himmel prasselte Regen, der von Sturm durch die Straßen gepeitscht wurde.
Stella weigerte sich, Erde auf die Särge zu werfen. Sie trat einfach zurück, als sie an der Reihe war und alle sie anschauten. Sie schüttelte kurz den Kopf, was ihre dunkelroten Locken in ihr Gesicht schleuderte, wo einige Haare an den trotzig angemalten blutroten Lippen hängen blieben. Trotz ihrer dreiundvierzig Jahre sah sie aus wie eine junge Frau. Am liebsten hätte sie auch ein rotes Kleid angezogen. Und rote Schuhe. Am liebsten hätte sie sich in der Kapelle vorn hingestellt und ein Lied gesungen, zu dem die Tante hätte zustimmend mit dem Kopf nicken oder im Takt mit den Zehen wackeln können. Es gab keinen Grund, über den Tod der beiden Menschen zu trauern, die da in wenigen Stunden in ihren Holzsärgen unter der Erde verschwunden sein würden.
Die eine, die Tante, nach der Stellas ältere Schwester Lysbeth getauft war, war wie eine Sonne durch das Leben aller Wolkenrath-Kinder gezogen. Sie hatte sie umrundet, erhellt, erwärmt oder aber auch wie der Mond als kalter Spiegel einiges an Selbsterkenntnis provoziert. Sie hatte ihre Umlaufbahn mehr als einmal geändert, aber sie war sich immer treu geblieben. Ein Leben wie das der Tante gab nicht den geringsten Anlass zur Trauer. Aber es gab viele Gründe zum Feiern, zur Ausgelassenheit, zu Leichtigkeit und zu tiefer Selbstbesinnung.
Stellas trotzige Gedanken konnten jedoch den sengenden Schmerz in ihrer Brust nicht vertreiben. Sie hatte es so lange gewusst, sie hätte so lange Zeit Abschied nehmen können, schließlich hatte auch die Tante nicht das Wasser der Unsterblichkeit getrunken, aber jetzt, da die Erde auf dem Sarg mit diesem hohlen Ton den Gedanken daran weckte, dass die Tante dort, klein, schmächtig und knochig, ganz allein lag und nie wieder zurückkehren würde, meinte Stella, der Schmerz über den Verlust würde auch sie umbringen. Tränen liefen ihre Wangen herunter, sie schluchzte hemmungslos. Die Welt ohne die Tante war nicht nur um einen Menschen reduziert, die Welt ohne die Tante war ohne Erklärung, ohne Weisheit, ohne Witz, ohne Derbheit, ohne einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf zur rechten Zeit, ohne die Sicherheit, dass alles gut werden würde. Dass dafür zumindest die Möglichkeit bestand.
Und wenn diese Möglichkeit für Stella nicht mehr denkbar war, wäre sie in einem dritten Sarg besser aufgehoben als hier auf dem Ohlsdorfer Friedhof ganz in Schwarz gekleidet mit knallroten Lippen.
Der Tod ihres Vaters Alexander Wolkenrath ließ Stella seltsam unberührt. Und das lag sicherlich nicht daran, dass er nicht ihr leiblicher Vater war, dass ihr leiblicher Vater, Fritz, der Geliebte ihrer Mutter, vor vielen Jahren, genauer gesagt 1919, in den Revolutionswirren am Ende des letzten Krieges, bereits gestorben war. Alexander hatte Stella nie fühlen lassen, dass sie nicht seine wirkliche Tochter war, ja, dass sie als Tochter seines Nebenbuhlers, des Mannes, mit dem seine Frau ihn gehörnt hatte, und zugleich als das schönste unter seinen Kindern ihn immer beschämend an sein eigenes Versagen als Mann erinnert hatte. Ganz im Gegenteil hatte er zu ihr eine engere Bindung gehabt, mehr Stolz auf sie gezeigt als auf seine älteste Tochter Lysbeth und auf seine Söhne Eckhardt und Johann. Sein Sohn Dritter und seine Tochter Stella, die waren immer nach seinem Geschmack gewesen, mutig, draufgängerisch, unternehmungslustig und von dieser Eleganz, die Reiter besitzen. Reiter zähmen das große starke Tier zwischen ihren Schenkeln.
Nein, Stella hegte nicht den geringsten Groll gegen ihren Vater. Auch der, dass er ihre Mutter nicht glücklich gemacht hatte, ja, sie an ihrem Glück sogar gehindert hatte, war verflogen. Keinem in der Familie war verborgen geblieben, wie mutig Alexander sich in den letzten Lebensmonaten seiner Frau verhalten hatte, wie viel Heilung ihrer verletzten Frauenseele er Käthe in ihren letzten Wochen noch geschenkt hatte. Und wie heilend das für ihn selbst gewesen war.
Dass er nun, einen Tag nach der Tante, gestorben war, entbehrte für Stella jeder Dramatik. Es schien folgerichtig. Schon nach Käthes Tod vor einem Jahr war er zu Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Er verfolgte seine täglichen Rituale, hielt sich sauber, saß in seinem Sessel, las die Zeitung und tat zuweilen kund, was er gelesen hatte. Er zog ohne ein Wort der Klage in das kleine Zimmer, in dem vorher seine Söhne geschlafen hatten, nahm an den gemeinsamen Mahlzeiten teil und hörte zu, was die anderen zu erzählen hatten. Wie stark das allerdings wirklich in ihn eindrang, merkte keiner, weil er kaum einmal nachfragte und keine Gemütsregung von sich gab. Längst hatte sich verflüchtigt, was ihn sein Leben lang angetrieben hatte, nämlich in seiner Firma Wolkenrath & Söhne einen großen Gewinn zu erzielen und so zu dem Reichtum zurückzukehren, in dem er aufgewachsen war, der Erbe des Fuhrunternehmens, das sein Großvater gegründet und sein Vater verspielt hatte. Das, was ihn wirklich mit Leben und Reichtum hätte erfüllen können, nämlich die Liebe seiner Frau Käthe, hatte in seinem Weltbild keinen Wert besessen. Dass er davon vor ihrem Tod noch einen Schimmer erhascht hatte, hatte sein Leben wie ein flüchtiger Lichtstrahl mit Erkenntnis und Wahrhaftigkeit erhellt.
Danach gab es nichts und niemanden mehr, der ihn wirklich berühren konnte, und er selbst war völlig unfähig, andere zu berühren. Also lebte er wie ein Einsiedler inmitten seiner Familie, wortlos wie die Hunde, die hingegen auf ihre körperliche Art Nähe suchten. Die Einzige, mit der Alexander Vertrautheit zeigte, war die Tante.
Zu ihr setzte er sich in die große Küche im Souterrain und sah ihr zu, wenn sie das Gemüse zubereitete. Dann sprach er von alten Zeiten, in denen er auf die eine oder andere Weise Triumphe gefeiert hatte. Er sprach von seiner Kindheit als reicher Sohn des Fuhrunternehmens Wolkenrath. Er sprach von seinen Pferden. Und davon, wie er den Besuch Bismarcks in Dresden miterlebt hatte. Er sprach von Geschäften, bei denen er groß rausgekommen war, und davon, dass er als einer der Ersten die Bedeutung der Elektrizität erkannt hatte. Die Tante hörte ihm zu, schrubbte, reinigte, schälte, schnippelte das Gemüse. Sie nickte, gab kurze bestätigende Laute von sich und stellte auch kleine Fragen zu einem geringfügigen Detail.
Stella war während eines solchen väterlichen Monologs einmal in die Küche getreten. Ihr Vater war ungerührt fortgefahren, anscheinend hatte er nicht gemerkt, dass er nicht mehr allein mit der Tante war. Zornig hatte sie die Tante hinterher zur Rede gestellt: »Er suhlt sich in seinem Selbstbetrug. Wie kannst du das unterstützen?« Die Tante hatte milde lächelnd geantwortet: »Die Wahrheit über sich selbst zu ertragen ist nicht allen Menschen gegeben, meine kleine Stella. Und wer damit so lange wartet wie dein Vater, müsste dafür ganz unbekannte Fähigkeiten entwickeln und eine große Seelenstärke, um den Schmerz und die Erschütterung ehrlicher Selbsterkenntnis auszuhalten. Diese Seelenstärke hat in seinem Leben nur einer entwickelt, der gelernt hat, sich im Spiegel zu betrachten. Wer das nicht tut, entwickelt nicht die Reife, die nötig ist, um anderen und sich selbst immer weniger Schaden zuzufügen, andere anzuhören, also wirklich zu hören, wenn sie einem etwas sagen, auch wenn es einem nicht gefällt. Also, das Paket an Lieblosigkeit und Egoismus und falschen Entscheidungen und all dem übrigen Mist ist im Alter deines Vaters ziemlich dick und schwer. Er müsste reifer sein, als er ist, um es zu öffnen und auszupacken und anzuschauen und in die Hände zu nehmen. Und nicht nur in die Hände, auch ins Herz. Du siehst, das Ganze ist wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. In der Tiefe seiner Seele weiß er allerdings um all das Schreckliche, Kalte, Gefühllose, was er gelebt hat. Es beruhigt und tröstet ihn, wenn er sich jetzt an den Glanz erinnert.«
Mit leichter Trauer in der Stimme fügte sie hinzu: »Nun gut, wenn ich jünger wäre, würde ich ihn vielleicht festhalten und daran hindern, sich so einfach aus der Verantwortung für sein Leben zu stehlen …« Sie blickte Stella fragend an, und Stella verstand die Frage sofort. Sie dachte nach. »Du hast recht«, sagte sie leise. »Er ist mir nicht wichtig genug. Diesen Mann aufzurütteln und zu sagen: ›Du belügst dich selbst‹, verbraucht zu viel von meiner Kraft.« Nach einer Zeit des Überlegens fügte sie hinzu: »Auch Lysbeth sind andere Sachen wichtiger.« Die Tante lachte amüsiert auf. »Siehst du, also müssen wir ihn sterben lassen, wie er gelebt hat, in der Selbstlüge einer falschen Größe.« Stella stimmte in das Lachen ein, anfangs zögernd, dann aber wie von einer Last befreit. Ja, sie trug keine Verantwortung für den Vater. Und außerdem hatte er auch das Recht, sich so umfassend selbst zu belügen, wie es ihn beglückte.
Die Tante war am 3. Oktober gestorben. Am nächsten Tag waren alle, sogar die Hunde, wie unter Schock. Sie schlichen auf Zehenspitzen und flüsternd durchs Haus. Zuerst bemerkte keiner Alexanders längere Abwesenheit. Als sie ihn zum kärglich traurigen Abendessen riefen und er nicht erschien, ging Stella in sein Zimmer und fand ihn auf seinem Sessel, den er vor das Fenster gerückt hatte. Er trug Gamaschenschuhe, ein blütenweißes Hemd, eine Hose mit feinen Nadelstreifen und einer exakten Bügelfalte. Sein verbleibender schmaler Haarkranz war sorgfältig gekämmt, die Hände weiß und die Fingernägel sauber und gefeilt. Ein feiner älterer Herr mit der Grandezza eines Reiters.
Stella hatte vor ihm gestanden, zuerst vor Schreck wie erstarrt, und dann vernahm sie die Worte der Tante in ihrem Ohr: »So werden wir ihn also sterben lassen, wie er gelebt hat.« Lächelnd rief sie Lysbeth und Aaron zu sich. Eckhardt und Cynthia ließ sie, wo sie waren. Das Essen wurde sowieso gemeinsam in der Küche unten eingenommen, seit die beiden in die Räume der Eltern gezogen waren.
Hand in Hand standen Lysbeth, Aaron und Stella vor dem toten Alexander. Er war gestorben, wie er gelebt hatte: ein eleganter Mann, aufrecht, ein Reiter, ein Mensch, der Reichtum und Würde ausstrahlt, mehr Schein als Sein.
»Wahrscheinlich ist es immer so«, sagte Lysbeth anschließend, als die drei in der Küche einen Kräuterschnaps aus den Beständen der Tante tranken: »Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Wie sollte es auch anders sein?«
In den letzten Tagen vor ihrem Tod hatte die Tante noch die Vorräte an Kräuterschnaps und Herzwein aufgefüllt, am letzten Tag hatte sie Stella noch einmal umarmt und ein letztes Mal ermahnt, sich durch den Krieg nicht die Liebe zu Anthony zerstören zu lassen. Stella hatte abwehrend reagiert, aber die Tante hatte gesagt: »Du wirst an mich denken, mein Kind. Krieg verändert die Menschen. Auch dich. Auch ihn. Das könnt ihr gar nicht verhindern. Und ihr seid jetzt Feinde.«
Es war nicht das erste Mal, dass sie Stella so angesprochen hatte, aber diesmal war es eindringlicher gewesen. »Krieg verändert alle. Auch euch. Wichtig ist nur, dass ihr euch danach auf das Wesentliche besinnt. Und das ist eure Liebe. Es wird nicht leicht sein, aber es wird möglich sein.« Und kurz vor ihrem Tod hatte sie Lysbeth zu sich ans Bett geholt, die auch neben ihr gesessen hatte, als die Tante starb.
Jetzt, da sie an den Gräbern stand, kamen Stella die Worte der Tante wieder in den Sinn: »Wenn der Krieg zu Ende ist …«
Ihr schien das Kriegsende zum Greifen nah. Vorausgesetzt, dass Amerika sich nicht einschaltete, denn dann würde Hitler Schwierigkeiten bekommen. Bis jetzt war alles schnell und gut für ihn und die seinen verlaufen. Frankreich besiegt, der Osten in vielen Bereichen einverleibt. Im Mai 1940 hatten sich die Holländer ergeben. Es hatte im vorigen Jahr einige wichtige Kriegsetappen gegeben, die Hoffnung geweckt hatten, dass der Krieg bald zu Ende sein würde. Allerdings hatte es keinerlei Hoffnung gegeben, dass Hitler geschlagen werden könnte. Ein Sieg in diesem Krieg, so schien es, konnte nur der Sieg der Deutschen sein. Auch seit Beginn des Krieges mit Russland lief alles für die Deutschen, als bräuchten sie die Siege nur zu pflücken.
Die fast täglichen Luftangriffe der Engländer seit 1940 hatten gezeigt, dass Deutschland einen wütenden starken Feind hatte. Das war zwar unendlich zermürbend für die Hamburger Bevölkerung, die seitdem keinen durchgehenden Schlaf mehr bekam, allnächtlich durch Alarm aus den Betten geholt wurde und sich dann in den Bunkern und Kellern die Zeit um die Ohren schlug. Aber es hatte die Hoffnung der Tante verstärkt, dass Hitler mit seinem größenwahnsinnigen Anspruch, die ganze Welt zu erobern, nicht durchkommen würde. Und seit Russland ein weiterer Feind war, hatte die Tante trotz der deutschen Kriegserfolge unerschütterlich die Niederlage der Deutschen vorhergesagt. »Wenn der Krieg zu Ende ist …«
Stella litt entsetzlich unter dem Krieg zwischen Deutschland und England. Die deutsche Armee hatte jeden englischen Angriff mit einem Gegenangriff beantwortet, Tausende von Menschen waren gestorben, Coventry sollte bereits völlig zerstört sein, und es wirkte nicht so, als könnte Hitler auf seinem Siegeszug aufgehalten werden. Stella hasste ihn für jede Bombe, die er auf England abwarf. Im September 1940 hatte es einen unerwarteten Tagesangriff auf die City von London gegeben, der dort entsetzliche Panik ausgelöst hatte, die Stella empfunden hatte, als wäre sie dabei gewesen. Ein voll besetzter Omnibus war durch eine Bombe in ein Wrack verwandelt worden. Stella hatte es vor sich gesehen: Junge Frauen wie Angela auf dem Weg zur Arbeit, Männer wie Anthony, die zu Hause Frau und Kind hatten, all diese Menschen nur noch blutige Fetzen, wenn sie nicht in Atome zersprengt worden waren. Im Oktober 1940 hatte dann ein Nachtangriff auf London angeblich zehntausendfünfhundert Menschen obdachlos gemacht.
Stella war zwar mit dem Hamburger Kapitän Jonathan Maukesch verheiratet, ihr eigentlicher Mann, ihr Geliebter, ihr Liebster aber war Anthony. Angela, Stellas Tochter, und Roberta, ihre Enkelin, waren bei ihm in London. Vielleicht war die kleine Roberta wie viele andere englische Kinder nach Australien, Kanada oder in die USA in Sicherheit gebracht worden. Und Anthony führte vielleicht irgendwo aktiv gegen Deutschland Krieg. Wenn einem dieser Menschen ein Haar gekrümmt würde, das hatte Stella sich geschworen, würde sie Hitler mit eigenen Händen umbringen, auf welche Weise auch immer.
Stella bangte während der Bombennächte um die Männer in den englischen Flugzeugen, obwohl diese natürlich auch ihr Leben bedrohten. Warum also sollte Stellas und Anthonys Liebe durch den Krieg gefährdet sein? Das Leben jedes Einzelnen von ihnen war gefährdet, aber doch nicht ihre Liebe!
Während sie den Kräuterschnaps auf ihren toten Vater tranken, sagte Lysbeth jenen Satz, der Stella noch lange beschäftigen sollte: »Stirbt nicht im Grunde jeder so, wie er gelebt hat?« Aaron und Stella hatten sie nur nachdenklich angesehen, und dann hatten sie über den Vater gesprochen und seine Selbstlügen und dass Reife und Alter nichts miteinander zu tun hatten. Der Vater hatte im Alter eine gewisse Güte entwickelt, aber die hatte er auch im Laufe seines Lebens immer mal wieder gezeigt. Er war im Alter den gleichen Dingen ausgewichen wie in seinem ganzen Leben: echtem ehrlichen Kontakt, vor allem zu sich selbst.
Aber er hatte etwas getan, das ihm Reife und Würde verliehen und ihm den Respekt seiner Töchter eingetragen hatte: Er hatte am Schluss seiner Ehe gewagt zu lieben. Er hatte sich Käthe rückhaltlos genähert, er hatte um sie geworben, ohne sich gleichzeitig durch Halbherzigkeit und mangelnde Ernsthaftigkeit zu schützen. Er hatte nicht taktiert, hatte nicht Käthe das Lieben überlassen, hatte es sich nicht bequem gemacht. Er war ihr als ihr Mann mit allem, was er zu dem Zeitpunkt zu geben hatte, begegnet. Und so war er über sich selbst hinausgewachsen. Das war der Zeitpunkt in seinem Leben, wo er nicht vorgab, etwas zu sein, wonach die anderen dann vergeblich suchen mussten, sondern wo er gerade gestanden hatte: für seine Ehe, seine Frau, seine Sehnsucht nach Käthe und ihrer Wärme, für seine Schuld, die er im Laufe ihrer Ehe auf sich geladen hatte, und für den Wunsch nach ihrem Verzeihen. Wo er nicht nur die Reiterfassade des geraden Rückens zeigte, sondern wirklich aufrecht gewesen war.
Nach Käthes Tod war er rasch gealtert. Er hatte sich aus dem Leben zurückgezogen, hatte seinen Geist auf alte Illusionen geworfen und sich sein Leben schöner geredet, als es gewesen war. Mehr Ehrlichkeit, mehr Wahrheit hatte er nicht aufzubringen vermocht. Aber er war ein gepflegter aufrechter Mann geblieben bis zum letzten Augenblick. Und auch darin lag Würde.
Nach der Beerdigung gingen alle zu Kaffee und Kuchen in ein Café neben dem Ohlsdorfer Friedhof. Erst als sich die Trauergemeinde von den Gräbern entfernte, bemerkte Stella den abseits stehenden kleinen Mann in SA-Uniform. Neben ihm stand eine hochschwangere Frau. Sie war in Tränen aufgelöst, sein mageres blasses Gesicht hingegen wirkte versteinert gefühllos. Das ist Johann, unser kleiner Bruder, mit seiner Ehefrau Sophie, dachte Stella, erschrocken, weil sie während der vergangenen Tage nicht ein einziges Mal daran gedacht hatte, Johann über den Tod seines Vaters zu informieren. Das ist doch nicht richtig, dachte sie. Er ist immerhin unser Bruder, auch wenn er ein erbärmlicher Nazi ist und unsere Mutter ihn enterbt hat, nachdem er Dritter bei der Gestapo denunziert hat. Stella zupfte Lysbeth am Ärmel und wollte sie auf das Paar aufmerksam machen. Als Lysbeth in die von Stella gewiesene Richtung blickte, waren Johann und seine Frau fort, wie vom Erdboden verschluckt. Verwirrt suchte Stella die Umgebung mit den Augen ab. Nichts. »Was ist los?«, flüsterte Lysbeth. »Johann«, antwortete Stella ebenso leise. Lysbeth fuhr zusammen. Stella sah ihr an, dass sie die gleichen schuldbewussten Überlegungen anstellte wie sie selbst kurz zuvor. »Wir haben ihn nicht eingeladen, das haben wir vollkommen vergessen, wie entsetzlich«, bemerkte Lysbeth. Stella nickte. »Jetzt ist es zu spät. Sie ist schon wieder schwanger …« Lysbeth schüttelte fassungslos den Kopf. Hand in Hand gingen die Schwestern Richtung Friedhofsausgang. Beide waren aufgewühlt. Von der Beerdigung, nun aber auch von der Erkenntnis, dass etwas geschehen war, das sie nie für möglich gehalten hätten: Sie hatten ihren Bruder Johann so lange aus ihren Gedanken und Gefühlen verdrängt, bis sie ihn völlig vergessen hatten. Es war nicht nur so, als wäre er tot. Es war, als hätte er niemals existiert. Und das war ein eindeutiger Beweis dafür, dass auch sie imstande waren, sich selbst zu betrügen. Wahrscheinlich lebte er noch in Altona, vielleicht stand die Geburt seines zehnten oder elften oder zwölften Kindes kurz bevor. Aber Stella und Lysbeth hatten ihn und seine Frau und seine Kinder vergessen.
Viele Nachbarn hatten sich zum Leichenschmaus eingefunden. Auch Luise und Fred Solmitz waren da und ihre Tochter Gisela. Es freute Stella, dass Gisela gekommen war. Die Tante hatte sich in den letzten Jahren viele Gedanken um die junge Frau gemacht, die einen jüdischen Vater und eine arische Mutter hatte. Stella hatte die drei ausdrücklich gebeten, anschließend noch mit zu Kaffee und Kuchen zu kommen. Sie hatte sehr wohl bemerkt, dass einige Nachbarn die Nase rümpften und sich daraufhin schnell von den Gräbern entfernten. Aber sie wollte eindeutig signalisieren, dass die jüdischen Nachbarn ihre Freunde waren.
In diesem Fall stimmte sie darin sogar mit Jonny, ihrem Ehemann, überein. Kapitän Jonathan Maukesch kannte Fred Solmitz, den Aufklärungspiloten, noch aus dem Ersten Weltkrieg. Wenn er auf Heimatbesuch nach Hamburg gekommen war, hatte er regelmäßig die Solmitz zum Wiedersehensfest eingeladen. Dann waren alle stets begeistert von dem von ihm gedeckten Tisch gewesen: Schokolade, Fischdosen, Seife, Bettbezüge, Strümpfe, Schuhe, Kaffee, ja, sogar Stopfwolle, an alles hatte Jonny gedacht. Einmal hatte Luise begeistert ausgerufen: »Was haben Sie für einen guten Mann!« Und wenn Jonny von seinen Kriegserlebnissen berichtete, guckte sie ihn fast verliebt an.
Stella hatte in den letzten Jahren oft nicht viel für Luise übriggehabt, weil diese doch sehr eigenartige Ansichten zu den Nazis geäußert hatte, deren begeisterte Anhängerin sie gewiss geblieben wäre, wenn es nicht die leidige Judenfrage gegeben hätte, die nun einmal ihren Mann und damit auch sie selbst betraf. Luises naive Begeisterungsfähigkeit rührte Stella aber immer wieder.
In der letzten Zeit hatte Stella unter den Nachbarn tuscheln gehört, dass Gisela einen Verlobten habe, einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater aus Blankenese. Sie blickte forschend auf die junge Frau. Was war an den Gerüchten dran? Denn es war äußerst unwahrscheinlich, dass es sich bei dem Mann aus Blankenese um einen Juden handelte. Einen Arier durfte Gisela als Halbjüdin aber nicht heiraten.
Stella dachte voller Mitgefühl, wie ausgeschlossen Gisela sich wahrscheinlich fühlte. Sie war einundzwanzig Jahre alt, in diesem Alter waren die meisten jungen Frauen verheiratet und hatten schon Kinder. Die Nazis hatten viele Vergünstigungen für Kinderreiche geschaffen, die Geburtenrate war in die Höhe geschnellt. Nur Gisela hatte weder Mann noch Kind.
Irgendwo klimperte ein Klavier, Stimmen vermischten sich zu Luftvibrationen, die wie Wassergeplätscher an Stellas Ohren drangen. Die dicken Vorhänge, die Teppiche, die weichen Sessel dämpften alles ab. Stella nippte an ihrem Kaffee. Ihr Magen war wie zugeschnürt. Er verbot ihr, etwas von dem Kuchen zu essen.
Sie ließ ihren Blick über die Runde der anwesenden Menschen schweifen. Ihr Bruder Eckhardt und seine Frau Cynthia saßen an einem Tisch mit den Solmitz. Unwillkürlich musste Stella schmunzeln. Cynthia schwankte immer wieder hin und her, wie sie sich den Solmitz gegenüber verhalten sollte. Sie verübelte ihnen sehr, dass sie Freds Judentum verschwiegen hatten, bis es über seiner Mitgliedschaft im Luftschutzbund herausgekommen war. Ja, Fred hatte sogar Luftschutzwart werden wollen, ungeachtet dessen, dass das für einen Juden natürlich nicht in Frage kam. Auf der anderen Seite bewunderte Cynthia sehr den Kapitän Jonny Maukesch, und der zeigte demonstrativ seine Freundschaft zu den Solmitz. Wie sollte Cynthia sich da verhalten?
Neben Stella saß ihre Schwester Lysbeth mit ihrem Mann Aaron, der den gelben Judenstern auf seiner Jacke trug. Im Gegensatz zu Lysbeths und Aarons Ehe galt Luises und Freds als privilegierte Mischehe, weil sie ein gemeinsames Kind hatten. Abgesehen davon hatte Fred im Gegensatz zu Aaron noch einige Meriten aufzuweisen, die sogar nationalsozialistische Beamte beeindruckten: Er war im letzten Krieg als Major verwundet worden, und zwar als einer der ersten Piloten Deutschlands, die sogar noch vom Kaiser persönlich besucht worden waren. Außerdem war er bis vor kurzem Eigentümer eines Hauses in der schönen Kippingstraße gewesen, und jeder wusste, dass er es seiner Frau nur überschrieben hatte, um das Haus zu bewahren.
Aber auch um Aaron gab es einen Schutzwall. Er wohnte in einem Haus gemeinsam mit einer großen arischen Familie, von denen einige der NSDAP angehörten. Sein Schwager Jonny Maukesch war ein angesehener Kapitän, der unter den Schifffahrts-Honoratioren Hamburgs ebenso wie unter dem Militär und auch in der NSDAP einen hervorragenden Ruf hatte, war er doch maßgeblich an den Kämpfen gegen die revolutionären Kräfte nach dem letzten Krieg beteiligt gewesen. Den größten Schutz aber, so schien es Stella, erhielten Fred wie Aaron durch die Liebe ihrer Frauen, die sich wie wilde Löwinnen verhielten, wenn jemand auf die Idee kam, ihren Männern ein Leid zuzufügen.
Ihrer Schwester Lysbeth gegenüber saß Lydia, Cynthias Mutter, eine Verwandtschaft, die mit zunehmendem Alter immer weniger zu passen schien.
Mit einem Mal schoss durch Stellas Kopf abermals der Satz: »Sterben wir nicht alle, wie wir gelebt haben«? Sie platzte mit dieser Frage in ein angeregtes Gespräch zwischen Lysbeth und Lydia.
»Du hast gesagt, jeder stirbt, wie er gelebt hat. Aber was ist mit den Kindern von Barmbek, die beim Spielen von der Bombe getötet worden sind?« Zwei erstaunte Augenpaare richteten sich auf sie. Lysbeths blaue Augen, die manchmal etwas verwaschen ins Grau tendierten. Lydias blaue Augen, die immer noch klar und scharf blickten, obwohl sie schon siebzig war. »Wovon sprichst du?«, fragte Lysbeth verwirrt. Stella erinnerte sie an ihr Gespräch in der Küche, und Lydia zeigte sofort Interesse an dieser Frage. Sie lachte laut auf. »Mein zweiter Mann Andreas Hagedorn ist jedenfalls gestorben, wie er gelebt hat: in der Badewanne. In der Geborgenheit des Mutterbauchs, warm, weich, ohne dass die helle laute Welt etwas von ihm verlangen konnte.« Liebevoll fügte sie hinzu: »Und ich stelle mir bei ihm auch vor, dass der Tod so etwas war, wie in den Mutterbauch zurückzukriechen. Keine Anforderung mehr, ein Mann zu sein, der der Welt eine Stärke zeigen musste, die er selbst gar nicht empfand, eine Camouflage, die ihn furchtbar anstrengte. Einfach wieder zurück in die undefinierte watteweiche Glückseligkeit der dunklen Umhüllung von warmem Wasser.«
Stella starrte Lydia an. Was für eine erstaunliche Frau! Wie treffend sie ihren verstorbenen Ehemann einschätzte. Je älter sie wurde, umso interessanter wurde sie. Es schien Stella, als erlaube Lydia sich mehr und mehr, sich selbst auszuloten, zu erproben und auszudrücken.
»Aber unsere Mutter?«, wandte Stella sich an Lysbeth. »Die ist doch ganz anders gestorben, als sie gelebt hat.« Lysbeth wiegte ihren Kopf bedächtig hin und her. »Ja und nein«, sagte sie sanft. »Unsere Mutter war immer eine sehr sinnliche und leidenschaftliche Frau.« Sie lächelte. »Denk nur daran, wie gern sie naschte.« Auch Stella lächelte. Ja, ihre Mutter war eine kleine Naschkatze gewesen. Und sie selbst war das Produkt einer leidenschaftlichen Liebe, die ihre Mutter offenbar sehr mitgerissen hatte. Auch Lydia lächelte. »Eure Mutter war eine ganz besondere Frau«, sagte sie. »Sie war an vielem interessiert, was an anderen Frauen der Generation vorübergegangen ist. Und ihr beiden Mädchen habt davon sehr profitiert.« Stella und Lysbeth warfen sich einen verschmitzten Blick zu. Stella war dreiundvierzig Jahre alt und Lysbeth sechsundvierzig. Mädchen?
Da kam Dritter mit seiner jungen Frau Marthe zu ihnen an den Tisch. Er hieß eigentlich Alexander, aber weil er nach Großvater und Vater als Dritter in der Familie diesen Namen trug, wurde er Dritter genannt. Er zog zwei Stühle heran und murmelte: »Die Meyers sind so langweilig. Das halte ich nicht länger aus. Zum Glück hat sich jetzt Jonny erbarmt.« Stella blickte zu dem Tisch, an dem die Meyers aus der Kippingstraße gemeinsam mit der Gemüsehändlerin und dem Schlachter saßen. Jonny führte ein angeregtes Gespräch mit ihnen. Stella war froh, dass er da war. Seit der Krieg begonnen hatte, noch eher, seit die Hatz auf die Juden begonnen hatte, bot Jonny der ganzen Familie einen gewissen Halt und Schutz.
Sie hatte ihn sogar einmal in Emden besucht, wo sein Schiff lag. Sie hatte es in der Hoffnung getan, nach all den Bombennächten in Hamburg einmal wieder auszuschlafen. Aber schon im Zug dahin hatte sie begriffen, dass sie sich geirrt hatte. Sie hatte Schutz und Ruhe so sehr mit Jonny verbunden, dass sie sich nicht anständig über die Situation in Emden informiert hatte. Ausgerechnet in der Nacht, als sie auf Jonnys Schiff schlafen wollte, gab es einen Fliegerangriff. Jonny und der zweite Offizier entschieden, dass Stella in einen Bunker am Kai gebracht werden sollte. Aber Jonny fand den Bunker nicht, und so irrten sie herum, stolperten über Poller, Trossen, Gleise, immer in dem Bewusstsein, dass direkt neben ihnen das tiefe Wasser lag. Splitter prasselten nieder, sie schaute in die roten Schlünde der ringsum krachenden Geschütze. Halb tot vor Angst stolperte sie schließlich zum Schiff zurück, wo sie wütend auf Jonny einschrie, wieso er sie rausschleppe, wenn er nicht einmal wisse, wo der Bunker sei.
Auf der Rückfahrt hatte sie sich allerdings geschämt wegen ihres dummen Ausflugs. Sie hätte es besser wissen müssen. Und Jonny einen Vorwurf zu machen, weil er sie nicht in Sicherheit brachte, war auch dumm.
Jahrelang hatte sie sich geärgert, dass sie sich nicht von ihm hatte scheiden lassen, nur weil er der Einzige war, der den Bewohnern des Hauses in der Kippingstraße finanzielle Sicherheit bot. Sie hatte das Gefühl gehabt, sich verkauft zu haben, aber inzwischen war die Bedrohung viel existentieller, als dass es nur um ein sicheres Einkommen ging. Aaron war Jude. Und Stellas geliebte Schwester war mit Aaron verheiratet. Stella glaubte, auf das Ende des Krieges warten zu müssen, bis sie wieder leben durfte. Dann würde es auch an der Zeit sein, mit Jonny ein klärendes Gespräch zu führen. In einem solchen Gespräch wollte sie ihm deutlich machen, dass sie ihn ohne jede Missgunst an seine Zweitfrau Greta und beider gemeinsame Tochter abgab; dann hätte Stella endlich die Freiheit, mit Anthony das zu leben, wonach sie sich seit vielen Jahren sehnte. Wenn sie dann noch lebte.
»Wenn wir dann noch leben«, war während der vergangenen zwei Jahre ein geflügelter Satz geworden. Er wurde zu jeder Verabredung hinzugefügt. Er war realistisch angesichts der Bombardierungen, die viele Menschenleben gekostet hatten und alle stets bedrohten.
Stella wagte nicht zu denken: Wenn Anthony dann noch lebt. Sie hatte zwar viel weniger Sinn für Übernatürliches als ihre Schwester Lysbeth, aber diesen Gedanken auch nur in den Bereich des Denkbaren dringen zu lassen, verbot ihr ganz eindeutig eine Überzeugung, die sagte: Alles, was du denken kannst, kann auch geschehen. Im Umkehrschluss bedeutete das für sie: Wenn ich es nicht denken kann, wird es auch nicht geschehen.
Stella hoffte mit der vollen Kraft ihres überschwänglichen Herzens auf ein Ende des Krieges. Aber der Krieg währte nun schon zwei Jahre, und es gab noch keinen Frieden. Immer wieder hatte es Etappen gegeben, wo sich die nächste Hoffnung zerschlug. Als sie im März 1940 die verrotteten Sandsäcke und Kisten im Vorgarten beseitigt hatten, die ihnen seit Kriegsbeginn die Küche verdunkelten, war dies der erste Moment gewesen, wo sie begriffen hatte, dass ihre anfängliche Erwartung, die Beseitigung der Sandsäcke würde gleichbedeutend mit dem Kriegsende sein, sich nicht erfüllt hatte. Die Gefahr war im Verlauf der zwei Jahre immer größer geworden, aber nicht der Schutz.
Die Beerdigung der Tante und ihres Vaters rief in Stella viele Erinnerungen an die vergangenen zwei Jahre wach. Am 4. Juni 1940 war der Fall von Dünkirchen bekanntgegeben worden, dadurch wurde die Schlacht in Flandern und um Artois beendet, 1,2 Millionen Gefangene waren in die Hände der Deutschen gefallen. Damit es auch ja keiner übersah, läuteten drei Tage lang die Glocken, eine ganze Woche lang war geflaggt worden.
Wahrscheinlich war Stella der Fliegerangriff vom 6. Juni so in Erinnerung geblieben, weil er in diese deutsche Triumphzeit fiel. Kurz nach 1.00 Uhr nachts begann der Angriff, und er ging bis Viertel vor vier. Es war so heftig, dass Stella gleich aufstand und auch alle anderen Familienmitglieder nicht im Bett blieben. In der kleinen Besenkammer im Souterrain hockten sie zusammen und warteten. Es gab schwere Einschläge ringsum, Flieger über dem Haus, ein gemeines Gefühl. Immer kamen sie wieder. Die Abwehrschüsse knallten. So tobte die Schlacht über ihren Köpfen in jener sternenklaren Nacht. Lysbeth und Aaron hatten sich umarmt, sie drückten sich eng aneinander. Stella sehnte sich unendlich nach Anthony, nach seinen beruhigenden Worten, und sie hielt es kaum aus, nicht zu wissen, wie es ihm und wie es ihrer Tochter ging.
Das Leben zog sich zusammen auf die Besenkammer. Und es war grausig und trotz allem, was sie in ihrem Verstand wusste, unvorstellbar und unbegreiflich, der Gedanke: Wirklich und wahrhaftig stand über ihnen allen in diesem Augenblick Tod und Vernichtung. Tot oder verstümmelt, ohne Haus und Zuhause, alles, was ihr einmal lieb und teuer gewesen war, verbrannt, verkohlt, und vielleicht, die schrecklichste Angst: als Einzige zu überleben. Nichts ängstigte Stella mehr als das. Unendlich wehrlos hatte sie sich in diesem lächerlich schwachen Haus gefühlt, ohne den geringsten Schutz. Bei jedem Einschlag zuckte sie zusammen, bis die Tante vorschlug, ein Lied zu singen oder etwas vorzulesen. »Singen«, seufzte Lysbeth. »Bitte.« Und also holte Stella ihr gesamtes Repertoire aus dem Gedächtnis und schmetterte gegen die Gefahr draußen an. Die anderen fielen ein, wenn sie Text und Melodie kannten, und manchmal summten sie auch einfach nur mit. Von jener Nacht an sangen sie, wenn Alarm war, und das gab Stella das Gefühl, wenigstens irgendetwas tun zu können.
Zwei Tage später war Stella von einem Polizisten angehalten worden, weil sie Hosen trug. »Eine widerliche und unberechtigte Torheit der Mode«, sagte Cynthia. Stella war empört über den Polizisten und betrachtete betrübt vor ihrem Spiegel die Hosen, die so schick waren. Der Polizist sagte, es seien nicht die Hosen an sich, die Ärgernis erregten, sondern die Tatsache, dass sie eng seien. Denn das sei englische Mode. Stella hatte gedacht: Genau, und deshalb trage ich sie. Aber am folgenden Tag sah sie einen weißen Verkehrsschutzmann, der sein Benzin auf dem Motorrad verfuhr, um Radfahrerinnen in Hosen anzuhalten. Stella schnaubte empört. Aber sie hielt sich daran, was der Polizist gesagt hatte, und verzichtete von nun an auf ihre Hosen. Sie alle waren wegen Aaron in ihrem Haus so gefährdet, dass sie sich keine unnötigen Scherereien leisten konnten.
Inzwischen hatte es sich bereits eingespielt: hoch beim hässlichen Sirenenton, Kette von der Haustür, Hintertür aufgeschlossen, Hauptgashahn abgestellt. Und dann das unheimliche Warten. Lauschen. Erzählen. Singen. Die Zeit verging schneller, wenn man sich beschäftigte. Aufatmen, wenn das Flugzeug sich entfernte, wenn die Flak verstummte. Noch vor der Entwarnung merkten sie, dass die Luft rein war. Dann hörten sie Schritte draußen, Stimmen, Fenster, die geschlossen wurden. Jedes Mal schreckten sie bei der Entwarnung zusammen, atmeten dankbar auf, warfen die Kleidung von sich und sprangen ins Bett.
Die Nachbarn in der Kippingstraße waren im Verlauf der vergangenen zwei Jahre stärker zusammengerückt. Viele hatten Klopfzeichen vereinbart, falls einer verschüttet unter den Trümmern seines Hauses liegen sollte und Hilfe brauchte. Es gab Pläne zwischen manchen Nachbarn, Wände zwischen den Häusern durchzubrechen, damit Fluchtwege geschaffen würden. Es gab Nachbarn wie die Meyers, die sich weigerten, die Solmitz zu grüßen, und die sie aus der Nachbarschaft ausschließen wollten. Stella und Lysbeth machten unerschütterlich deutlich, dass sie zu den Solmitz hielten.
Es hatte allerdings auch immer wieder Momente gegeben, wo es ihnen schwergefallen war, ihre Sympathie für Luise zu bewahren. Im Juni 1940 zum Beispiel, als zuerst die elsass-lothringische Armee die Waffen gestreckt hatte und kurz darauf Paris eingenommen worden war, da hatte Luise auf der Straße begeistert wie ein Kind geplappert: »Als ich es im Rundfunk gehört habe, flogen mir die Hände. Das Unfassbare ist wahr geworden: Paris ist in deutscher Hand! Während der Marsch ertönte, marschierten unsere Soldaten ein. Mein Gott, ich habe wie ein Schlosshund geheult. Wie großartig es ist: Die Hakenkreuzflagge weht statt der Trikolore über Paris.« Als Luise dann noch hinzufügte: »Deutsche Soldaten in Versailles! Wer schlug die Demütigen von 1919 mit Blindheit?«, hatten sich Stella und Lysbeth hastig verabschiedet. Aber sie waren in den darauffolgenden Tagen Luises Begeisterung nicht entkommen. »Fort Vaux vor Verdun gestürmt! Das ruchbare, blutige, vielumstrittene Fort Vaux! Wer hätte das zu träumen gewagt?« Und am gleichen Tag am Abend: »Nun haben sie auch die Zitadelle Verdun genommen. Das unbezwingbare Verdun! Und die Maginotlinie in breiter Front südlich Saarbrücken durchbrochen! Man kann gar nicht so schnell mit.« Und am 17. Juni war sie auf der Straße auf die Tante zugestürmt und hatte gerufen: »Welch großer, großer Tag des deutschen Volkes. Haben Sie es schon gehört? Marschall Pétain, der Sieger von Verdun, lässt wissen, dass Frankreich die Waffen niederlegen will, und bittet um die Friedensbedingungen! Unfasslich. Ich war gerade in der Küche, da riefen aus der Höhe durchs Fenster Fred und Gisela die frohe Botschaft, wie die Engel: Frankreich hat kapituliert! Wir konnten es kaum glauben. Wir waren alle in einem Rausch von Begeisterung und Glück.«
Stella dachte daran, wie die Tante beim Abendessen spöttische Bemerkungen über Luise Solmitz gemacht hatte, die offenbar nach wie vor wünschte, die deutsche Niederlage im letzten Krieg rückgängig zu machen. »Was für ein Glück für die Frau, dass ihr Mann Jude ist«, hatte die Tante trocken bemerkt, »sonst hätte sie wahrscheinlich keine Chance, überhaupt irgendetwas zu begreifen.«
Stellas Magen krampfte sich abermals zusammen. Solche Bemerkungen der Tante würde sie nun nie wieder hören. Wie sollte sie das nur aushalten? Wenn sie Anthony wenigstens einen Brief schreiben könnte, aber selbst das war nicht mehr möglich.
In ihren traurigen und sehnsüchtigen Gedanken versunken, bemerkte Stella, wie Dritter sich zu Lysbeth lehnte und ihr etwas ins Ohr flüsterte. Sofort war Stella hellwach. Ihr Bruder und ihre Schwester hatten ein Geheimnis! Sie sah, wie Lysbeth errötete, wie sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete, und dann drückte sie die Hand ihrer jungen Schwägerin und nickte ihr liebevoll zu. Stella warf einen Blick auf den sich leicht vorwölbenden Bauch ihrer Schwägerin und dachte: Warum habe ich das nicht vorher bemerkt? Sie ist schwanger, verdammter Mist. In diesen Zeiten ein Kind zeugen, das kann nur ein Tollkühner wie Dritter. Und wie will er denn eine Familie ernähren? Bis jetzt verdient Marthe noch mehr als er. Außerdem lebt er bei seiner Schwiegermutter in einer Zweizimmerwohnung. Und was ist, wenn er in den Krieg eingezogen wird? Irgendwann greifen sie vielleicht auch auf die Älteren zurück. Das arme Kind! Stella wurde heiß vor Zorn. Am liebsten hätte sie ihren Bruder geschüttelt.
2
Erst einen guten Monat zuvor, am 1. September 1941, hatte es bei den Wolkenraths eine Doppelhochzeit gegeben. Eckhardt, der älteste der Söhne, hatte im stolzen Alter von sechsundvierzig endlich seine langjährige Verlobte Cynthia Gaerber geheiratet, obwohl ihm – und auch ihr – klar war, dass sie die Hochzeitsnacht wie alle Nächte zuvor eher wie Geschwister denn als Mann und Frau verbringen würden; Eckhardt interessierte sich sexuell nicht für Frauen, und Cynthia ekelte sich inzwischen vor allem Geschlechtlichen, allein Hitler konnte ihr, der begeisterten Nationalsozialistin, feuchte Träume entlocken.
Eckhardts Bruder Alexander, »Dritter« genannt, hatte seine junge Braut Marthe geheiratet. Er war danach zu Frau und Schwiegermutter in die Gärtnerstraße gezogen, während Cynthia in die Kippingstraße gekommen war. Cynthia und Eckhardt hatten sich in der mittleren, der Beletage, eingenistet, in der früher die Eltern ihr Wohn- und ihr Schlafzimmer gehabt hatten. Die Räume, in denen sich vorher die ganze Familie getroffen und mit allen Differenzen und Konflikten ein Zuhause gefunden hatte, waren durch Cynthia zu einer Gruft geworden. Sie hatte nicht nur das einstige Wohnzimmer zu ihrem Schlafzimmer gemacht, sie hatte es auch in aller Geschmacklosigkeit, die man sich nur ausdenken konnte, eingerichtet. Dieses Zimmer, das nach vorne hinaus lag, besaß einen Erker, dessen hohe Fenster eine lichte Großzügigkeit erzeugten, ein Eindruck, der durch die hohen Decken mit dem üppigen Rosenstuck und durch den großen Ofen mit den grünen schimmernden Kacheln noch verstärkt wurde. Außerdem ging von diesem Zimmer ein Wintergarten ab; der war zwar selten benutzt worden, weil er im Winter zu kalt und im Sommer zu warm war, aber auch er hatte das Bild von eleganter Großzügigkeit unterstrichen. Jetzt stand dort ein wuchtiges Bett aus dunkler Eiche. Die Fenster verschwanden unter eng gefalteten Tüllgardinen, die jedoch sogar tagsüber hinter zugezogenen grünsamtenen Vorhängen ein unsichtbares Dasein fristeten. Das Zimmer lag immer im Dunkeln. Ein schwerer Kleiderschrank von dunkelbraunem Eichenholz und eine Frisierkommode im gleichen Stil vervollständigten das bedrückende Ensemble.
Ins Nebenzimmer hatte Cynthia alle Möbel gepfercht, die aus dem früheren Wohnzimmer der Eltern stammten. Außerdem hatte sie Möbel aus ihrem Mädchenzimmer mitgenommen, ebenso wie Papierwaren, die sie beim Verkauf der Fabrik ihres Vaters »gerettet« hatte, so wie Eckhardt es mit Elektroartikeln aus der Firma Wolkenrath & Söhne getan hatte. Dieser Raum sah also aus wie ein Gerümpellager. Die Papierwaren wollten sie zwar nach und nach in ihrem kleinen Kiosk, den sie in einem Laden im Souterrain nahe der Emilie-Wüstenfeld-Schule aufgemacht hatten, verkaufen, doch die Schulkinder, die dort für wenige Groschen Kleinigkeiten erstanden, waren an den von Cynthias Vater einst in seiner Fabrik hergestellten hochwertigen Erzeugnissen wenig interessiert.
Da Cynthia sehr darauf bedacht war, Strom zu sparen, wurden in ihren Zimmern höchstens funzelige Lämpchen angezündet und auch erst, wenn es draußen sehr dunkel war. Angeblich hatte sie empfindliche Augen, aber jeder kannte den eigentlichen Grund: Cynthia war geizig. Dabei verdienten Eckhardt und Cynthia recht gut mit ihrem Laden. Außerdem erhielt Eckhardt eine kleine Versehrtenrente aus dem vergangenen Krieg.
Stella weigerte sich, diese beiden Räume zu betreten, weil es ihr Brechreiz verursachte. Dem Anblick ihres Bruders und seiner Frau konnte sie allerdings nicht aus dem Weg gehen.
Seit sie verheiratet war, hatte Cynthia sich in eine Frau verwandelt, die einem Angst machen konnte. Schon in jungen Jahren war sie keine Schönheit gewesen, aber jetzt, mit Mitte vierzig, sah sie aus wie eine Oberaufseherin im Gefängnis: Groß und dünn, wie sie war, trug sie dunkelblaue Faltenröcke zu weißen oder blau-weiß gestreiften Blusen, die hoch geschlossen und oben am Kragen mit einer Kameebrosche verziert waren. Diese hatte Käthe ihr einmal geschenkt, Cynthia selbst hätte sich so ein apartes Schmuckstück nicht ausgesucht. Cynthia trug geschnürte dunkelbraune Halbstiefel, auf denen sie über den Holzboden klackte. Und ihre inzwischen ergrauten Haare, die ihr, dünn, wie sie waren, noch nie zur Zierde gereicht hatten, hatte sie nun zu einem strengen Knoten oben auf dem Kopf gezurrt. Ihre Lippen waren noch schmaler geworden, und ihre Augenbrauen wirkten, als würden sie mit dem Alter nicht nur grauer, sondern auch dichter über den tiefliegenden grauen Augen wuchern.
Jetzt gewannen Cynthia und Eckhardt durch den Tod des Vaters weiteren Platz dazu. Sie machten eine kleine Küche aus dem Zimmer, das er am Schluss bewohnt hatte und das davor das Schlafzimmer der drei Wolkenrath-Söhne Dritter, Eckhardt und lange Zeit auch Johanns gewesen war, bis dieser als Erster der Söhne geheiratet hatte und ausgezogen war. Cynthia und Eckhardt aßen nun nicht mehr mit den anderen in der Küche im Souterrain.
Schon sehr bald merkten sie, dass sie dabei schlechter fuhren, aber sie sprachen nicht darüber. Sie hatten nicht nur die leckeren Suppen und die liebevoll zubereiteten sonstigen Gerichte der Tante verloren, sondern auch die Wärme des Familientisches, für die vor allem die Tante gesorgt hatte. Jetzt saßen sie zu zweit vor ihren faden Gerichten, die nicht nur wegen der Lebensmittelknappheit mager schmeckten, sondern auch, weil all die Kräuter fehlten, die die Tante im Garten angepflanzt und sogar in der Stadt an so mancher Ecke entdeckt und gesammelt hatte, bis sie starb. Eckhardt vermisste die Abende mit den anderen sehr. So musste er sich Cynthias Tratschgeschichten anhören, in denen sie sich über andere Frauen und deren Lebenswandel erregte. Oder er saß schweigend mit ihr am Tisch und sehnte sich nach der Lebhaftigkeit seiner Schwester Stella.
Lysbeth und Aaron vermissten die Tante von morgens bis abends. Ihre Stimme, ihr Krähenlachen, ihre tröstlich derben Kommentare zum Lauf der Welt, ihre Liebe. Das Zimmer, in dem die Tante im Souterrain neben Lysbeth und Aaron gewohnt hatte, wurde zu einem kleinen Gartenzimmer eingerichtet. Der Schrank, der zwischen den beiden Zimmern gestanden hatte, damit für Lysbeth und Aaron ein wenig Intimität geschaffen wurde und nicht jedes Wort durch die große Schiebetür drang, wurde an eine andere Wand gestellt. Dadurch gewann das Zimmer, das Schlafzimmer und Wohnzimmer und Arbeitsraum gleichzeitig war, mehr Licht und Leichtigkeit. Aaron öffnete tagsüber die Schiebetür und genoss die neue Weite. Lysbeth schien sie kaum wahrzunehmen. Aaron suchte verzweifelt nach irgendetwas, das ihr den Schmerz über den Weggang der Tante zu ertragen half. Lysbeth merkte nicht einmal das.
Nach dem Tod der Eltern und der Tante und nach Dritters Auszug war das Haus leerer und düsterer geworden. Gemeinsam mit ihrer Schwester versuchte Stella, den Alltag im Krieg so gut wie möglich zu bewältigen. Sie schloss sich Lysbeth enger an als in den Jahren zuvor. Oft war sie kurz davor, mit Lysbeth noch einmal über ihren Bruder Johann zu sprechen und ihm vielleicht irgendeine Kleinigkeit vom Vater zukommen zu lassen, als Erinnerung, aber Lysbeth wirkte in ihrer Trauer so verschlossen, dass Stella den missratenen Bruder nicht für das richtige Gesprächsthema hielt. Sie langweilte sich häufig, wusste nicht, was sie tun sollte, außer sich um die drei Hunde zu kümmern. Für die Hunde war zwar vor allem Eckhardt zuständig gewesen, der sich vor ein paar Jahren der Windhundzucht verschrieben hatte, um durch das geteilte Freizeitvergnügen seinem heimlichen Geliebten Askan von Modersen nahe zu sein. Doch die tierliebe Stella hatte sich immer schon für die Hunde verantwortlich gefühlt, auch wenn ihr die tägliche regelmäßige Pflege, auf die die Hunde angewiesen waren, und das Füttern und Ausführen zuweilen lästig geworden waren. Jetzt aber war sie dankbar für diese Aufgabe.
Abends auszugehen war unmöglich geworden. Theater und Kinos beendeten früh ihre Vorstellungen, viele Tanzlokale hatten geschlossen. Jonny war auf See, sie hatte ihre Zimmer im zweiten Stockwerk ganz für sich. In ihrem Wohnzimmer stand jetzt auch das Klavier, aber allein zu musizieren kam ihr so traurig und einsam vor, dass sie das Instrument mied. Ohnehin vermied sie es, sich lange in ihrer Wohnung oben aufzuhalten. Sie ging nach unten zu Lysbeth und Aaron ins Souterrain oder verbrachte ihre Zeit mit beiden in der Küche.
Es gab eine große Leere in Stella. Sie versuchte, so wenig wie möglich daran zu denken, dass sie ihre Mutter, ihren Vater und die Tante verloren hatte. Noch weniger wollte sie die Panik spüren, die in ihr aufstieg, wenn sie daran dachte, dass sie auch Anthony und Angela und Roberta verlieren könnte. Der Krieg war da, und sie war zur Untätigkeit verdammt. Sie konnte nichts tun, um ihn zu beenden. Sie musste hoffen und abwarten, das aber widersprach vollkommen ihrem Naturell.
So schlug sie Lysbeth vor, im Garten Gemüse anzubauen. Einen kleinen Kräutergarten hatte Lysbeth schon gemeinsam mit der Tante angelegt, nun wollte Stella sich an Kartoffeln und Möhren und Bohnen und Erbsen und Gurken wagen. Lysbeth war zwar einverstanden, aber nicht Feuer und Flamme. Also kümmerte Stella sich allein um die Planung. Sie beschloss, den Winter zu nutzen, um sich über alles zu informieren, was Kartoffeln und Möhren und Erbsen und Bohnen und Gurken brauchten, um zu gedeihen. Sie las Gartenbaubücher mit der Absicht, sich allmählich zu einer Fachfrau für Gemüseanbau zu entwickeln. Lysbeth hinderte sie zwar nicht, aber sie war nicht im Geringsten für Stellas Projekt entflammt.
Stella ekelte sich vor den vielen widerlichen Bunkern in der Stadt, den Zickzackgräben, den gestapelten Mauersteinen, den Haufen von Sand für die Luftschutzkeller, die neu gebaut wurden, den öffentlichen Luftschutzräumen, den Rettungswachen, den Entgiftungstrupps. All das war für sie eine stete Mahnung an Tod und Verderben. All das erinnerte sie daran, dass Anthony gegen Deutschland Krieg führte und dass seine Niederlage nicht unwahrscheinlich war. Dem versuchte sie, mit dem Gedanken an Gemüseanbau etwas Lebendiges, Wachsendes und Gesundes entgegenzusetzen.
Der Krieg war schon längst in jede Ritze, jede Falte des Alltags eingezogen. Selbst die Tauben auf dem Hopfenmarkt und den anderen Plätzen der Stadt hatten sich verändert. Sie waren entsetzlich hungrig. Futter für sie wurde nicht mehr verkauft, es gab ja kaum noch etwas fürs Hausgeflügel. Wenn sich einer ihrer erbarmte, setzten sie sich auf diesen Menschen, auf Schulter, Arm, Hände, als wollten sie sich von nun an auf diesem Gönner einrichten. In manchen Straßen waren die Häuser zu beiden Seiten scheußlich ausgefetzt, nach jedem Luftangriff lagen irgendwo schwere Brocken, Splitter, Fensterscheiben herum. Und es gab den Alltag, in dem alle ein wenig dichter zusammenrückten.
Im Gemüseladen, beim Fleischer, auf der Straße wurden Gespräche geführt, in denen die Menschen einerseits viel mehr von sich preisgaben, von ihren Ängsten und Nöten, als es in der Vergangenheit üblich gewesen war, andererseits aber waren alle ständig auf der Hut. Jeder wusste, dass ein falsches Wort schlimme Konsequenzen haben konnte. In den Gesprächen wechselten sich die Ängste mit den Versuchen ab, ermutigende, tröstliche Sätze zu sagen. So bemerkte der Fleischer in der Bundesstraße: »Im vorigen Krieg ist jeder Neunte gefallen. Es gab also mehr Aussicht, zu den acht Überlebenden zu gehören. Und jetzt stehen Hunderttausende von Haushaltungen unversehrt in Hamburg, Tausende bleiben auch nach den schwersten Angriffen heil. Warum sollen wir nicht dazugehören? Und eigentlich haben wir doch schon unser Fett weg. Nun können sie uns verschonen.« Nach diesen Worten machte sich eine spürbare Erleichterung im Laden breit.
Man munkelte, dass bei den Solmitz jüdische Obdachlose untergebracht werden sollten. »In dem großen Haus nur drei Personen«, wurde getuschelt, »und so viele Leute haben gar nichts mehr.« Die Nachbarn zerbrachen sich den Kopf über das Dilemma, in dem die Behörde steckte: Einerseits konnten Luise keine Juden, andererseits konnte Ariern das Zusammenleben unter einem Dach mit Fred Solmitz nicht zugemutet werden. Aber weder Arier noch Juden in diesem nur von drei Menschen bewohnten Haus, das wäre eine zu große Bevorzugung, das wäre geradezu eine Belohnung für die Mischehe. Das konnte nicht geduldet werden. Also warteten alle gespannt darauf, wie sich dieses Problem lösen würde.
»Ein jüdischer Mann in der Wohngemeinschaft, und der Haushalt, der Wohnraum gilt als jüdischer«, betonte der Nachbar Meyer, der die Solmitz schon seit einiger Zeit nicht mehr grüßte. Stella fragte sich, ob auch ihr Wohnraum als jüdischer galt. Immerhin lebte bei ihnen ein Jude. Ob wohl auch bei ihnen bald jemand einquartiert werden würde? Immerhin hatten sie acht Zimmer für sechs Personen. Jonny zählte zum Glück mit, obwohl er die meiste Zeit fort war. Sie hatte nichts dagegen, wenn ein Jude bei ihnen einquartiert würde, aber sie stellte sich vor, welches Theater Cynthia und vielleicht auch Eckhardt machen würden.
Die Nachbarschaft in der Kippingstraße wurde enger. Es war leichter, am Abend Nachbarn zu besuchen als weiter entfernte Freunde, denn wenn der Alarm losging, konnte sich jeder in sein Haus, in seinen Keller begeben, was vor allem deshalb bevorzugt wurde, weil jeder auf sein Haus achtgeben wollte. Splitter mussten möglichst sofort entfernt, Brände gelöscht werden. Alle hatten zwar Angst um ihr Leben, aber sie waren mehr denn je mit ihren Häusern verbunden. Das war ihr Zuhause, das war ihr Halt. Selbst wenn die Häuser in der Kippingstraße über den Menschen in den Besenkammern oder Vorratskellern zusammenfallen würden wie ein Kartenhaus, so boten sie dennoch den Schutz der eigenen vier Wände, ein irrealer Schutz zwar, der aber umso deutlicher empfunden wurde.
Ein Zuhause umhüllt einen Menschen wie erweiterte Kleidung, wie eine Schutzhaut. In einem Zuhause gibt es Vertrautheit, und Vertrautheit kommt von Vertrauen. Ein Zuhause bietet das Vertrauen, bei sich selbst zu sein. Da riecht es nach dem eigenen Körper, da ertönt die eigene Stimme, da sieht das Auge die Dinge, die einen selbst widerspiegeln. Und da sind die Menschen, zu denen man Vertrauen hat. Im eigenen Zuhause darf man sich unverstellt zeigen, darf angstfrei sagen, was man auf dem Herzen hat, ja, man darf sogar Dinge tun, die in der Öffentlichkeit verpönt sind wie schmatzen oder furzen. Oder Witze über Hitler erzählen.
In den Luftschutzbunkern hingegen wurde es zwar üblich, im Nachthemd oder mit Lockenwicklern zu erscheinen, aber alles war fremd: Die Menschen, der Geruch, die Geräusche, das, worauf der Blick fiel, verlangte Anpassung. Und das in der Todesangst der Bombenabwürfe.
Nein, die Menschen in der Kippingstraße bevorzugten ihre Häuser. Und jeder, der zu Besuch war und während des Angriffs im Haus blieb, wurde eingespannt, um das Haus zu schützen, Flaksplitter zu entfernen, Brände zu löschen, das Dach zu kontrollieren.
Also besuchten die Nachbarn einander am Abend, unterhielten sich, spielten Schach oder Skat oder auch Mensch ärgere Dich nicht. Bombenlose Nächte hatten einen Namen bekommen: Bolona. In den Bolonas genossen sie es, die Besuche erst um Mitternacht oder später zu beenden, dann legten sie ihren kurzen Weg nach Hause zurück, gewärmt, fröhlich, um einen geselligen Abend reicher. Es trafen sich natürlich nur die Nachbarn, die ungefähr die gleiche Gesinnung teilten, so dass man sich auch da untereinander zu Hause fühlte und keine unangenehmen Überraschungen erleben musste.
Juden durften nicht von Ariern besucht werden, darauf stand Schutzhaft. Seit Aaron den Stern trug, blieben Lysbeth und Aaron abends zu Hause.
Die Solmitz hingegen verließen oft ihr Haus mit einer Flasche Bier oder Wein unter dem Arm, ihnen standen immer noch viele Türen offen. Da Fred keinen Stern trug, brachten sich die Menschen, die zu ihm Kontakt hatten, nicht in Gefahr.
Cynthia und Eckhardt besuchten besonders gern die Nachbarn, die im Luftschutz, in der Partei oder in der Frauenschaft aktiv waren und mit denen sie die neuesten deutschen Kriegserfolge feiern und debattieren konnten. Sie hatten neuerdings eine Weltkarte ins Treppenhaus gehängt, und auf dieser Karte wurden regelmäßig die deutschen Siege mit kleinen Hakenkreuzfähnchen markiert. Damit hatten sie eine eindeutige Duftmarke gesetzt: In diesem Haus werden deutsche Siege gefeiert. Jeder Besucher bekam auf diese Weise direkt nach dem Eintreten den vermeintlichen Geist des Hauses zu spüren.
Stella, Lysbeth und Aaron hatten in den vergangenen Jahren nicht besonders häufig Nachbarn besucht, eher hatten sie Besuch empfangen. Als Käthe noch gelebt hatte, war das Wohnzimmer stets voller Menschen gewesen. Manchmal hatten sich auch Nachbarn zu den kleinen spontanen Feiern eingefunden, bei denen Stella und Dritter Klavier gespielt und Stella gesungen hatte. Jetzt mussten sie sich auch in dieser Hinsicht neu orientieren.
Aaron empfand es als harte Strafe, dass sein Kontakt zu anderen Menschen so eingeschränkt worden war. Er durfte nicht mehr ins Kino gehen, das war Juden verboten, ebenso der Besuch von Restaurants und allen übrigen Vergnügungsstätten. Bevor er den Stern trug, war er manches Mal noch mit Lysbeth und Stella ins Kino gegangen, in einen anderen Stadtteil, damit kein Nachbar ihn sehen konnte. Aber das war jetzt unmöglich geworden.
Stella langweilte sich. Sie sehnte sich nach neuen Eindrücken, der Kriegsalltag ödete sie an. Sie trug eine große Bereitschaft in sich, neue Menschen kennenzulernen. Im Spätsommer war sie während der üblichen nachbarschaftlichen Plaudereien beim Fleischer und bei der Gemüsefrau auf eine junge Frau aufmerksam geworden, die ein angenehmes Gesicht mit nach oben gebogenen Mundwinkeln hatte, so dass sie immer aussah, als ob sie lächelte. Also arrangierte Stella es so, dass sie gemeinsam mit der jungen Frau den Gemüseladen verließ. Zufällig hatten sie den gleichen Weg. Angeregt unterhielten sie sich über die Situation der Einquartierten, die in einem fremden Haus unfreiwillig als Untermieter wohnen mussten. Gerlinde, so hieß die junge Frau, und ihr Mann Peter waren ausgebombt und in das Haus an der Ecke Kielortallee und Kippingstraße in ein Zimmer einquartiert worden.
Stella lud Gerlinde und ihren Mann nach einigen weiteren zufälligen Gesprächen zu einem Abend mit Wein und Keksen ein. An jenem Abend stellte sie fest, dass Peter wunderschön Klavier spielen konnte. Stella und er hörten gar nicht wieder auf, vierhändig zu spielen, so viel Freude bereitete es ihnen. Gerlinde hatte eine angenehme Altstimme. Stella kramte ihr altes Repertoire aus ihrem Gedächtnis hervor, und die beiden waren begeistert von ihren Liedern. Dieser Abend war eine der glücklichen Bolonas, aber er war auch ein besonders glücklicher für Stella, die endlich einmal wieder ihre Sorgen vergessen hatte und ihre Musik in fröhlicher Ausgelassenheit mit anderen Menschen genießen konnte.
Nach diesem Abend besuchten die beiden Stella häufig. Bei diesen Gelegenheiten öffnete Stella eine Flasche Wein aus Jonnys Beständen, Peter brachte sein Kriegsbier mit, sie warfen die Knabbereien zusammen, die sie irgendwo aufgetrieben hatten, und saßen oben bei Stella im Wohnzimmer, unterhielten sich und musizierten miteinander. Gerlinde hatte eine Triangel mitgebracht, das war ihr instrumenteller Beitrag. Ansonsten feuerte sie die beiden anderen an und ließ ihre schöne Stimme ertönen.
Zuerst tastete Stella sich langsam vor, worüber sie mit Gerlinde und Peter sprechen konnte, und sie merkte, dass die beiden das Gleiche taten. Peter war vom Kriegsdienst freigestellt, weil er als Drucker beim Hamburger Fremdenblatt arbeitete. Diese Zeitung war vor 1933 sozialdemokratisch gewesen, seitdem verbreitete sie Nazi-Propaganda. Stella wusste, dass die Drucker unter den Handwerkern als besonders gebildet galten. Die Drucker beim Hamburger Fremdenblatt waren vor dem Krieg ebenso wie der Chefredakteur und der Verleger sozialdemokratisch und gewerkschaftlich aktiv gewesen. Wozu gehörte also Peter? Zur Nazi-Linie oder zu den Druckern, die jetzt ihren Mund hielten, weil direkt nach der Machtergreifung die politisch aktivsten unter ihnen gleich ins Gefängnis geworfen worden waren?
Ende September erzählte das Paar von einem Brief, den sie von einer Tante bekommen hatten, deren zwanzigjähriger Sohn vor St. Petersburg gefallen war. »Es ist ein sehr heldischer Brief«, sagte Peter spöttisch. »Er endet mit den Worten: ›In stolzer Trauer‹.« »Wie abstoßend«, entfuhr es Stella. Sie war etwas erschrocken über ihre unvorsichtige Bemerkung, da traute Gerlinde sich offenbar auch mehr als sonst. »Ich kann diese Heldenmütter einfach nicht ab.« Stella nickte erleichtert. Peter lachte. »Wir nennen sie die ›Flintenfrieda‹. Sie heißt nämlich Frieda.«