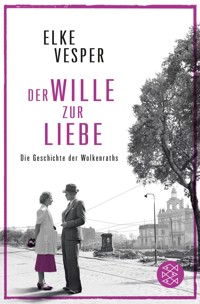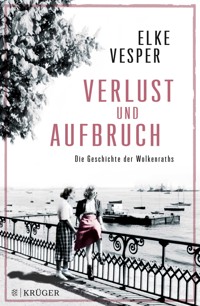
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geschichte der Wolkenraths
- Sprache: Deutsch
Zwischen Wirtschaftswunder und Flower-Power – der fünfte Teil der großen Saga um die Hamburger Familie Wolkenrath 1952: Die gesamte Familie Wolkenrath lebt jetzt wieder zusammen im Haus in der Kippingstraße. Lysbeth und Aaron arbeiten als Ärzte und beobachten mit Entsetzen, wie viele alte Nazis immer noch wichtige Positionen in der Gesellschaft innehaben. Stella zieht es immer wieder in ihre Geburtsstadt Dresden, wo sie mit der Realität im Osten Deutschlands konfrontiert wird. Währenddessen singen die Beatles in Hamburger Clubs, protestieren Studenten auf der Straße gegen den Muff von tausend Jahren, und die Frauen beginnen, für ihre Rechte zu kämpfen. Was wird die neue Zeit für die Wolkenraths bereithalten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1341
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Elke Vesper
Verlust und Aufbruch
Die Geschichte der Wolkenraths
Über dieses Buch
1952: Die gesamte Familie Wolkenrath lebt jetzt wieder zusammen im Haus in der Kippingstraße. Lysbeth und Aaron arbeiten als Ärzte und beobachten mit Entsetzen, wie viele alte Nazis immer noch wichtige Positionen in der Gesellschaft innehaben. Stella zieht es immer wieder in ihre Geburtsstadt Dresden, wo sie mit der Realität im Osten Deutschlands konfrontiert wird. Währenddessen singen die Beatles in Hamburger Clubs, protestieren Studenten auf der Straße gegen den Muff von tausend Jahren, und die Frauen beginnen, für ihre Rechte zu kämpfen. Was wird die neue Zeit für die Wolkenraths bereithalten?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
©2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Vintage Germany / Karin Schröder, www.buerosued.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490257-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
[Widmung]
[Personenverzeichnis]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
Das wahre Maß des Lebens ist die Erinnerung.
Walter Benjamin
Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen.
William Faulkner
Diesen Roman widme ich Rüdiger Regenstein, Inspirator aller Wolkenrath-Romane, mit tiefem Dank für seine Freundschaft und Loyalität.
1
Marthe versuchte mit ihrem schmalen Mund sogar ein Lächeln, als sie ihren Mann anschaute, der aber seinen Blick starr nach vorne gerichtet hielt. Sein Name lautete Alexander Wolkenrath, so hieß er in dritter Generation, weshalb seine Schwester Stella ihn irgendwann Dritter genannt hatte. Als Marthe ihn vor elf Jahren kennengelernt hatte, gehörte dieser Name bereits zu ihm wie seine frühe Kahlköpfigkeit. Eingequetscht zwischen ihm und der Wagentür, machte sie sich schmaler, als sie ohnehin schon war, um Dritter nicht zu viel Platz wegzunehmen, der sonst vielleicht in die Verlegenheit käme, Josef, der sie freundlicherweise in seinem Hanomag von Ratekau nach Hamburg fuhr, beim Bedienen der Gangschaltung zu behindern.
Josef war Schmied, und er zitierte gern aus der Bibel. Das hatte er auch getan, als er nach einem letzten Bier in der einzigen Kneipe von Ratekau Dritter linkisch den Arm um die Schulter gelegt und gesagt hatte: »Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Dat is von Jesaja. Ick foar di no Hamborch, min Jung.«
Dritter hatte es, weil er es furchtbar komisch fand, in derselben Nacht noch Marthe erzählen wollen, damit sie endlich mal wieder etwas zu lachen hatte, sie war aber schon eingeschlafen und hatte also nur Kauderwelsch verstanden und nichts komisch gefunden, weder aus ihrem als einzigen Lebensquell empfundenen Schlaf aufgeweckt zu werden, noch was ihr Mann ihr da mit seinem Bieratem entgegenfaselte.
Am nächsten Morgen jedoch hörte sie ihm zu, überraschte ihn dann aber mit einer alles andere als amüsierten Reaktion: »Diese Religiösen lügen wie gedruckt. Er führt uns nicht in sein Haus, er entfernt uns aus seinem Dorf, so schnell er kann, als hätten wir Lepra.« In Dritters verwirrtes Gesicht hinein fauchte sie, und es klang so entsetzlich bitter, dass er sich schämte für das, was aus seiner Frau geworden war: »So einen Versager wie dich will keiner in seinem Haus, nicht mal drei Straßen weiter haben.« Nach einer kurzen Pause, in der sie, atemlos vor Zorn, kein Wort mehr herausgebracht hatte, stieß sie noch hervor: »Und sein Jung bist du auch nicht, eher ist er dein Jung.«
Böswillig erinnerte sie ihn damit daran, dass Dritters Söhne im Alter von fünf, sieben und zehn im Alter von Josefs Tochter waren. Deren Großvater war jünger als Dritter.
Nun saßen sie also auf der Vorderbank des dreirädrigen Autos, das in jeder Kurve umzukippen drohte, hinten auf der Ladefläche zwischen allen möglichen zusammengerafften, scheinbar wertvollen und fürs Leben notwendigen Sachen, ihre zwei jüngsten Söhne Wilhelm und Peter. Alexander, der Älteste der drei, war schon vor Monaten nach Hamburg zu seinen Tanten gezogen, um auf den Besuch des Gymnasiums vorbereitet zu werden.
Von Zeit zu Zeit kontrollierte Marthe durch die schmale Glasscheibe zwischen Fahrerkabine und Ladefläche, ob sie auch keinen Unfug anstellten. Sie konnte zwar nicht hören, was die Jungs sagten, aber sie schienen viel Spaß zu haben, denn ihre Gesichter waren hell und neugierig auf die Fahrbahn hinter ihnen, auf die Felder und Wiesen rechts und links und einander zugewandt. Wenn ein Auto hinter ihnen fuhr, was immer nur kurz vor dem notwendigen Überholmanöver geschah, fuchtelten und winkten Wilhelm und Peter wie verrückt, und Marthe bemerkte, dass viele der Insassen der vorbeifahrenden Autos lächelnd darauf antworteten. Wenn die wüssten, was für ein Elend hier kutschiert wird, dachte sie.
Es war nicht das erste Mal, dass sie daran zweifelte, ob ihre Entscheidung, diesen Mann vor elf Jahren, am 1. September 1941, zu heiraten, die richtige gewesen war. Nun, im Grunde zweifelte sie gar nicht mehr, sie wusste, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Die Zeit seit ihrer Eheschließung hatte mehr oder weniger einem Albtraum geglichen. Erst seit sie 1945 – ermöglicht durch ihre guten Beziehungen zu Major Tom, was wiederum ermöglicht worden war durch ihre guten Englischkenntnisse – auf die ehemalige Flakstation in Ratekau gezogen waren und Dritter seine hochfliegenden Pläne von einer Fabrik, in der Herde hergestellt werden sollten, zielstrebig von Tag zu Tag verfolgte, zumindest schien es so, und sie gleichzeitig aufgrund des weitläufigen Geländes und einiger Helfer so etwas wie Landwirtschaft betrieben, wenigstens so viel, dass sie regelmäßig zu essen hatten, erst seitdem hatte Marthe wieder Hoffnung geschöpft, dass ihre Vorstellung vom Leben vielleicht doch irgendwann verwirklicht werden könnte. Sogar mit diesem Mann.
Diese Hoffnung hatte sich nun zerschlagen. Dritter war grandios gescheitert, er konnte seine Rechnungen schon seit längerem nicht mehr bezahlen, und er musste sowohl die Fabrik mit den Werkzeugen, die Zeichentische der Ingenieure wie auch das Wohnhaus und die Landwirtschaftsgeräte holterdipolter zurücklassen.
»Holterdipolter«, das war das Wort, das sie benutzt hatte, damit die Jungs etwas zu lachen hatten, als sie die Ladefläche des Hanomag mit den Möbeln und dem Hausrat beluden, von dem Marthe sich nicht trennen wollte.
Wilhelm und Peter saßen auf einem zusammengerollten Teppich, vor ihnen Kisten voll edelsten Geschirrs und Kristalls, das aus der Zeit stammte, als Dritter zurückgelassenes Eigentum geflohener Juden ersteigert hatte. Zwei Koffer enthielten ihre Kleidung. Während des Einpackens war Marthe sehr sauer aufgestoßen, dass die Anzüge und Schuhe ihres Mannes mehr Platz beanspruchten als ihre wenigen Röcke und Blusen und ihre zwei Paar schwarzen Pumps. Seit Jahren schon verfolgte Marthe das Ziel, gediegen gekleidet zu sein. Gediegenes Understatement, das war ihr Wahlspruch, geprägt durch die Zeit als Aupair in London, die sie bis heute als Schmuck ihres Lebens mit sich trug und vorzeigte wie andere Frauen einen wertvollen Diamantring. Für die Präsentation ihrer Gediegenheit reichten zwei schwarze Röcke und zwei weiße Blusen, dazu noch eine schwarze Bluse für festliche Anlässe, die Eleganz unterstrich sie mit einer Perlenkette. Dazu zwei Paar schwarze Pumps und zwei Paar Nylonstrümpfe. Dritter hingegen besaß vier Anzüge, zwei mit Nadelstreifen, einen dunkelblauen, einen sommerlich hellen, und die Anzahl seiner Schuhe ging ins Lächerliche. »So viele Schuhe brauchen nur Nutten«, hatte sie verächtlich gemurmelt, als sie den Inhalt der Schränke in die Koffer verstaute. Aber sie hatte jeden einzelnen Schuh mit Zeitungspapier umwickelt und ihn zwischen die Kleidung in die Koffer gequetscht. Erst als sie merkte, dass auf diese Weise kein Platz mehr für die Kleidung der Söhne blieb – und die besaßen außer den Lederhosen nur wenig –, hatte sie die Schuhe seufzend wieder herausgerissen und in einen Pappkarton geworfen. Ein zweiter Karton musste für die Gummistiefel der Jungs herhalten, sie selbst hatte beschlossen, ihre Gummistiefel mit dem Hausrat in Ratekau denjenigen zu hinterlassen, die damit etwas anfangen wollten. Und konnten. Vielleicht würde die Station auch geplündert werden, niemand wusste, was geschehen würde, wenn Dritter mit seiner Familie verschwunden war.
Er hatte schon lange gewusst, dass ihm das Wasser bis zum Hals stand, bevor er es Marthe endlich gebeichtet hatte. Er hatte die vielen Gläubiger wortgewaltig so lange vertröstet, bis ihm nichts anderes übrigblieb, als alles Inventar zurückzulassen und einfach zu verschwinden. Bei ihm war nichts mehr zu holen, die Seifenblase einer Fabrik von Herden und anderen Elektroartikeln war geplatzt, nun musste er sein nacktes Leben retten – und das seiner Familie.
Niemals in ihrem Leben, so schwor Marthe sich, als sie mit entschiedenem Schwung ihre Gummistiefel neben die Eingangstür zurückplatzierte, wo sie sie unschlüssig hochgenommen hatte, niemals mehr würde sie solche ungemütlichen, den Gang hässlich verunstaltenden Treter an ihre Füße lassen. Ihre schmalen Lippen umspielte ein leises versöhnliches Lächeln, als sie beschloss, bis zu ihrem Tod nur noch schwarze Pumps zu tragen, auch im Hause, Pantoffeln kämen ebenfalls nicht mehr an ihre Füße.
Der Hanomag rumpelte durch Schlaglöcher. Anfangs hatten Wilhelm und Peter es noch witzig gefunden, wie sie in die Höhe geschleudert wurden und dann hinunterplumpsten, inzwischen versuchten sie, die übelsten Löcher auszugleichen. Marthe bemerkte, wie ihre Söhne missmutig wurden, sich verstohlen die Hintern rieben und nach einiger Zeit, als niemand ihnen zu Hilfe kam, versuchten, es sich etwas bequemer zu machen, indem sie Bettwäsche auf den Teppich stopften und sich aneinanderlehnten. So schaukelten und hopsten sie auf der Ladefläche langsam in den Schlaf.
Auch Marthes Kopf wackelte hin und her, sie war versucht, ihn auf Dritters Schulter abzulegen, aber das verbot sie sich. Sie hatte am Morgen ihre Haare so gut wie möglich frisiert, um den Schwägerinnen nicht vollständig verwahrlost entgegenzutreten. Also erlaubte sie sich nur, den Kopf leicht an die Scheibe zu legen, wo jedes Schlagloch allerdings verhinderte, dass sie irgendwie einschlummerte. Schließlich wollte sie weder ihre Frisur noch ihren Kopf und schon gar nicht die Scheibe beschädigen. Wie viel Zeit schließlich vergangen war, als sie endlich in Hamburg in der Kippingstraße anlangten, vermochte sie nicht mehr einzuschätzen.
Die Jungs schliefen noch, und das erleichterte Dritter und Josef, die Ladefläche zu leeren und die Sachen auf den Gartenweg vor dem Haus abzustellen, ohne dass ihnen die zwei im Wege waren. Marthe stand unschlüssig daneben. Was sollte sie tun? Was würde jetzt geschehen? Sie hatten zwar geklingelt, aber im Haus bewegte sich nichts. Marthe setzte sich auf einen Pappkarton.
Sie wusste, dass Dritters Geschwister nicht gerade begeistert gewesen waren, als sie erfuhren, dass zusätzlich zu dem bereits im Haus wohnenden ältesten Sohn die ganze restliche Familie einfallen würde. Dritter hatte zwar kein Wort darüber verloren, aber sie ahnte, dass er sich einiges hatte ausdenken müssen, um vorübergehend Obdach gewährt zu bekommen.
In dem Haus wohnten Dritters Schwester Lysbeth mit ihrem Mann Aaron, der, obgleich Jude, die Nazizeit überlebt hatte, und das auch, weil die arische Familie Wolkenrath getreu ihrem Wahlspruch »Blut ist dicker als Wasser« den Mann ihrer Schwester als Familienmitglied immer wieder geschützt hatte. Lysbeth und Aaron, dessen war Marthe sich sicher, hatten bestimmt Verständnis für ihre verzweifelte Lage. Anders als Cynthia, der Frau von Dritters älterem Bruder Eckhardt. Cynthias Verehrung für Hitler hatte das Ausmaß einer sexuellen Obsession angenommen, sie verehrte Sieger, und sie verachtete den Bruder ihres Mannes, Alexander der Dritte, weil der sich immer wieder als Verlierer auf ganzer Linie erwies. Dritters Schwester Stella bewohnte die obere Etage des Hauses, aber sie hielt sich lange Zeiten in England bei ihrem Liebsten Anthony Walker auf, einem erfolgreichen Schriftsteller, was jedoch glücklicher klang, als es war, weil Stella bis zum heutigen Tage, sieben Jahre nach Kriegsende, immer noch nicht gewagt hatte, sich von ihrem Ehemann, dem Kapitän Jonny Maukesch, scheiden zu lassen. Während Stellas Abwesenheit bestand also die Gefahr, dass Jonny die obere Etage bewohnte, und Jonny hatte Dritter bereits einmal verklagt, weil der ihm ein Schwein, für dessen Mästung Jonny nach dem Krieg während des allgemeinen Hungerns seinem Schwager Geld gegeben hatte, nie hatte zukommen lassen, und weil er ihm eine ausgeliehene Schreibmaschine nicht zurückgegeben hatte. Jonny war also, so vermutete Marthe, nicht unbedingt versessen darauf, mit der Familie von Dritter unter einem Dach zu wohnen. Blieb noch Eckhardt, Dritters älterer Bruder, Ehemann von Cynthia. Sie hatten damals sogar eine Doppelhochzeit gefeiert, Dritter und Marthe und Eckhardt und Cynthia. Eckhardt folgte Cynthia wie ein ängstlicher Hund. Dass dies aus Liebe geschah, bezweifelte Marthe, seit sie die beiden kannte, aber eins war gewiss: Wenn Cynthia ihr die Anwesenheit in diesem Haus zur Hölle machen würde, würde ihr Mann ihr keinen Widerpart bieten.
Länger als vorübergehend, so hatte Marthe ihrem Mann eindeutig klargemacht, wäre sie nicht bereit, sich mit ihrer ganzen Familie in das kleine Zimmer zu quetschen, das als »Gartenzimmer« bezeichnet wurde, weil es der Zugang zum Garten war, der von allen auch weiterhin benutzt werden würde, das hatten Dritters Geschwister verlangt, und so hatte Dritter es wiederum seiner Familie erklärt, ohne auch nur ein leises Murren des Widerspruchs zu dulden. Zugleich hatte er hoch und heilig versprochen, sowohl seiner Frau als auch seinen Geschwistern, dass das Ganze ein Intermezzo sein würde von allerhöchstens zwei Monaten, dann würden sie in ihr Haus in der Johnsallee ziehen. Dort mussten nur noch die Mieter der unteren Etage das Haus verlassen. Eckhardt, der ansonsten eher sanft und vorsichtig war, hatte sich Dritters Plänen besonders vehement widersetzt, hatte sogar schriftlich die Drohung ausgesprochen, dass er juristische Maßnahmen ergreifen werde, sollte Dritter sich nicht an die Abmachungen halten. Diese Drohung hatte Marthe besonders geängstigt, denn wenn schon Eckhardt sich so verhielt, was würde dann seine Frau tun oder Jonny Maukesch.
Marthe entdeckte ihren Sohn Alexander, der gemessenen Schrittes an der Hand seiner Tante Cynthia auf das Haus zustrebte, in dem er seit Monaten wohnte und vor dem der olivfarbene verbeulte Hanomag des Schmieds parkte, in dem seine Familie aus Ratekau gekommen war. Marthes Magen krampfte sich zusammen, als sie den kurzen Ruck sah, der durch Alex ging, als er seine Brüder erkannte, die nach wie vor auf der Ladefläche ausgestreckt schliefen. Sie sah auch, wie Cynthias Griff fester wurde und Alexander wieder in den gleichen Schritt fiel wie zuvor, ohne Eile gleichmäßig voranstrebend. Wie ein marschierender Soldat, dachte Marthe, und am liebsten hätte sie der Schwägerin die Hand ihres Sohnes entrissen. Sie verfluchte sich selbst, dass sie Alex in die Obhut dieser Frau gegeben hatte, nur damit er auf die »Höhere Schule« gehen und Abitur machen konnte.
In diesem Augenblick, wie durch Zauberei, wachte Wilhelm auf, rieb sich die Augen, rüttelte an Peters Schultern und rief: »Aufwachen, du Schlafmütze! Wir sind da.« Er erblickte seinen älteren Bruder, den er unendlich vermisst hatte, seit der aus Ratekau fort nach Hamburg gezogen war. »Alex!«, schrie er, und mit der ihm eigenen körperlichen Behändigkeit sprang er auf, vom Wagen herunter und rannte auf Alex zu, fröhlich wie ein junger Hund auf einen Spielkameraden. Leicht peinlich berührt verzog Alex seinen Mund, blickte fragend zu seiner Tante, die zögernd seine Hand losließ, und streckte Wilhelm den Arm entgegen. Der achtete gar nicht darauf, er schmiss sich dem Bruder an die Brust und sprang an ihm hoch. »Du bist gewachsen!«, rief er. »Mensch, so groß warst du doch letztes Mal noch nicht!« Da schlich sich ein verstohlenes Grinsen auf Alex’ Gesicht. »Sieben Zentimeter«, verkündete er stolz. »Onkel Eckhardt hat mich vermessen.«
Marthe hatte keinen Schritt auf ihren Sohn zu gemacht. Er sollte zu ihr kommen, hatte sie beschlossen, als sie den Gleichschritt von Schwägerin und Sohn beobachtet hatte. Nun aber hielt es sie nicht länger, sie durchmaß den Gartenweg mit schnellen Schritten und schloss ihren Sohn in ihre Arme. Sie unterdrückte die Tränen, die in ihr von der Brust hochschießen wollten, als sie merkte, wie sich Alex in ihrer Umarmung versteifte. Seine Arme hingen an ihm herab, seinen Kopf hielt er starr von ihr abgewandt. Die Genugtuung, sie weinen zu sehen, würde sie der Schwägerin nie zuteil werden lassen.
Was ist los mit ihm?, schrie es in ihr. Aber bevor sie auf die Antwort ihrer inneren Stimme horchen konnte, war auch Peter von der Ladefläche gehüpft und hängte sich an Alex’ Schultern, hangelte sich am Rücken des Bruders hoch, bis er wie ein Rucksack an ihm hing, die Beine um seine Taille geklemmt.
Alex machte sich hastig von seiner Mutter los und trottete ein paar Schritte mit dem Bruder hin und her auf dem Gartenweg, bis er ihn abschüttelte. »Das reicht! Ich bin ja kein Pferd«, sagte er streng. Peter gehorchte sofort.
Cynthia näherte sich, reichte allen höflich die Hand, auch sie auf diese seltsam starre Weise wie Alex, als wollte sie ihr Gegenüber in möglichst großer Entfernung halten. Sie schloss die Haustür auf, bemerkte kühl: »Ihr wisst ja, wie der Weg nach unten geht. Wenn ihr alles ausgeladen habt, sagt Bescheid, dann koche ich euch einen Kaffee.« Sie legte eine Hand auf Alex’ Kopf und führte ihn so mit sich: »Wir beide schauen uns erst mal deine Hausaufgaben an.« Alex folgte ihr selbstverständlich zu ihrer Wohnung, die fünf Treppenstufen höher lag als die Eingangstür. Dritter sah ihnen mit zusammengekniffenen Augen nach, wandte sich seinen beiden jüngeren Söhnen zu und sagte knapp: »Fasst mit an!«
Wilhelm hatte auf der Flakstation gelernt, bei der Arbeit anzupacken, wenn Not am Mann war. Also griff er selbstverständlich zu, um Kartons herunterzuwuchten. Peter wurde verboten, gemeinsam mit Wilhelm die Kartons die Treppen hinabzutransportieren, in denen sich zerbrechliche Dinge wie Geschirr oder Gläser oder Vasen befanden. Er durfte die Gummistiefel tragen. Zumindest mit dem Wetter hatten sie Glück. In den vergangenen Tagen hatte es geregnet und gestürmt, heute schien sogar die Sonne. »April, April, der macht, was er will«, hatte Wilhelm gesungen, nachdem Josef gegrummelt hatte: »April is wie mine Fru, unberechenbar.«
Als das Gartenzimmer vollgestellt war – Marthe fragte sich, wo sie nun noch Platz finden sollten für das mitgebrachte Bett –, sagte Josef energisch: »So, Lüd, nu bruk ik n anständigen Bohnenkaffee.« »Wilhelm«, kommandierte Dritter und wies mit dem Kinn nach oben. Gehorsam rannte Wilhelm die Treppen hinauf, klopfte an die Tür der Tante, öffnete sie vorsichtig, bevor er etwas gehört hatte, rief: »Wir sind fertig, du sollst Kaffee kochen!«, und rannte wieder die Treppen hinunter, als hätte er Angst, von einer bösen Hexe verfolgt zu werden.
Es dauerte nicht lange, und sie saßen um den großen Tisch in der Küche im Souterrain versammelt, die »Herrschaftsküche« genannt wurde, obwohl niemandem mehr ersichtlich war, was an diesem dunklen, irgendwie Kälte und Feuchtigkeit ausstrahlenden Raum mit den vergilbten Kacheln herrschaftlich sein sollte. In der Mitte des Tisches dampften Schwaden aus einer goldverzierten Kanne, und der Duft nach Kaffee verzauberte die Luft. Um sie herum lagen unzählige Windhunde auf dem Fußboden.
Plötzlich standen Lysbeth und Aaron in der Küche. Niemand hatte sie kommen hören. »Es tut mir so leid, dass wir nicht da waren, als ihr kamt, aber ich konnte mich nicht früher freimachen«, sagte Lysbeth und umarmte alle der Reihe nach, wobei sie ihrer Schwägerin Cynthia ebenso wie Josef nur die Hand reichte. Aaron klopfte den Männern auf die Schulter, ebenso den drei Brüdern. Bevor er Marthe umarmte, hielt er sie auf Armlänge entfernt, um sie besser betrachten zu können. »Mit Verlaub«, sagte er lächelnd, »aber die Landluft ist dir gut bekommen, du siehst besser aus denn je.« Marthe errötete. »Das wundert mich nicht«, warf Cynthia spitz ein, »auf dem Lande gibt es alles satt. Im Gegensatz zur Stadt, wo wir für unser täglich Brot hart arbeiten müssen.« Marthe verschluckte eine patzige Antwort. Wie sollte sie jetzt davon sprechen, dass ihr Alltag kein Zuckerschlecken gewesen war, wo sie doch als Schmarotzer hier unterkriechen mussten.
Lysbeth trank einen Schluck Kaffee und sagte dann: »Liebste Cynthia, um der Wahrheit die Ehre zu geben, hungern tut hier im Haus niemand, oder siehst du das anders?« Cynthia wandte ihr das Gesicht zu, und es wirkte, als wollte sie Lysbeth mit ihrer spitzen Nase aufspießen. »Dass hier niemand hungert, liegt daran, dass hier alle arbeiten und keiner schmarotzt.«
Josef sagte bedächtig, Wort für Wort in schönstem Hochdeutsch betonend: »Ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit, und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen, und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen! Jesaia.«
Aller Augen richteten sich auf ihn, der seelenruhig seine Tasse noch einmal vollschenkte. Wilhelm stieß Peter in die Seite: »Siehst du, so ist das, mein Bruder, sei gefälligst barmherzig«, schnappte nach dem belegten Brot, das vor Peter auf dem Teller lag und stopfte es sich in den Mund.
2
Marthe hatte einiges zu tun mit ihrem Hass. Das war keine bellende Wut, kein keifender Ärger, kein knurrender Groll, ihr Hass war schneidend, beißend, ihr Hass war auf Vernichtung aus. Ihr Hass machte sie bekannt mit der Mörderin in ihr.
Marthe hasste ihren Mann dafür, dass sie als ungebetener Gast in diesem Haus wohnen musste, weil er mit der vielversprechenden Firma Wolkenrath und Söhne in Ratekau Schiffbruch erlitten hatte. Sie waren nun elf Jahre lang verheiratet, in diesen Jahren hatte sie fünf Kinder geboren, zwei Kinder an den Tod verloren, und das alles, obwohl sie nie darauf erpicht gewesen war, Mutter zu werden, denn im Grunde mochte sie Kinder nicht besonders.
Sie hatte mit diesem Mann ein Desaster nach dem anderen erlebt, all seine Versprechungen hatten sich als schillernde Seifenblasen entpuppt. Sie hatte nicht Mutter werden wollen, sondern Gattin eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Nun war sie Mutter, auch noch von drei Söhnen, obwohl sie unter einer beliebigen Menge von Kindern die Mädchen meistens noch am ansprechendsten fand, und sie war alles andere als eine Gattin, sie war die Frau eines Bankrotteurs.
Bei Kriegsende hatte sie Hoffnung auf eine hellere Zukunft geschöpft. Dritters Fähigkeit, günstige Gelegenheiten zu erkennen und zu ergreifen, hatte ihr als Licht in der Nachkriegsdüsternis gedient. Den Traum, Bürgermeisterin zu werden, hatte sie schnell aufgegeben, stattdessen musste sie wie eine Bäuerin auf matschigem Boden die Kuh Hyacinthe melken und die Kartoffeln aus der Erde klauben. Das war zwar nicht märchenhaft, aber während alle hungerten, gab es bei ihnen Milch und Kartoffeln satt. Außerdem gaukelten ihres Mannes Visionen für die Zukunft ihr das Bild einer Unternehmersgattin vor.
Sie erinnerte sich noch sehr gut daran, wie sie ihn kennengelernt hatte, einen stattlichen gutgekleideten Mann, der sie zum Plausch bei Kaffee und Kuchen in das exklusive Hotel Vier Jahreszeiten an der Binnenalster einlud und zum Tanztee ins Hotel Atlantik an der Außenalster, wo er tanzte wie ein junger Gott, obwohl er auch damals schon für ihre Verhältnisse ein alter Mann gewesen war. Er hatte sie mit vielem verführt, das aussah wie Gold, sich aber später als Blech entpuppte. Er hatte ihr sogar eine Zukunft in dem herrschaftlichen Jugendstilhaus in der Johnsallee in Aussicht gestellt, das er von einer jüdischen Familie für Brosamen erworben hatte. Stattdessen war er bei ihr und ihrer Mutter in der Gärtnerstraße untergekrochen und hatte sein Haus in der Johnsallee vermietet, um wenigstens ein geringes Einkommen zu haben. In so vielem hatte er sie getäuscht, und immer wieder hatte sie ihm verziehen, doch inzwischen überschritt die Menge dessen, was sie ihm verzeihen musste, ihre Kapazität des Verzeihens, so kam es ihr zumindest vor, seit sie in der Kippingstraße gestrandet waren.
Schöne Bilder, auch Fotos, müssen in Gold gerahmt sein, so lautete Marthes Credo, und deshalb stand ihr Hochzeitsfoto in einem Rahmen aus breitem, in Gold lackiertem Holz sogar jetzt, da sie kaum eigene Möbel hatten, auf dem Nachttisch neben dem Foto ihrer Mutter, die leider nach Cuxhaven zurückgezogen war, als Dritter mit seiner Familie in Scharbeutz Unterschlupf vor dem Krieg gefunden hatte.
Marthe hatte auf der Flakstation nicht lange in der Erde buddeln müssen, bald hatte sie eine Magd gehabt, und dann kam auch der Mann, den bald alle Onkel Wertmann nannten. Wertmann war in der Lage, eine unglaubliche Zuversicht zu verbreiten, das geschah allein, weil er Zuversicht und Sicherheit und Weitsicht im Überfluss besaß und wie absichtslos um sich herum verstreute. Bald ging ein Knecht Onkel Wertmann zur Hand bei der Bewirtschaftung der riesigen ehemaligen Flakfläche.
Die Anzahl der Bewohner der Flakstation wuchs ständig, und alle wurden satt. Das war in diesen Jahren nach dem Krieg ein Segen, von dem die Städter nur träumen konnten, weshalb sie in die Dörfer einfielen wie Kartoffelkäfer und die wertvollsten Dinge ihres Haushalts gegen Eier, Speck und Kartoffeln tauschten.
Marthe hatte ihr Leben als Ehefrau mit einer kleinen Aussteuer begonnen, inzwischen war ihr Haushalt vom Feinsten, zum einen, weil Dritter noch im »Reich« die »Nachlässe« der Juden billig ersteigert hatte, zum anderen, weil Marthe die meisten wirklich schönen Sachen ihres Hausrats gegen Eier und Kartoffeln und manchmal gegen Speck von den hungernden Städtern erworben hatte.
Sie hatte die Hühner gehasst, die auf dem eigens eingezäunten Acker im Matsch die ihnen hingeworfenen Körner aufpickten, deren Kot ätzend stank – Marthe bekam Atemnot, wenn der Knecht das Hühnerhaus mit der Spritze reinigte –, aber die Hühner hatten ihnen mehr Reichtum beschert, als es Dritter mit seinen unternehmerischen Spinnereien gelungen war.
Nun hatte Dritter wieder einmal alles vergeigt. Monatelang hatten sie gebangt, ob sie wenigstens die Baracke verkaufen könnten, die er als Fabrikgebäude ausgebaut hatte, um angeblich Herde herzustellen, wo große Zeichentische wie Schmuckstücke aufgereiht waren und sich davor sogar zeitweilig schon Zeichner aufgebaut hatten. Dritter, so war ihr jetzt klar, ernüchtert nach all den Illusionen, war ein Schaumschläger, ein Versager, ja, gewissermaßen ein Heiratsschwindler. Für all das hasste sie ihn.
Und jetzt war sie hier in diesem Haus gestrandet, das damals zu seiner Heiratsschwindelei dazugehört hatte, denn er hatte sie in dieses Haus geführt und so getan, als wäre es gewissermaßen auch seines, auf jeden Fall, als sei es das Haus seiner Familie, und diese Familie war unglaublich vorzeigbar: gebildet und schön und illuster. Jonny Maukesch, der Kapitän der Woermann-Linie, ein so schmucker Mann! Er hatte damals bei dem ersten Treffen seine Kapitänsuniform getragen, und seine Augen hatten so blau geblitzt, dass sie nicht umhinkam, ihn sich auf der Brücke eines Schiffes auszumalen, wo er die Richtung wies. Vielleicht, so grübelte Marthe heute zuweilen, habe ich mich von Dritter nur zum Heiraten verleiten lassen, weil ich eigentlich in Jonny Maukesch verliebt war. Eigentlich hätte sie lieber den Kapitän geheiratet, aber der war nun mal vergeben an die großartige Stella, auch das ein Argument, das für Dritter sprach, dass er nämlich eine so brillante Schwester hatte.
Sogar Cynthia in der strengen Kluft einer Anstaltsleiterin, gestärkte Bluse und Granatbrosche über blauem Faltenrock, sogar Eckhardt mit seinem seiner Frau ergebenen hündischen Blick, all das hatte sie für Dritter eingenommen, wirkte es doch so gediegen, so hamburgisch, so Vertrauen einflößend.
Schon damals hatte Dritter das Bild geschönt. Den Juden Aaron und seine etwas weltfremde Frau Lysbeth hatte er beim ersten Treffen vor ihr versteckt. Sonst hätte sie ahnen können, dass in dieser Familie nicht alles von purem Gold war, und seinen Bruder Johann und dessen dreizehn Kinder hatte Dritter ihr nie offenbart, das war zufällig vor ein paar Tagen aufgeflogen, als eine Todesanzeige ins Haus flatterte: Johann Wolkenrath wurde beerdigt. Darunter eine lange Liste von Kindern. Dritter hatte die Anzeige vor Marthe nicht so schnell verschwinden lassen können, wie er es beabsichtigt hatte. Also hatte er ihr Rede und Antwort stehen müssen.
So hatte sie erfahren, dass dieser Bruder der Auslöser dafür gewesen war, dass Dritter mehr als vier Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Auch das eine Sache, die er ihr nicht gestanden hatte, die sie erst von dem Arzt erfahren hatte, der 1941 die Ehetauglichkeitsuntersuchung durchgeführt hatte. Was verschwieg Dritter ihr noch? Mittlerweile hielt Marthe alles für möglich.
Aaron und Lysbeth waren ihr inzwischen die liebsten Familienmitglieder. Für deren Unterstützung bei ihrer ersten Geburt, der von Alexander dem Vierten, würde sie ihnen auf ewig dankbar sein. Die beiden hatten auch sofort das Gartenzimmer geräumt, damit Dritter und seine Familie ein eigenes Zimmer bekamen. »Früher hat die Tante da gelebt, jetzt wohnt ihr da, wir haben viel übrig für nette Nachbarn.« So waren die beiden.
Wenn sie ehrlich zu sich war, so wusste Marthe, dass sie das für Aaron und Lysbeth nicht getan hätte. Sie hätte es wahrscheinlich für niemanden getan, denn sie hatte den Eindruck, dass man im Leben seinen Platz erobern und behaupten musste, ihn freiwillig herzugeben, grenzte an Dummheit.
In dieser Hinsicht traf sie sich mit Dritter, in jeder anderen Hinsicht unterschieden sie sich voneinander wie ein Buch und ein Hammer. Sie hatten keinen Schnittpunkt, selbst bei ihren drei Söhnen war Marthe nicht davon überzeugt, ob ihr Mann und sie sich in der Liebe zu den Jungs trafen. Für Dritter erfüllten die drei gewisse Aufgaben: Alex sollte höher hinaus, er sollte Abitur machen und zeigen, was in Dritter gesteckt hätte, wenn er in seiner Entfaltung nicht durch die widrigen Umstände seiner Herkunft beschnitten worden wäre. Wilhelm sollte seinem Vater zur Hand gehen, er war praktisch veranlagt, so hatte Dritter entschieden und ihn bereits auf der Flakstation zu einfachen Arbeiten herangezogen, was leicht gewesen war, weil Onkel Wertmann, der im Grunde genommen den Laden geschmissen hatte, es verstanden hatte, Wilhelm so zu begeistern, dass der Junge ihm wie ein Welpe folgte. Und Peter, was war Peter für Dritter? Marthe wusste es nicht, denn Dritter übersah seinen dritten Sohn meistens, sie vermutete jedoch, dass er stolz auf dessen hübsches Gesicht und seine anschmiegsame Art war. Vielleicht bot Peter seinem Vater auch eine gewisse Befreiung von seinen Pflichten als Ehemann. Peters Zärtlichkeiten, seine körperliche Nähe, der Duft seiner Haut, die Berührung durch seine weichen Hände, all das beglückte Marthe mehr, als Dritter sie je hatte beglücken können. Peter konnte seine Mutter um den Finger wickeln, und er tat es auch. Marthe war nicht in der Lage, ihm zu widerstehen, allein bei Peter empfand sie eine Wärme und Liebe, die sie vielleicht früher für ihre Mutter empfunden hatte, die ihr aber ihr Mann und auch ihre beiden älteren Söhne nicht zu entlocken vermochten.
Ihre Liebe zu Peter flößte ihr eine Art von Verzeihen für Dritter ein, denn er hatte sie ja mit dem Jungen geschwängert, aber das schmälerte nicht ihren Hass. Vor allem hasste sie Dritter dafür, dass er sie in eine Falle gelockt hatte, aus der es kein Entrinnen gab. Er war siebenundfünfzig Jahre alt, sie ging auf die vierzig zu.
»Du hast mir meine Jugend gestohlen!«, hatte sie ihn angeschrien, als er ihr gestanden hatte, dass sie Ratekau verlassen und vorerst im Haus seiner Eltern, das nun das Haus seiner Geschwister war, unterkriechen mussten. Und er hatte ihr noch mehr gebeichtet, nämlich, dass er seinen Erbanteil bereits verwirkt hatte, indem er seinen ihm zustehenden Teil des Hauses als Sicherheit für Kredite gegeben hatte. Diese Kredite hatte er nicht abzahlen können, und also hatte Jonny Maukesch ihn bei den Gläubigern ausgelöst. Nun war Jonny Eigentümer des Hausanteils, der einmal Dritter gehört hatte. Es war Dritter ziemlich dreckig gegangen bei diesem Gespräch, und Marthe hatte gemerkt, dass er bei ihr Trost und Verständnis suchte für den Reinfall, den er mit seiner Firma erlitten hatte, in der er mit Herden beginnen und dann aber mit größeren industriellen Produkten fortfahren wollte. Er war der Hoffnungsträger der englischen Verwaltung von Ratekau gewesen, aber er hatte alles in den Sand gesetzt.
Nein, Marthe hatte ihm nicht den Trost und die Wärme geben können, die er sich von ihr erhoffte. Sie war eiskalt geworden, und schließlich war all das, was seit Jahren in ihr brodelte, aus ihr herausgebrochen wie bei einem Vulkan, und sie hatte geschrien: »Du hast mir meine Jugend gestohlen! Jetzt sitze ich hier mit drei Kindern und einem alten Mann, was soll bloß aus mir werden?« Sie war heulend aufgestanden, hatte Dritter abgeschüttelt und war hinausgerannt in die dunkle Nacht, die auf der ehemaligen Flakstation nur von dem Licht in ihrem Schlafzimmer erhellt wurde. In dieses Schlafzimmer hatte sie nicht zurückgewollt. Aber natürlich war sie dorthin zurückgekehrt, denn wo auf der Welt hätte sie sonst hingehen können?
Nun war sie hier in diesem Haus gefangen. Der einzige Platz, wo sie sich einigermaßen wohl fühlte, war ihr Bett, und die einzige Tätigkeit, die sie irgendwie beruhigte, war das Lesen von Romanen und neuerdings des Spiegel. Luise Solmitz, die im Haus gegenüber wohnte, versorgte sie täglich mit literarischem Nachschub, lachend sagte sie: »Du frisst die Bücher ja geradezu.« Aber man hörte ihr an, dass ihr Marthes Interesse an Literatur gefiel.
Manchmal weinte Marthe, aber selten. Dafür reichte ihre Kraft nicht, die verbraucht wurde von den notwendigsten hausfraulichen Verrichtungen, die sie ebenfalls hasste. In Ratekau hatte sie nicht kochen müssen. Auch die Wäsche hatte sie nicht waschen müssen. Sie hatte sich darum gekümmert, dass alles getan wurde, sie hatte den Überblick gehabt, darin war sie gut, darin war sie Dritter überlegen, der sich in all seinen Ideen und Plänen verlor, kaum hatte er das eine begonnen, liebäugelte er schon mit dem nächsten. Marthe wusste, wann die Wäsche gewaschen werden musste, wann die Kartoffeln zur Neige gingen, wann der Nachbarin ein Besuch abgestattet werden musste, damit sie freundlich gestimmt blieb. Marthe wusste auch, wie sie mit Major Tom umgehen musste, damit er für die Aufrechterhaltung der Privilegien von Dritter und seiner Fabrik sorgte. Marthe empfing Dritters Geschäftsfreunde und führte mit ihnen Gespräche, die denen lange in Erinnerung blieben, weil sie klug, gebildet und charmant war. Aber Marthe war keine deutsche Hausfrau. Sie hasste deutsche Hausfrauen vielleicht ebenso sehr wie sie Dritter hasste.
Der einzige Mensch – Lysbeth und Aaron vielleicht ausgenommen, aber die waren fast nie da, weil sie so viel arbeiteten –, mit dem sie sich in der Kippingstraße gut verstand, war Luise Solmitz, auch wenn diese ungefähr im gleichen Alter wie Dritter war und Marthe einen Abscheu gegen Menschen in Dritters Alter entwickelt hatte. Luise war ebenfalls keine Hausfrau. Sie beschäftigte ein Mädchen, sogar während der scheußlichen Jahre unter Hitler hatte sie eine Haushaltshilfe gehabt, obwohl das damals bestimmt nicht leicht für sie gewesen war, weil ihr Mann Jude war, worüber heute niemand mehr sprach, auch Luise und er selbst nicht. Man wusste nicht genau, war er nun Jude oder vielleicht nur halb oder gar nicht, immerhin war er doch Major im Ersten Weltkrieg gewesen, aber in der Nachbarschaft wurde gemunkelt, und auch Cynthia ließ Bemerkungen darüber fallen, dass es Schikane gegen ihn und Luise und auch gegen ihre Tochter Gisela gegeben hatte, die heute in Belgien wohnte. Oder war es Frankreich? Egal. Luise sprach fließend Englisch und Französisch, genau wie Marthe, die ja als Aupair in London gewesen war, also konnten die beiden in ihre Gespräche immer mal wieder kleine Redewendungen einflechten, die jemand Stumpfsinniges und Engstirniges wie Cynthia nicht verstehen konnte. Das brachte Marthe Spaß. Wenn sie zum Beispiel zu Luise summte: »Too late now …«, und damit ja nicht nur Englisch sprach, sondern auf den Film Königliche Hochzeit anspielte mit Fred Astaire und Jane Powell in den Hauptrollen, und Luise fortführte: »… to forget your smile«, und Marthe dann wieder brummte, denn singen war ihr nicht gegeben: »Too late now …« und Luise fortfuhr: »… to forget and go on …«, dann stand Cynthia daneben und verstand nur Kauderwelsch, denn sie hatte weder den Film gesehen, noch konnte sie den Song verstehen, noch wusste sie, dass die Filmsongs von Fred Astaire und Jane Powell auf einer Schallplatte verewigt worden waren, die Luise besaß und die Marthe und Luise sich schon mehrmals angehört hatten, weil ihnen die Lieder so sehr gefielen, besonders das von Jane Powell mit dem Schmelz der hingegebenen Liebe gesungene It’s too late now. In solchen Situationen fühlte Marthe sich etwas entschädigt für die vielen täglichen kleinen Demütigungen.
Marthe liebte auch den Five o’Clock Tea, den sie mit Luise und manchmal mit deren Mann Fred zelebrierte, so richtig auf englische Art. Wenn sie danach allerdings in das gegenüberliegende Haus zurückkehrte, in dem sie jetzt wohnte, fiel der Hass sie nur umso heftiger an, schnürte ihren Atem ab und ließ sie von innen brennen.
Sie hasste die Hunde, von denen sie sich eingeengt und bedroht fühlte, sobald sie ins Haus trat. Sie hatte Cynthia schon aufgefordert, die »Tölen« gefälligst in ihren Räumen zu halten, aber Cynthia hatte nur in schneidender Zuckersüße geantwortet: »Liebste, das Treppenhaus ist auch unser Raum und die Herrschaftsküche ebenfalls.« Für diesen Ausdruck »Herrschaftsküche« hasste Marthe ihre Schwägerin ganz besonders. Was war denn daran herrschaftlich? Es fiel kaum Licht hinein, der Herd musste mit Brikett oder Holz geheizt werden, die Kacheln an den Wänden waren teilweise abgefallen und diejenigen am Fußboden vergilbt. Früher einmal hatte es einen Speisenaufzug gegeben, der von der Küche nach oben in das Zimmer führte, das heute Cynthias und Eckhardts Schlafzimmer war. Aber dieser Speisenaufzug war schon lange durch einen Fußboden versperrt, der in die Wohnung in der Beletage gezogen worden war. Als Marthe ihren Mann nach diesem Lastenaufzug gefragt hatte, hatte er geantwortet, dass dieser schon verschlossen gewesen war, als seine Mutter Anfang der Zwanzigerjahre das Haus gekauft und so für Mann und fünf Kinder ein Zuhause gefunden hatte.
Herrschaftlich also! Besonders herrschaftlich war ja wohl, dass die von Cynthia und Eckhardt gezüchteten Windhunde in der Küche ihr Geschäft verrichteten, wenn es draußen regnete oder wenn Cynthia keine Lust hatte, die Tölen zu bewegen, was besonders oft vorkam, wenn Stella nicht da war, die die zwölf Hunde regelmäßig an der Leine ausführte, was aussah, als wäre sie ein griechischer Gladiator. Aber Stella hielt sich schon seit geraumer Zeit in London bei ihrem Liebhaber Anthony auf, diesem berühmten Dichter, dessen Werke Marthe nicht anrührte. Sie hätte sie ja lesen können, sie war des Englischen mächtig, aber sie empfand so viel Hass gegen die gesamte Familie Wolkenrath, oft sogar Aaron und Lysbeth eingeschlossen, obwohl sie sich ihrer Ungerechtigkeit bewusst war, dass sie es einfach nicht über sich bringen konnte, einen Roman von Anthony Walker zu lesen. Schlimm genug, dass Stella nun, nachdem ihr Mann Jonny Maukesch als Kapitän abgehalftert war, denn er war ein eindeutiger Nazi gewesen, sich als nächsten Lover einen berühmten und dazu reichen Schriftsteller angelacht hatte. Es wäre einfach zu viel gewesen, wenn Marthe jetzt auch noch hätte zugeben müssen, dass sie seine Schreiberei interessant fand.
Wenn Stella in London weilte, okkupierte Jonny die Wohnung oben, hielt dort Hof und lud Leute ein, die aus dem alten Naziclan stammten und jetzt wieder zu Macht gelangten. Jonny fand sich nicht damit ab, in Hamburg nichts beeinflussen zu können. Er war ein Macher, auch wenn er kein Schiff mehr befehligte.
Leider hatte Dritter sich mit Jonny komplett überworfen, denn Jonny hatte ihm seinerzeit Geld überlassen, mit dem Dritter in Ratekau ein Schwein für ihn mästen sollte. Nur hatte Jonny das Schwein nie erhalten, weder lebend noch geschlachtet. Dritter hatte manchmal bei seinen Geschwistern gut Wetter gemacht, indem er ihnen einen Schweinebraten aus Ratekau brachte, häufiger jedoch versprach und wie so viele seiner Versprechen nicht hielt, aber das komplette Schwein blieb aus. Zudem hatte Jonny einen aberwitzigen Gerichtsprozess gegen Dritter geführt, weil Jonny ihm vor dem Krieg eine Schreibmaschine zum Gebrauch überlassen, diese aber nie zurückbekommen hatte. Dritter hatte die Schreibmaschine nicht zurückgeben können, zunächst, weil er sie für seine Firma brauchte, auf dieser Schreibmaschine tippte seine Sekretärin, später dann, weil er sie mit dem übrigen Inventar verkauft hatte, denn er brauchte das Geld dringend, um seine Schulden zu bezahlen. Dritter stopfte immer ein Loch, indem er ein anderes Loch aufriss, so war er.
Einmal war Jonny sogar nach Ratekau gekommen und hatte Dritter verprügeln wollen. Das hatte für ihn aber nicht gut geendet, weil Dritter stärker war als er. Jonny war raffinierter als Dritter, er hatte schon nach dem Ersten Weltkrieg, wie erzählt wurde, konspirative Kontakte gepflegt, die zum Kapp-Putsch und später sogar zu Hitlers Machtausweitung in Hamburg geführt hatten, gleichzeitig blieb er aber immer im Schatten. Jonny sah in seiner Kapitänsuniform mit den ausgepolsterten Schultern und den Bügelfalten auch sehr stark aus, aber Dritter kannte sich nun mal im Straßenkampf aus, er hatte im Gefängnis gesessen, er hatte sogar in Ratekau noch geritten, auch wenn es nur auf einem Ackergaul gewesen war, aber selbst den vermochte er allein mit geradem Rücken, angelegten Schenkeln und drängenden Hacken zu dirigieren. Dritter wusste, wie und wohin er schlagen musste, damit es weh tat und der andere außer Gefecht gesetzt wurde.
Von Jonny war also nicht das geringste Entgegenkommen zu erwarten, was Räume betraf. Also war den Jungs strengstens verboten worden, auch nur einen Fuß auf die erste Stufe der Treppe zu setzen, die nach oben führte, wo Tante Stella und manchmal Onkel Jonny wohnten.
Zum Glück besaß Jonny den Anstand, nicht seine Mätresse mit in die Kippingstraße zu bringen, aber das lag wohl vor allem an Greta, die, wie Stella einmal gesagt hatte, eine Frau von feinem Charakter war, und außerdem an Jonnys geisteskranker Tochter Walburga, die er wahrhaftig durch die Nazizeit gerettet hatte, indem er sie nach Namibia geschickt hatte. Das Gerücht ging, dass Greta und Walburga der Zeit dort nachtrauerten, aber das konnte Marthe nicht beurteilen.
Ihr Hass gegen Jonny hielt sich in Grenzen. Sie entschuldigte sein aufgeblasenes Gehabe, wenn er in der Kippingstraße auftauchte, damit, dass Stella ihn zum Gehörnten gemacht hatte. Und dass er Dritter hasste, verstand sie auch, obwohl es ihr damals Genugtuung verschafft hatte, als Jonny mit eingezogenem Schwanz und einigen blauen Flecken aus Ratekau geschlichen war und sich fortan auf gerichtliche Auseinandersetzungen beschränkt hatte.
Wen sie hasste wie die Pest, schlimmer als die Pest, wie die Krankheiten, die ihre Kinder dahingerafft hatten, wie die Unfähigkeit der Ärzte, ihre Kinder zu retten, wie Dritters Trieb, der ihr immer die nächste Schwangerschaft beschert hatte in einer Zeit, wo sie selbst nicht satt wurde, das war Cynthia und alles, was mit Cynthia zusammenhing.
Dieser Hass beruhte auf Gegenseitigkeit. Cynthia versuchte, ihr eins auszuwischen, wo sie nur konnte. Wenn Marthe und Dritter nicht da waren, ließ Cynthia die Hunde durch deren Zimmer nach hinten in den Garten, und es war jetzt schon zweimal vorgekommen, dass einer der Hunde auf dem Teppich Dreckspuren hinterlassen hatte, die auch Kotspuren hätten sein können, bestimmt sogar waren, wie Marthe durchs Haus brüllte, als sie ihr Zimmer betrat. Da lief sie über vor Wut, und kurze Zeit später hörte sie, wie Cynthia zu ihrem Mann sagte: »Das Proletenweib unten hat wieder nicht an sich halten können.«
Proletenweib. Das war ungefähr die größte Beleidigung, die man Marthe zufügen konnte. Sie war stolz auf ihre Bildung, ihre Kultur, ihre Welterfahrenheit. Sie hatte Abitur gemacht, hatte als Sekretärin gearbeitet, sprach Englisch und Französisch, las Bücher und Zeitungen, trank Five o’Clock Tea, wieso, bitte schön, war all das proletenhaft? Und trotzdem gab es ihr jedes Mal einen Stich, was wahrscheinlich daran lag, dass sie ihre Situation in diesem Haus als sozial sehr inferior und, aber das gestand nur sie selbst sich ein, ihren Mann im Grunde als proletenhaft empfand. Aber wenn sie das dachte, schob sie es schnell beiseite und, trotz allem Hass, entschuldigte sie Dritter mit den widrigen Umständen und Zeiten, doch sie hatte Schwierigkeiten damit, diese Entschuldigungen selbst zu glauben.
3
Wie Mauern versperrten die Häuser den Blick auf die Welt dahinter. Am Ende der kleinen Straße bog Wilhelm nach rechts ab, wäre er nach links geschert, hätte er an seiner Schule vorbeilaufen müssen, wo er in die zweite Klasse ging, aber von Schule hatte er für diesen Tag genug. Auch hatte er bereits erkundet, dass in dieser Richtung wenig Chance auf freie Sicht bestand. Also nach rechts.
Bei der nächsten Abzweigung hielt er kurz inne. »Einmal um den Block darfst du laufen. Weiter nicht«, hatte die Mutter gemahnt, die sich in ihrer alten Heimat in Ratekau nie darum geschert hatte, wie lange er von zu Hause fortblieb.
Seine Beine waren zwar kurz und dünn, doch sie waren erprobt darin, weite Entfernungen zurückzulegen. In Ratekau hatte er während des vergangenen Jahres täglich eine ziemlich lange Strecke zur Schule laufen müssen, das schreckte ihn nicht im Geringsten. Nun reckte sich in seinem Kopf allerdings der mahnende Zeigefinger der Mutter.
Rund um den Block herum sah man nur Häuser, da gab es kein einziges leeres Grundstück, auch nicht aus Trümmern, das wusste er bereits. Nach kurzem inneren Kampf besiegte Wilhelms Sehnsucht nach freiem Himmel das Verbot der Mutter, das ihm ohnehin keine übermäßig große Furcht einjagte. Eine Drohung des Vaters hätte ihn mehr geschreckt, denn er hatte die Erfahrung gemacht, dass der Vater ihm mit seinen Schlägen nicht nur weh tun, sondern ihn in einen Zustand versetzen konnte, den er bis dahin nicht gekannt hatte, wo ihm nämlich alles egal war und er nicht einmal mehr Angst hatte zu sterben, sondern sich nur noch wünschte, tot zu sein.
Diese Furcht hatte der Vater Wilhelm in jener denkwürdigen Nacht gelehrt, an die er sich nicht gern zurückerinnerte, die aber kurz vor dem Einschlafen oder beim Aufwachen oder manchmal sogar beim Spielen plötzlich einfach da war, mit all den Gefühlen, die dazugehörten und einer Angst, die ihm die Luft abschnürte. Damals hatte er das Auto von Papas Geschäftsfreund verschönern wollen, indem er es mit einem Messer auf der Höhe unterhalb der Fenster einmal an jeder Seite sorgfältig einritzte. Es sollte richtig schön aussehen, er hatte Zeit und Mühe hineingelegt, damit eine gerade Linie jede Seite des Autos verzierte. Die Reifen des schönen dunkelblauen Autos waren von einem weißen Kreis rund um die Felgen geschmückt. Das hatte Wilhelm gefallen, das Dunkelblau des Autos, das Schwarz der Reifen und der weiße Kreis darauf. Bei einem anderen Auto hatte er einmal einen silbernen Streifen unterhalb der Fenster gesehen, von Kotflügel zu Kotflügel. Er hatte seinem Vater und dem Geschäftsfreund, an dessen Namen er sich beim besten Willen nicht erinnerte, eine Freude machen wollen. Doch sein Vater hatte den schlafenden Wilhelm ohne Vorwarnung aus dem Bett gezerrt und vermöbelt, bis Wilhelm sich wünschte, tot zu sein. Besonders schlimm war gewesen, dass der Vater nichts erklärt, ihn einfach nur gepackt und geprügelt hatte. Die einzigen Worte, die er durch seine zusammengebissenen Zähne ausgestoßen hatte, waren: »Das tust du nie wieder oder ich schlag dich tot!« In Wilhelm war ein fürchterliches Durcheinander entstanden, in diesem Durcheinander gab es die Frage nach dem Warum, denn er wusste nicht, was er falsch gemacht hatte, und es gab diesen Schmerz, denn der Vater hatte ziemlich viel Kraft, und es gab die Frage, ob der Vater ihn jetzt schon totschlagen wollte oder erst beim nächsten Mal, und dann gab es den Wunsch, es möge aufhören, und die Hoffnung, dass es schneller aufhören würde, wenn er nicht schrie und weinte, denn der Vater mochte keine Memmen, und Jungstränen waren ihm verhasst. Also hatte Wilhelm die Zunge zwischen die Zähne geschoben und fest drauf gebissen, so hielt er sich vom Schreien ab, gleichzeitig linderte dieser Schmerz auf eine fast tröstliche Weise den Schmerz, den die Schläge ihm zufügten. Erst als das Blut ihm das Kinn herablief und auf sein Nachthemd tropfte, ließ der Vater von ihm ab.
Wilhelm konnte sich nicht vorstellen, dass der Vater ebenso viel Aufmerksamkeit darauf richten würde, ob Wilhelm sich weiter als einmal um den Block entfernte, wie auf das Auto seines Geschäftsfreundes. Der ja auch nicht mehr Vaters Geschäftsfreund war, so viel hatte Wilhelm begriffen, denn der Vater hatte keine Geschäftsfreunde mehr. Die hatten ihn alle fallengelassen, und in Wilhelm zuckte manchmal die Angst, dass dieser eine Geschäftsfreund, an dessen Namen er sich beim besten Willen nicht erinnerte, den Vater vielleicht fallengelassen hatte, weil Wilhelm sein Auto kaputt gemacht hatte. Denn das wusste er heute: Der Lack eines Autos war wie dessen Kleidung, und in eine Hose oder ein Hemd schnitt man ja auch nicht willkürlich oder riss einen Schlitz hinein. Inzwischen hatte Wilhelm natürlich begriffen, was er da Dummes angestellt hatte und dass das ein teurer Schaden gewesen war, den er verursacht hatte, aber inzwischen war er ja sieben Jahre alt und wusste über Autos mehr als sein älterer Bruder Alex, der schon aufs Gymnasium ging.
Nur wenige Schritte, und Wilhelm hatte eine breite Straße erreicht. Hier gab es Neubauten neben Trümmergrundstücken, hier brummte von Zeit zu Zeit ein Auto über das Kopfsteinpflaster, und Wilhelm sagte leise vor sich hin die Namen: Isetta, Hanomag, Volkswagen, Tempo, … Dann wieder rumpelte eine Droschke über die steinernen Kinderköpfe, vorne saß ein Kutscher, der den Gaul mit einer Peitsche antrieb. Dazwischen schoben Männer Lastkarren mit Steinen oder anderem Baumaterial, beladen von Frauen, die es auf den Grundstücken zusammensammelten, wo die Häuser von den Engländern und Amerikanern zerbombt worden waren.
Hier nicht rechts abzubiegen und dann wieder rechts und dann wieder rechts in die Kippingstraße zurückzukehren, wuchs sich nun doch zu einer Gefahr aus. Dem Vater wäre es vielleicht egal, wie weit Wilhelm lief, aber wenn die Mutter sich beim Vater über ihn beklagte, würde der für Räson sorgen.
Doch die Sehnsucht, die Wilhelm antrieb, war sogar stärker als die Angst vor dem Vater. Der Vater hatte gesagt, Hamburg habe einen wunderschönen großen See in der Mitte der Stadt, außerdem hatte er gesagt, Hamburg sei eine Hafenstadt, da führen große Schiffe den Fluss entlang. Das wollte Wilhelm sehen. Also stapfte er auf seinen dünnen kurzen Beinen weiter und weiter von zu Hause fort. Von Straße zu Straße wuchsen die Häuser, als wollten sie Schabernack mit ihm treiben. Staunend blieb er stehen, als eine Straßenbahn an ihm vorbeifuhr und eine Menge von Geräuschen verursachte, die er so noch nie gehört hatte, sie zischte auf ihren Schienen, dann knallte sie, als wollte sie von den Schienen springen, dann quietschte sie, weil Wilhelm direkt neben einer Haltestelle stand, und nach einem schrillen Klingeln setzte sie sich mit einem Geräusch von unwilliger Anstrengung wieder in Bewegung.
Wilhelm ging weiter, an Grundstücken vorbei, die ihm den Blick auf den Himmel freigaben, weil zwischen zwei Häusern eines oder zwei verschwunden waren. An manchen Wänden konnte er noch erkennen, wie die Wohnungen tapeziert gewesen waren, die es dort einmal gegeben hatte. Aber so weit er auch ging, ein See oder Fluss tat sich vor seinen Augen nicht auf. Trotzig stapfte er weiter, wollte nicht klein beigeben. Irgendwann würde sich schon alles verkehren, die Häuser würden schrumpfen, und dann wäre er endlich im häuserfreien Raum, dort, wo sich der Himmel nicht nur über ihm, sondern auch vor ihm, neben ihm, hinter ihm erstrecken würde. Wo sich der See vor ihm zu erkennen gäbe und er sich im glänzenden Spiegel betrachten könnte. Wo es Bäume gäbe und zwitschernde Vögel. Wo er sich auf den Boden fallen lassen, die Erde riechen und seine Gedanken zu den Wolken schicken könnte. Wo er sich endlich wieder Geschichten nach der Gestalt der über ihn herjagenden oder spazierenden oder gemütlich bummelnden Wolken erträumen und erzählen könnte.
Er wanderte stundenlang durch Hamburg. Sie hatten Mai, er war schon seit einem Monat in Hamburg, in dieser Zeit waren die Abende länger geworden, ebenso wie Wilhelms Ausflüge. Auch hatte sich der Geruch der Erde verändert, aber lange nicht so, wie er es aus Ratekau kannte. Die Straßen kamen ihm vor wie Gefängnisse, die Häuser waren die Wärter. Sie ließen ihn nicht hinaus, dorthin, woher er kam, wo sein Zuhause war, dorthin, wo es Erde und Bäume und Wasser und Himmel gab. Als die Dämmerung einsetzte mit einem diesigen Grau, das sich über das legte, was vom Himmel übriggeblieben war, kehrte er um.
Eine Weile schaute er einem Gasanzünder zu, wie der mit seinem langen Stock an einer Schnur zog und die Laternen zum Flackern brachte. Erst jetzt merkte er, dass er sehr weit gelaufen war. Seine Beine schmerzten, er war hungrig und durstig. Aber er setzte sich wieder in Trab, und bald bewegten sich seine Beine wie von allein. Auf dem Land hatte er gelernt, sich unter freiem Himmel weit von zu Hause zu entfernen und jederzeit wieder zurückzufinden, das half ihm auch in dieser Steinwüste, sich zu orientieren: Hier gab es ein Haus mit einem Engel über der Haustür, hier ein Trümmergrundstück, hier eine Bäckerei. Er hatte sich Orientierungspunkte gemerkt, wie er es stets getan hatte. Doch den freien Himmel hatte er nicht gefunden.
Als er vor das Haus seiner Tanten trat, gab es einen Moment der Heimeligkeit und Geborgenheit, wo es sich gut und warm in Wilhelm anfühlte. Im Erdgeschoss schimmerte Licht durch die zugezogenen Vorhänge, auch durch die kleinen Fenster zu ebener Erde, hinter denen die Küche im Souterrain lag, in die ein Etagenbett für Wilhelm und seinen kleineren Bruder Peter gestellt worden war, ließ ein Lichtschimmer ahnen, dass unten Menschen waren, er also nicht allein sein würde.
Das Gefühl der Geborgenheit verschwand schnell, als er die Haustür öffnete, die wie immer unverschlossen war. Wilhelm besaß mit seinen sieben Jahren bereits einen starken Sinn für die Schönheit, die ihn im Vorflur empfing. Die in matten Farben gemusterten Kacheln, rot und grün, die bunten Fenster in der Tür zwischen Vorflur und Haus, die eine Blume zeigten, das alles machte ihn irgendwie froh, aber es flößte ihm zugleich Ehrfurcht und Angst ein. Seine Eltern hatten ihm und seinen Brüdern eingeschärft, dass sie keinen Krach machen, nicht herumtoben, nichts zerstören oder irgendwie von seinem angestammten Platz entfernen durften. Wilhelm fürchtete, ja, er war sich gefährlich sicher, dass der Vater wieder diesen Blick bekommen würde, den er damals gehabt hatte, sollte Wilhelm in diesem Haus irgendetwas kaputt machen.
Kaum hatte er das Treppenhaus betreten, war er von einer Horde aus zwölf schwanzwedelnden Hunden umgeben. Wilhelm streichelte über das glatte Fell derjenigen Hunde, die sich am dichtesten an ihn drängten, er flüsterte einige Hundenamen, die ihm gerade einfielen, und schob sich durch die Masse der Leiber hindurch, um zur Treppe zu gelangen, die nach unten ins Souterrain führte.
Da stockte er, denn aus der Wohnung von Tante Cynthia und Onkel Eckhardt drangen die zornig keifende Stimme seiner Tante und die aufgebrachte schnarrende seines Onkels. »Ich mache das nicht länger mit, was bildet sich dieses Pack ein? Sie ist so arrogant, heute hat sie mich nicht mal gegrüßt, und ihre Bastarde, die stinken das Klo voll!« Das war Tante Cynthia. Onkel Eckhardt war schwerer zu verstehen. »Ich habe einen Brief ans Gericht geschrieben, die müssen ihn raussetzen.« »Dein Bruder ist schlimmer als die Pest! Er lügt und betrügt, was das Zeug hält. Wieso bist du nicht Manns genug, ihn ohne Gericht rauszusetzen?«
Sanft schob Wilhelm die Hunde weg und schlich nach unten. Er wusste genau, über wen die beiden sprachen, und zwar über seine Eltern und seine Brüder, und über ihn selbst. Seine Eltern taten ihm leid, besonders seine Mutter. Die sagte zuweilen in einem ähnlichen Ton wie seine Tante Cynthia, dass sie es in diesem asozialen Haus keinen Tag länger aushalte. Sein Vater beruhigte sie dann jedes Mal mit der Aussicht auf den baldigen Umzug in das Haus in der Johnsallee. Sobald die Wohnung im Parterre frei wäre, sagte er, wären sie dort, und das könne nur noch wenige Wochen dauern.
Wilhelm hoffte, dass es bald so weit wäre, gleichzeitig hatte er Angst davor, denn dann würde er schon wieder die Schule wechseln müssen. Er hasste den Augenblick vorne vor der Klasse, wo die Lehrerin, eine Hand auf seine Schulter gelegt, seinen Namen nannte: Wilhelm Wolkenrath. Immer, wenn dieser Name fiel, wurde gelacht oder wenigstens gekichert. Einer tat es immer, und dann stimmten andere ein, auch wenn die Lehrerin strenge Augen machte oder sogar die Grinser mahnend beim Namen nannte. Wilhelm hatte sich entsetzlich gefühlt. Was war so falsch an dem Namen? Wolke und Rat. Das war doch schön, er selbst liebte die Wolken, und er empfand es so, dass sie ihm oft Rat erteilten, und sei es nur der, auf der Wiese liegen zu bleiben und die Veränderung der Gestalten zu verfolgen, die über ihn hinwegglitten.
Die Küche unten, in der das Etagenbett stand, war dunkel und kalt und stank nach Hund. Hier bekamen die Hunde zu fressen, und wenn es draußen regnete, geschah es schon mal, dass sie ihr Geschäft auf dem Boden aus vergilbten schwarzen und weißen Kacheln verrichteten, weil die Tante sie nicht vor die Tür schickte. Wilhelms Mutter glaubte freilich, das sei Schikane, weil sie und der Vater in dem Zimmer schliefen, von wo die Tür in den Garten führte, und sie hasste die Hunde und hatte sich verbeten, dass die durch ihr Schlafzimmer hindurch in den Garten getrieben würden. »Wenn man sich so viele Hunde anschafft«, hatte sie Tante Cynthia ins Gesicht gezischt, »dann muss man auch dafür sorgen, dass die Hunde Auslauf haben.« Sie hatte nicht gesagt, dass die Tante ihren knochigen Hintern in Bewegung setzen und der armen Welt präsentieren müsse. Das hatte sie nur dem Vater gesagt. Allerdings so laut, dass Wilhelm vermutete, dass die Tante es gehört hatte.
Vorsichtig tappte Wilhelm über den Flur im Souterrain. Das Gartenzimmer lag direkt rechts unten neben der Treppe. Durch den Türschlitz leuchtete Licht. Also war jemand da, wahrscheinlich die Mutter, und sehr wahrscheinlich lag sie im Bett und las, wie sie es in der letzten Zeit fast immer tat.
Aber wo war Peter, wo Alex? Manchmal beneidete Wilhelm seinen Bruder Alex, der oben bei Tante Cynthia und Onkel Eckhardt schlief, seit er ein Jahr vor dem Rest der Familie nach Hamburg gekommen war, um die Prüfung fürs Gymnasium zu absolvieren. Tante Cynthia hatte ihn darauf vorbereiten sollen, und sie hatte es ja wohl auch so gewollt. Alex hatte die Prüfung trotzdem nicht bestanden, aber der Vater hatte dem Direktor des Gymnasiums einen ganzen Kasten mit Ochsenschwanzsuppe in Dosen und einen zweiten mit Dosenwürstchen zukommen lassen – »Lehrer sind nicht überbezahlt, nicht einmal Schulleiter«, hatte er der Mutter erklärt, und Wilhelm und auch Alex hatten es deutlich gehört –, und deshalb hatte Alex die Prüfung wiederholen dürfen und auch bestanden, ob wegen der Geschenke oder weil er es wirklich besser gemacht hatte, wusste Wilhelm nicht und, wie er vermutete, auch Alex nicht. Wilhelm wusste, dass Alex sich schämte, das sah er ihm einfach an. Dabei tat Alex immer so, als wüsste er viel mehr als Wilhelm und als wäre Wilhelm einfach zu dumm, um zu verstehen, womit Alex sich beschäftigte. Wilhelm glaubte sogar, dass sein Bruder Alex sehr viel klüger war als er selbst und dass er ganz gewiss nicht verstand, was in der fünften Klasse gelernt wurde, war ihm doch der Unterricht in der zweiten schon lästig und unverständlich, aber er war sich ziemlich sicher, dass Alex sich immer noch schämte, weil er die Prüfung nicht bestanden hatte, obwohl die Tante ihr ganzes »Herzblut«, wie sie sagte, hineingelegt hatte.
Wilhelm kannte sich mit Scham aus. Er schämte sich, weil er so klein war. Und weil er es beim besten Willen nicht fertigbrachte, auf der Bank in der Klasse still sitzen zu bleiben, wenngleich er schon tausendmal in der Ecke hatte stehen müssen, weil er schon wieder aufgestanden war. Seine einzige Chance, sitzen zu bleiben, war, aus dem Fenster zu schauen und den Wolken hinterherzuträumen, aber das missfiel der Lehrerin ebenso, als würde er durch das Klassenzimmer laufen, um zu schauen, was die anderen geschrieben oder gemalt hatten.