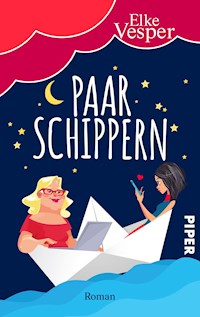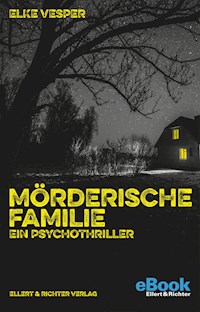8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geschichte der Wolkenraths
- Sprache: Deutsch
Manchmal sagen Träume die Wahrheit Dresden im Jahr 1889: Die zwanzigjährige Käthe Volpert heiratet den zehn Jahre älteren Alexander Wolkenrath. Er ist ein eleganter Mann, jeder Zoll ein Kavalier ... dass er aus einer verarmten Familie stammt und nichts gelernt hat, stört Käthe wenig. Sie bekommen fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter. Die Mädchen – beide an einem 13. geboren – entwickeln ganz unterschiedliche, außergewöhnliche Fähigkeiten. Die Verantwortung für die große Familie liegt allein bei Käthe. Als sie Dresden schließlich verlassen müssen, ist sie froh, dass sie in einer Urne – getarnt als die Asche ihrer Großmutter – einen Notgroschen dabei hat. Wird ihr der Beutel voller Goldtaler, den sie einst im Hochzeitskleid ihrer toten Mutter gefunden hat, helfen, die Zukunft zu meistern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 824
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Elke Vesper
Die Frauen der Wolkenraths
Roman
Fischer e-books
Für Thomas
mit Dank für sein Interesse an meinem Schreiben,
seine klare Kritik, seine wertvollen Impulse,
vor allem aber für seine Liebe – und für das Licht in seinen Augen.
1
Sie konnte sich noch so sehr dagegen wehren: Der Geruch von Lavendel ließ sie stets an die Mutter denken. Ein scharfer bitterer Gedanke an Tod.
Dabei war sie heute zum ersten Mal seit der Beerdigung mit diesem Gefühl aufgewacht, das sie für immer verloren geglaubt hatte: eine erwartungsfrohe Neugier auf den Tag. Heute wird etwas Besonderes geschehen, hatte sie gedacht und war voller Vorfreude aus dem Bett gesprungen.
Doch dann schüttete sie Wasser aus der hohen Porzellankanne in die dazugehörige Schüssel und griff nach der Seife, die in einem zierlichen, im Mohnblumenmuster zu Kanne und Schüssel passenden Schälchen lag. Kaum hatte Käthe begonnen, ihre Hände damit einzureiben, brach ihre frohe Stimmung jäh in sich zusammen. Lavendelduft stieg zart in ihre Nase. In ihrer Magengegend ballte sich ein trauriger Kloß zusammen. Es ist unvermeidbar, dachte sie, ich werde nie wieder fröhlich sein.
Sie beendete ihre Morgentoilette, nun selbst nach Lavendel duftend, bürstete ihre dicken Haare und sah einen Moment lang verblüfft in den Spiegel, da ein Strahl der Morgensonne ihr Haar wie einen Heiligenschein von glühendem Kupfer um ihren Kopf erstrahlen ließ. Da war der Sonnenstrahl vorüber, und ihre Haare sahen aus wie immer: ein ärgerliches Rotblond, an Schläfen und Nacken so aufdringlich geringelt, dass es sich trotz Zopf und Haube nicht anständig verbergen ließ.
Sie flocht zwei Zöpfe, verschlang sie im Nacken in gegenläufiger Richtung und steckte sie oben auf dem Kopf fest, sodass es aussah, als trüge sie einen Kranz. Sie prüfte im Spiegel, ob sie nun endlich ein sittsames Bild abgab. Doch erst, als die weiße gestärkte Haube unter ihrem Kinn mit einer Schleife festgezurrt war, fühlte sie sich gerüstet, der Welt entgegenzutreten. Nun noch die zur Haube passende Schürze über das dunkelblaue Kleid, und sie war bereit für ihre tägliche Arbeit.
Später an jenem Tag im Mai 1889 wird Käthe sich zweimal an ihr morgendliches Gefühl von erwartungsfroher Neugier erinnern. Bis dahin allerdings wird sie es vollkommen vergessen.
Käthe war still, bescheiden und fleißig und so gesehen die perfekte Tochter eines Witwers, der als angesehener Dresdner Tischlermeister eine Frau brauchte, die die Aufgaben der Meisterin erfüllte.
Als Mädchen war Käthe entzückend gewesen, rund und rosig, mit Wangengrübchen, blonden Löckchen und großen blauen Augen. Als ihre Mutter durch einige geschickte Versuche feststellte, dass sie auch noch intelligent war, begann sie das Kind im Verborgenen mit einer anderen Welt als der für Mädchen ihres Standes üblichen vertraut zu machen. Käthe lernte nicht nur lesen und schreiben, dem Vater die Bücher zu führen, der Mutter im Haushalt zur Hand zu gehen, sondern sie verschlang bald alle Romane, die die Mutter heimlich kaufte, denn der Vater hielt solche Lektüre für unnützes Zeug.
Als Käthe einmal zufällig der Lesestoff ausgegangen war, machte sie sich aus Langeweile über die Zeitung des Vaters her, und bald gehörte die Lektüre der Dresdner Nachrichten zu ihrer täglichen Beschäftigung.
Das bereitete den Boden für eine politische Komplizenschaft mit dem Vater. Er hatte immer schon mit seinen beiden Gesellen und den zur Bescheidenheit angehaltenen Lehrlingen am Mittagstisch über Politik gesprochen. Als Käthe zehn Jahre alt war, wagte sie einen scheuen Einwurf und wurde vom Vater mit einer strengen Rüge zum Schweigen gebracht. Später dann aber, unter vier Augen, forderte er sie auf, ihm ihre Kenntnis und Meinung mitzuteilen. Dies war der Beginn eines regen Gedankenaustauschs zwischen Vater und Tochter, der allerdings ebenso geheim gehalten wurde wie die Gespräche zwischen Mutter und Tochter über Romane, Theaterstücke, Musik und Schauspieler.
So wuchs Käthe mit Übung im Geheimhalten auf. Es war ihr nicht einmal bewusst, dass es sich um Geheimnisse handelte, für sie gehörten sie zum Regelwerk, das ihr Leben ordnete. Ebenso wie das Verbergen ihres kupferblonden Schopfes vor der Welt, einschließlich dem Vater.
Hexenstroh, hatte der Vater scherzhaft kommentiert, als die blonden Haare der ungefähr fünfjährigen Käthe eine kupferrote Farbe annahmen. Das Wort war nie wieder gefallen, aber es hatte sich in Käthe eingebrannt, obgleich ihre Mutter ihr täglich Komplimente wegen ihrer kräftigen Haarpracht gemacht hatte. Der Mutter hatte es Freude bereitet, Käthes Haare zu waschen und zu bürsten, bis sie ihr glänzend über Brüste und Rücken fielen. Seit ihrem Tod vor einem halben Jahr quälte Käthe sich alleine damit ab.
Eckhard Volpert, Käthes Vater und angesehener Handwerksmeister in Dresden, hatte seine Fehler, aber er war ein ehrlicher Mensch. Wenn er früher seine Frau Charlotte und neuerdings seine Tochter Käthe in aller Strenge dazu anhielt, mit einem Betrag hauszuhalten, der sie dazu zwang, stundenlang Knochen auszukochen, um wenigstens die Andeutung eines Fleischgeschmacks in den Eintopf zu zwingen, so führten sie es auf seine Zuverlässigkeit zurück, mit der er seine Familie sowie den ganzen Handwerksbetrieb am Leben hielt. Auch dass er Käthe seit dem Tod der Mutter selbstverständlich zumutete, von morgens halb sechs Uhr bis abends spät tätig zu sein, um den gesamten Haushalt einschließlich des Kochens zu besorgen, nur unterstützt durch ein dreizehnjähriges Mädchen, das kaum etwas kostete, so erklärte Käthe dies nicht mit seinem Geiz, sondern damit, dass Fleiß und Mäßigung menschliche Tugenden waren, die der Vater nicht nur anderen abverlangte, sondern auch sich selbst.
Außerdem arbeitete sie gern. Während sie das Haus putzte und das Essen vorbereitete, summte sie in Gedanken und Träumen verloren vor sich hin. Wenn sie am Waschplatz die Wäsche wusch, genoss sie das Geplapper der anderen Frauen, die es wiederum genossen, in Käthe eine stille, aufmerksame Zuhörerin zu finden.
Es gab im Wohnhaus des Tischlermeisters Volpert drei Zimmer auf jeder Etage. Kein Palast und keine Hütte. Jener Tag war wie jeder Dienstag der gründlichen Reinigung der Zimmer in der ersten Etage gewidmet. Hier lag das elterliche Schlafzimmer, das nach dem Tod der Mutter in nichts verändert worden war. Selbst das dicke Federplumeau auf der rechten Seite des großen Ehebettes, wo die Mutter geschlafen hatte, wurde von Zeit zu Zeit mit frischem Leinen bezogen, obwohl Meister Volpert sich strikt auf die linke Seite beschränkte.
Zudem befand sich dort ihr eigenes Zimmer und das des ersten Gesellen. Dort hatte, solange Käthe sich erinnern konnte, der alte Ludwig gewohnt, bis er vor etwa einem Jahr am Morgen kalt und steif in seinem Bett liegen geblieben war, obwohl er sonst immer als Erster aufstand. Nach diesem plötzlichen, erschreckenden Tod nahm bald Fritz seinen Platz ein, in der Tischlerei und im Haus. Käthe kannte ihn schon aus seiner Lehrlingszeit, dennoch empfand sie stets eine leichte unerklärliche Beunruhigung, wenn sie ihm vor seinem Zimmer begegnete. Also versuchte sie, ein solches Aufeinandertreffen zu vermeiden. Und das Reinigen seines Zimmers, wie es bei Ludwig zuvor stets geschehen war, hatte Fritz sich verbeten.
Allwöchentlich schleppte Lieschen, Käthes kleine Hilfe, Wasser vom Brunnen die Treppe hinauf, wo Käthe sich zuerst dem Staubwischen widmete, denn ihre Mutter hatte sie gelehrt, immer von oben nach unten zu putzen. War sie heute besonders empfindlich, oder stank der Lavendel noch ekliger als sonst? Als sie den Schrank im elterlichen Schlafzimmer feucht auswischte, stieg der Duft ihr abermals süßlich in die Nase. Die Mutter hatte auf Lavendel geschworen, unter anderem zum Vertreiben von Motten aus Schränken. Käthe biss die Zähne zusammen, der Kloß in der Magengegend machte sie jetzt wütend. Wenn er sich in ihr einnistete, würde sie schlapp und müde werden, Gefahr laufen, aus dem Zimmer zu flüchten, am liebsten in ihr Bett, und die Decke über den Kopf ziehen. Und weinen. Endlich weinen. Wie lange hatte sie nicht geweint? Seit die Mutter zu husten begonnen hatte? Vielleicht. An die schlimme Zeit vor dem Tod erinnerte sie sich nur verschwommen, und auch kaum an die Zeit danach. Durch alle Erinnerungen waberte widerlich Lavendelduft.
Sie zwang sich, ihre kleine Melodie weiterzusummen, und packte die Kleidung der Mutter mit einem festen Griff. Die Mutter hatte einen fast schon krankhaften Ekel gegen Motten gehabt, es ging nicht an, dass Käthe sich von dem Kloß im Bauch davon abhalten ließ, ihre Kleider auszuklopfen, um etwaigen Motten den Garaus zu machen.
Die Mutter hatte schöne Kleider besessen, warme, satte Farben auf seidigen, samtigen oder duftigen Stoffen, immer üppig, immer schimmernd. Als fielen Käthe Schuppen von den Augen, erkannte sie plötzlich, dass es wertvolle Kleider waren. Unverständlich wertvolle Kleider in Anbetracht der Sparsamkeit des Meisters. Käthe hatte sich nie Gedanken darüber gemacht, hatte den Glanz der Mutter allein auf deren Schönheit zurückgeführt. Eine zierliche Frau mit schwarzen welligen Haaren und schokoladenbraunen Augen, in jeder Hinsicht anders als die kräftige rundliche Käthe.
Nachdem sie den Schrank feucht ausgewischt hatte, schüttelte sie ein Kleid nach dem andern aus, strich mit einer feinen Bürste darüber und hängte es wieder zurück. Ganz am Schluss hatte sie das Hochzeitskleid der Mutter in der Hand, eine ehemals weiße dicke Wolke aus Tüll und Seide und Spitze, die nun an manchen Stellen eine leicht gelbliche Färbung aufwies. Käthe hatte ihre Mutter manchmal in dem Kleid bewundert, wenn sie es wie zum Maskenball anprobiert hatte. Als Käthe noch schmal und zart gewesen war, hatte ihre Mutter es sogar einmal ihr angezogen, und schon damals war Käthe unter dem Gewicht fast zusammengebrochen. Jetzt allerdings, als sie es in der Hand hielt und kritisch die Stockflecken betrachtete, erschien ihr das Gewicht weitaus höher, als sie es in Erinnerung hatte. Sie hob das Kleid einige Male prüfend in die Höhe. Zwischen ihren Augenbrauen bildete sich eine nachdenkliche Falte. War da nicht ein Geräusch? Ein seltsam klimpernder Ton wie von einem Glöckchen.
Die blonden Härchen auf ihren Armen richteten sich auf. Über ihren Rücken lief ein Schauer. Steckte der Geist der Mutter in dem Kleid? Sprach sie zu ihr?
Käthe schüttelte den Kopf, als wollte sie die dummen Gedanken an Geister rauswerfen. Die Haube rutschte vor ihr rechtes Auge. Sie rückte sie gerade. Nun schüttelte sie das Kleid. Eindeutiges Klingeln. Oder Klimpern? Sie breitete die voluminöse Stoffwolke auf dem Bett aus und untersuchte sie gründlich.
Schließlich ertasteten ihre Hände im Gewirr der Röcke einen Fremdkörper. Vorsichtig legte sie eine Stofflage nach der anderen frei. Sie unterdrückte einen Schrei, als sie endlich erkannte, was da war: An der Innennaht der Taille war mit drei von Edelsteinen glitzernden Broschen ein Beutel befestigt! Und er gehörte eindeutig nicht zu dem Kleid, denn er war aus grobem, grauen Leinenstoff.
Atemlos öffnete Käthe die Broschen eine nach der anderen, legte die Schmuckstücke neben das Kleid aufs Bett und hatte endlich den Beutel in der Hand. Schon bevor sie hineinschaute, ahnte sie, was drinnen war. Als sie das Band löste und die Öffnung freilegte, entrang sich ihrer Kehle ein seufzender kleiner Schrei.
Gold!
Ihr funkelten eine Menge runder großer Goldtaler entgegen. Sie keuchte. Ein großer dicker Beutel voller Gold!
Benommen saß sie eine Weile auf dem Bett, griff von Zeit zu Zeit in den Beutel und ließ die Taler durch ihre Finger rinnen, als müsste sie sich vergewissern, dass sie auch wirklich da waren.
Plötzlich vernahm sie Lieschens schwere Schritte auf der Treppe. Ihr Herz klopfte ein kurzes Stakkato, mit fliegenden Händen stopfte sie den Beutel unter die Bettdecke, griff nach dem Kleid, legte es sich über den Schoß und setzte ein trauriges Gesicht auf, was nicht schwerfiel.
Lieschen prallte zurück, als sie Käthe so jämmerlich mit dem Hochzeitskleid der Mutter auf dem Bett sitzen sah.
»Lass mich bitte allein«, hauchte Käthe.
Das Mädchen bedachte sie mit einem hilflosen Blick. Was soll ich tun?, stand in ihren Augen. Bitte nicht weinen!
Käthe legte etwas mehr Kraft in ihre Stimme. »Bitte nimm den Eimer mit und wisch die Treppe! Ich will allein sein.«
Lieschen wirkte immer noch nicht überzeugt, ob sie nicht irgendetwas anderes tun sollte, zum Beispiel Trost spenden. Gleichzeitig sah man ihr an, dass sie mit allem, was mit Gefühlen zu tun hatte, wenig Erfahrung besaß.
»Bitte geh jetzt!« Käthe wies energisch zur Tür. Erst als Lieschen erschrocken aufschrie, bemerkte sie, dass ihre Geste das Kleid in die Luft gewirbelt hatte. Ein weißes flüchtiges Gebilde, von einem Nebel aus silbernem Staub umhüllt. Man konnte in Lieschens angstgeweiteten Augen unschwer ihre Gedanken lesen: Da tanzt der Geist der toten Meisterin.
Das Mädchen verdrückte sich rückwärts aus dem Schlafzimmer. Nachdem Lieschen die Tür leise geschlossen hatte, horchte Käthe noch eine Weile hinter ihr her. Als sie unter die Bettdecke griff und den Beutel hervorzog, hatte sie sich schon wieder gefangen. Hier lag ein Geheimnis im Hochzeitskleid der Mutter verborgen. Entweder hatte die Mutter selber oder der Vater es dort versteckt.
Geheimnisse galt es zu respektieren, so lautete die Regel. Sorgfältig befestigte sie den Beutel mittels der Broschen wieder an der Innennaht der Taille. Sie strich noch einmal mit weichen zärtlichen Händen über das Kleid, dann hängte sie es zurück. Sie rang sich selbst das kühne Versprechen ab, alles ganz schnell zu vergessen.
Käthes Schwäche trug mehrere Namen: Conradi oder Pfefferküchler oder Konditor. Käthes Schwäche wurde geprägt durch Düfte: Dieses Wabern heißer Schokolade, das über die Nase direkt die Speichelproduktion anregt. Dieses verführerische Aroma aus Zimt und Pfeffer und Honig. Und sogar die Geräusche waren unvergleichlich köstlich: Das zarte Geklingel der Löffel auf dem Porzellan. Die plaudernden Stimmen, die sich zu einem Klangteppich verwebten. Das Klackern der Absätze der Kellnerin. Von der Ekstase der Geschmacksknospen ganz zu schweigen.
Gewöhnlich versuchte Käthe sich mit allen möglichen Argumenten zu überzeugen, dass der Mensch weder heiße Schokolade noch Pfefferkuchen oder sonstige Leckereien zum Leben brauche. An sechs Tagen in der Woche siegte ihr Verstand. Am Donnerstag allerdings, wenn sie Besorgungen in der Waisenhausstraße machte, geschah es immer wieder, dass sie sich selbst mit allen möglichen Schmeicheleien weich stimmte und sich unerwartet auf einem Stuhl in der Konditorei Conradi in der Seestraße wiederfand, vor sich einen Pfefferkuchen neben dampfender Schokolade, auf der eine verlockende Haube cremiger Sahne saß, alles selbstverständlich serviert in entzückendem zartem Porzellan.
An jenem Dienstag, nach erfolgtem Hausputz, Vor- und Nachbereiten des Mittagessens und Eintragungen ins Haushaltsbuch, war sie durch den bestürzenden Fund im Hochzeitskleid der Mutter so durcheinandergebracht, dass sie es am Nachmittag nicht mehr zu Hause aushielt.
Meister Volpert war es, der ihr einen Vorwand schenkte: Beim Mittagstisch erinnerte er sie daran, dass die Enkelin seiner Schwester Ingeborg, die in Bayern vor dreißig Jahren einen Bauern geheiratet hatte, in einer Woche sechs Jahre alt würde und sie ihr wohl etwas schicken müssten.
Am Nachmittag machte Käthe sich also ohne Haube und Schürze, stattdessen mit einem zum Kleid und zur Trauer passenden dunkelblauen Hut auf in die Seestraße Nr.?2, wo sie sich zwischen den Spielsachen und den von Arras in eigener Fabrik hergestellten Puppen fühlte wie im Kinderparadies. Sie kaufte eine Puppe mit blauen Augen, blondem Haarkranz, einem schüchternen Lächeln und Grübchen.
Anschließend wäre es geradezu eine Sünde gewesen, dem Pfefferküchler Conradi keinen Besuch abzustatten.
Dass sie an jenem Dienstagnachmittag untätig und genießerisch im Café Conradi bei einer heißen Schokolade und einem Pfefferkuchen saß, wird sie später der Vorsehung zuschreiben, dem bereits am Morgen vor dem Aufstehen geahnten Schicksal, zu dem auch der eigenartige Fund im Hochzeitskleid ihrer Mutter gehörte.
Seit sie denken konnte, lebte Käthe mit Männern zusammen. Männer fast jeder Generation, die Lehrlinge waren Knaben, die Gesellen junge und ältere Männer. Der alte Ludwig war für Käthe wie ein Großvater gewesen. Der Anblick männlicher Körper war ihr vertraut, seit sie als Mädchen unbeachtet hinter der Gardine gelugt hatte, wenn der damalige Geselle, Siegfried, ein Mann, dessen Körperbau seinem Namen alle Ehre machte, sich nackt am Brunnen wusch. Sie teilte das Essen mit Männern, sie wusch ihre Kleidung, sie wusste, wie sie rochen, ja, sie hatte sogar gelernt, ihre Gedanken und Gefühle zu lesen, die sich manchmal sehr davon unterschieden, was sie aussprachen. Männer waren ihr nicht fremd. Nicht einmal die in ihren Blicken aufflackernde Begierde, die sich in Gegenwart des Meisters oder der Meisterin schnell in scheue Aufmerksamkeit wandelte, konnte sie aus der Fassung bringen, denn sie war ihr vertraut, seit sich mit dreizehn Jahren Fettpolster über ihren bis dahin knochigen Körper gelegt hatten.
Als jetzt aber kurz nach dem vertrauten Klingelgeräusch beim Öffnen der Tür ein junger Mann nach einem Adlerblick ins Rund mit energischen Schritten den Raum durchmaß und ohne Umschweife den Tisch ansteuerte, an dem Käthe saß, wo er mit einer zackigen Verbeugung fragte: »Darf ich mich freundlicherweise zu Ihnen setzen, gnädiges Fräulein?«, brachte sie keinen Ton heraus. Stumm nickte sie. Hitze stieg wie Mehlschwitze von ihrer Brust hoch in ihr Gesicht.
Ich werde knallrot, dachte sie entsetzt. Wie töricht von mir!
Sie bemerkte, wie der Mann ihr einen amüsierten Blick zuwarf. Sie schlug die Augen nieder und starrte ihren Pfefferkuchen an. Er setzte sich. Schlug die Beine übereinander. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie die perfekte Bügelfalte in seinen gestreiften Hosen, die glänzenden Schuhe mit den weißen Gamaschen.
Sie konnte kaum atmen, so peinlich war ihr das Ganze. Zu allem Übel spürte sie jetzt auch noch, wie eine Locke ihre Stirn kitzelte. Er konnte ihre Haare sehen!
Warum tat sich nicht einfach ein Abgrund auf?
Sie vernahm die klackenden Schritte der Kellnerin.
»Einen Pfefferkuchen und ein Kännchen Schokolade, bitte, Fräulein Luise.« Eine Stimme, die Käthe Gänsehaut verursachte. Schmeichelnd, vertraulich, zugleich mit dem befehlsgewohnten knarzenden Unterton, der Käthe von Offizieren und adligen Herrschaften vertraut war, die beim Vater besondere Einlegarbeiten oder Schnitzwerk bestellten.
»Comme toujours, Herr Wolkenrath, ich eile …« Die Kellnerin, die Käthe bislang nur mit einem blasiert höflichen Lächeln bedient hatte, kicherte kokett.
In Käthes Kopf summte ein ganzer Bienenstock. Hatte die affige Göre eben Wolkenrath gesagt? War das der Wolkenrath? Nein, das konnte nicht sein. Der war doch alt. Hatte sie nicht gerade etwas über einen neuerlichen Verkauf des frühere Fuhrunternehmens Wolkenrath gelesen?
»Fräulein, ich glaube, Ihre Schokolade wird kalt …« Wieder diese schmeichelnde Stimme, nun ohne jedes Knarzen.
Wenn ich nicht gleich atme, falle ich tot um, dachte Käthe, und erstaunlicherweise weckte das Bild einer auf der Stelle umkippenden toten Taube wieder ihren Sinn für die Wirklichkeit. Mit einem scheuen Lächeln blickte sie hoch. Für den Bruchteil einer Sekunde sah sie sein Gesicht scharf in allen Einzelheiten, und es brannte sich in ihr Gedächtnis ein, von nun an jederzeit abrufbar: Ein schmaler ovaler Kopf, scharf umrissene Gesichtszüge, eine markante lange Nase, ein blonder Schnauzbart über schmalen entschiedenen Lippen. Ein kräftiges längliches Kinn, elegant geformte Ohren. Allein die Augenpartie ließ die Klarheit der übrigen Züge vermissen. Die blassen Brauen sackten müde zu den Schläfen über wässrig blauen, fast verschwommen blickenden Augen.
Käthes Urteil stand sofort fest: Dieser Mann war eine atemberaubende Mischung aus männlicher Kraft und verletzlicher Empfindsamkeit.
Bebenden Herzens griff sie zu ihrer Tasse und zwang sich, ihre Kehle so weit zu öffnen, dass das Getränk hindurchfließen konnte.
»Pour Monsieur Wolkenrath, das Pfefferküchlein und die Chocolat!« Die Kellnerin, von der Käthe nun wusste, dass sie den Namen Luise trug, flötete auf eine geradezu anstößige Weise.
Da war der Name wieder! In Käthe fochten ihre Neugier und ihre Erziehung einen Kampf miteinander aus.
»Na dann …« Monsieur Wolkenrath stach die Gabel in den Kuchen und führte ein anständiges Stück zum Mund. Käthe erblickte große kräftige Zähne, die sich über den Pfefferkuchen hermachten.
»Sind Sie ein Sohn des Herrn Wolkenrath?« Die Frage war ihr herausgerutscht, sie biss sich auf die Unterlippe. »Entschuldigen Sie«, fügte sie schnell hinzu, »wie unerzogen von mir …«
Der Mann tupfte mit der Serviette über seine Lippen. Schluckte. Lächelte. »Aber wieso denn?«, sagte er beruhigend und hob seine Hand, als wolle er sie auf die ihre legen. Schnell zog Käthe ihre Hand fort. Was dachte er von ihr? Da blickte er ihr tief in die Augen, kam ihr über den Tisch etwas entgegen und raunte: »Ich bin nicht ein Sohn des alten Wolkenrath, ich bin der Sohn. Es gibt keinen anderen. Leider Gottes!« Er seufzte spöttisch. Käthe sah fasziniert zu, wie sein Gesicht endgültig auseinanderfiel in einen unteren Teil, der spöttisch und distanziert lächelte, und Augen, die geradezu verzweifelt sehnsüchtig um Verständnis flehten.
Vor ihr saß eine verletzte Seele! Käthes Herz floss über. Der Mann musste nichts weiter sagen, nichts tun, sie verstand ihn. Denn auch ihre Seele war verletzt. Als hätte der Schmied ein Brandzeichen auf die zarte Haut ihres pochenden Herzens gesetzt, so war sie gezeichnet, seit ihre Mutter das erste Mal Blut gespuckt hatte. Wie Sklaven sich am Brandzeichen erkannten und trotz aller Unterschiede verbunden fühlten, so empfand jetzt Käthe. Vor ihr saß ein Gezeichneter.
»Ich bin auch das einzige Kind«, sagte sie in einem gänzlich unverstellten Ton, der mehr als die Worte ausdrückte, wie tief sie ihn verstand. »Einerseits bekommt man alle Liebe, andererseits trägt man alle Verantwortung. Ist es nicht so?«
»Alle Liebe?« Sein Lächeln war fast schon eine Grimasse. »Nun, ich empfinde mehr die Last der Verantwortung.« Er setzte sich gerade auf, nickte höflich. »Wenn ich mich vorstellen darf, Alexander Wolkenrath. Würden Sie mir vielleicht die Ehre erweisen, mir auch Ihren Namen zu nennen?«
Wie töricht du bist, schalt Käthe sich zum zweiten Mal. Es gibt doch keinen Grund zu erröten! Dennoch kroch wieder diese dickflüssige Hitze in ihr hoch, bis sie in den Wangen stecken blieb.
»Käthe Volpert«, sagte sie leise und reichte ihm die Hand. Er erhob sich kurz, verbeugte sich zackig und hauchte einen Kuss auf ihre Hand. Als er wieder saß, legte sich Schweigen über die beiden wie eine Decke, die sie von allem um sie herum trennte. Schweigend verspeisten sie ihre Kuchen, tranken ihre Getränke, nur einmal kurz unterbrochen durch Alexanders Bemerkung: »Der Conradi wird nicht ohne Grund Pfefferküchler genannt, sein Kuchen ist einfach exquisit!« Was Käthe mit lebhaftem, fast schon übermütigem Nicken bestätigte.
»Würden Sie mir die Ehre erweisen, Sie einzuladen, Fräulein Käthe?«, fragte Alexander, als Luise erschien, um das Geschirr abzuräumen. Käthe antwortete laut und klar: »Ja, danke«, was Luise mit einem schnippischen Mund kommentierte. Sie nannte Alexander wieder Monsieur und bedankte sich mit einem tiefen koketten Knicks für das Trinkgeld.
Käthe zermarterte sich das Gehirn, wie sie den Mann dazu bringen könnte, nicht gleichzeitig mit ihr das Lokal zu verlassen. Dresden war eine Stadt, in der Gerüchte herumflogen wie Fliegen über Unrat. Sie wollte keinesfalls, dass ihr Vater gerüchteweise erfuhr, sie hätte sich mit einem jungen Mann in der Konditorei getroffen. Als ihr nichts Besseres einfiel, erhob sie sich, reichte Alexander die Hand und sagte geradeheraus: »Adieu, Herr Wolkenrath, es war mir ein Vergnügen, aber bitte bleiben Sie jetzt sitzen. Um uns herum gibt es mehr Plaudertaschen als Pfefferkuchen. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Fräulein Luise dazugehört.«
Alexander grinste. »Jedenfalls gehört sie nicht zu den Pfefferkuchen.« Er erhob sich und knallte die Hacken andeutungsweise zusammen. Wieder hauchte er einen Kuss über ihre Hand. Bevor sie sich umdrehen konnte, sagte er leise: »Ich würde Sie gern wiedersehen. Darf ich Sie einladen?« Forschend und ängstlich sah er sie an. Als sie nicht widersprach, lächelte er erleichtert und schlug nach kurzem Nachdenken vor: »Was halten Sie von einem Ausflug am Sonntag zum Schillerschlösschen? Oder wir könnten mit dem Dampfschiff fahren?«
Käthe nickte überwältigt. Ja, jubelte es in ihr. Ja, ich will ihn wiedersehen, was der Vater auch immer sagen mag! Sie verabredeten sich am Platz vor dem Königlichen Schloss. Dort standen Kutschen und Fiaker, sodass sie bei jedem Wetter überall hinfahren konnten.
»Bis Sonntag. Um elf vor dem Schloss«, sagte Käthe.
Glücklich verließ sie die Konditorei.
2
Am Dienstagabend lag die Zeit bis Sonntag vor ihr wie eine endlose unüberwindbare Wüste.
Am Mittwochmorgen beschloss sie, sämtliche Vorräte an Lavendelseife hinter dem Rücken des Vaters fortzuwerfen und durch Maiglöckchenseife oder geruchsneutrale grüne Seife zu ersetzen.
Am Donnerstag setzte sie diese Absicht während ihres üblichen Einkaufsganges in die Tat um und kehrte danach wie gewöhnlich bei Conradi zu einer heißen Schokolade ein. Diesmal bediente nicht Luise, und es erschien auch kein schneidiger junger Mann an ihrem Tisch. Letzteres bewirkte, dass die Schokolade ihr weniger süß erschien als sonst, auch wenn sie vor sich selbst nicht eingestand, dass sie auf ein Wiedersehen gehofft hatte.
Donnerstagabend war das Haus lavendelfrei. Käthe empfand ein rebellisches Glück. Nie wieder, so schwor sie sich, würde sie diesem Duft die Möglichkeit geben, ihr die Laune zu versauern. Die Kleider der Mutter rochen natürlich noch danach, aber die mied Käthe ohnehin seit dem Fund des Goldes.
Die ganze Zeit über musste sie den Drang in sich niederkämpfen, in alten Zeitungen zu graben, um die tragische Geschichte des Fuhrunternehmens Wolkenrath & Söhne noch einmal nachzulesen. Nein, der junge Wolkenrath, den sie bei sich nur zärtlich Alexander nannte, sollte ihr die ganze Geschichte aus eigener Anschauung erzählen.
Erst am Freitagmorgen stellte sie sich die Frage, wie sie ihre Abwesenheit am Sonntag dem Vater beibringen könne.
Abgesehen von ihren kleinen verschwiegenen Stelldicheins mit heißer Schokolade und sonstigen Leckereien war Käthes Leben ansonsten vollkommen durchsichtig für den Vater, wenn man einmal davon absah, dass sie einen Roman pro Woche las. Seit dem Tod der Mutter ging sie nicht einmal mehr ins Theater. Der einzige Ort, den sie außer Geschäften oder dem Markt aufsuchte, war das Konservatorium für Musik in der Landhausstraße 6 im zweiten Stock, wo sie mit väterlicher Zustimmung vom Kaiserlichen Kammermusikus Schmole Pianounterricht erhielt. Sonntags spielte sie dem Vater normalerweise nach dem Nachmittagskaffee auf dem Piano vor. Dann trank er einen französischen Weinbrand, schmauchte eine kubanische Zigarre und wippte im Takt der Musik mit dem Fuß, der in sonntäglichen Hauspantoffeln steckte.
Käthe fiel nur eine einzige Ausrede ein: Es gehe ihr sehr schlecht und sie müsse deshalb den Sonntag mit abgedunkeltem Fenster in ihrem Zimmer verbringen. Sie wusste, dass der Vater eine ungeheuer große Abneigung gegen Krankheit hatte, was durch die Schwälle von Blut, die die Mutter kurz vor ihrem Tod auf Fußboden und Bett erbrochen hatte, noch verstärkt worden war. Ohne Zwang würde er keinen Fuß in ein Krankenzimmer setzen. Doch wie sollte sie aus dem Haus kommen? Und was, wenn sie Fritz begegnete? Sie würde ihn zu ihrem Vertrauten machen müssen!
Nein, allein der Gedanke war ihr schon zuwider. Es widerstrebte Käthe nicht besonders, vor dem Vater ein Geheimnis zu haben. Es wäre ihr aber sehr unangenehm gewesen, es mit einer anderen Person zu teilen. Doch da war noch etwas. Fritz hatte diese grauen klaren Augen, die einen direkt anschauten, und dann kam es Käthe immer so vor, als leuchte hinter dem Grau ein Licht. Und dann hatte er diese aufrechte Haltung, diese breiten Schultern, diesen selbstverständlichen Gang. Käthe konnte sich nicht vorstellen, dass er jemals einen anderen Menschen anlog. Und sie wollte nicht, dass er sie für eine Lügnerin hielt. Das kam also gar nicht infrage.
Freitag beim Mittagessen geschah dann etwas, das Käthe nachdenklich stimmte. Bisher hatte sie sich Gott als eine Instanz erklärt, die Menschen sich ausgedacht hatten, um Gut und Böse leichter auseinanderhalten zu können. Aus Angst vor göttlicher Strafe entschieden sie sich leichter für das Gute. Nach dem Mittag dachte Käthe ernsthaft darüber nach, dass es Gott vielleicht wirklich gab. Und zwar einen Gott mit einem ganz persönlichen Interesse an Käthes Glück. Es passierte Folgendes: »Meister«, sagte der Lehrling Friedrich, »meine Mutter lässt ausrichten, dass sie am Sonntag silberne Hochzeit feiert und Ihr eingeladen seid.« Das war eine lange Rede gewesen, und Friedrichs Gesicht sah aus wie ein roter Streuselkuchen. Trotzdem holte er noch einmal tief Luft und fügte hinzu: »Herzlich eingeladen, hat sie gesagt.« Sein schmaler Brustkorb fiel erleichtert zusammen, und er starrte Meister Volpert erwartungsvoll an.
Der trank bedächtig einen großen Schluck aus seinem Wasserkrug – bestes Dresdner Heilwasser. Meister Volpert schwor auf die Ratschläge von Friedrich Robert Nitzsche und machte deshalb nicht nur allmorgendlich die von Obigem empfohlene »Zimmergymnastik«, sondern er trank auch täglich Dresdner Heilwasser. Außerdem schwor er auf E. H. F. Hartmann, der das Bier als deutsches Nationalgetränk pries und seine Wirkungen als Heilmittel auf den menschlichen Organismus. Hartmann hatte einen »diätetischen Rathgeber« verfasst für alle diejenigen, »welche durch mäßigen Biergenuss ihre Gesundheit verbessern und bis ins Alter bewahren wollen«. Nebst genauer Angabe, die Fehler, Verfälschungen und Krankheiten des Bieres zu erkennen und unschädlich zu machen. Für jeweils einen halben Taler hatte Meister Volperts Mutter die Ratgeber beider obiger Herren erstanden und sie ihrem Sohn geschenkt, als er seine Tischlerei eröffnete. Seitdem hielt er sich an die Vorschriften. Er machte in der Frühe seine Zimmergymnastik, trank am Mittag Heilwasser und am Abend Bier.
Nachdem er einen großen Schluck zu sich genommen hatte, räusperte sich Meister Volpert. Dann räusperte er sich noch einmal, etwas länger. Danach warf er einen Hilfe suchenden Blick zu Käthe. Die aber versagte ihm ihr Mitgefühl, denn sie erkannte Gottes Geschenk und nahm es dankbar an.
»Wie wunderschön!«, verkündete sie, vollmundiger und überzeugender, als sie üblicherweise zu sprechen pflegte. »Wie reizend von deiner Frau Mutter, meinen Vater einzuladen. Er war auch gar zu lange nicht mehr aus.«
Meister Volpert senkte den Kopf, und man konnte ihm ansehen, dass er sich zu erinnern versuchte, ob er Friedrichs Mutter überhaupt jemals zu Gesicht bekommen hatte.
Selbstverständlich hast du, ermunterte Käthe ihn in Gedanken. Kein Lehrling beginnt ohne vorheriges Gespräch des Meisters mit den Eltern. Und soweit ich mich erinnere, war Friedrichs Mutter eine eindrucksvolle Walküre, die ihren stillen Mann mehr als verblassen ließ.
»Ich kann dich doch nicht den ganzen Sonntag allein lassen, mein liebes Kind.« Meister Volpert warf einen fast schon verzweifelten Blick zu Käthe.
Aber diese blieb ungerührt. »Ich bin fast zwanzig, Vater«, beruhigte sie ihn mit einem entzückenden Lächeln, das ihre Grübchen zum Vorschein brachte. »Und es wird nicht lange dauern, dann verbringen wir viele Tage getrennt. Denn ich werde einen Mann und Kinder haben wie alle Frauen meines Alters.«
Alle Köpfe am Tisch schnellten in die Höhe. Die Gesellen und der zweite Lehrling hatten das Gespräch bisher eher gelangweilt verfolgt. Jetzt aber war etwas vollkommen Neues geschehen. Etwas Alarmierendes. Fast so etwas wie eine Kampfansage. In Fritz’ grauen Augen, die Käthes einzufangen suchten, lag eine drängende Frage. Käthe schaute über alle hinweg.
Eckhard Volpert griff nach seinem Wasserkrug. Dann stellte er ihn wieder auf den Tisch. Etwas zu hart vielleicht. Bedächtig hob er seinen Blick zu Käthe und betrachtete sie, als hätte er sie noch nie gesehen. Ebenso langsam wendete er seinen Kopf Friedrich zu und nickte mit dem Kopf. »Sag deiner Mutter vielen Dank. Ich werde kommen. Wie viel Uhr?«
Käthes Herz beschleunigte den Takt. »Gegen elf, Meister, die Feier geht den ganzen Tag.« Als sie diese Antwort vernahm, musste sie an sich halten, nicht erleichtert auszuatmen.
Friedrich grinste gequält. »Ich habe ein paar schlimme Onkel, die prügeln sich wahrscheinlich schon vor dem Abendbrot. Dann komm ich einfach in Eure Nähe, Meister.«
Wieder nickte Meister Volpert. Er vermied es, Käthe anzuschauen, das merkte sie. Sie fühlte sich nicht ganz wohl in ihrer Haut, aber sie dachte auch an die letzten unter Qualen geächzten Worte ihrer Mutter: »Pass auf ihn auf, Käthe, aber lass dich nicht einsperren! Dein Körper ist fürs Kinderkriegen geboren. Niemand darf dich davon abhalten!« Ihre immer noch wunderschönen schmalen Hände hatten nach Käthes gegriffen, die ihr in jenem Augenblick unerträglich fleischig und lebendig ins Auge stachen. Zwei eiskalte elegante Hände über zwei dicklichen Händen voll warmen Lebens. Da röchelte die Mutter ein letztes Mal, bäumte sich auf – und war von der Mühsal des Atmens erlöst.
»Käthe könnte doch mitkommen«, unternahm Meister Volpert einen letzten Versuch.
Friedrichs pickeliges Gesicht rötete sich abermals. Er schluckte und warf einen beschwörenden Blick gen Himmel. Käthe lächelte unwillkürlich. Der arme Junge!, dachte sie. Seine Mutter hat ihm unter Garantie eingeschärft: Der Alte allein. Ohne Tochter. Heiratsfähige junge Mädchen gab es in Dresden genug, aber betuchte Witwer im besten Alter von Mitte vierzig waren Mangelware.
Mit einem Mal verspürte Käthe einen Anflug von Panik. Sie beruhigte sich sofort. Sie werden es nicht schaffen, sagte sie sich. Er hat Mama geliebt. Unendlich geliebt. Er wird keine andere wollen. Sie verstand nicht, warum ihr das sogar in diesem Augenblick so wichtig war, aber es war so.
Käthe warf ein Grübchenlächeln in die Runde der Männer. Sie erhob sich. Im selben Augenblick erschien Lieschen im Raum. »Ich kann am Sonntag nicht«, erklärte Käthe laut und vernehmlich. Dann räumte sie still die Teller zusammen und begab sich mit Lieschen gemeinsam an den Abwasch.
3
Der Tag war viel zu schwül für Mai. Kaum dass sie das Haus verlassen hatte, schwitzte Käthe schon. Und ihre Füße wurden von Sekunde zu Sekunde dicker. Spätestens am Schlossplatz, so fürchtete sie, würden die Nähte ihrer Stiefelchen reißen. Mit einem peinlichen knarzenden Geräusch, das an einen Pups erinnern und den eleganten Herrn Wolkenrath in die Flucht treiben würde. Wenn sie überhaupt jemals auf diesen Folterinstrumenten bis zum Schlossplatz gelangen würde. Sofern Alexander überhaupt noch dort wäre, da sie mindestens fünfzehn Minuten Verspätung hatte. Aber vielleicht kehrte sie ja auch auf halbem Wege um, weil ihr Mut mit jedem Schweißtropfen sank.
Auf zu engen Lederstiefeletten, in ein zu enges Korsett geschnürt, in ein zu langes und dunkles Kleid gestopft, auf dem Kopf über dem Kranz aus dicken roten Zöpfen einen unvorteilhaften schwarzen Hut mit einem Schleier vor den Augen, hastete sie die Straßen so schnell entlang, dass ihr Gang gerade noch einen letzten Rest von Sonntagsschicklichkeit bewahrte. Schweißtropfen rannen zwischen ihren eingezwängten Brüsten hinunter, fingen sich in der Korsage, wo diese aus Käthes leichtem Bauch eine Wespentaille machte. Ihre bauschige knielange Unterhose aus gestärktem Leinen klatschte feucht um ihre Beine. Ächzend blieb sie stehen. Es war eindeutig zu heiß für einen Ausflug! Außerdem kam sie zu spät. Sie sollte umkehren und vielleicht am kommenden Dienstag um die gleiche Zeit wieder in die Konditorei Conradi gehen.
Nein! Sie bellte dieses Wort in sich hinein. Nein! Sie hatte noch nie gekniffen, und sie hatte nicht vor zu kneifen.
Käthe war zwar still und sanft, ihr runder weicher Mund zeugte nicht nur von ihrer Naschlust, sondern auch davon, dass sie weder verkniffen noch streng oder auch nur im Ansatz zänkisch war, und auch ihre Augen sprachen von dieser ihr eigenen treuherzigen Arglosigkeit. Gleichzeitig aber besaß sie eine aufrechte Haltung, kräftige Hände und einen unerschrockenen Blick, der zuweilen sogar unschicklich lang auf einem anderen Menschen verweilte und so den anderen zu peinlich berührtem Fortblicken animierte.
Ja, Käthe hatte Angst vor dem, was ihr mit Alexander Wolkenrath vielleicht geschehen könnte, aber sie war fest entschlossen, es zu erleben. Schlimmer als die Angst war die überaus lästige Kleidung, vor allem die engen Stiefel. Aber sie war doch kein verwöhntes Prinzesschen! Du bist harte Arbeit gewohnt!, herrschte sie sich an, du wirst ja wohl etwas Schwitzen aushalten!
So erreichte sie den Schlossplatz, auf schmerzenden Füßen, mit klebrigem Schweiß zwischen den zusammengepressten Brüsten, unter dem Hut juckender Kopfhaut und verringerter Atemkapazität bei erhöhtem Sauerstoffbedarf.
Er stand in der Mitte des Platzes. Groß, aufrecht, breite Schultern, schmale Hüften, perfekt gebaut. Er war haargenau gleich gekleidet wie am Dienstag: graue Hosen mit feinen weißen Streifen, ein eleganter schwarzer Überzieher, weiße Gamaschen. In der linken Hand trug er eine kleine Reitgerte. Allein das von dem gelassenen Mann wie losgelöst wirkende Auf- und Abwippen der Gerte sprach von Nervosität.
Käthe dehnte ihren Brustkorb bis an die äußerste Grenze des Korsetts aus. Sie spürte nicht, wie die Fischbeinstäbe sich schmerzhaft in ihre Haut drückten. Sie spürte nur die Wohltat des Atems – und ihre herzrasende Freude auf den Mann.
Er blickte in eine andere Richtung, wandte sich ihr erst zu, als sie schon bis auf ein paar Schritte an ihn herangekommen war. Bevor sein Gesicht sich zu dem charmanten Lächeln verzog, das sie von ihm schon kannte, sah sie es nackt, ohne Maske. Er war sehr bleich. Die Züge seines Gesichts schienen vor Anspannung wie erstarrt. Er wirkte mürrisch – und als hätte er Angst.
Ihn so verletzlich zu sehen verlieh ihr augenblicklich ein Gefühl von Kraft und Stärke. Freudig eilte Käthe auf ihn zu. »Es tut mir so leid, Herr Wolkenrath! Ich habe Sie warten lassen. Ich bin einfach nicht früher aus dem Haus gekommen. Mein Vater ist zu einer silbernen Hochzeit eingeladen, und ich musste noch seinen Anzug bürsten und seine Schuhe wienern, und unser Mädchen, die Liese, geht sonntags immer zur Kirche, sodass ich da keine Hilfe habe …«
Zu ihrer eigenen Überraschung plapperte sie zwitschernd vor sich hin, wie sie es bislang nur von anderen Mädchen kannte. Er hauchte einen Kuss über ihre Hand, die von einem leichten Schweißfilm bedeckt war, und sagte lächelnd: »Es ist sehr heiß heute, finden Sie nicht auch?«, was sie wiederum dazu brachte, längere unwichtige Sätze übers Wetter von sich zu geben.
Er legte ihre Hand in seine Armbeuge und führte sie zum Rand des Platzes, wo mehrere Fiaker und Kutschen standen. Entschieden steuerte er auf ein überdachtes Gefährt zu, größer als ein Fiaker, aber kleiner als alle Kutschen, die Käthe jemals gesehen hatte.
Der Kutscher, ein alter Mann mit wettergegerbter Haut, sah ihnen aufmerksam entgegen. Als sie vor ihm stand, stellte Käthe fest, dass er noch gar nicht so alt war. Die in einem Stern von Falten liegenden Augen blitzten jung und hellwach.
»Heinrich, da wären wir«, sagte Alexander Wolkenrath knapp. »Bitte fahr das Fräulein Käthe und mich zum Schillerschlösschen. Schönste Wege, selbstredend!«
»Selbstredend!«, bestätigte der Kutscher, und Käthe meinte, einen leicht spöttischen Unterton wahrzunehmen. Als er sie jedoch mit einer höflichen Verneigung begrüßte, »Einen schönen guten Tag, das Fräulein!«, da lag nicht die Andeutung von Spott, weder in der Stimme noch in den Augen, noch in den Mundwinkeln.
Alexander unterstützte Käthe leicht am Ellbogen, als sie die Stufen zur Kutsche hinaufstieg, eine warme zarte Berührung wie weiche Vogelschwingen.
Nachdem sie endlich auf den Lederpolstern Platz genommen hatten, gab Käthe einen völlig undamenhaften Schnaufer der Erleichterung von sich. »Wie angenehm kühl es hier ist!«, seufzte sie. »Ich hatte schon befürchtet, in der Hitze zu schmelzen.«
»Wie heiße Schokolade«, schmeichelte Alexander, »und obendrauf eine Sahnehaube.« Er griff sacht zu dem Schleier vor ihrem Gesicht. »Darf ich?« Käthe hielt beklommen den Atem an.
Ruckelnd setzte sich die Kutsche in Bewegung. Schnell warf Käthe ihren Schleier mit einem Schwung hoch. Sie sah, dass Alexander ihr am liebsten den Hut ganz abgenommen hätte, hielt ihn aber mit ihrem geraden durchdringenden Blick davon ab.
Unter leichtem Geplauder über das Wetter, die Gegend und den allgemeinen Verlauf von Sonntagen passierten sie bald die Schillerstraße und erreichten eine reizende Umgebung. Sie fuhren am Lincke’schen Bade vorbei und schauten von oben herab in dessen schönen Garten, wo Rittersporn und Rosen darum wetteiferten, die Blicke auf sich zu ziehen. Sie fuhren durch eine rechts und links von blühenden Kastanienbäumen gesäumte Allee und warfen neugierige Blicke auf die prächtigen Häuser, die von parkähnlichen Gärten umgeben waren. Käthe spürte mehr, als sie es sah, wie sich eine dunkle Wolke auf die Stimmung des Mannes neben ihr legte. Am liebsten hätte sie ihm die Hand gedrückt.
Da sagte er auch schon: »Sie haben bestimmt von der Geschichte meiner Familie gehört, Fräulein Käthe?« Es klang weniger wie eine Frage, sondern eher wie eine allgemeine bittere Anklage des Gerüchtesumpfs in Dresdner Kreisen. Käthe nickte denn auch entschuldigend.
Alexander wies zu einem gewaltigen Haus mit verschnörkelten Giebeln. »Kein Mensch weiß, wie schnell man so etwas verlieren kann, wenn ihm das nicht schon zugestoßen ist.«
Käthes Herz zog sich zusammen, und sie schämte sich jetzt sehr wegen ihrer Neugier, die sie fast dazu getrieben hätte, sich sein trauriges Schicksal vor ihrem Treffen noch einmal zu Gemüte zu führen.
Schon bogen sie auf den weiträumigen Platz vor dem Schillerschlösschen ein, wo es noch ziemlich leer aussah.
»Waren Sie schon einmal hier, Fräulein Käthe?«, fragte Alexander Wolkenrath und öffnete die Tür der Kutsche für sie. Verneinend schüttelte Käthe den Kopf. Sie wackelte leicht mit den Zehen in ihren Stiefeln. Es fühlte sich jetzt besser an, aber immer noch nicht wirklich bequem. Hoffentlich gelüstete es Alexander Wolkenrath nicht nach einem gemeinsamen Spaziergang.
»In den Mittags- und Abendstunden trifft man hier eine zahlreiche Versammlung von Gästen aus allen Ständen an«, erläuterte er und versetzte ihr damit einen schmerzlichen Stich.
Er hält es für nötig, dich zu beruhigen, dass du dich hier nicht fehl am Platze fühlen musst, dachte sie traurig. Wahrscheinlich besucht er sonst das Café Français, wo sich die Adligen und Höhergestellten treffen, um eine heiße Schokolade zu trinken und zu plaudern. Mit einem Mal fühlte sie sich sehr unelegant und schäbig in ihrem schwarzen Trauerkleid mit dem schwarzen Hut.
Alexander wies den Kutscher an, auf sie zu warten. Doch dann wandte er sich fragend Käthe zu. »Oder wollen wir einen kleinen Spaziergang an der Elbe machen? Wir könnten nach Loschwitz gehen und den Schillerpavillon besuchen, wo der große Dichter einst sein Lied von der Glocke, Wallensteins Lager und, ich glaube, auch einen Teil von Don Carlos schrieb.«
Käthe nickte, überwältigt von der literarischen Bildung des Mannes. Heinrich schnalzte sofort mit der Zunge und hatte es offenbar eilig fortzukommen. »Wann?«, fragte er mit rauer Stimme, der man anhörte, dass sie durch Sprechen wenig geschmiert wurde.
Alexander blickte Käthe fragend an. »Wann müssen Sie zurück sein?«
Sie schrak zusammen. Darüber hatte sie sich noch gar keine Gedanken gemacht. »Ich weiß nicht«, bekannte sie wahrheitsgemäß. »Am Abend.«
Alexander lachte leise. Das ärgerte sie. Sie fühlte sich verspottet.
»Um vier! Hier!«, wies er Heinrich an.
Wieder versuchte er, Käthes Hand in seine Armbeuge zu legen, aber sie hielt Abstand. Auf schmerzenden Füßen stiefelte sie über den Kies neben ihm her.
Der Garten des Restaurants lag auf der anderen Seite. Sie umrundeten das Schloss, und da standen sie dann. Käthe stieß einen kleinen Laut der Begeisterung aus. »Was für eine reizende Aussicht!« Vor ihnen lag die in der Sonne glitzernde Elbe, dahinter wellten sich die Hügel der Sächsischen Schweiz.
Alexander führte sie zu einem der Gartentische und bestellte für beide Limonade und zwei Brezeln. »Das Mittagessen nehmen wir später ein, nachdem wir unseren Spaziergang gemacht haben. Einverstanden, Fräulein Käthe?«
Sie stimmte all seinen Vorschlägen zu.
An einem Nebentisch saßen noch andere junge Leute, zwei junge Frauen mit hellen leichten Sommerkleidern, die den Hals unbedeckt und deren durchsichtige Ärmel die Unterarme erkennen ließen. Käthe errötete schon vom Hinsehen. Hier fanden sich offenbar wirklich Menschen aller Stände ein. Die Limonade schmeckte nach Johannisbeeren. Käthe trank sie mit einem Strohhalm in sparsamen Schlucken.
»Mein Großvater hat mich oft mit hierher genommen, auch mein Vater. Auf dem Pferd. Zuerst haben sie mich vor sich gesetzt, dann hatte ich mein eigenes Pony. Können Sie reiten, Fräulein Käthe?«
Kopfschüttelnd verneinte Käthe, während sie weiter an ihrem Strohhalm nuckelte. Er sah das wohl als Aufforderung an weiterzusprechen und kam dem offenbar gerne nach. »Mein Großvater hat das Fuhrunternehmen Wolkenrath so groß gemacht, mein Vater hat es übernommen.« Alexander schnaubte kurz durch die Nase, ein trockener empörter Laut. »Er hat auch alles andere übernommen. Ein großes, gastfreundliches Haus, Dienstmädchen, Pferde und Kutschen. Mein Vater war ein Herrenreiter. Er wurde zu allen Jagden eingeladen, und er war oft der Meisterschütze.«
Käthes Kopfhaut kribbelte scheußlich. Und obwohl es ihr zur zweiten Natur geworden war, ihr Haar zu verbergen, hoben sich ihre Hände plötzlich fast von allein, und sie nestelte die Nadeln aus dem Haar, mit denen der Hut gehalten wurde. Sie wusste, dass sich nun überall um ihren Kopf herum zarte rote Locken aus dem Kranz lösen würden. Aus irgendeinem Grund war es ihr egal. Die Frauen da hinten trugen gar keine Hüte. Und sie lachten laut. Und sahen hübsch aus. Und wurden von den Männern, die bei ihnen saßen, geradezu ehrfürchtig behandelt.
Käthe hielt den Hut in der Hand, einen Moment schwebte er über ihrem Kopf, bevor sie ihn auf ihren Schoß sinken ließ. Sie warf einen scheuen Blick auf Alexander Wolkenrath. Starrte er sie jetzt an? War er entsetzt von ihrem Benehmen? Oder von ihrer Haarfarbe?
Er blickte in die Ferne, wo er offenbar etwas ganz anderes sah als die Sächsische Schweiz. Das beruhigte Käthe. Und es wurmte sie. Schließlich hatte sie eben eine umstürzlerische Tat begangen. Und er schaute nicht einmal hin.
»Man sagt«, gab sie erhobenen Kopfes und mit kühler Miene von sich, »dass Ihr Vater in moralischen Belangen … nun, nicht gerade ein Leitstern war …«
Alexander brach in meckerndes Lachen aus. »Leitstern? Leitstern! Das ist gut!« Er lehnte sich über den Gartentisch zu ihr und sah sie staunend an, als hätte er sie eben erst entdeckt: »Sie haben ja feuerrote Haare«, sagte er. Es klang weder bewundernd noch abwertend, noch von irgendeinem anderen Gefühl getrübt als dem Staunen. »Das habe ich gar nicht bemerkt«, sagte er langsam und fügte dann mit einem nachdenklichen Lächeln hinzu: »In der Schule war ein Junge mit roten Haaren, der wurde immer gehänselt. Irgendwann hat man ihn aus der Elbe gezogen. Ertrunken.«
Käthe wurde übel. Sie setzte den Hut wieder auf den Haarkranz und steckte ihn fest. »Mir war ein bisschen warm«, erklärte sie. »Jetzt geht es wieder.«
Er hinderte sie nicht, blickte nun wieder in die Ferne, als hätte er die Farbe ihrer Haare schon vergessen. »Sie haben recht«, sagte er nachdenklich, »mein Vater war kein moralischer Leithammel. Er hat ein paar Bastarde gezeugt, hundertprozentig, er hat gesoffen, na ja, und dann war da die verhängnisvolle Sache mit dem Spiel. Besonders wenn er betrunken war, konnte er nicht wieder aufhören.«
Käthe wusste, warum Alexander im Zusammenhang mit der Spielleidenschaft seines Vaters das Wort »verhängnisvoll« benutzte. Denn sein Vater besaß heute nichts mehr. Er war bettelarm.
In der Zeitung hatte gestanden, dass Bankier Eisentraut von Alexander Wolkenrath, Inhaber des Kutschenunternehmens Wolkenrath & Söhne, dessen gesamtes Vermögen, einschließlich der Firma und des Anwesens, übertragen bekommen habe. Beide hätten bestritten, dass es sich um Spielschulden handelte, beide hätten einvernehmlich einen »Handel« abgeschlossen.
Einen Tag zuvor hatte das Dienstmädchen der Familie Eisentraut einem Redakteur der Zeitung erzählt, dass die beiden Männer jede Woche um Geld Karten spielten. Laut ihrer Beschreibung endete das Spiel in jener fatalen Nacht damit, dass Alexander, sehr angetrunken, in hemmungsloser Gier, das Rad des Verlierens umzudrehen, einen Schuldschein einsetzte, mit dem er seine Firma, sein Haus und sein gesamtes Vermögen übertrug.
Am nächsten Tag bereits bestritt das Dienstmädchen vor allen möglichen Leuten, jemals so etwas zum Herrn Redakteur gesagt zu haben, er sei wahrscheinlich ärgerlich auf sie, weil sie nie bereit gewesen sei, mit ihm zum Tanzen zu gehen, obwohl er sie dieserhalb ständig belagere.
Käthe warf einen verstohlenen Blick auf den in seinem Schmerz versunkenen jungen Mann. Da richtete er seine wässrigen Augen auf sie und sagte: »Es tut so gut, mit einer verständnisvollen Seele über diese Katastrophe meines Lebens zu sprechen. Wissen Sie, Fräulein Käthe, ich schweige sonst darüber, denn all das ist mit sehr viel Scham behaftet, aber Ihnen vertraue ich.« Mit einem anrührenden Lächeln fügte er hinzu: »Und wenn das Herz überfließt … bitte verzeihen Sie meine Vertraulichkeit, wir kennen uns erst so kurze Zeit …«
Da griff Käthe kurz entschlossen über den Tisch nach seiner zu einer Faust geballten Hand und legte die ihre darüber, wie um ihn zu schützen. Er schluckte und öffnete seine Hand im Nu. Er packte nicht zu, und das war gut so. Er ließ seine offene Hand unter der ihren liegen und sagte leise: »Ich eiferte dem Vater schon als Kind nach. Im sicheren Bewusstsein, einmal alles zu erben. Pferde fühlen sich wohl bei mir. Ich kann die Kutschen nicht nur lenken und verleihen, ich kann sie sogar reparieren und die Kutscher einweisen, und ich kann dem Schmied auf die Finger sehen. Ich bin groß geworden als zukünftiger Chef.«
Jetzt die Hand wegzuziehen, wäre Käthe herzlos erschienen. Und dass Alexander ihren Handteller von unten mit seinem Daumen zu streicheln begann, kam ihr auch eher absichtslos vor, wenn es ihren Magen auch in Aufruhr versetzte.
Alexander schwieg und streichelte gedankenverloren weiter. Käthe empfand die starke Notwendigkeit, etwas zu sagen. Aber was? Nahegelegen hätte jetzt eine scharfe Bemerkung über die Gier der Juden. Bankier Eisentraut und seine Familie waren aber in Dresden als ehrenwerte Menschen bekannt, wenn es natürlich nach dem Vorfall viele gegeben hatte, die das Ganze auf die jüdische Geldgier zurückführten. Käthes Vater hingegen, Meister Volpert, donnerte, wenn er solche Worte vernahm: »Der deutsche Antisemitismus wird uns noch teuer zu stehen kommen. Was wäre das deutsche Volk ohne die Juden? Halbiert um Kultur und Wissenschaft und diese Lebensart, die wir von ihnen lernen können. Jawohl, mein Kind, du kannst mir glauben, ich habe Möbel für deutsche Adlige gebaut und für jüdische Wohlhabende. Und ich kann dir sagen: Die deutschen Adligen wollen es immer genauso, wie es irgendeiner aus ihrer Bekanntschaft schon hat. Die Juden finden ihre Modelle in der ganzen Welt.« Und ein anderes Mal, als am Tisch einer der Lehrlinge über den Bankier Eisentraut aufs Abfälligste herzog, schnitt ihm Meister Volpert das Wort ab: »Du Grünschnabel, was weißt du schon von Ehre und Stolz? Eisentraut hatte gar keine Wahl. Wenn er dem Wolkenrath das Vermögen gelassen hätte, hätte er ihm seine männliche Ehre geraubt. Das zu tun ist der Eisentraut viel zu sehr Ehrenmann.«
Der Ober kam. Käthe entzog Alexander sacht ihre Hand. Er zückte seine Geldbörse und zahlte.
Als sie zur Elbe hinuntergingen, legte Käthe wie selbstverständlich ihre Hand in seine Armbeuge. Ihre Füße schmerzten nicht mehr im Geringsten. Sie sog die Luft tief ein. Atmete den Geruch des Flusses. Und die Ahnung vom Duft des Mannes, der dicht neben ihr war. Plötzlich fühlte sie sich leicht und kühl trotz der Schwüle, die jetzt, gegen Mittag hin, immer noch zunahm.
Schweigend gingen sie eine Weile am Elbufer entlang. Da legte Alexander seine rechte Hand auf Käthes und sagte mit belegter Stimme: »Mein Vater hat damals nichts gesagt, nur: ›Packt das Silber ein, wir ziehen um.‹«
Das Silber. Ja, das Silber konnten sie getrost mitnehmen, dachte Käthe. Die Eisentrauts hatten selbst genug. Aber hatten sie nicht an allem genug? Sie wusste, wohin die Wolkenraths gezogen waren. Bankier Eisentraut hatte ihnen Wohnrecht bewilligt, nun allerdings nicht wie zuvor in zwölf Zimmern und Wirtschaftsräumen, und auch das Gesinde stand ihnen nicht mehr zur Verfügung, aber sie bekamen die Erlaubnis, kostenlos in einer der Kuscherwohnungen mit zwei kleinen Zimmern und einer Wohnküche zu hausen.
»Sie wissen, dass Eisentraut …?«
Käthe nickte. Vielleicht weiß ich gar nicht, was er meint, dachte sie und warf ihm schnell einen fragenden Blick zu. Er verlor sich wieder in traurigen Erinnerungen. Aber es war ihr unmöglich, mit sachlicher Stimme zu fragen: Sie meinen, dass Eisentraut Ihrer Familie in einem Akt von Mitmenschlichkeit ein Wohnrecht auf Lebenszeit gewährte?
Es war Stadtgespräch gewesen. Jeder, der die Werkstatt betrat, hatte etwas dazu zu sagen. Meister Volpert hatte kein Kritteln an Eisentrauts guter Absicht gelten lassen. In Wahrheit aber wusste keiner, ob Eisentrauts Beschluss von guter Absicht getrieben war oder vom Bedürfnis des Siegers, das Schicksal des Verlierers von eigener Hand weiter zu bestimmen. Tatsächlich hatte ihm der Sieg nicht zur Vergrößerung der Lebensfreude gereicht. Denn Alexander Wolkenrath lief fortan als Opfer durch die Welt, ausgeraubt, bestohlen, betrogen. Auf die Spitze trieb er das Drama mit einem Selbstmordversuch, der, zum nächsten Stadtgespräch geworden, der Familie Eisentraut das Leben schwer machte.
»Herr Wolkenrath?« Er schreckte zusammen. Käthe hatte ihn offenbar aus seinen Gedanken gerissen.
»Ja?«
Sie holte tief Luft und sagte dann mit fester Stimme: »Ich möchte nicht weiterlaufen. Es ist heiß. Meine Schuhe drücken. Und ich habe Hunger. Was halten Sie davon, wenn wir zum Schillerschlösschen zurückgehen und dort zu Mittag essen?«
Alexander Wolkenrath blieb stehen, musterte sie von oben bis unten, blickte ihr tief in die Augen und brach in das meckernde Lachen aus, das sie schon von ihm kannte.
»Sie haben diese roten Haare zu Recht«, sagte er hechelnd zwischen den Lachkollern. »Ich kenne keine Frau, die zugeben würde, dass ihre Schuhe drücken. Kommen Sie, meine drücken auch.«
4
Das Schillerschlösschen war ein viereckiger protziger Kasten, eher gewaltig als anmutig. Ihren Reiz erhielt die Anlage durch den weitläufigen Garten, in dem ungefähr dreißig rechteckige große Tische aufgestellt waren, an denen man zur Not zu sechst Platz finden konnte. Das wirklich Besondere aber war die Plattform oben auf dem Dach, von wo aus der Blick geradezu grandios in die Ferne schweifen konnte.
Käthe und Alexander erklommen die ausgetretenen Holzstufen. Drinnen war es zum Glück kühl, sodass es einer Wohltat nahe kam, sich hier aufzuhalten, selbst wenn man Treppen steigen musste.
Sie hatten draußen bereits einen Tisch belegt, eine Notwendigkeit, da um die Mittagszeit das Volk herbeiströmte. Sie hatten der Bedienung auch schon ihre Bestellung aufgegeben, und wollten sich nun vor dem Essen und bevor die Plattform überfüllt wäre, die Zeit vertreiben. Als sie mit einem leichten Schnaufer die letzte Stufe hinter sich gelassen hatten und ins Freie traten, verschlug ihnen die Hitze den Atem. Käthe japste nach Luft, einen Moment lang empfand sie in ihrem engen Korsett Erstickungsangst. Dann beruhigte sich ihr Herzschlag wieder.
Alexander hatte offenbar von ihrer Not nichts bemerkt. Er war schon einige Schritte zur Metallbrüstung vorausgeeilt und rief nun: »Fräulein Käthe, schauen Sie nur, welch entzückender Ausblick!«
Käthe folgte ihm mit schnellen kleinen Schritten, bemerkte dabei aus den Augenwinkeln, dass die Besucher hier oben ausnahmslos Herren waren. Interessierte Blicke streiften sie. Natürlich, dachte sie ironisch, steile Treppen sind nichts für Frauen in zu engen Schuhen und Korsetts.
Man genoss von der Plattform aus einen weiten Blick auf die sich windende Elbe, in der Ferne die Sächsische Schweiz, die Loschwitzer Weinberge und auch die Stadt Dresden. Leicht an den Arm des Mannes neben ihr gelehnt, sah Käthe die Sonne sich im Fluss spiegeln, den leichten Dunst auf den entfernten grünen Hügeln, hörte das Bellen eines Hundes und fragte sich, wie es angehen konnte, dass jedes Gefühl von Trauer für immer aus ihrer Brust verschwunden zu sein schien.
»Fräulein Käthe«, erklang da Alexanders Stimme vorsichtig neben ihr, »darf ich Sie etwas fragen?«
Ihr Herz schlug einen beschleunigten Takt. »Ja?«
»Weiß Ihr Vater eigentlich von unserem Rendezvous?«
Käthe blinzelte. Wegen der blendenden Helligkeit, erklärte sie vor sich selbst. Denn zu Enttäuschung gibt es nicht den geringsten Anlass.
Sie rückte unauffällig etwas von ihm ab. »Warum fragen Sie, Herr Wolkenrath?« Er wies mit dem freien Arm hinab zum Platz, der sich mit Menschen füllte. »Da unten, schauen Sie!« Käthe senkte ihren Blick auf Zylinder, Fracks, Frauenhüte, die mit Seidenblumen und echten Federn geschmückt waren. Von oben sahen die Frauen alle aus wie Wespen, mit gebauschten Ärmeln, enggeschnürten Taillen und das Hinterteil betonenden Kleidern. Manche der Männer lüpften gerade ihre Zylinder, viele Frauen trugen kleine Sonnenschirme aus bunter Seide, an den Rändern mit Rüschen verziert. Die Schuhe der Frauen waren kaum zu sehen, aber Käthe wusste, dass sie ebenso enge Stiefeletten trugen wie sie. Die Kleider und Blusen der Frauen fanden ebenso wie Käthes einen am Hals enganliegenden Abschluss, sogar die kleinen Mädchen waren schon so eingezwängt.
»Nein, mein Vater weiß nicht, dass ich hier bin … mit Ihnen«, sagte Käthe langsam, denn allmählich begriff sie, worauf er hinauswollte. Da unten traf sich neben den Franzosen und Engländern, die Dresden von Mai bis September mit Vorliebe besuchten, der gesamte Dresdner Handwerksstand und viele der Geschäftsleute, bei denen Käthe einkaufte.
Gleichermaßen erschrocken starrten Käthe und Alexander über die Brüstung hinunter auf den großen Schlossgarten. Käthe erkannte den Inhaber der Kunst- und Handelsgärtnerei, Carl Weigt, der ein guter Bekannter ihres Vaters war. An dessen Arm seine Gattin, deren rotangelaufenes Gesicht Käthe bis oben erkennen konnte. Albin Grohmann, der sich Gold- und Silberarbeiter nannte und sein Gewölbe in Meisel’s Hotel hatte, war umgeben von drei in Rosa, Hellgrün und Lavendelblau gekleideten Töchtern. Seine Frau, schmal in Dunkelgrau, wirkte daneben wie die Gouvernante.
Tatsächlich hatte Käthe bis zu diesem Augenblick nicht daran gedacht, dass Alexander und sie von Leuten gesehen werden könnten, die es ihrem Vater erzählen würden. Tatsächlich hatte Käthe einen solchen Respekt vor Geheimnissen, dass ihr gar nicht in den Sinn gekommen war, andere Leute könnten irgendwie Einfluss nehmen auf eine Sache, die nur sie selbst und ihren Vater betraf. Dabei war es ja nun mehr als naheliegend, wie sie jetzt begriff. Sie fühlte sich, als hätte jemand einen Eimer kaltes Wasser über sie geschüttet.
»Nun«, Käthe richtete sich nach einer Zeit längeren Nachdenkens zu voller Größe auf, »darf ich Ihnen auch eine Frage stellen, Herr Wolkenrath?«
Er drückte leicht ihre Hand, die nach wie vor auf seinem Unterarm lag. »Jede, liebes Fräulein. Jede!«
»Wie alt sind Sie?« Sie richtete einen ruhigen Blick auf ihn. Ihre Augen schimmerten jetzt fast olivgrün.
Diesem Blick standzuhalten fiel keinem leicht. Alexanders Augen glitten über sie hinweg hinunter auf den Gartenplatz. »Neunundzwanzig«, sagte er. Käthe fragte sich kurz, ob der Unterton von Gereiztheit ihrer Frage galt oder der Tatsache seines Alters. Sie entzog ihm ihre Hand und stellte sich vor ihm auf.
»Nun, mein Herr, ich bin neunzehn Jahre alt. Ich finde, wir sind beide alt genug, um uns zum Mittagessen am Sonntag mit einem Vertreter des anderen Geschlechtes zu verabreden.« Sie strich sich energisch eine Locke hinter die Ohren. »Schließlich kann uns die ganze Stadt dabei beobachten, dass wir nichts Verbotenes tun, noch öffentlicher als da unten kann man sich ja kaum begegnen.«
Als sie die Stufen hinabstiegen, bedauerte sie sehr, dass sie in der Eile ihres morgendlichen Aufbruchs keinen Sonnenschirm mitgenommen hatte. Ein Schirm bot eine wunderbare Möglichkeit, sich ein wenig dahinter zu verstecken, sich draufzulehnen, damit zu spielen, um jede mögliche Verlegenheit geflissentlich unsichtbar zu machen. Doch kaum waren sie unten angekommen, lief alles ganz anders, als sie befürchtet hatte.
Die Bekannten neigten die Köpfe, zogen die Zylinder vor ihr und ihrem Begleiter. Keiner trat nah an sie heran, um sie in ein verfängliches Gespräch zu verwickeln. Alle schienen damit beschäftigt, ihre eigenen Plätze zu finden, und wenn Gespräche geknüpft wurden, dann zwischen Männern, die einander Ehrerbietung bezeugten. Die Frauen und Mädchen standen in diesem Fall wartend daneben, und mancher war es anzusehen, dass sie nicht gerade begeistert davon war, in der Sonne zu schmoren, während der Gatte oder Vater bedeutsame Konversation betrieb.
Aber keiner der anwesenden Männer schien ein Gespräch mit Alexander anknüpfen zu wollen. Käthe stellte sich vor, wie es wäre, wenn sie hier mit dem Vater wäre. Entsetzlich! Sie schüttelte sich in Gedanken. Wahrscheinlich wäre sie schon der Ohnmacht nahe vom Warten. Doch zum Glück hatte sie wie alle anderen Frauen stets ein Riechfläschchen in ihrem Stoffbeutel dabei, falls die wenige Luft, die sie eingeatmet bekam, und die Abschnürung aller wichtiger Organe einschließlich der Füße dazu führte, dass ihr die Sinne schwanden. Dass Alexander aber so wenig von den Männern beachtet wurde, irritierte sie. Ich werde ihn fragen müssen, was er eigentlich im Leben treibt, nahm sie sich vor, intelligent genug, diese Frage aufzuschieben.
Alexander war schweigsamer und in sich gekehrter, als Käthe ihn bisher erlebt hatte. Sie fühlte sich ein wenig unbeachtet und alleingelassen zwischen all diesen Menschen, die sie durchaus, das merkte sie wohl, aus den Augenwinkeln beobachteten. Sie versuchte ein Gespräch zu beginnen, indem sie Bemerkungen über das Mahl machte, ein beachtliches Stück vom Schweinebraten mit Kartoffeln und Zuckererbsen. Sie trank sogar ein Bier, um Alexander nicht das Gefühl zu vermitteln, sie sei zimperlich. Sie versuchte es mit Bemerkungen übers Wetter, über die sich hier einfindenden Dresdner, über die Mode, französisch zu parlieren, und dann sogar über das Schlösschen, das mit Schiller, soweit sie wusste, nichts zu tun hatte. Doch Alexander blieb einsilbig, in sich gekehrt.
Schließlich bedachte sie ihn wieder mit ihrem durchdringenden Blick und sagte: »Sind Sie eigentlich noch im Fuhrkutschenunternehmen tätig, Herr Wolkenrath?«
Ihr war durchaus bewusst, dass das eine geradezu unartige Frage war, denn sie hatte damals in der Zeitung gelesen, dass die Familie Eisentraut fast fluchtartig die Stadt verlassen hatte, nachdem sie es ein paar Jahre trotzig in ihrem Reichtum ausgehalten hatte, während Herr und Frau Wolkenrath in der Armut lebten, als wären sie ihres rechtmäßigen Besitzes beraubt worden.
Im Übrigen bewiesen weder Bankier Eisentraut noch seine Söhne das geringste Interesse an Pferden oder Kutschen, ganz im Gegenteil, die Entwicklung der Elektrizität faszinierte sie ungeheuer. Der alte Eisentraut hatte den alten Wolkenrath unmittelbar nach Einlösen des Wechsels gebeten, das Unternehmen als Geschäftsführer weiter zu leiten, Alexander Wolkenrath aber hatte zur Antwort auf den Boden gespuckt.
Vor ungefähr drei Jahren, Käthe erinnerte sich, dass sie zu der Zeit gerade einen neuen Klavierlehrer bekommen hatte, sprach ganz Dresden davon, dass Eisentraut alles verkauft habe, Wolkenraths Unternehmen, das Haus, sein eigenes Haus und seine Bank. In seiner Fürsorge für den ehemaligen Freund trieb er es so weit, in den Kaufvertrag für das Haus eine Klausel einzusetzen, dass Alexander der Ältere und seine Frau bis an ihr Lebensende in der Kutscherwohnung kostenlos wohnen bleiben dürften.