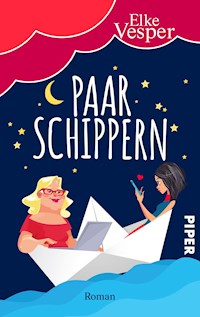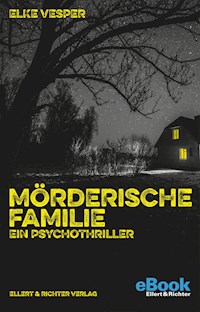8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geschichte der Wolkenraths
- Sprache: Deutsch
Die Familie Wolkenrath kommt 1920 von Dresden nach Hamburg. Die Mutter kauft von geerbten Goldstücken ein großes Haus, das zum Lebensmittelpunkt für die ganze Familie wird. Die Töchter Lysbeth und Stella feiern 1922 Doppelhochzeit. Doch beide werden ihr Glück nicht als Ehefrau und Mutter finden: Lysbeths Ehe wird bald geschieden. Mit Hilfe von Aaron, einem jungen Studenten, beginnt sie heimlich ein Medizinstudium. Stella geht mit ihrem Mann Jonny nach Afrika und verliebt sich in das Land und seine Bewohner. Doch Jonny ist nicht nur im Umgang mit den Schwarzen brutal, auch Stella behandelt er schlecht. Schließlich kehrt sie ohne ihn nach Hamburg zurück. Gemeinsam meistern die beiden so unterschiedlichen Schwestern die Herausforderungen der Zeit - und bewahren ihr großes Geheimnis. Der zweite Teil der großen Wolkenrath-Saga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1044
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Elke Vesper
Die Träume der Töchter
Roman
Fischer e-books
»… freilich ließ es sich nicht leugnen, dass Häuser einatmen und ausatmen, Wände sich mit Seufzern vollsaugen und die Wände sie auch wieder abgeben. Häuser strahlen ja durchaus menschliches Glück und menschlichen Kummer aus. Jeder normale Mensch würde zusammenbrechen unter der Last von Gefühlen, die ein Haus birgt, und doch konnte Hass selbst für ein Haus zuviel werden. Es war gefährlich, zu hassen.«
Nayantara Saghal, Die Memsahib
Dieses Buch widme ich meinen Töchtern Anja Jacobsen und Mareike Vesper, die so unterschiedlich sind und doch jede auf ihre Weise schön und kreativ, voller Weisheit und Unvernunft, deren Lachen ebenso die Wände zum Wackeln bringt wie ihre Tränen. Ich danke beiden für alles, was sie in mein Leben brachten und bringen, vor allem aber für ihre Liebe, die sich durch keine meiner zahlreichen Schwächen je beirren ließ.
1
Johnny, wenn du Geburtstag hast …«
Stellas Stimme besaß ein ganz eigenes, unvergleichliches Timbre. Sie klang nach Bar und Alkohol und Zigaretten, dabei sehr unschuldig, sie war klar und präzise, dennoch voll Geheimnis, sie klang, als würde Stella gleich in Gelächter ausbrechen, selbst wenn sie dramatisch die Augen schloss und ihr Publikum zu Tränen rührte.
»Neuerdings dein Lieblingslied …«, meinte Alexander, ihr Bruder, anzüglich. Sie schnaubte kurz durch die Nase und sang weiter bis zum Schluss: »… dass du doch jeden Tag Geburtstag hätt’st.«
Lysbeth zog ihren Bruder Johann vom Stuhl hoch. »Komm, es wird höchste Zeit, dass du tanzen lernst. Stella, spiel einen Onestepp!«
»Hallo, du süße Klingelfee …«, sang Stella lachend und begleitete sich dabei auf dem Klavier. Ihr Bruder Alexander wurde seit frühester Kindheit Dritter genannt. Sein Vater hieß, ebenso wie dessen Vater, auch Alexander, was für endlose Konfusion gesorgt hatte. Bis aus Alexander »dritter Alexander« und dann der einprägsame Name »Dritter« wurde. Dritter setzte sich mit einem Dreh seines hübschen kleinen Hinterns auf einen Hocker neben sie und improvisierte ein paar Takte. Stella warf ihm einen Blick aus ihren veilchenfarbenen Augen zu, der jedem anderen Mann in die Hose gefahren wäre, Dritter aber warf nur einen ebensolchen Blick zurück und fuhrwerkte wie ein Teufel auf den Tasten herum.
Johann, acht Jahre jünger und einen enormen Kopf kleiner als Lysbeth, entzog ihr mit einem Ruck seine Hand. »Ich bin doch kein Kleinkind! Hör auf, mich rumzukommandieren«, maulte er.
»Oho! Unser Kleiner wird erwachsen«, kommentierte Eckhardt den lauen Wutausbruch seines jüngsten Bruders. »Komm, Lysbeth, meine schöne Schwester. Wenn der Kleine nicht will, ich halte die Stange!«
Er fasste um ihre Taille und schob sie in zackigen Tanzschritten, den Arm bald oben, bald unten, durch das Klavierzimmer der Gaerbers. Einen Moment lang war Lysbeth versucht gewesen, ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Jeder wusste doch, dass sie keine schöne Schwester war, und die Anzüglichkeit mit der Stange verletzte sie immer wieder, auch wenn sie seit frühester Kindheit alle möglichen Ausdrücke gewöhnt war: Bohnenstange, Stangenspargel oder nur Stange mit allen möglichen Adjektiven – dürr, lang, platt, trocken, mager, um nur einige zu nennen. Aber sie liebte es nun einmal zu tanzen, auch mit ihrem Bruder Eckhardt, der zwar ebenfalls einen Kopf kleiner war als sie, aber in den Schultern beweglich und ein begeisterter Tänzer. Sie wusste ja auch, dass er es nicht böse meinte. Außerdem passierte es ihr in den letzten Wochen gar nicht so selten, dass sie Worte hörte wie: »Schöne junge Frau«, oder »Welcher Zauber liegt in Ihren Augen«, oder »Sie sind ein Engel«, wobei ausnahmsweise nicht ihr Wesen, sondern wirklich und wahrhaftig ihr Äußeres gemeint war.
»Abklatschen!« Vor Eckhardt und Lysbeth stand mit einem strahlenden Lächeln auf den blutrot geschminkten Lippen Eckhardts Verlobte Cynthia Gaerber. Ohne aus dem Takt zu kommen, griff Eckhardt nach seiner neuen Dame und schwenkte sie durch den Raum. Stella und Dritter spielten einen Onestepp nach dem andern.
Schwer atmend setzte Lysbeth sich nieder. Was für ein wundervoller Abend, dachte sie. Wie herrlich sich unser Leben verändert hat, seit wir aus Dresden abgereist sind. Geflohen, korrigierte sie sich spöttisch, denn es war keine Reise, es war eine Flucht gewesen. Ihr Vater hatte Dummheiten gemacht, arge Dummheiten. Er hatte sich hier und dort Geld geliehen, ohne es zurückzahlen zu können. Er hatte seine Gläubiger vertröstet, bis die ihn verprügelten und Schlimmeres androhten. Erst als ihm das Wasser bis zum Hals stand, hatte er sich seiner Frau anvertraut, die, wie es nun einmal ihre Art war, einerseits praktische Konsequenzen gezogen, andererseits Alexanders Beichte für sich behalten hatte. Alexander selbst hatte seinen Kindern kurz vor der nächtlichen Abreise sein Fehlverhalten gestanden.
Vor vier Tagen erst war die Familie Wolkenrath – die Eltern Käthe und Alexander und die Kinder Lysbeth, Alexander, Stella, Eckhardt und Johann – in Hamburg angelangt und wohnte seither bei den Gaerbers, der Familie von Eckhardts Verlobter Cynthia. Natürlich nur so lange, bis sie ein eigenes Domizil gefunden hatten. Lysbeth schien, als habe sich in diesen wenigen Tagen ihr ganzes Leben zum Besseren gewandelt. Das lag nicht nur daran, dass das Haus der Gaerbers einfach wundervoll gelegen war – das nahe Elbufer lud zu romantischen Spaziergängen ein –, dass es hier immer ausreichend zu essen gab, zudem noch köstlich zubereitet, und dass sie im Haushalt nichts selbst tun mussten. Es lag nicht einmal an der Großzügigkeit der Räume, die so vieles ermöglichten. Man konnte tanzen, Klavier spielen, zu zehnt gemeinsam am großen Esstisch sitzen. Überhaupt schluckte das riesige Haus mühelos die ganze Familie Wolkenrath mit ihren immerhin sieben Personen. Nein, dass Lysbeth sich hier so wohlfühlte, lag vor allem an Lydia, der Hausherrin.
Lydia Gaerbers dunkle Stimme klang vom Nebenraum, dem Salon, wohin sich die beiden Elternpaare jeden Abend nach dem Essen begaben und über alles Mögliche redeten, herüber und übertönte sogar das Klavier.
»Es war doch Ludendorff selbst, der Prinz Max von Baden ermächtigt hat, der alte Fuchs wollte doch nur die Verantwortung von sich abwälzen, damit er hinterher behaupten konnte, die deutsche Armee wäre im Felde ungeschlagen gewesen.«
Lydia nahm kein Blatt vor den Mund, und Lysbeth fühlte sich sehr zu ihr hingezogen. Ebenso erging es ihrer Mutter, das spürte Lysbeth, und es freute sie, denn Käthe hatte eine schlimme Zeit hinter sich, seit Fritz gestorben war. Fritz, der geheime Geliebte der Mutter, Fritz, der Vater von Stella. Fritz, der nach dem Krieg Kommunist geworden und beim Kampf für die Republik gestorben war. All das wussten die Schwestern erst seit kurzem. Die Brüder hatten es nicht erfahren, und wenn es nach Lysbeth ging, würde es auch dabei bleiben.
Lydia hatte die Wolkenraths eingeladen, so lange bei ihnen wohnen zu bleiben, wie es ihnen beliebte. Sie hatte ihnen die Wohnung in der ersten Etage ihres großen Hauses zur Verfügung gestellt. Dort hatten früher Lydias Eltern gelebt, die noch vor dem Krieg gestorben waren. Seitdem standen die zwei Zimmer leer, denn für Gäste gab es noch ein Extrazimmer, wo jetzt die drei Söhne der Wolkenraths, Dritter, Eckhardt und Johann, wohnten. Die beiden Töchter hatten das kleinere Zimmer zugeteilt bekommen, wo sie auf Sofas schliefen, während Käthe und Alexander das Ehebett benutzten. Manchmal fragte Lysbeth sich, ob ihre Eltern überhaupt noch ein Ehebett brauchten. Für eine junge Frau von siebenundzwanzig Jahren, immerhin noch Jungfrau, dachte sie ungewöhnlich offen und selbstverständlich an Sexualität. Sie empfand keinerlei Scheu bei dem Gedanken, dass Käthe und Fritz eine leidenschaftliche Liebe verbunden hatte. Ohne Leidenschaft und Liebe hätte ihre Mutter sich niemals für ein solches Doppelleben hergegeben, aus dem sogar noch ein Kind hervorgegangen war.
Lysbeth lauschte zum Salon. Zum Glück war es in beiden Familien nicht üblich, dass nur die Männer über Geschäfte und Politik und die Frauen lediglich über Mode und Haushalt sprachen. Lydia und Käthe beteiligten sich lebhaft an der politischen Diskussion über permanente Geldentwertung und die Lüge vom Dolchstoß.
Gerade sprach Lydia davon, dass sie 1918, also während des Krieges, auf einer Tagung in einem alten Thüringer Schloss gewesen war. »Ich habe sogar Cynthia gefragt, ob sie Lust habe, mich zu begleiten, aber sie hat nur wie ein verschrecktes Kaninchen geguckt.« Lysbeth spitzte die Ohren. So etwas war während des Krieges möglich gewesen?
»Lydia hat von Beginn an keinen Hehl daraus gemacht, dass sie diesen Krieg widerlich und unvernünftig fand. Ich glaube, Cynthia war ihre Mutter unheimlich. Das gesamte Vaterland führte den Krieg zumindest im Geiste mit, nur ein einziger Mensch stellte sich gegen das nationale Anliegen: Lydia Gaerber. Gegen einen so mächtigen Strom zu schwimmen, schien Cynthia lebensgefährlich. Womit sie ja nicht unrecht hatte.« Karl-Wilhelm Gaerbers Stimme drang auffallend hell und gepresst in Lysbeths Ohren.
»Versteck dich mal nicht hinter deiner Tochter!« Lysbeth zuckte zusammen. Das klang scharf. Die folgenden Worte klangen noch schärfer. »Hätte ihr Vater eine eindeutige Haltung für oder gegen den Krieg eingenommen, wäre es Cynthia leichter gefallen, sich eindeutig gegen mich zu stellen oder aber stillschweigend mit einem von uns übereinzustimmen. So aber spürte sie neben dem irritierenden Gegensatz von allgemeiner Autorität und meiner Meinung vor allem, wie unglücklich der Vater über mich war, weil ich Dinge aussprach, gegen die er keine Argumente wusste, die ihn als Geschäftsmann jedoch noch mehr in Schwierigkeiten brachten, als er ohnehin schon war.«
Lysbeth hielt den Atem an. Stritten sich die beiden dort in aller Öffentlichkeit? Sie hatte nie einen Streit zwischen ihren Eltern miterlebt.
»Der Vater bin ich«, klang es da trocken von nebenan. Alle lachten. Wenn auch beklommen. »Wenigstens hat Cynthia den Vorschlag ihrer Mutter abgelehnt.«
»Die Mutter bin ich!« Das nun folgende Lachen klang bereits etwas gelöster. Käthe und Alexander Wolkenrath schienen sich darauf einzustellen, dass in diesem Hause nicht nur über Politik freimütig debattiert wurde, sondern auch über eheliche Zwistigkeiten.
»Ich kam mir vor wie eine Verräterin.« Lysbeth zuckte zusammen. Cynthias Atem streifte ihre Wange. Sie hatte nicht mitbekommen, dass der Tanz beendet war und Cynthia sich neben sie gestellt hatte. »Ich habe sehr schmerzhaft gespürt, wie sehr meine Mutter unter ihrer Einsamkeit litt und wie sehr sie sich eine Verbündete wünschte, aber ich habe nun mal nicht ihre Courage.«
Aus dem Nebenzimmer drang Lydias Stimme. »Ich konnte den Anblick der Versehrten nicht ertragen. Es gab täglich mehr von ihnen. Ich litt mit den Müttern der Gefallenen, als hätte ich selbst einen Sohn verloren. Mir wurde speiübel angesichts des Hungers in den Gesichtern der Menschen. Mein Glück war mir peinlich: Mein Mann war nicht eingezogen. Ich hatte keinen Sohn zu verlieren. Und meine Tochter war sooo brav. Ich musste keine Angst haben, dass sie als Soldatenliebchen aus Versehen geschwängert würde. Zu allem Überfluss hatten wir immer noch genug zu essen. Es war nicht so üppig wie früher, aber Anna, unsere Köchin, zauberte von irgendwoher täglich etwas Leckeres auf den Tisch.«
Lysbeth sah, wie ihre Mutter nickte, und sie wusste, was sie dachte. Sie hatte um zwei Söhne im Krieg gebangt, Fritz, ihren Liebsten, hatte sie zu guter Letzt bei Bauern verstecken müssen, sie hatte eine Tochter, die zum Soldatenliebchen geworden war, und eine, die sich mit dem Chirurgenbesteck so gut auszukennen lernte, dass sie ihren Mund immer mehr verschloss.
Lysbeth, die Cynthias Nähe fast vergessen hatte, schreckte wieder leicht zusammen, als mit heißem Atem in ihr Ohr geraunt wurde: »Meine Mutter hat ganz besonders unter der Indifferenz meines Vaters gelitten, unter seiner Drückebergerei, seiner Angst. Sie bekam einen seltsamen, juckenden Ausschlag an den Armen. Nachdem ich ängstlich abgesagt hatte, an der Konferenz teilzunehmen, hat sie sich die Arme fast blutig gekratzt. ›Dann fahr ich eben allein, kein Problem‹, hat sie gesagt. Aber die Blutstropfen auf ihren Armen waren voller Vorwurf.«
Lysbeth blickte kurz neben sich. »Du hast dich schuldig gefühlt?«, fragte sie leise. Allerdings war es gar nicht nötig, leise zu sprechen, denn Stella und Dritter hauten kräftig in die Tasten, spornten sich gegenseitig an, improvisierten auf dem Klavier und hatten gar keine Augen für die beiden jungen Frauen, die sich an die Tür zum Salon pressten. Johann hatte schon vor einiger Zeit den Raum verlassen, und Eckhardt war ebenfalls nicht da.
»O ja«, wisperte Cynthia. »Ich weiß nicht, ob du dies Gefühl von Schuld kennst. Es macht, dass du dich schwer und träge fühlst, auch wenn du dünn bist. In der Schule war ich zu feige, um den Hurraparolen der Lehrer ein einziges der Argumente meiner Mutter entgegenzusetzen. Zu Hause war ich zu feige, ihr Verrat am Vaterland oder wenigstens am Vater vorzuwerfen, und auch zu feige, ihn darauf hinzuweisen, dass seine unentschlossene Haltung alles nur noch schlimmer machte.«
»Lydia hat gepackt, sich kühl von mir und Cynthia verabschiedet, und dann fuhr sie los.« Karl-Wilhelm klang, als wirkte die Trauer in ihm nach. »Wir waren mitten im Krieg, versteht ihr, es ging nicht um eine kleine Seereise.«
Lysbeths Blick wurde von ihrem eigenen Vater angezogen. Diesen Gesichtsausdruck hatte sie bei ihm noch nie gesehen. Er sah aus, als wolle er Karl-Wilhelms Frau an dessen Stelle übers Knie legen und zur Räson bringen. Gleichzeitig wirkte er voller Respekt, ja, geradezu Ehrfurcht vor Lydia. Und es kam Lysbeth so vor, als wecke die auf ein grünes Sofa gegossene zierliche Frau männliche Gefühle in ihm.
Lydia wirkte unverschämt jung. Nein, alterslos, entschied Lysbeth. Mit den blonden halblangen Wellen war sie die einzige Frau im Haus, die keine kurzen Haare trug. Käthe hatte ihren langen, inzwischen ergrauten Zopf nach Fritz’ Tod abgeschnitten, die jungen Frauen Stella, Lysbeth und Cynthia trugen die modischen Pagenschnitte. Alle sahen irgendwie hart aus, allein Lydia wirkte weich und sehr weiblich. »Ich hatte zwar die schlichteste Kleidung im Koffer, die ich finden konnte, dennoch stach ich unter den Teilnehmern der Tagung heraus, als wäre ich blitzblank zwischen lauter leicht angeschmuddelten Menschen. Ich selbst bemerkte es sofort mit Entsetzen, die anderen schienen mich hingegen kaum wahrzunehmen.«
»Für meine Mutter begann ein neuer Abschnitt in ihrem Leben. Und wir wurden unwichtig.« Cynthias Hüfte lehnte sich gegen Lysbeths. Sie waren beide gleich groß, schmal, fast mager, ohne Busen. Für beide war die aktuelle Mode wie gemacht. Bohnenstangen, dachte Lysbeth spöttisch. Zwei Bohnenstangen, die sich aneinanderlehnen. Der Hüftknochen von Cynthia drückte hart gegen den ihren. Sie empfand das Bedürfnis, etwas abzurücken, aber sie wusste, dass sie Cynthia damit verletzen würde. Cynthia hatte keine Geschwister. In ihrem Näherrücken lag Schwesternsehnsucht. Wenn du wüsstest, was ich für eine famose Schwester habe, dachte Lysbeth.
»Das Schloss war von einer überwältigenden märchenhaften Romantik. Im ersten Moment habe ich die ganze Welt drumherum vergessen, sogar den Krieg. Aber die Teilnehmer haben mich schnell in die Realität zurückgerufen.« Lydias Stimme klang plötzlich hoch und aufgeregt wie die eines jungen Mädchens. »Meine Freundin Antonia war auch da. Ihr müsst sie irgendwann kennenlernen. Sie ist Jüdin. Unglaublich! Immer schon war sie unglaublich. Sie hatte ihre Tochter mitgenommen, die war damals sechs. Ein lebhaftes Wesen. Ganz unbeschadet von Hunger und Not hüpfte die Kleine durch die Kriegstage.«
»Antonia, Antonia, immer Antonia«, flüsterte Cynthia wütend.
Lysbeth drehte ihren Kopf zu Cynthia. »Sollen wir uns dazusetzen?«, raunte sie. »Ich komme mir irgendwie schäbig vor. Der Lauscher an der Wand …« Was sie nicht sagte, war, dass sie genug von Cynthias heißem Atem hatte, von ihren spitzen Hüftknochen und überhaupt von dieser eigenartigen Vertraulichkeit.
Ohne eine Antwort abzuwarten, schlenderte sie in den Salon, der mit einigen Sofas, Sesseln und kleinen Stühlchen genug Platz bot für eine große Gruppe von Gästen.
Lysbeth setzte sich auf ein winziges gold-braun gestreiftes Biedermeiersofa, auf dem noch niemand saß. Cynthia rutschte mit einem lässigen Schwung neben sie, zog die Beine hoch und lehnte sich vertraulich gegen Lysbeth, die gar keine Chance hatte auszuweichen.
Lydias Blick streifte sie forschend. Dann beschloss sie, einfach im Gespräch fortzufahren. Sie berichtete begeistert von der Konferenz während des Krieges. Dort trafen sich Jugendvereine, Pazifisten, Theosophen, Sozialpolitiker, Anarchisten, Jünger chinesischer Weisheit, des Buddhismus, indischer Atemkunst – eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft mit unterschiedlichsten Auffassungen. Das Einzige, was alle verband, war die Forderung nach schnellster Beendigung des Krieges, nach Frieden ohne Annexionen und nach einem Völkerbund. Ansonsten vertrat jeder leidenschaftlich und kompromisslos seine Richtung. Sie stritten untereinander, was das Zeug hielt. In der Freideutschen Jugend gab es einen linken Flügel unter Führung des Studenten Buntfalter, der sich als Schriftsteller vorstellte. Energisch stritt er mit Pazifisten, Vegetariern, Gottsuchern und abergläubischen Wirrköpfen. »Ich habe seine Nähe sehr gesucht«, gestand Lydia. »Ich fand ihn begabt und geistreich. Aber er war so jung, und ich habe mich noch nie so alt gefühlt wie in diesen Tagen.«
»Gnädige Frau Lydia«, erhob Alexander Wolkenrath Einspruch. »Sie sind jung und schön, wie können Sie nur so denken!« Lysbeth suchte den Blick ihrer Mutter, die ihr verschwörerisch zulächelte. Alexander zeigte sich von seiner Kavaliersseite, aber es kam ihm von Herzen, das hörte nicht nur Lysbeth. Sie liebte die Geschichte, wie die Eltern sich kennengelernt hatten, sie wusste, wie sehr die Mutter von der charmanten, zuvorkommenden Seite Alexander Wolkenraths bezaubert gewesen war. Manchmal blitzte sie wieder hervor, so wie jetzt, und dann wurden Käthes Augen immer noch weich, so wie jetzt.
Lydia sprang auf und verschwand mit einem geheimnisvollen: »Ich bin gleich zurück«, Richtung Küche. Und wirklich war sie im Nu wieder da, mit einer Flasche Champagner in der Hand. Anna, die ihr folgte, trug ein Tablett mit funkelnden Kristallkelchen.
»Alle herkommen!«, rief Lydia energisch ins Nebenzimmer, wo Stella und Dritter immer noch vierhändig auf dem Klavier experimentierten.
Lydia ließ den Korken aus der Champagnerflasche knallen und schenkte in jeden Kelch ein wenig des sprudelnden Getränks. »Meine liebe Käthe, lieber Alexander und alle Kinder der Familie Wolkenrath«, sagte sie feierlich, »ich möchte, dass wir uns duzen. Mir ist es sowieso immer wieder rausgerutscht. Nun lassen Sie uns darauf anstoßen, dass wir alle eine Familie geworden sind und immer mehr zusammenwachsen wollen!«
Stella griff als Erste nach einem Glas und schmetterte: »Ah, ça ira, ça ira, ça ira, lahaha familjehe, ça ira!«
»Das ist ein Revolutionslied«, gab Karl-Wilhelm mit einem leise rügenden Unterton zu bedenken.
»Ist das nicht schön!«, jubilierte seine Frau und bewegte sich anmutig im Raum, um mit jedem anzustoßen. »Aufs Du! Auf die Revolutionen, die wir zukünftig gemeinsam anzetteln wollen!«
Alle lachten, und Stella sang noch einmal ihre Abwandlung des Liedes, das die Aristokraten an den Laternen baumeln sehen wollte. Karl-Wilhelms Lachen allerdings klang beklommen.
Als alle sich wieder gesetzt hatten, nun auch Stella und Dritter, bat Käthe um eine Fortführung der Beschreibung dieser Tagung. »Wer ist denn dort aufgetreten?«, fragte sie. »Wurden Vorträge gehalten?«
Bereitwillig griff Lydia den Faden wieder auf. »Ja, zum Beispiel hat der Student Brandwetter vom Geschichtsverein einen Vortrag über ›Die große Französische Revolution und die Pariser Kommune von 1871‹ gehalten. Die Verbindung zur Gegenwart hat er sehr geschickt eingeflochten. Zu guter Letzt hat er die deutschen Intellektuellen aufgerufen, den großen französischen Vorbildern zu folgen und für eine neue, bessere Gesellschaftsordnung einzutreten.«
»Seht ihr«, alberte Stella herum, »die Französische Revolution ist allgegenwärtig. Wahrscheinlich haben sich auch die Kieler Matrosen darauf berufen, als sie ihre Offiziere einen Kopf kürzer machen wollten.«
Käthe warf ihr einen scharfen Blick zu, aber Stella jauchzte nur auf, weil Dritter sie ins Knie gekniffen hatte. Die beiden wirken wie ein Liebespaar, dachte Lysbeth, und es versetzte ihr einen Stich. Noch nie hatte ihr Bruder Dritter sie mit der Aufmerksamkeit bedacht, die er für Stella hatte.
Als hätte sie Stellas Einwurf gar nicht gehört, sagte Lydia: »Brandwetter hat einen wirklichen Brand in meinem Herzen entfacht.« Alexander lachte amüsiert. Lydia lächelte ihm zu. »Er hat mich an meine Jugend erinnert. Das war schmerzlich und beglückend. So gern wäre ich noch einmal jung gewesen! Alles hätte ich anders gemacht! Nie wieder einen Hamburger Pfeffersack geheiratet, niemals wäre ich in diese Falle getappt, in der ich das Gefühl hatte, bei lebendigem Leib zu verfaulen.«
Alle hielten den Atem an. Sogar die beschwipste Stella, die mit ihrem Bruder herumalberte, riss erschrocken die Augen auf. Da klang ruhig Karl-Wilhelms Stimme, als hätte nicht Lydia ihn, sondern er sie gerade verletzt: »Das meint Lydia nicht so. Das dürft ihr nicht so ernst nehmen. Manchmal neigt sie zu radikalen Formulierungen. Und ihre Ideen verändern sich auch von Tag zu Tag. Zum Beispiel ist sie nach dem Krieg auf einem anderen Kongress gewesen. Von dem kehrte sie als Märchenerzählerin zurück.«
Erstaunt bemerkte Lysbeth, wie Lydia errötete. Was passierte da gerade zwischen den Eheleuten? Märchenerzählerin?
Im Raum machte sich ein peinliches Schweigen breit. Kurz nur, aber es wirkte endlos. Stella leerte hastig ihr Glas und erhob sich, leicht schwankend. »Auf, auf, Dritter, mein Schatz! Wir spielen weiter. Die Musike, die Musike ruft!« Dritter war im Nu auf den Beinen. »Kommt doch alle mit rüber«, sagte er mit einem schmelzenden Blick auf Lydia. Er legte eine Hand auf ihre Schulter, ebenso kurz, kürzer noch als zuvor die Schweigeminute gewährt hatte, aber es war, als ströme neues Leben in Lydia. »Ja«, sagte sie leise, »das ist eine gute Idee.«
In diesem Augenblick liebte Lysbeth ihren Bruder sehr. Sie wusste, wie wenig tief sein Mitgefühl ging, aber immerhin war er in der Lage, mit ein paar Worten, einem Blick, einer Berührung genau das Richtige zu tun, um Lydia aus ihrer Beschämung zu reißen.
Als wäre sie es ihrer Würde schuldig, sagte Lydia, ohne ihren Mann mit einem einzigen Blick zu streifen, als spräche sie allein zu Dritter, an dessen Augen sie sich festhielt: »Du warst im Krieg. Du weißt, dass alle, die den Krieg erlebt haben, verändert zurückgekommen sind.« Er blieb stehen und hielt ihrem Blick lächelnd stand.
Lysbeth stockte der Atem. Es wirkte, als würde Lydia umfallen, wenn er seine Aufmerksamkeit jetzt von ihr abzöge.
»Ich war nicht im Krieg«, sagte Lydia trocken, »denn ich bin eine Frau. Ich glaube, ich habe mir das verübelt. Aber dort auf dem Schloss lernte ich, dass der Krieg nicht nur geschadet hat. Nein, so ist es falsch. Aber ich habe Menschen kennengelernt, die sich der Lehre der Zerstörung nicht verweigerten. Die wahre, aufrichtige Worte sprachen.«
Es kam Lysbeth so vor, als vibriere Lydias Körper. »Ich habe dort etwas ganz Besonderes erlebt. Ich habe unmittelbar daran teilgenommen. Altes brach zusammen, und Neues keimte auf. Ein junger Frontsoldat, ein Arbeiter, hat seine Gedichte vom Grauen des Krieges vorgelesen. Dafür hätte er ins Militärgefängnis kommen können. Es waren keine schönen Verse, alles andere als Kleist und Lessing, aber sie waren rau und wahr. Darin lag eine Schönheit, die mich erregt hat. Expressionistische Maler, eben von der Front zurück, haben ihre verstörenden Zeichnungen von Hand zu Hand gehen lassen.« Plötzlich brach sie in ein leichtes, amüsiertes Lachen aus. »Mein Gott, was tu ich hier? Ich verderbe euch allen den Abend. Kommt, lasst uns rübergehen! Lasst uns genießen, wie gut wir es haben.«
Selbstverständlich erhob sich allgemeiner Protest, dass Lydia keinesfalls irgendjemandem den Abend verdarb. Alexander bat sogar darum, mehr von dieser Konferenz zu hören. Doch Lydia ging, eingehakt bei Dritter, ins Nebenzimmer und bat die beiden Geschwister, ein paar Abendlieder zu spielen, sodass alle sich noch einmal im gemeinsamen Gesang der schönen deutschen Volkslieder zusammenfinden könnten, bevor sie schlafen gingen.
Stella sah ihren Bruder fragend an, der zuckte mit den Schultern. Und nun geschah etwas, das Lysbeth nicht mehr für möglich gehalten hatte. Käthe setzte sich in diesem Augenblick allgemeiner Unentschlossenheit ans Klavier und stimmte »Der Mond ist aufgegangen« an. Ihr Spiel war anfangs vorsichtig, man hörte, dass sie das Instrument seit Jahren nicht mehr benutzt hatte, doch nach wenigen Tönen ging eine Verwandlung mit ihr vor, die auf die Gesichter im Raum ein andächtiges Staunen zauberte. Käthe, die harte, traurige Frau, wurde weich und jung.
Ein Abendlied nach dem andern perlte von ihren Händen auf die Tasten. Sie kannte alle Texte und sang mit klarer, heller Stimme, und nach und nach fielen alle ein. Sogar Stella und Dritter erinnerten sich an die Lieder ihrer Kindheit.
Eine Woche später zog die Familie Wolkenrath in die Feldstraße am Heiligengeißfeld. Auf dem Kopfsteinpflaster der breiten Straße rumpelten Pferdekutschen und Autos. Schwarz und blattlos säumten Linden die Feldstraße rechts und links. Käthe und Alexander waren glücklich, in dieser Straße mit den schönen alten Häusern eine große Wohnung gefunden zu haben. Dennoch waren alle ein wenig traurig, von der Elbchaussee fortzuziehen. Ihnen war auch klar, dass jetzt wieder Schmalhans Küchenmeister sein würde. Sie besaßen nicht die gutgefüllte Speisekammer der Gaerbers, und hier gab es auch keinen Hof wie in Dresden, in dem wenigstens Kartoffeln und Möhren angepflanzt werden konnten. Ebenso würde ihnen die berühmte Gemüsesuppe der alten Tante Lysbeth fehlen, die bis zu ihrer Abreise immer wieder in Notzeiten ihre Stimmung aufgehellt hatte.
Natürlich war es im Grunde nicht die Suppe, sondern die Tante selbst gewesen, die so wohltuend auf die gesamte Familie Wolkenrath eingewirkt hatte. Vor dem Krieg hatte die Tante allein in ihrem Häuschen bei Laubegast gewohnt. Dort arbeitete sie als heilende Kräuterfrau und Helferin in sämtlichen Fragen, die mit dem Kinderkriegen zusammenhingen, einschließlich Abtreibungen. Sie hatte ihr Wissen an die siebzehnjährige Lysbeth weitergegeben, und sie hatte Stella geholfen, als diese, dreizehnjährig, schwanger war, indem sie Adoptiveltern für das Kind gefunden hatte. Als die Familie Anfang 1921 nach Hamburg floh, kehrte die Tante wieder nach Laubegast zurück. Mit ihren neunzig Jahren sei sie zu alt, hatte sie erklärt, um diesen Wechsel noch mitzumachen.
Die neue Wohnung der Wolkenraths befand sich im zweiten Stock und hatte sechs Zimmer, die Toilette lag zwischen zwei Etagen im Treppenhaus. Dritter, Eckhardt und Johann schliefen in einem Zimmer, auch wenn sie nun Männer waren. Aber das kannten sie ja schon. Ebenso wie die Mädchen, auch wenn sie nun Frauen waren. Alexander und Käthe hatten ein Schlafzimmer. Dann das Wohnzimmer. Darauf bestand Käthe. Das Klavier hatte wie durch ein Wunder die Reise heil überstanden. Es bekam einen Ehrenplatz im Wohnzimmer, das Stella mit allerlei Schnickschnack so ausstaffierte, dass es dem Salon der Gaerbers ein wenig ähnelte.
Zwei Räume der Wohnung waren dem Geschäft vorbehalten: Elektrogroßhandel Wolkenrath und Söhne. In Wirklichkeit trieben sie Handel mit allem, was sie kriegen konnten. Taten eine große Ladung Fischkisten auf und verkauften sie am Hafen. Ergatterten einen Schwung Pullover und verkauften sie Stück für Stück. Im Geschäft herrschte Chaos, aber Begeisterung. Sie lebten von der Hand in den Mund, aber sie lebten besser als die Arbeitslosen, die auf den Straßen bettelten.
Der Krieg hatte ein Millionenheer in die Städte und aufs Land zurückgekippt. Wie Müll, verbraucht, vernichtet, beschädigt, lagen die Menschen nun in den Städten herum. Die deutschen Männer hatten im Krieg nahezu alles verloren, was einmal von Bedeutung gewesen war. Vor allem ihre Würde und ihre Moral. Vor dem Krieg waren die Männer diktatorische Patriarchen gewesen. Frau und Kinder hatten nach ihrer Pfeifen zu tanzen. Die Männer, die aus dem Krieg zurückkehrten, taten so, als könnten sie dort wieder anknüpfen. Aber ihr Rückgrat war gebrochen, und ihre Frauen hatten ihre eigene Kraft erprobt. Die Kinder waren von den Vätern enttäuscht, hatten sie doch in der Schule gelernt, dass Deutschland unbesiegbar wäre.
All dies schwappte in jede einzelne Familie hinein. Auch in die der Wolkenraths. Jedoch war Alexander Wolkenrath noch nie der Patriarch in der Familie gewesen, diese Rolle hatte der alte Volpert, Käthes Vater, innegehabt. Aber der war tot, und seitdem stand Käthe vollkommen auf ihren eigenen Füßen. Außerdem besaß sie eine ganz besondere Urne. Angeblich lag darin die Asche ihrer Mutter, in Wirklichkeit aber versteckte Käthe dort Goldstücke, die ihre Eltern für sie gespart hatten. Von diesem Schatz wussten zwar ihre Töchter Lysbeth und Stella, aber keines der männlichen Familienmitglieder. Irgendwann wollte Käthe davon ein Haus kaufen, so wie ihr Vater es ihr geraten hatte. Doch erst einmal mussten sie sich in Hamburg zurechtfinden.
Im Laufe der ersten Wochen trug Lydia diskret einiges zur Wohnungseinrichtung bei, indem sie von Zeit zu Zeit mit einem Möbelstück auftauchte, das sie angeblich nicht brauchen konnte. Das Wohnzimmer ähnelte immer stärker ihrem Salon, en miniature, versteht sich. Es war das Zentrum des Familienlebens. Dort wurde jeden Abend auf dem Klavier geklimpert. Stella und Dritter spielten vierhändig die neumodischen Rhythmen, dass es allen in den Füßen zuckte. Käthe aber rührte es nicht an, obwohl ihre Kinder sie immer wieder darum baten. Sie versteckte ihre Hände am liebsten, denn sie waren in den vergangenen Jahren von der vielen Hausarbeit rau und knochig geworden.
»Ein Klavier geziemt sich für Menschen mit Bildung und Stil«, sagte Stella. Und sie sahen auch aus wie Menschen mit Bildung und Stil. Die Töchter stets nach der neuesten Mode gekleidet. Stella und Cynthia hatten Lysbeth vor einiger Zeit schon zum Friseur geschleift, seitdem trug auch sie ihre blondem, dünnen Haare zu einem Pagenkopf geschnitten, was bei der großen, überschlanken jungen Frau erstaunlich raffiniert aussah. Cynthia hatte ihr zwei kurze Hängerkleider von sich geschenkt. Eins in Grün und eins in Feuerrot. Dazu hatte Stella der Schwester den passenden Lippenstift gekauft. Lysbeth wirkte wie eine völlig veränderte Frau. Als Dritter sie in dem roten Kleid sah, pfiff er anerkennend durch die Zähne. »Ich versteh den Maximilian«, sagte er. Lysbeth blickte ihn erstaunt an. »Du willst doch nicht behaupten, du hast nicht gemerkt, wie der hinter dir her ist?«, bemerkte Dritter spöttisch. Lysbeth zuckte die Schultern. Von Männern, die angeblich hinter ihr her waren, wollte sie nichts hören.
Nicht nur die Frauen der Familie waren immer schick und modern. Die Söhne gingen stets in Anzug und mit Hut aus dem Haus, die Schuhe gewienert, das war Soldatenehre.
Seit der Verlobung mit Cynthia war Eckhardt aufgeblüht. Er fühlte sich der Jugend wieder zugehörig. Sein Verstand arbeitete wieder einigermaßen vernünftig. Vor drei Jahren noch, nachdem er im Krieg mit einem Splitter im Kopf verschüttet und wie durch ein Wunder gerettet worden war, hatte er den Segen dieses Wunders angezweifelt. Wer wollte schon ein verblödeter Krüppel sein, der sich mühte, die richtigen Worte zu finden? Jetzt aber fiel er keinem mehr besonders auf. Sicher, seine überragende Intelligenz von vor dem Krieg war dahin. Aber daran erinnerte er sich selbst kaum mehr. Die Narbe am Kopf sah man nicht unter dem Haar. Die zeitweiligen Migräneanfälle, verbunden mit dunkler Schwermut, hielt er vor anderen verborgen. Dann blieb er drei Tage lang im Bett. Die Vorhänge mussten zugezogen sein, weil er keine Helligkeit ertragen konnte. Er erbrach sich und litt still vor sich hin. Die übrige Zeit aber war er Teil einer vergnügten Gruppe, die aus seiner Verlobten, Dritter und seinen beiden Schwestern sowie Freunden von Cynthia, Maximilian von Schnell, Jonny Maukesch und Leni, bestand. Seit die jungen Leute einander auf Cynthias und Eckhardts Verlobung kennengelernt hatten, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Jonny und Maximilian hatten während des Krieges als Erste Offiziere der Kriegsmarine gedient. Leni war Lehrerin und Jonnys Verlobte.
Manchmal fuhren sie zu siebt in Maximilians offenem Auto durch die Gegend, dann saßen die Frauen auf den Schößen der Männer, was ein großer Spaß war.
Nur Johann stand immer ein wenig abseits. Er war peinlich klein, er war nicht besonders klug, bei weitem nicht so schlau wie Eckhardt vor dem Krieg und nicht einmal so schnell im Denken wie Eckhardt nach dem Krieg.
Mit Bewunderung und zunehmendem Neid folgte Johanns Blick dem großen Bruder Dritter, der immer wilder, kantiger und gefährlicher wurde. Auf der Reeperbahn, die um die Ecke der Feldstraße lag, kannte Dritter sich bald besser aus als die meisten Hamburger. Johann aber fürchtete sich vor dieser Vergnügungsmeile.
Dritter kommandierte Johann herum, wie es ihm Spaß machte. Bei Eckhardt achtete er auf kameradschaftliches Verstehen. Eckhardt war die Brücke zur Elbchaussee und zu Hamburger Geschäftsleuten, die sich nicht leicht Fremden öffneten. Dritter vermied sorgfältig, Eckhardt auszustechen. Er wusste, dass ihm das mit Leichtigkeit gelingen würde. Besonders bei Cynthia hielt er sich sehr zurück. Ihre Mutter Lydia hingegen überschüttete er mit Komplimenten, überrollte sie mit seinem Charme, nahm sie mit seinem einschmeichelnden Blick gefangen.
Johann wurde weder mit zur Elbchaussee noch zur Reeperbahn genommen. Das war ihm eigentlich recht. Er war überaus glücklich, nicht mehr bei Lydia Gaerber Gast sein zu müssen. Mit ihren unpatriotischen Ansichten gehörte sie für ihn zu der verhassten Gruppe der Roten und der Juden, Vaterlandsverräter, die Deutschland den Stoß in den Rücken versetzt hatten. Lydia trug Schuld daran, dass der Krieg verloren war. Johann hasste sie geradezu, es ekelte ihn, dass sie eine Frau war. Auch zur Reeperbahn wollte er eigentlich nicht mit. Tanzen war ihm ein Gräuel. Die aufreizend geschminkten Frauen, die rauchten und rumhurten, einschließlich seiner Schwestern, empfand er als abartig und gefährlich. Wenn es nach ihm ginge, würde er sie mit deutscher Seife schrubben, einschließlich ihres Mundes, aus dem unflätige Worte und obszönes Lachen drangen, und einschließlich ihres Geschlechts. Aber er war sich nicht sicher, ob seine Schwester Stella überhaupt jemals eine anständige deutsche Frau werden könnte.
Leider ging nichts nach ihm. Er gehörte nicht dazu. Johann, der Kleine. Johann, das Muttersöhnchen. Johann mit den dicken Fingern, der weder Klavier spielen noch reiten, noch schießen, noch Frauen aufreißen konnte. Johann, der nie eine gute Gelegenheit auskundschaftete, nicht fürs Geschäft, nicht fürs Vergnügen. Johann, der sich dranhängte, aber nicht selbst aktiv war. Johann, der nie ein wirklich findiger Unternehmer werden würde.
»Mensch, Johann«, sagte der Vater Alexander ein ums andere Mal, »wir leben in Zeiten, wo die Karten neu gemischt werden. Heute kann man reich werden, wenn man die Augen offen hält.« Doch vergeblich. Johann machte nicht den Eindruck, als würde er von der Nachkriegswirtschaft profitieren können.
Keiner bekam mit, als Johann Freunde fand, die ihn als ihresgleichen aufnahmen. Ihm war, als wäre er endlich in der Familie gelandet, zu der er in Wirklichkeit gehörte.
Im Spätsommer, die Linden verabschiedeten sich gerade von ihrer Zeit des süßen Duftes und des klebrigen Saftes, passierte etwas Verhängnisvolles. Johann wollte die Wohnung verlassen, obwohl es erst Nachmittag war. Man hatte seinen Kaffee getrunken und ein Glas Rum dazu, gleich sollte weitergearbeitet werden.
Da sagte Johann leichthin: »Ich geh denn mal …«
Dritter schaute irritiert auf.
Eckhardt warf einen misstrauischen Blick zum Flur. »Guck mal, Dritter«, sagte er grinsend, »Johann ist sehr dick geworden.«
Dritter schoss aus dem Zimmer. Bevor Johann die Wohnungstür erreicht hatte, erwischte er ihn. »Hier geblieben, Bürschchen!«
Er griff unter Johanns Mantel und pfiff durch die Zähne. Mit einem Ruck zog er einen Pullover heraus und dann einen nach dem andern. Die Pullover! Die Goldpullover, die aus ihrer wunderbaren Gelegenheit stammten.
Eine wundersame Gelegenheit sogar, denn Lysbeths Verehrer Maximilian von Schnell bemühte sich ungemein, der Familie Wolkenrath von Nutzen zu sein. Maximilian war zwar als Erster Offizier zur See gefahren, er hatte sogar den Matrosenaufstand miterlebt und war beinahe erhängt worden, aber er war zugleich und zum Glück ein Fabrikantensohn. Sein Vater besaß eine Fabrik, in der nordische Pullover hergestellt wurden. Er verkaufte sie teuer. Maximilian sorgte seit einiger Zeit dafür, dass die als Ausschussware deklarierten Stücke billig der Familie Wolkenrath zukamen, ja er fügte sogar noch einige perfekte Pullover hinzu, denn ihm war sehr daran gelegen, die etwas spröde Dresdnerin milde zu stimmen. Wofür die Brüder schon sorgen wollten, denn die neue Einkunftsquelle für Wolkenrath und Söhne wirkte geradezu unversiegbar. Die in Männersachen vollkommen naive Lysbeth ahnte allerdings überhaupt nicht, dass das Pullovergeschäft etwas mit ihr zu tun hatte.
»Du Dieb!«, zischte Dritter und schlug zu. »Bruderdieb!« Und er schlug noch einmal zu.
Eckhardt stand daneben, die Fäuste geballt, die Augen zusammengekniffen, um im schummrigen Flur besser sehen zu können. Dritter schlug zu, bis Johann wie ein nasses Bündel Pullover auf die Erde sackte. Alles ging recht leise vonstatten. Die Mutter in der Küche hatte nichts vernommen.
»Und nun verschwinde!«, befahl Eckhardt streng. Er schloss die Tür hinter dem Bruder, der sich auf allen vieren davonstahl.
Dritter wischte sich die Hände aneinander sauber, rückte das Hemd gerade und den Schlips. Als das Telefon klingelte, ging er gemessenen Schrittes hin. »Wolkenrath und Söhne«. Das klang so ruhig und gelassen, als hätte nicht eben eine kleine Prügelei zwischen Brüdern stattgefunden. Es war ja auch eigentlich keine Prügelei gewesen, sondern eher ein pädagogisches Disziplinieren. Der kleine Bruder hatte seine Lektion hoffentlich gelernt.
Am Telefon vernahm Dritter nach kurzem Schweigen in breitem Ruhrpottdialekt: »Is dä Hännes do?« Dritter stutzte, dann grinste er. Seine Stimme wurde weich wie geschmolzene Butter: »Dä Hännes? Nein, gnädiges Fräulein, mein werter Bruder Johann hat soeben das Büro verlassen. Soll ich ihm etwas ausrichten … und von wem denn bitte?«
Er grinste Eckhardt an und feixte. Doch der tat so, als achte er gar nicht auf das Telefonat, und blätterte in Kalkulationen, die ungeordnet auf einem der drei Schreibtische lagen. Die Kalkulationen waren seine Aufgabe, die Berechenbarkeit von Zahlen beruhigte ihn, er liebte es, sich damit zu beschäftigen.
»Dat Sophie …« Dritter konnte das Lachen kaum mehr zurückhalten, nun schaute auch Eckhardt auf und zog fragend die Augenbrauen in die Höhe. »Nun, Fräulein Sophie, das ist ja sehr bedauerlich, ich werde es meinem Herrn Bruder ausrichten. Sie sind heute Abend leider verhindert und bedauern es sehr, aber es sei nicht anders möglich. Ja, selbstverständlich. Servus, Mademoiselle.«
Er hängte den Hörer ein und schüttelte einen Augenblick lang den Kopf, dann brach er in wieherndes Gelächter aus.
»Dat Sophie! Ich werd verrückt, unser Kleiner hat eine Damenbekanntschaft gemacht, ich fass es nicht.«
»Na los, spuck aus! Was war das für eine Nudel?« Eckhardts Wangen waren leicht gerötet, in der letzten Zeit hatte er eine Vorliebe für Klatschgeschichten entwickelt. Und dass Johann, der noch kleiner war als er, einem Mädchen den Kopf verdreht hatte, das auch noch die Dreistigkeit besaß, in der Firma anzurufen, das ging über Klatsch weit hinaus.
»Dat wor dat Sophie. Dat Sophie klingt blutjung, ich würd mal sagen, zwanzig, aber höchstens.« Alexander kannte sich mit Frauenstimmen aus. Er kannte sich auch mit Frauenhänden, Frauenküssen und all dem Übrigen aus, was mit dem andern Geschlecht zu tun hatte. »Und sie klingt, als könnte sie unserm Kleinen Suppe kochen. Wär nicht von Übel, paar Muckis muss er noch entwickeln, kann sich ja nicht von jedem zu Brei schlagen lassen.«
Eckhardt grinste. Seine Cynthia war nicht die große Köchin, aber sie war eine feine Dame. Auch wenn sie einen Pagenkopf trug und mit der Zigarettenspitze herumfuchtelte, weil sie meinte, die moderne Frau müsste rauchen. Er fand das nicht gerade seriös und zeigte ihr das auch, indem er manchmal etwas wortkarg wurde, aber im Großen und Ganzen war Cynthia ganz eindeutig ein Mädchen aus besserem Hause, und darauf kam es an.
So etwas hatte nicht einmal Dritter vorzuweisen. Dritter, dem das Mädchen weggelaufen war. Darüber sprachen die Brüder nie, nicht einmal nachts, wenn die Lichter aus waren und Eckhardt nicht einschlafen konnte, weil aus Dritters Ecke Zigarettenrauch quoll.
Auch in dieser Nacht schaute Eckhardt zu dem rötlich glimmenden Licht, das sich durch den Tabak fraß, bis es endlich erlosch. Wie so oft malte er sich Dritters Kummer wegen dem Mädchen aus, das von einem anderen ein Kind bekommen hatte, wenig später als ein Jahr, nachdem Dritter gesagt hatte: »Wenn ich zurückkomme, heirate ich sie, das ist klargemacht.«
Mit einem warmen Gefühl der Sicherheit glitten seine Gedanken zu Cynthia. Seit Ende letzten Jahres waren sie nun schon verlobt. Zum Glück waren sie sich einig, dass sie nicht so bald heiraten wollten.
Vor zwei Wochen war leider etwas geschehen, das Eckhardt zugesetzt hatte. Mitten auf der Reeperbahn war er Askan von Modersen geradezu in die Arme gelaufen. Sie hatten einander männlich auf die Rücken geklopft und gemeinsam mit Dritter und Jonny Maukesch ein Bier darauf getrunken, dass sie alle den Krieg überlebt hatten. Askan hatte sich danach verabschiedet, mit Bedauern, wie er sagte, aber er hatte eine Verabredung, und am kommenden Tag wollte er wieder aufs elterliche Gut in Sachsen fahren, das er seit Kriegsende führte, da sein Vater inzwischen gestorben und der Betrieb für die Mutter viel zu groß war.
Eckhart musste die Tränen der Freude über das Wiedersehen mit aller Gewalt unterdrücken. Beim Abschied klopften sie sich nicht einmal die Rücken, sondern verbeugten sich nur zackig voreinander. Auch da musste Eckhardt wieder alle Kraft aufwenden, damit er Askan nicht um ein Wiedersehen bat.
Dabei war er doch froh gewesen, dass er diesen Mann mit seinem teuflischen Einfluss so lange nicht gesehen hatte. Und er wollte ihn auch nie wiedersehen!
Aber heiraten wollte er nicht so bald.
All diese Gedanken bewirkten eine irgendwie angenehm schwebende, müde Leichtigkeit, nun, nicht gerade Leichtigkeit, Eckhardt und Leichtigkeit, das passte nicht zusammen, aber trotz des Zigarettenrauchs, der in seiner Kehle kratze, kehrte Freundlichkeit in Eckhardts Seele ein, eine versöhnliche Wärme. Er schlief ein, bevor der Glimmstängel erloschen war.
»Sag mal, wusstest du, dass Johann eine Freundin hat?« Dritter fragte als Erstes die Mutter. Die schüttelte energisch den Kopf. Dann fragte er die Schwestern. Die kicherten ungläubig. Also wusste niemand etwas davon.
2
Wie kann Jonny bloß ein solches Gänschen wie Leni heiraten wollen? Leni ist Lehrerin.« Stella spuckte das letzte Wort aus, als handle es sich bei Lehrerinnen um etwas Ähnliches wie lästige Kriechtiere.
Dritter lachte meckernd.
Sie saßen im Alsterpavillon, den die Hamburger »Kachelofen« nannten, weil er ebenso gebaut war, und tranken Limonade. Dritter sah aus wie ein Dandy. Umwerfend attraktiv mit seinem markanten Gesicht, den breiten Schultern, den gestreiften Hosenbeinen, die er lässig übereinandergeschlagen hatte, vor allem aber mit diesem Blick, den er Frauen zuwarf: Unter leicht gesenkten Augenlidern, ein schneller scharfer Blick mitten ins Herz. Keine konnte ihm widerstehen. Und wenn ihm eine widerstand, legte er sich besonders ins Zeug, stellte eine innige Stimmung her, erzählte offen von den Schmerzen, die es ihm bereitet hatte, als Beatrice, seine Liebste, ihn so schmählich betrogen hatte und für ihn mitten im Krieg verloren war. Danach widerstand ihm auch die Hartgesottenste nicht mehr.
»Leni ist ganz nett«, sagte er blasiert.
Jetzt war es an Stella zu lachen.
Wer Stella vor dem Krieg gesehen hatte, hätte sie nicht wiedererkannt. Sie trug einen Pagenschnitt, die eigentlich roten, wilden Haare bändigte sie jeden Morgen zu einer glatten Kappe, und weil Rot wirklich vollkommen aus der Mode war, trug sie die Haare schwarz gefärbt. Eine schwarzhaarige Frau mit veilchenfarbigen Augen. Die Veilchenfarbe trat noch besonders hervor, weil sie ihre Wimpern täglich eine halbe Stunde lang schwarz und schwärzer und lang und länger tuschte und ihnen zum Abschluss mit einer neumodischen Wimpernzange einen runden Schwung verlieh. Ihre Lippen waren blutrot geschminkt, ihre Brüste kaum noch sichtbar, da sie sie abschnürte. Sie trug modische Hängekleider. Mit einem Busen hätte sie darin schwanger ausgesehen, und das wollte sie nun wirklich nicht.
Allein wenn Stella lachte, breit, ansteckend, hemmungslos, war sie unverkennbar sie selbst. Und sie lachte häufig, denn sie wusste, dass ihr Lachen die Männer verrückt machte – und ihr Hüftschwung und wie sie an ihrer Zigarettenspitze nuckelte. Im Augenblick allerdings war sie nicht so wahnsinnig daran interessiert, Männer verrückt zu machen, im Augenblick ging es ihr ausschließlich um Jonny Maukesch. Kapitän Jonny Maukesch! Sie musste ständig an ihn denken. Das war ihr noch nie passiert.
Dabei hatte sie am Anfang nur gedacht, dass er gut aussah und etwas Zwingendes hatte. Dass er eine gute Partie war, ließ sie völlig kalt. Sie hatte nicht im Geringsten das Gefühl, unter die Haube zu müssen. Im Gegensatz zu Vorkriegszeiten war eine unverheiratete Frau Mitte zwanzig nichts Besonderes. Auch dass sie keine Jungfrau mehr war, hatte die Männer, mit denen sie in den letzten Jahren zu tun gehabt hatte, nicht davon abgehalten, sie ihren Müttern vorstellen zu wollen, natürlich auch den Vätern, sofern die nicht im Krieg gefallen waren, und ihr einen Heiratsantrag zu machen. Stella hatte sich bemüht, keinen zu verletzen. Sie hatte gelacht, aber nicht verächtlich, sondern auf eine Weise, die den Männern gefiel: geschmeichelt, kokett, irgendwie die Männlichkeit ihres Gegenübers bestätigend. Aber sie hatte nie mit »Ja« geantwortet.
Nein, gelangweilt hatte sie sich während des Krieges nicht.
Stella hatte sozusagen ein Studium der Männer betrieben und war dabei völlig unversehrt geblieben. Keiner hatte sie verletzt. Keinem hatte sie sich ausgeliefert. Und wenn sie auch zahlreiche Erfahrungen im Bereich der körperlichen Liebe gesammelt hatte, so hatte sie sich doch keinem hingegeben.
Sie wusste jetzt, nach acht Jahren Studium, was Männer wollten, wie Männer dachten, wie Männer sich ausdrückten und was sie verschwiegen. Sie hatte gelernt, wie sie Männer in ihren Bann ziehen und wie sie Macht über sie ausüben konnte. Es war alles ganz anders, als es Mädchen ihrer Generation beigebracht worden war.
Es ging nämlich überhaupt nicht darum, lieb und nett zu sein. Ganz im Gegenteil. Man musste mal unglaublich lieb und sanft und zärtlich und aufmerksam sein und dann wieder wie ein Biest. Dann musste man Krallen zeigen, ihn nicht ranlassen, unerreichbar sein. Es gab Frauen wie sie, Frauen, die sich nicht einem Mann auslieferten, weil sie ihn liebten, die sich nicht schwängern ließen und im Lazarett noch heirateten, sondern Frauen, die sich gut kleideten, auch im Krieg zu essen hatten und ihre Talente pflegten, die sie von Männern unabhängig machten. Diese Frauen waren nicht schlechter als die anderen. Sie wussten nur, dass Liebe einen dicken Bauch, aber keinen vollen Magen macht. Sie wussten, dass es die Männer waren, über die man Bescheid wissen musste, um das eigene Talent durchzusetzen, denn Talent reichte nicht aus, um erfolgreich zu sein. Mit Talent allein überzeugte keine Frau einen einflussreichen Mann.
Stella hatte eine Schauspielerin, Sonja, kennengelernt, die ihr gesagt hatte, worauf es ankam. »Männer sind wie Luftballons«, hatte Sonja gesagt. »Wenn du draufdrückst, wenn du nach einem Engagement, nach Unterstützung oder gar nach ihrer Liebe jammerst und schreist, weichen sie zurück, weiter und weiter. Wenn du loslässt, kommen sie näher. Und wenn du mal drückst, mal loslässt, mal drückst, mal loslässt, geraten sie in Wallung. Dann kommen sie in Bewegung, dann werden sie verrückt. Alter Trick. Erst dann darfst du von einem Engagement sprechen. Andere Frauen fangen dann von Heirat an, Frauen wie wir sprechen von einem festen Vertrag. So und nicht anders musst du es machen!«
Stella hatte sich daran gehalten. Es hatte keinen gegeben, der ihr nicht verfallen war. Beinahe hätte sie sogar einen Schallplattenvertrag bekommen, aber das hatte sich zerschlagen.
Jetzt allerdings musste sie immer an Jonny Maukesch denken.
Er war weiß Gott nicht der erste Offizier, mit dem sie es zu tun hatte. Er war auch nicht der erste blauäugige schneidige Mann, der sich in den Schultern wiegte und strahlend blaue Augen hatte. O nein.
Aber, verdammt nochmal, er war der Erste, der sie interessierte. Und ausgerechnet er sollte unerreichbar sein? Das wollte sie nun wirklich nicht akzeptieren. Aber sie fühlte sich wie ein kleines, unerfahrenes Mädchen, wenn sie ihm begegnete. Sie verlor völlig die Kontrolle über die Situation und hatte nur noch das drängende Bedürfnis, von ihm geküsst zu werden.
»Dritter, du musst mir irgendwie helfen. Gib mir einen Rat!« Ihr Ton war schmeichelnd, in ihren Augen lag ungekünstelte Hilflosigkeit.
Dritter schlug ein Bein über das andere und zupfte die Bügelfalten gerade. »Du willst einen Rat?«, fragte er gedehnt. »Vergiss ihn! Ich verstehe überhaupt nicht, wieso du so verrückt nach ihm bist. Fritz hätte gesagt: Das ist ein verdammter Konterrevolutionär.«
»Ich versteh es auch nicht«, antwortete Stella mit einem gequälten Lächeln. Ihr kamen die Tränen. Fritz hätte in diesem Zusammenhang nicht erwähnt werden dürfen. Seit kurzem erst wusste sie, dass er ihr leiblicher Vater war, aber auch vorher hatte sie ihn wie einen Vater geliebt. Er war als aufrechter Revolutionär gestorben. Natürlich wäre er entsetzt gewesen über die Faszination, die Jonny Maukesch auf sie ausübte. Ja, aber er war tot. Wenn Fritz noch lebte, wäre sowieso alles anders, dachte sie traurig.
Als er die Tränen der Schwester sah, zog Dritter irritiert die Augenbrauen in die Höhe. So kannte er sie nicht. Er war kurz davor, ihr davon zu erzählen, was ihn belastete. Eckhardt hatte eine Vorladung zum Gericht bekommen. Eine Vaterschaftsklage. Dritter kannte die Frau. Gut. Zu gut. Er zückte sein silbernes Etui und bot seiner Schwester eine Zigarette an.
Lysbeth hatte in Hamburg ihre alte Leidenschaft neu entdeckt: Das Theater. Diese Stadt hatte so ein breites Angebot. In manchen Wochen ging Lysbeth viermal ins Theater. Da war das Schauspielhaus, das Thalia-Theater, das Altonaer Theater und neuerdings die Kammerspiele, in denen moderne expressionistische Stücke gezeigt wurden, die Lysbeth ganz besonders interessant fand. Oft wurde Lysbeth von Lydia Gaerber begleitet. Lydia kannte manche der Expressionisten persönlich, sie war überhaupt sehr informiert, was das moderne Kunstleben anging.
Lysbeth hatte aber auch kein Problem damit, allein ins Theater zu gehen. Früher hatten Eckhardt und sie sich gemeinsam für die Welt auf der Bühne begeistert, aber jetzt war er angeblich abends nach der langen und anstrengenden Bürotätigkeit zu müde. Viele Abende verbrachte er noch über den Büchern der Firma Wolkenrath und Söhne, da er für die Buchhaltung zuständig war. Seine Verlobte Cynthia las unglaublich viel. Sie empfand das Theater als zu einengend. »Wenn ich lese«, sagte sie, »kann meine Phantasie die Bilder schaffen, das Theater setzt sie mir immer schon vor.« »Meine Phantasie hingegen«, pflegte ihre Mutter Lydia auf diesen Ausspruch schnippisch zu entgegnen, »kann beides vertragen, die Bilder des Theaters und die Worte der Literatur.«
Lydia fand sich oft und gerne in der Feldstraße ein. Sie liebte es, mit Alexander Wolkenrath und seinen Söhnen zu plaudern. Vor allem aber liebte sie es, weg von ihrem Mann zu sein, der immer häufiger in eine trübsinnige Schweigsamkeit fiel.
Lysbeth fand Cynthia erschütternd langweilig, und ganz besonders ärgerte sie, dass sie eher aussahen wie Schwestern, als sie und Stella es taten. Beide waren sie groß, sehr schlank mit langen Gliedern, beide blond und beide irgendwie unscheinbar. Nicht hässlich, einfach so, dass Männer sie übersahen.
Lysbeth wusste nicht, dass sie durchaus etwas Besonderes ausstrahlte, etwas, das man erst auf den zweiten Blick entdeckte. In Lysbeths Innerem lagen Klarheit und Leidenschaft. Eine Tiefe, die ihr Glanz verlieh. Ihr Leben, das innere wie das äußere, war erfüllt von Gedanken, Gefühlen, von Bildern und Träumen, von Geheimnissen, die niemanden etwas angingen, und von Liebe. Und vom Feuer der Leidenschaft. Ihre Liebe gehörte vor allen anderen der kleinen Angelina, ihre Leidenschaft galt der Medizin.
Lysbeth liebte ihre Nichte Angelina mit der ganzen Kraft ihres Wesens. Angelina war jetzt fast zehn Jahre alt, ein kluges, manchmal freches, sehr lebhaftes Mädchen, das zu Lysbeth eine innigere Bindung hatte als zu ihrer Adoptivmutter, von der sie bis jetzt nicht einmal wusste, dass sie nicht ihre leibliche Mutter war. Und Stella ahnte nichts von Lysbeths Beziehung zu ihrer Tochter.
Seit sie in Hamburg wohnten, fuhr Lysbeth einmal monatlich zu ihrer alten Tante nach Laubegast bei Dresden. Dass sie bei diesen Gelegenheiten auch Angelina besuchte, die auf einem Bauernhof in der Nähe lebte, wusste niemand außer Käthe, die sich regelmäßig danach erkundigte, wie es ihrer Enkelin ging.
Ja, Lysbeths Liebe gehörte Angelina, ihre Leidenschaft der Kunst und der Medizin. Während des Krieges hatte sie im Krankenhaus viel gelernt. Sie hatte festgestellt, dass ihr bei Blut und Eiter und Schmerzensschreien nicht übel wurde. Sie war ganz allein von dem Willen beseelt, Leben zu retten, und zwar so zu retten, dass es möglichst unbeschadet blieb. Natürlich wurde in Kriegszeiten die Chirurgie nicht gerade elegant betrieben. Es wurde eher zu viel abgeschnitten als zu wenig, aber dennoch hatte Lysbeth gelernt, den Unterschied zwischen einem Schlachter und einem Arzt mit Ehre im Leib zu beurteilen.
Sie wünschte sich nichts mehr, als Medizin zu studieren. Ärztin zu werden, das war ihre geheime Sehnsucht. Aber sie hatte nicht einmal Abitur gemacht. Und in ihrer Familie hatte noch nie jemand studiert. Sie behielt ihre Sehnsucht für sich. Vielleicht loderte sie deshalb so besonders hell.
Wen wunderte es da, dass ihr das Frausein eher als Last schien denn als ein Schatz, den sie pflegte, damit sie für ihre weiblichen Reize möglichst viel eintauschen konnte, solange sie noch einen Tauschwert bedeuteten.
Einmal hatte sie sich während des Krieges in einen Arzt verliebt. Aber er war verheiratet und hatte zwei Kinder. Sie hatte ständig versucht, gleiche Dienste wie er zu bekommen, doch als er sie dann einmal nachts küsste, musste sie feststellen, dass ihr das unangenehm war. Verliebt war sie in den Arzt, nicht in den Mann. Sie war besessen von seinen feinen Chirurgenhänden, doch nicht, weil sie von ihm berührt werden wollte, sondern weil sie in der Lage sein wollte, so zu operieren wie er.
Eigentlich interessierte Lysbeth sich nicht für Männer. Sie war siebenundzwanzig Jahre alt, eine alte Jungfer. Wirklich Jungfer. Mit Häutchen und allem. Aber darauf war sie nun wirklich nicht stolz. Ganz im Gegenteil, sie hatte sich während des Krieges sogar manchmal wirklich verliebt, in den einen oder anderen der Soldaten, die in den Krankenhäusern, in denen sie aushalf, betreut wurden, da sie mit ihren Armstümpfen oder gänzlich ohne Beine mehr Hilfe brauchten als diejenigen, die durch einen Splitter im Kopf den Verstand ganz oder beinahe verloren hatten wie ihr Bruder Eckardt.
Leider waren alle, in die sie sich verliebt hatte, gestorben. Wundbrand, Lungenentzündung oder einfach Mutlosigkeit. Lebensunlust. Lysbeth hatte es aufgegeben, sich zu verlieben. Sie hatte sich damit abgefunden, als alte Jungfer zu sterben. So schlimm war das nun wahrhaftig nicht!
Auf Eckhardts und Cynthias Verlobungsfeier hatte Lysbeth sehr hübsch ausgesehen, das wusste sie. Und sie hatte mit Graf von Schnell getanzt. Der Graf war überraschend interessiert an ihr gewesen. Und es war ihm gelungen, sich für Lysbeth interessant zu machen. Der junge Mann, ja, er schien ihr jung, jünger als sie selbst, war einfach nicht von ihrer Seite gewichen. Neuerdings besuchte er oft Lysbeths Brüder in der Feldstraße, und wenn sie zu mehreren ausgingen, wirkte es fast, als wäre Lysbeth für ihn Luft. Sie war schon lange zu dem Schluss gekommen, dass Graf von Schnell sich dafür schämte, auf der Verlobung zu viel mit ihr getanzt zu haben. Sie hatte schon überlegt, ihm einfach zu sagen, er solle sich nichts draus machen und sich ihr gegenüber doch ganz natürlich verhalten. Andererseits wollte sie ihn mit so einem Satz nicht in Verlegenheit bringen. Er war ihr längst genauso wichtig oder unwichtig geworden wie alle anderen Männer.
Wie perplex war sie deshalb, als sie von einem Theaterbesuch nach Hause kam und Maximilian von Schnell mit hochrotem Kopf aufsprang, als sie in den Salon trat, wo er mit Käthe bei einer Tasse Tee saß. Mit zackiger Verbeugung und glänzenden Augen begrüßte er Lysbeth.
»Herr von Schnell ist überraschend vorbeigekommen«, half Käthe den beiden aus der Verlegenheit. »Er hat uns einen kleinen Besuch abgestattet, ist das nicht reizend?«
Lysbeth zog ihre Handschuhe aus und nahm ihren Hut ab. »Ja, ganz reizend«, sagte sie, mit ihren Gedanken immer noch bei dem Stück, das sie gesehen hatte, Die Maschinenstürmer von Ernst Toller, ein eigenartiges modernes Drama.
Käthe, die aus Erfahrung wusste, dass Lysbeth jetzt ganz in Gedanken versunken aus dem Salon in die Küche verschwinden, sich einen Tee zubereiten würde und den Besuch vergessen hätte, noch bevor sie im Mädchen-Schlafzimmer angekommen wäre, sagte schnell: »Stell dir vor, Lysbeth, Herr von Schnell hat so interessant davon erzählt, wo er überall auf der Welt schon gewesen ist.« Dabei schenkte sie Lysbeth aus der feinen Teekanne in die dazu passende Tasse etwas von dem dampfenden Apfelschalentee.
Lysbeth musterte den Gast über die Tasse hinweg. Ja, sie hatten sehr schön miteinander getanzt. Sie erinnerte sie sich jetzt wieder an das angenehme Gefühl, als sein Atem ihren Nacken berührte und seine Hand auf ihrem Rücken lag. Doch das war zehn Monate her. Danach waren sie unzählige Male in der Gruppe mit ihren Geschwistern und Jonny Maukesch und seiner Verlobten ausgegangen. Er hatte mit ihrer Schwester getanzt, mit Cynthia, mit Leni, aber nie mit ihr. Einmal hatten sie sich wieder längere Zeit unterhalten. Da hatte er von Afrika erzählt, wo er vor dem Krieg häufig in den deutschen Kolonien gewesen war. Doch auch dieses Gespräch war schon Wochen her.
Sie sah ihn an. Er sah so jung aus. Und so unbeschadet durch den Krieg. Wie alt mochte er sein? »Wie alt sind Sie?«, fragte sie ihn geradeheraus. Sie hatte sich während der Jahre im Krankenhaus einen direkten, etwas schroffen Ton angewöhnt. Es hatte keine Zeit gegeben für Schnörkel und Süßholzraspeln.
Er guckte erstaunt, dann brach er in lautes Lachen aus. »Wissen Sie, gnädige Frau«, sagte er an Käthe gewandt, »ich sagte Ihnen bereits, dass ich immer an Ihre Tochter denken muss. Und ich bin jetzt überzeugt: Es ist diese frische, direkte Art, die mich anzieht. Einfach erfrischend.«
Wenn du dich da mal nicht irrst, dachte Käthe. Lysbeth hatte manchmal etwas Direktes, so war es wohl, oder es klang so, weil sie einfach fragte, wenn sie etwas wissen wollte. Ansonsten aber war Lysbeth so verschlossen und in sich gekehrt wie keines ihrer übrigen Kinder.
Über all ihre Kinder wusste Käthe recht gut Bescheid. Sie wusste, dass Dritter ein Filou war, sie wusste, dass Eckhardt sich eigentlich aus Frauen nichts machte, und sie wusste, dass Johann von einem schlimmen Minderwertigkeitskomplex geplagt war. Sie wollte gar nicht so genau wissen, was Stella mit Männern anstellte. Aber sie hatte keine Ahnung, was eigentlich in Lysbeth vor sich ging.
»Ich dachte, man dürfe nur eine Frau nicht nach dem Alter fragen«, bemerkte da Lysbeth mit einem charmanten Lächeln, das Käthe völlig überraschte.
»Ich bin 1894 am 13. Juni geboren«, antwortete Maximilian von Schnell, und Mutter wie Tochter gaben ein lautes Geräusch des Erstaunens von sich. Er schüttelte den Kopf, sein Blick wanderte von Käthe zu Lysbeth. Was habe ich falsch gemacht?, fragte der Blick.
»Da bin ich auch geboren«, erklärte Lysbeth schlicht. Sie dachte nach. »Ich bin müde«, sagte sie. »Ich gehe jetzt ins Bett. Es tut mir leid, ich hätte mich gern länger mit Ihnen unterhalten. Auf Wiedersehen!«
Sie reichte ihm die Hand. Er erhob sich und hauchte mit tiefer Verbeugung einen zarten Kuss über ihren Handrücken. »Auf Wiedersehen, Fräulein Wolkenrath!«, sagte er mit belegter Stimme. Als sie die Tür erreicht hatte, räusperte er sich. Sie drehte sich zu ihm um. Er stand da wie angenagelt. »Ich würde Sie gern zum Tanz einladen! Am Sonntag zum Tanztee ins Atlantik. Wären Sie einverstanden? Nur Sie und ich.«
Na endlich, dachte Käthe. Lysbeth nickte. »Ja, mit Vergnügen.«
»Ich hole Sie um drei Uhr ab. Einverstanden?« Er blickte sich nach Käthe um. Die nickte zustimmend.
3
Zum Jahreswechsel 1921/22 mussten die Wolkenraths sich entscheiden, wohin sie gehen wollten. Sie hatten zwei Einladungen erhalten. Eine von den Gaerbers, die wie jedes Jahr ein Silvestermenü für eine erlesene Schar von Gästen planten. Die andere von Leni. Ihre Eltern wollten ein großes Fest feiern, das vor allem für ihre Tochter und ihren Schwiegersohn in spe sein sollte.
Cynthia hatte etwas nörgelnd erklärt, dass Anna jedes Jahr das gleiche Menü bereite: vorweg eine klare Suppe, danach Fasan, Klöße, Rotkohl und als Nachspeise Schwarzwälder Kirschtorte.
Leni hatte gesagt, dass ihre Eltern ein letztes Mal, bevor Leni ausziehen, ihren eigenen Hausstand gründen und die ehrbare Ehefrau eines Kapitäns abgeben würde, ein ausgelassenes Fest mit vielen jungen Leuten feiern wollten. Es sollte Kartoffelsalat, Frikadellen und Würstchen geben, dazu eine Bowle, und nachts würden Berliner mit Marmeladenfüllung angeboten. Alles mit wenig Aufwand. Als einzigen Luxus hatten sie eine kleine Gruppe arbeitsloser Musiker engagiert, die mit Gitarre, Akkordeon und Geige zum Tanz aufspielen sollten.
Es war keine leichte Entscheidung. Stella, an der es nagte, dass Leni und Jonny Maukesch ihre Hochzeit auf den 2. April festgelegt hatten – den ersten hatten sie vermieden, um deutlich zu machen, dass ihre Ehe kein Aprilscherz sein sollte –, plädierte dafür, zu den Gaerbers zu gehen. Am liebsten wollte sie dem Kapitän Maukesch nie mehr begegnen.
Lysbeth und Maximilian von Schnell waren seit dem Tanztee im Atlantik ein öffentlich anerkanntes Pärchen. Sie liebte es, mit ihm zu tanzen, mochte gerne mit ihm reden, und sie fand ihn sogar für einen Offizier erstaunlich liberal in manchen seiner Ansichten, zum Beispiel, was die Berufstätigkeit von Frauen betraf, die er durchaus begrüßte. Maximilian war Jonny Maukeschs Freund, deshalb würden sie selbstverständlich bei Leni feiern.
Käthe und Alexander nahmen die Einladung der Gaerbers mit Vergnügen an.
Eckhardt hatte verkündet, er wolle überall feiern, wo Dritter nicht sei. Es hatte einen Riesenkrach zwischen den Brüdern gegeben. Anfang Dezember hatte Eckhardt vor Gericht erscheinen müssen, weil eine gewisse Germute von Müller eine Vaterschaftsklage gegen ihn angestrengt hatte. Bei der Gegenüberstellung waren sowohl Eckhardt als auch die junge Mutter perplex gewesen. Sie kannten einander tatsächlich. Und zwar hatten sie sich bei einem Tanztee im Ballhaus Trichter auf St. Pauli gesehen. Sie hatten allerdings nicht ein einziges Mal miteinander getanzt. Eckhardt hatte die ansehnliche junge Frau mit den großen Brüsten und der schmalen Taille in den Armen seines Bruders beobachtet, ohne jeden Neid – er mochte keine großen Brüste.
Eckhardt hatte sich noch nie in seinem Leben so beschämt gefühlt wie vor dem Richter, der sich viel Mühe gegeben hatte, die ganze Geschichte zu verstehen. Zu guter Letzt hatte er für die Sache »von Müller gegen Wolkenrath« einen neuen Termin anberaumt, nun mit Alexander Wolkenrath als Beklagtem.