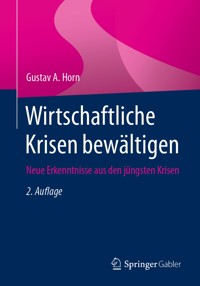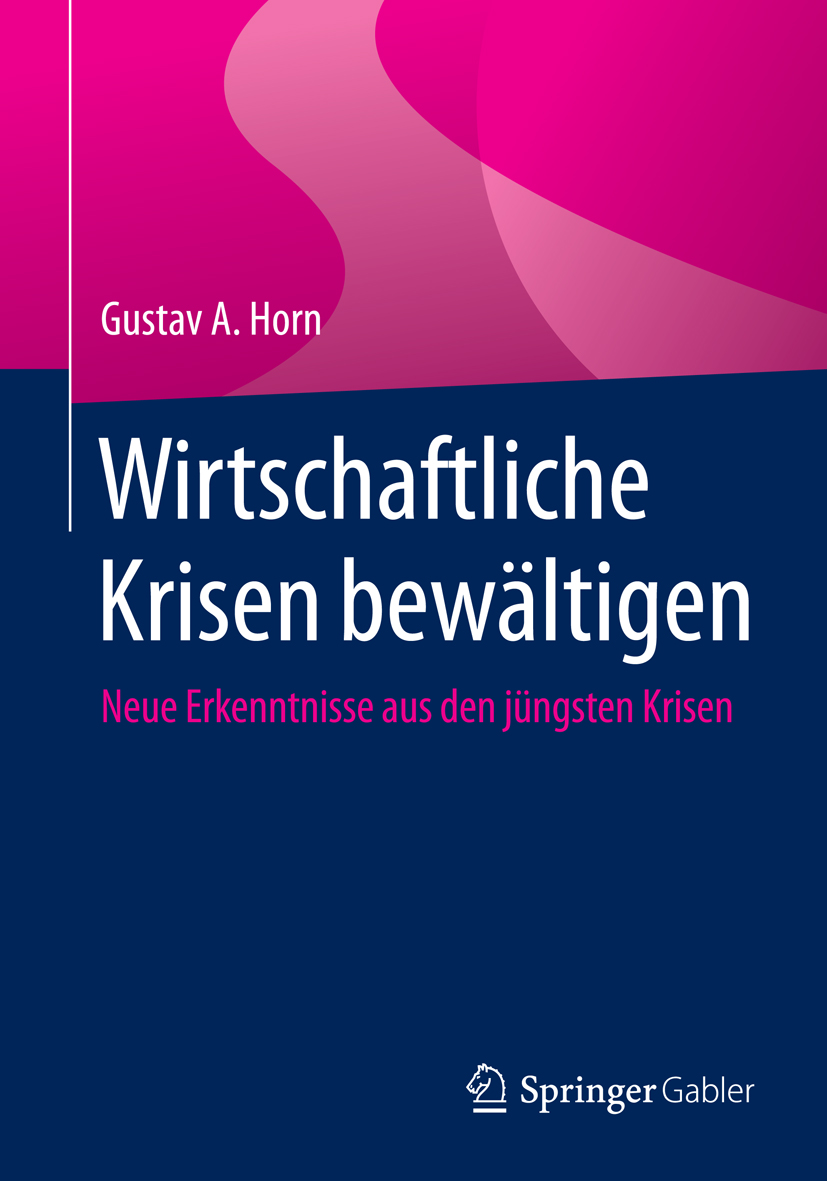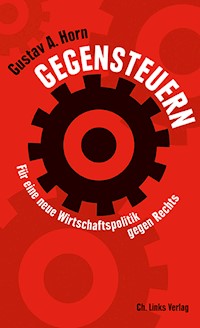Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit nimmt zu. Für die Bewältigung der Krise haben die Niedrigverdiener die Zeche gezahlt. Profi tiert haben die Reichen. Das ist ein ethischer und politischer Skandal. Und es ist eine Katastrophe für die Wirtschaft. Denn ohne stärkere Kaufkraft der niedrigeren Einkommensschichten werden wir vor einem Abgrund stehen, wenn die Wirtschaftskrise zurückkehrt. Und mit dieser Rückkehr müssen wir trotz aller Jubelrufe über das aktuelle Wachstum rechnen, denn die internationalen Märkte sind instabil. Wie können wir uns retten? Der streitbare und renommierte Ökonom Gustav A. Horn zeigt messerscharf: Die Stabilisierung der Wirtschaft und die Bekämpfung der Ungleichheit gehen Hand in Hand. Er liefert eine klare Marschroute für eine stabile und gerechte wirtschaftliche Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.campus.de
Information zum Buch
Die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit nimmt zu. Für die Bewältigung der Krise haben die Niedrigverdiener die Zeche gezahlt. Profi tiert haben die Reichen. Das ist ein ethischer und politischer Skandal. Und es ist eine Katastrophe für die Wirtschaft. Denn ohne stärkere Kaufkraft der niedrigeren Einkommensschichten werden wir vor einem Abgrund stehen, wenn die Wirtschaftskrise zurückkehrt. Und mit dieser Rückkehr müssen wir trotz aller Jubelrufe über das aktuelle Wachstum rechnen, denn die internationalen Märkte sind instabil. Wie können wir uns retten? Der streitbare und renommierte Ökonom Gustav A. Horn zeigt messerscharf: Die Stabilisierung der Wirtschaft und die Bekämpfung der Ungleichheit gehen Hand in Hand. Er liefert eine klare Marschroute für eine stabile und gerechte wirtschaftliche Zukunft.
Informationen zum Autor
Gustav A. Horn, geboren 1954, ist einer der bekanntesten deutschen Ökonomen. Er leitet das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung. Mit zahlreichen Medienauftritten hat er sich als eine der markantesten Stimmen gegen die vorherrschende marktliberale Ökonomie etabliert.
Gustav A. Horn
Des Reichtums fette Beute
Wie die Ungleichheit unser Land ruiniert
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Copyright © 2011 Campus Verlag GmbH, Frankfurt am MainUmschlaggestaltung: Anne Strasser, HamburgUmschlagmotiv: Anne Strasser, Hamburg
ISBN der Printausgabe: 978-3-593-39347-6E-Book ISBN: 978-3-593-41068-5
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
|7|Vorwort
Dieses Buch entstand, nachdem das tiefste Tal der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise bereits durchschritten war. Viele bejubeln angesichts sinkender Arbeitslosenzahlen und steigender Binnennachfrage das Ende der Krise. Doch deren Wurzeln im Denken und Handeln bestehen fort. Deswegen droht uns ein böses Erwachen, wenn die Krise zurückkehrt. Mein Buch möchte dazu beitragen, dies zu verhindern.
Wir müssen erkennen, dass wir die Krise einer ganz bestimmten Entwicklung zu verdanken haben – einer Entwicklung, die sich international genauso zeigt wie innerhalb der Grenzen unseres Landes. Ich meine die zunehmende Bereicherung weniger und das Zurückfallen vieler im Hinblick auf Einkommen und Vermögen. Diese Entwicklung stellt unsere Gesellschaften nicht nur vor große intellektuelle, politische und auch ethisch-moralische Herausforderungen, die bei Weitem noch nicht angenommen wurden. Sie ist vor allem für unsere Wirtschaft von letztlich zerstörerischer Wirkung. Deshalb ist es höchste Zeit, dass die Ökonomie ihre gewohnten Bahnen verlässt und neue Denkweisen entwickelt. Schon im Vorfeld der Krise hat der Mainstream der deutschen Ökonomen mit seiner von einzelwirtschaftlichem Denken geprägten wirtschaftspolitischen Ausrichtung krass versagt. Nun gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen und das Ruder herumzureißen. Mit diesem Appell wende ich mich als Ökonom aber nicht nur an die Kollegen vom Fach, sondern vor allem an die Bürger und die Politik.
|8|Das Buch ist aus meiner Perspektive geschrieben – der eines Konjunkturforschers, der im Herbst 2007, als die Finanzkrise in den USA begann, sehr nervös wurde, und der im Sommer 2008, als sie sich weltweit auf die übrige Wirtschaft auszudehnen begann, das Fürchten lernte. Es ist die Perspektive des wirtschaftspolitischen Beraters, der in vielen Krisensitzungen erleben musste, wie wenig die Wirtschaftspolitiker von den Ökonomen intellektuell auf eine Krise vorbereitet worden waren. Der Grund für dieses Versagen liegt auf der Hand: Aus der – theoretischen – Sicht dieser Ökonomen durfte es eine solche Krisen gar nicht geben. Das Buch zeigt die Geschehnisse aus der Perspektive eines Beobachters, der erleben durfte, wie Politiker nolens volens von den Verhältnissen zu richtigen Entscheidungen gedrängt wurden, sodass die Wirtschaftspolitik diese historische Herausforderung zunächst bestanden hat. Und es ist die Perspektive eines Ökonomen, der leider auch erleben musste, dass viele Lehren aus der Krise schnell wieder vergessen wurden.
Dieses Buch wäre ohne das Zutun vieler Menschen, die mir nahestehen, nicht geschrieben worden. Mein Dank gilt in erster Line meiner Frau Sabine und meinen Töchtern Janna und Julith, die über ein halbes Jahr hinweg ihren schreibenden Mann und Vater zu ertragen hatten. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, die mit einem schreibenden Chef zurechtkommen mussten. Mein Dank geht an Thomas Oechsle für das Korrekturlesen und vor allem an Heike Joebges für die Einführung in die Logik der Finanzmärkte sowie Sabine Malsbender und Torsten Niechoj für die grafische Darstellung. Ohne die kritischen und weiterführenden Anmerkungen meines Lektors Olaf Meier und die Feinpolitur des Textes durch Sabine Rock ließe sich dieses Buch deutlich schlechter lesen. Mein Dank gilt den vielen Kolleginnen und Kollegen in und außerhalb der Hans-Böckler-Stiftung, ohne deren intellektuelle Unterstützung dieses Buch nicht möglich gewesen wäre. Ich danke auch für die Anregungen vieler Politiker und Journalisten, die meinen Blick für die Realität geschärft haben. Ihnen allen sei das Buch gewidmet.
|9|Zeitenwende oder Ende aller Zeiten
Rerum Cognoscere Causas
(Die Ursachen der Dinge erkennen)
Vergil, Motto der London School of Economics
Eine Frage der Gerechtigkeit … und mehr
Warum regen sich alle bloß so auf? Eine Kassiererin wird entlassen, weil sie widerrechtlich Getränkebons im Wert von 1,30 Euro eingetauscht hat. Sie muss sich vor Gericht mühsam durch mehrere Instanzen wieder auf ihre Stelle einklagen. Ein Investmentbanker, dessen Bank wegen riskanter Geschäfte mit Milliarden Euro an Steuergeldern gerettet werden musste, erstreitet sich vor Gericht Bonuszahlungen in Millionenhöhe, die sein Arbeitgeber ihm aufgrund der schwierigen Lage der Bank verweigerte. Ist doch alles rechtens! Und dennoch regen sich alle auf. Warum nur?
Weil die Bürger dieses Landes es als ungerecht empfinden. Sie empfinden es als ungerecht, wenn eine Mitarbeiterin, die über Jahre hinweg zuverlässig für ihren Arbeitgeber die anstrengende und oft stressige Arbeit an der Kasse eines Supermarktes erledigt hat, wegen einer Lappalie entlassen wird. Diese Frau verliert auf diese Weise nicht nur ihre derzeitige Arbeit, sondern – angesichts ihres Alters – höchstwahrscheinlich jegliche Jobperspektive. Die Menschen empfinden es auch als ungerecht, wenn ein Investmentbanker, der mit seiner Tätigkeit hohe Risiken für seinen Arbeitgeber und vor allem für die Steuerzahler eingegangen ist, dafür noch mithilfe von Steuergeldern hoch belohnt wird, selbst wenn seine Tätigkeit im Einverständnis mit seinem Arbeitgeber geschah. Die Kassiererin und der Investmentbanker |10|– am Beispiel dieses ungleichen Paares wird deutlich: In unserem Land stimmt etwas nicht. Und daran ändert auch ein zeitweiliger Aufschwung nichts. Denn das Schicksal der beiden ist nur das Treibgut auf einem Meer der Ungerechtigkeit. Die Ursachen für diese Skandale liegen tiefer, und die Folgen beschränken sich nicht auf das Vorhandensein von Ungerechtigkeit. Sie sind auch ökonomischer Natur. Ich möchte hier zunächst nur die wichtigsten nennen: hohe Krisenanfälligkeit, schwaches Wachstum, niedrige Beschäftigung und ein tief verschuldeter Staat. Das Grundübel lässt sich auf einen Satz reduzieren: Deutschland hat sich auf den Weg zu einem plutokratischen System begeben, einem System also, das der Herrschaft des Reichtums unterliegt.
Die wirtschaftliche Leistung unseres Landes wird zunehmend eine Beute des Reichtums. Die Menschen, die bereits über hohe Einkommen und Vermögen verfügen, sind in der Lage, diese unter den bestehenden wirtschaftspolitischen Bedingungen immer stärker zu steigern, während breite Kreise der Bevölkerung schon seit Jahren vom Wohlstandszuwachs abgeschnitten sind. Dass es so gekommen ist, hat vielfältige Ursachen. Es entspricht auch nicht einem abgefeimten Plan, sondern ist im Kern das Ergebnis intellektuellen Versagens vor allem der Ökonomen und einer langen Kette falscher wirtschaftspolitischer Entscheidungen, über die noch zu reden sein wird.
Schon seit Jahren herrscht in einer bestimmten Frage Übereinstimmung zwischen der Mehrheit der Ökonomen, den Wirtschaftspolitikern und den Medien: Der ungebremste Markt schafft Wohlstand, Stabilität und Gerechtigkeit – mehr jedenfalls, als es ein gezügelter Markt, der sich an wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen orientieren muss, vermag. Man stimmt in diesen Kreisen zudem darin überein, dass Leistung sich wieder lohnen muss. Was damit gemeint ist? Der viel Verdienende, der gefühlte Leistungsträger, soll einen immer größeren Anteil seines Einkommens behalten und in seinem ökonomischen Tatendrang nicht durch allzu viele Vorschriften gebremst werden. Die Wirtschaftspolitik sorgt durch niedrigere |11|Steuern auf Einkommen und Vermögen sowie durch den Abbau von Vorschriften und Regulierungen auch gerne für ein entsprechendes Umfeld. Seit Jahren kann man den Weg der Wirtschaftspolitik in Deutschland, aber nicht nur hier, so beschreiben.
Keine Einsicht in Sicht
Und das hat anhaltende Folgen. Über Jahre hinweg verschlechterte sich in Deutschland wie auch in anderen Ländern die Einkommenslage des Mittelstands, von den Einkommensperspektiven der Unterschichten ganz zu schweigen. Der Zusammenhalt der Gesellschaft wurde immer brüchiger. Die Kaufkraft weiter Bevölkerungskreise schwand, während einige wenige gewaltige Einkommenszuwächse erzielten. Die Folge: Es entstand eine polarisierte Gesellschaft. Den vielen mit verschlechterter Einkommensperspektive standen die wenigen mit glänzenden Aussichten gegenüber. Und dann kam die Krise.
Der Finanzsektor war kurz vor dem Zusammenbruch, die Konjunktur stürzte ab, die Staatsverschuldung explodierte und die Spekulation blühte. Der Euroraum stand nach Ansicht vieler Finanzinvestoren zeitweise kurz vor seinem Zerfall. Man hätte nun erwarten können, dass diese Turbulenzen und Verwerfungen auf breiter Front die Einsichten in das Wirtschaftsgeschehen verändern würden. Es hätte sich endlich die Erkenntnis durchsetzen können, dass in der Wirtschaftspolitik etwas grundsätzlich falsch gelaufen ist – und dass dies eine wesentliche Ursache der Krise ist. Es war genau der richtige Zeitpunkt für eine echte Kurskorrektur, die sicherlich nicht nur ich mir gewünscht habe. Man hätte ganz neu fragen müssen, wie Märkte funktionieren. War die freie Marktwirtschaft von den meisten Ökonomen zuvor als ein Ideal verstanden worden, das für alle am Wirtschaftsgeschehen Beteiligten optimale Ergebnisse lieferte, hätte man nun den Fokus auf ihre Unvollkommenheiten und Gefährdungen richten müssen – vor allem, um sie wirtschaftspolitisch entschärfen |12|zu können. Wohin hatte der Glaube an das freie Spiel der Kräfte uns bis dahin gebracht? Es gab eine deutlich Tendenz, die Einkommen immer ungleicher zu machen und diesen Zustand zu verfestigen. Es gab Schieflagen in den globalen Handelsbeziehungen und vor allem eine Anfälligkeit für Krisen in Zeiten großer Unsicherheit. All das schien die Wirtschaftspolitik rund um den Globus zeitweilig vollkommen zu überfordern. Und an Vorwarnungen hat es nie gemangelt. Seit 2007 war es doch überdeutlich, dass der Finanzsektor ein Krisenherd globalen Ausmaßes ist.
Doch es hat sich wenig geändert. Darüber sollte der Jubel über einen möglicherweise beginnenden Aufschwung in Deutschland nicht hinwegtäuschen. Woanders herrscht noch Krise. Dabei erzürnen die rücksichtslosen Bereicherungen der Finanzmarktakteure vor der internationalen Kulisse zusammenbrechender Märkte mit rasant steigender Arbeitslosigkeit und ausufernder Staatsverschuldung die Menschen in den betroffenen Ländern umso mehr, je länger die Krise dort dauert. Besonders provozierend ist dabei nicht nur die Tatsache, dass die Investmentbanker kein Unrechtsbewusstsein zeigen. Sie denken auch nicht daran, ihr Verhalten – möglicherweise geläutert durch die Erfahrungen der Krise – auch nur im Geringsten zu ändern. Es ist ihnen offensichtlich völlig gleichgültig, ob infolge ihres Handelns Millionen Menschen arbeitslos oder ganze Staaten insolvent werden. Damit siedeln sie sich nicht nur im Hinblick auf ihre Einkommen und ihre Vermögen, sondern auch im Hinblick auf ihre Normen außerhalb der bestehenden Gesellschaften an. Das entspricht ihrem unveränderten Selbstverständnis als globale Elite, die sich politisch gesetzten und zumeist national begrenzten Gegebenheiten nicht mehr fügen muss. Diese stehen in ihren Augen ohnehin unter dem Verdacht provinzieller Beschränktheit und mangelnder Kenntnis. Und das Schlimme ist, dass Letzteres sogar richtig sein dürfte.
Doch diese ungeheure Provokation demokratischer und gesellschaftlicher Verhaltensweisen wird bis heute nicht richtig verstanden und aufgenommen. Das liegt nicht zuletzt an der geradezu unterwürfigen |13|Haltung der meisten Ökonomen gegenüber Marktergebnissen, die sie auch mitten in der sich überschlagenden Krise nicht ablegten. Auch die schädlichsten spekulativen Attacken finden noch ihre Billigung. Sie betrachten sie als rationale und Erkenntnis erzeugende Verhaltensweisen der Märkte. Es gab zwar angesichts der massiven Gewalt der Probleme ein gewisses Umdenken – das jedoch vor allem in den USA, weniger stark in Europa. Aber selbst in den Vereinigten Staaten hatte Präsident Obama große Schwierigkeiten, seine weit gehenden Reformvorschläge gegen die überaus starke Lobby der Finanzwirtschaft durchzusetzen. Er wurde zu halbherzigen Kompromissen gezwungen. Allein das spricht Bände über die wahren Machtverhältnisse.
In Deutschland hingegen, wo die Dogmatik des ökonomischen Mainstreams mit besonderer Inbrunst gepflegt wird, ist von einer Zeitenwende des ökonomischen Denkens kaum etwas zu spüren. Noch immer gilt hier vor allem derjenige als ökonomisch vernünftig, der die Beute des Reichtums zu erhöhen verspricht – nicht aber derjenige, der es sich zum Ziel setzt, Armut zu bekämpfen und eine breite Teilhabe am wirtschaftlichen Leistungszuwachs zu erreichen. Er ist in den Augen der meisten Ökonomen ein naiver Gutmensch. Man wird seine Ziele zwar großmütig als ehrenhaft anerkennen, aber sofort eilig anfügen, dass sie die Wirtschaft schädigen würden. Und das ist ein absolutes Tabu.
Die ökonomische Wissenschaft in Deutschland macht ungerührt dort weiter, wo sie schon vor der Krise stand. Vielleicht akzeptiert sie die eine oder andere etwas strengere Regulierung auf den Finanzmärkten, schließlich sind die Missstände dort unübersehbar. Aber im Prinzip sind ihre Vertreter der Meinung, dass auch vor der Krise alles richtig gemacht wurde. Mehr noch: Eigentlich war man doch nicht streng genug mit der eigenen Bevölkerung, oder? Die Verschuldungsregeln für den Staat hätten noch strikter sein sollen und man hätte den Kündigungsschutz noch flexibler gestalten müssen.
In wohl keinem anderen Satz spiegelt sich dieses Denken besser wider als in der Aussage, die von den Spitzen unseres Staates – dem |14|ehemaligen Bundespräsidenten Köhler, der Bundeskanzlerin und dem Bundesbankpräsidenten Weber – immer und immer wieder zu hören ist: »Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt.« Mit diesem Satz sollen breite Kürzungen im Sozialbereich und eine Fortsetzung des ökonomischen Drucks auf weite Kreise der Mittel- und Unterschicht erklärt und vorbereitet werden. Wen aber meinen all diese Menschen eigentlich mit dem »Wir« – wer soll da über seine Verhältnisse gelebt haben? Und, falls wir uns angesprochen fühlen, was haben »wir« eigentlich getan? Darüber möchte ich gerne reden. Und auch darüber, dass genau diese Politik, dieses Festhalten am Nicht-Bewährten, bereits den Keim für die nächste Krise gelegt hat. Ich bin mir ganz sicher: Nur eine scharfe Wende im ökonomischen Denken und im wirtschaftspolitischen Handeln kann verhindern, dass diese ungute Saat aufgeht.
Blick zurück im Zorn: unsere verfehlte Wirtschaftspolitik
Schon lange hatte es beunruhigende Signale gegeben, doch dass dem Weltfinanzsystem im September 2008 der unmittelbare Zusammenbruch drohte, hatten die meisten Ökonomen nicht vorhergesehen. Es war ein echter Schock. Eigentlich war es sogar unvorstellbar. Doch der Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers erschütterte die Finanzwelt in ihren Grundfesten. Der Blick in den Abgrund vermittelte vor allem eines: eine tiefe und fundamentale Unsicherheit. Sie wurde noch verstärkt durch die Ratlosigkeit der politischen Akteure. Sie wussten einfach nicht, wie sie mit dieser dramatischen Situation umgehen sollten. Die gängigen Vorstellungen der ökonomischen Wissenschaft waren gescheitert.
Der Absturz der Volkswirtschaften in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zwang die Wirtschaftspolitik im Herbst 2008, sich mit ökonomischen Realitäten auseinanderzusetzen, die in der ökonomischen |15|Wissenschaft und damit auch in der wirtschaftspolitischen Beratung so nicht vorgesehen waren. Zunächst herrschte eine gewisse Ratlosigkeit vor, aus der sich dann aber doch eine neue Dynamik entwickelte. Die Dinge kamen in Bewegung. Es bildete sich allmählich eine neue Sichtweise auf das wirtschaftliche Geschehen heraus – eine Entwicklung, die sicherlich wirtschaftspolitischen Nöten und Notwendigkeiten geschuldet war. Diese ökonomische Zeitenwende wird nach wie vor von den drängenden Fragen der Wirtschaftspolitik angetrieben. Ihre Entstehung, die zwangsläufig eine Geschichte der Wirtschaftspolitik dieser Zeit ist, möchte ich in diesem Kapitel skizzieren. Daraus lassen sich wertvolle Erkenntnisse ziehen: Wir werden sehen, wie die Wirtschaftspolitik sich grundlegend ändern muss, um die globale Wirtschaft in Zukunft krisensicherer zu machen.
Wirtschaftspolitische Wende in den Siebzigern
Alles schien auf einem guten Weg zu sein. Das, was die (meisten) Ökonomen vom Wesen der Marktwirtschaft halten, ist durchaus optimistisch. Im Kern gehen die gängigen Vorstellungen davon aus, dass Märkte, wenn sie ungehindert funktionieren, nicht nur optimale Ergebnisse liefern, sondern dass sie auch stabil sind. Auf wohlfunktionierenden Märkten werden alle Wünsche für Käufe und Verkäufe bei gegebenen Preisen erfüllt. Die Marktteilnehmer sind zufrieden und es wird nichts vergeudet. Der Markt ist also effizient. Auch unerwartete Ereignisse wie ein besonders steiler Anstieg der Produktion oder ein plötzliches Abfallen der wirtschaftlichen Aktivität können diese Idylle nicht nachhaltig stören. Sie werden, lässt man den marktwirtschaftlichen Kräften nur genug Raum, dank flexibler Preise und Löhne relativ rasch bewältigt, ohne nachhaltige Spuren zu hinterlassen. Man interpretiert sie als konjunkturelle Beulen und Dellen, die keine weitere Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung haben. Schon gar nicht vermögen sie die Grundfesten der Volkswirtschaft zu erschüttern. Es ist daher nur folgerichtig, solche Schwankungen |16|eher als ein Problem für die Wirtschaftsstatistiker und Wirtschaftshistoriker zu verstehen, die sie möglichst exakt messen und dann archivieren. Bleibt man bei dieser Logik, dann müssen die Wirtschaftspolitiker diese Schwankungen der wirtschaftlichen Aktivität jedenfalls nicht für allzu bedeutsam halten und sollten deshalb auch nicht versuchen, sie durch Konjunkturpolitik zu bekämpfen.
Diese Linie konnte sich auf die vorherrschende ökonomische Lehre berufen, die diese Sichtweise seit Mitte der 1970er Jahre immer wieder zur Grundlage ihrer wirtschaftspolitischen Beratung gemacht hatte. Damals war die zuvor dominierende keynesianische Lehre in eine tiefe Krise geraten.
Der erste Ölpreisschock führte 1973 in eine tiefe Rezession und darüber hinaus zu enormen Inflationsraten und einer extrem hohen Staatsverschuldung. Die letzten Erfahrungen mit solchen Herausforderungen lagen vor dem Zweiten Weltkrieg. Das gleichzeitige Auftreten von hoher Arbeitslosigkeit und hoher Inflation brachte die damals gängige Lehre, den Keynesianismus, in eine paradoxe Situation: Die Arbeitslosigkeit musste durch eine stimulierende Wirtschaftspolitik bekämpft werden, während die Inflation eher nach bremsenden Instrumenten verlangte. Dieser Konflikt wurde zugunsten der Bekämpfung der Rezession entschieden. Aus jener Zeit stammt die Aussage des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, dass ihm 5 Prozent Inflation lieber seien als 5 Prozent Arbeitslosigkeit. Trotz dieses markigen Bekenntnisses war jedoch unverkennbar, dass der Niedergang des Keynesianismus eingesetzt hatte. Er war anscheinend nicht in der Lage, Inflation und Arbeitslosigkeit gleichzeitig zu bekämpfen, und führte außerdem dazu, dass der Staat immer tiefer in eine Schuldenfalle geriet. Meiner Meinung nach lag dies daran, dass diese Denkrichtung sich in einseitiger Weise verhärtet hatte. Anstatt permanent nur auf die Nachfrage zu schauen, hätten die Keynesianer damals auch die Angebotsbedingungen mit in den Blick nehmen müssen. Zu Beginn der Ölkrise herrschte weitgehend Vollbeschäftigung. Unter diesen Umständen die Nachfrage zu stimulieren konnte am Ende nur zur Inflation führen und hatte im Übrigen mit den Gedanken von |17|Keynes nicht viel zu tun.1*1So konnte die Inflation jedenfalls nicht bekämpft werden.
Es war Zeit für ein neues Heilmittel. Eine damals aufsteigende Theorierichtung, die als Neuklassik bezeichnet wird2*, schien besser dafür geeignet zu sein, die Inflation zu stoppen. Sie begründete aus einzelwirtschaftlich rationalem Verhalten, bei dem alle Akteure jederzeit nach ihrem maximalen Gewinn oder Nutzen streben, dass Märkte in sich stabil sind. Anders als vom Keynesianismus postuliert bedürften diese Märkte keiner Stabilisierungspolitik seitens des Staates. Dieser vermöge letztlich nicht besser zu stabilisieren, als die Märkte es aus eigener Kraft könnten. Er erzeuge durch die vergebliche Bekämpfung der Rezession mit hohen staatlichen Finanzmitteln zudem auf längere Sicht nichts anderes als eine unerträglich hohe Staatsverschuldung und Inflation. Besser sei es, das Marktsystem sich selbst zu überlassen und auf dessen eigene Stabilisierungsfähigkeit durch flexible Löhne und Preise sowie im internationalen Handel auf flexible Wechselkurse zu vertrauen. So weit die verlockende Theorie. Die Niederlage des Keynesianismus blieb nicht ohne Folgen für die keynesianische Lehre; sie änderte sich gleichfalls. Es entstand der Neukeynesianismus.2 Er übernahm die neuklassische Methodik, gesamtwirtschaftliche Phänomene aus einzelwirtschaftlich rationalem Verhalten herzuleiten. Der wesentliche Unterschied zur Neuklassik besteht darin, dass im Neukeynesianismus Märkte nicht als vollkommen stabil angesehen werden. Löhne und Preise seien aufgrund von Anpassungskosten und Informationsproblemen nicht hinreichend flexibel, um dieser Aufgabe jederzeit und mit hoher Geschwindigkeit gerecht zu werden. Das ist aber nur ein eher gradueller Unterschied, über dessen Bedeutung es auch innerhalb des Neukeynesianismus verschiedene Meinungen |18|gibt. Während manche kaum eine Divergenz zur Neuklassik ausmachen und folglich auch jede Form von Stabilisierungspolitik weitgehend ablehnen, betonen andere deren Notwendigkeit.3
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn sich in den vergangenen Jahren ein Art Konsens herausgebildet hat. Der sogenannte »Washington-Konsens« ist nach dem Sitz des Internationalen Währungsfonds (IMF) benannt.4 Der IMF vertrat bis vor Kurzem gegenüber seinen Mitgliedsstaaten genau diese Politik. Im Grundsatz geht man dabei von der Stabilität der Märkte aus. Zeitweilige Störungen, die nicht ausgeschlossen werden, sollten im Wesentlichen durch Automatismen in der Finanzpolitik wie zum Beispiel die gesetzlich geregelte Zahlung von Arbeitslosengeld oder, falls nötig, durch die von Tagespolitik unabhängige Geldpolitik bekämpft werden. Für Konjunkturprogramme und ähnliche Einzelentscheidungen der Finanzpolitik gibt es in dieser Lehre keinen Raum. Damit wird Wirtschaftspolitik im Kern als Störfaktor für ein reibungsloses Funktionieren der Märkte angesehen.
Probleme treten nach dieser vorherrschenden Lehre in einem marktwirtschaftlichen System nur dann auf, wenn Märkte an ihrer freien Entfaltung gehindert werden. Gerne werden immer wieder rechtliche Vorschriften als aussagekräftiges Beispiel genannt, um diese These zu stützen. Insbesondere rechtliche und tarifvertragliche Regulierungen auf dem Arbeitsmarkt wurden in Deutschland als ein maßgebliches Hemmnis für wirtschaftliche Dynamik angesehen und entsprechend bekämpft. Aber auch auf den Finanzmärkten wurden in Kontinentaleuropa und vor allem in Deutschland beschränkende Vorschriften gelockert, um der zuvor vermeintlich gebremsten Dynamik dieser Märkte freien Lauf zu lassen.
Die scheinbar moderne Wirtschaftspolitik von Rot-Grün
Die Wirtschaftspolitik in Deutschland hinkte in dieser Hinsicht den internationalen Tendenzen sogar hinterher. Die Regierungen unter |19|Thatcher in Großbritannien und Reagan in den USA in den 1980er Jahren hatten ein klares wirtschaftspolitisches Profil. Der Markt, der – angeblich oder tatsächlich – durch staatliche Fesseln oder gewerkschaftliche Machtpositionen stranguliert war, musste von diesen Fesseln befreit werden. Gerade dieses angelsächsische Modell, das vermeintlich deutlich höhere Wachstumsraten erzeugte als das kontinentaleuropäische und vor allem der in Deutschland praktizierte rheinische Kapitalismus, der auf der Zusammenarbeit der Sozialpartner (Unternehmen und Gewerkschaften) basierte, wirkte höchst attraktiv. Also nahm die Wirtschaftspolitik in anderen Ländern es sich zum Vorbild. Dies war der Beginn des Aufstiegs neoliberaler Wirtschaftspolitik in Deutschland, die die Kooperation der Sozialpartner als ein Relikt der Nachkriegszeit betrachtete. Alles, was zählte, war der Markt.
Gegen Ende der Ära Kohl machten sich selbst Parteien wie die SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die zuvor eine durchaus kritische Haltung zum ungehinderten Wirken der Marktkräfte an den Tag gelegt hatten, mehrheitlich zu Fürsprechern einer »modernen« Wirtschaftspolitik (Bundeskanzler Schröder), die den ungehinderten Marktkräften eine entscheidende Rolle einräumte. Im Zuge eines auch von der britischen Labour-Partei vertretenen dritten Wegs sollten die Marktkräfte genutzt werden, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und umweltpolitische Ziele zu erreichen. Man betrachtete das als mächtiges Gegenbild zu einer verkrusteten Wirtschaftspolitik der Regierung Kohl, deren Untätigkeit und Konsenssucht jeden wirtschaftspolitischen Aufbruch behinderte. Politisch entstand in dieser Zeit ein Bündnis, in dem sich die Gegner des rheinischen Kapitalismus mit politischen Linken und Linksliberalen zusammentaten. Die Linke versöhnte sich mit der Marktwirtschaft. Die kritischen Debatten der unmittelbaren Nachkriegszeit und der 1970er Jahre, als sich im Gefolge der 68er-Umwälzungen ebenfalls eine sehr marktkritische Haltung entwickelte, gehörten damit der Vergangenheit an. Eine neue Ära begann. Wie die Bundestagswahl 1998 zeigte, war dieses Bündnis von linker Politik und neoliberaler Wirtschaftspolitik |20|durchaus eine mehrheitsfähige Konstellation. Daran änderte auf Dauer auch die kritische Haltung des kurzzeitigen Finanzministers und SPD-Parteivorsitzenden Lafontaine und seiner Anhänger nichts. Sie blieben nicht lange in ihren Ämtern. Damit war der Weg frei für den Durchbruch einer Wirtschaftspolitik, die den ungehinderten Kräften des Marktes mehr Raum gab.
Man kann die nachfolgende Zeit auch als eine Phase des linken Neoliberalismus verstehen, in der sich linke politische Inhalte wie die Verweigerung der Teilnahme am Irakkrieg oder der Ausstieg aus der Atomindustrie mit einer neoliberalen Wirtschaftspolitik paarten. Angefeuert wurde das Ganze von einer Opposition, die einen immer noch radikaleren neoliberalen Kurs einforderte. Das führte zu einer Wirtschaftspolitik mit massiven Steuersenkungen für Unternehmen und Gutverdiener, Deregulierungen und Privatisierungen auf den Güter- und Finanzmärkten sowie Kürzungen in der Rentenversicherung. Der Schwerpunkt der Maßnahmen war eine ausgeprägte Deregulierung des Arbeitsmarktes durch erleichterte Zulassung von geringfügiger Beschäftigung, befristete Verträge und Zeitarbeit. Die Vermittlung von Arbeitslosen sollte effizienter werden, und man wollte die Anreize für Arbeitslose, Arbeit anzunehmen, verbessern. Dies wurde in Anknüpfung an ganz andere Vorstellungen aus den 1970er Jahren als eine Politik der »Reformen« bezeichnet – vermutlich, um sich auch sprachlich vom ökonomischen Stillstand der letzten Jahre der Regierung Kohl abzugrenzen. Wenn es in jener Zeit eine wirtschaftspolitische Ikone gab, dann war es ein möglichst junger und intelligenter Finanzinvestor, der mühelos mit komplexen Wertpapieren global agiert und horrende Gewinne einfährt. Auf diese Weise kommt er nicht nur zu privatem Reichtum, nein, er erfüllt darüber hinaus auch eine geradezu gemeinnützige Aufgabe – dass überall und zu jeder Zeit Kapital zur Verfügung steht. Das alles geschieht auf einem Markt, der wie kein zweiter Modernität ausstrahlt: keine schmutzige Industrieproduktion, sondern saubere Dienstleistung; keine alten Maschinen, sondern das Internet.
|21|All das befand sich im Einklang mit der vorherrschenden ökonomischen Lehre. Die Wissenschaftler kritisierten allenfalls die in ihren Augen zu zögerliche Vorgehensweise der Wirtschaftspolitik. Diese Ungeduld teilten sie mit den meisten Medien, die ansonsten den vorherrschenden wirtschaftspolitischen Kurs mit unverhohlenem Wohlwollen begleiteten.
Der amerikanische Nobelpreisträger für Ökonomie Robert Solow hat in diesem Kontext einmal geschrieben, dass eine Ökonomie »the high road or the low road« zu mehr Beschäftigung nehmen könne.5 Die Wirtschaftspolitik könne die Schwerpunkte entweder so setzen, dass möglichst viele gut qualifizierte und sozial abgesicherte Stellen entstehen, oder sie legt den Schwerpunkt so, dass die Anzahl der Jobs maximiert wird, ohne Rücksicht auf deren Qualität. Im ersten Fall (»high road«) werden zwar Anreize zur Ausweitung der Beschäftigung gesetzt, es gibt aber Auflagen im Hinblick auf die soziale Sicherung und er ist mit Qualifizierungsmöglichkeiten für die Einzustellenden verbunden. Auf diese Weise sollen qualifizierte und vor allem gut bezahlte Jobs entstehen, die dann ein hohes Steueraufkommen generieren und aufgrund guter Einkommen kräftige Nachfrageimpulse auslösen. Diese Impulse sollen wiederum dazu beitragen, die Binnenwirtschaft zu beleben. Die »low road«, von der Solow spricht, sieht anders aus. In diesem Fall werden Anreize für neue Jobs vor allem dadurch geschaffen, dass beschränkende Vorschriften zur sozialen Sicherung abgeschafft oder aufgeweicht werden. Auf diese Weise sollen möglichst viele Stellen geschaffen werden, unabhängig von deren Qualität.
Während die erste Strategie vor allem in den skandinavischen Ländern bevorzugt wurde, folgten sowohl die USA als auch Deutschland eher dem letzteren Pfad. Die Konsequenzen der jeweiligen Strategie liegen auf der Hand: Während die erste Strategie eine starke Tendenz zu einer egalitäreren Einkommensverteilung begründet, trägt die zweite zu einer merklich gespreizten Verteilung der Einkommen bei. Aber das ist ja, folgt man der gängigen ökonomischen Lehrmeinung, durchaus gewollt. Nicht mehr die Bekämpfung der Armut steht im Mittelpunkt wirtschaftspolitischer Anstrengungen, sondern die Förderung |22|des Reichtums. Reichtum wird schick – und geht zulasten einer breiten Bevölkerungsschicht, die nicht daran beteiligt ist.
Um die Dynamik des wirtschaftspolitischen Umbruchs zu Beginn des neuen Jahrhunderts zu verstehen, muss man etwas über die damaligen wirtschaftlichen Hintergründe wissen. Die wirtschaftliche Lage war in Deutschland zwischen 2001 und 2005 alles andere als gut. Wie in allen anderen großen Industrienationen war die Wirtschaft auch in Deutschland im Verlauf des Jahres 2000 in eine Rezession gestürzt, die sich durch die Terroranschläge in den USA im September 2001 und die damit verbundene wirtschaftliche Unsicherheit noch verlängerte. Während sich aber die Wirtschaft in den meisten Staaten rasch erholte, schwenkte Deutschland auf einen Pfad wirtschaftlicher Stagnation mit nahezu Nullwachstum, hoher Schuldenaufnahme des Staates und hoher Arbeitslosigkeit ein. Es entstand das Bild einer lahmen Volkswirtschaft, die sich nicht oder nur unzureichend an die Erfordernisse der Globalisierung angepasst hatte. Die deutsche Wirtschaft war in den Augen der Reformer offensichtlich weniger erfolgreich darin, die Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen, als die meisten anderen europäischen Volkswirtschaften. Der kranke Mann Europas war deutsch. Ein grundlegender Reformprozesses schien absolut notwendig zu sein.
Die wirtschaftlichen Reformen jener Zeit zielten folgerichtig primär darauf ab, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die öffentlichen Haushalte zu sanieren und auf diese Weise schließlich die Arbeitslosigkeit zu senken. Um diese Ziele zu erreichen, musste – zumindest aus Sicht der angesagten ökonomischen Lehre – der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der Reformbemühungen stehen. Die Wurzel der diagnostizierten Krankheit waren aus dieser Sicht die zu hohen Löhne, welche wiederum als das Resultat eines inflexiblen Arbeitsmarktes, zu hoher Sozialleistungen und zu mächtiger Gewerkschaften erschienen. Wäre der Arbeitsmarkt flexibler, indem vor allem der strenge Kündigungsschutz gelockert würde, so die Überlegung, wären die Unternehmen schneller bereit, auch in unsicheren Zeiten Menschen einzustellen. Zugleich würde der aufgeweichte |23|Kündigungsschutz die Gewerkschaften schwächen und so verhindern, dass diese hohe Löhne durchsetzen.
Die hohen Sozialleistungen verhindern laut dieser ökonomischen Denkschule, dass sich insbesondere im Niedriglohnbereich die Löhne deutlich genug nach unten anpassen. Nur so aber hätten gering Qualifizierte mit niedriger Produktivität eine Beschäftigungschance. Zugleich verringerten niedrigere Sozialleistungen auch die Lohnnebenkosten. Damit verbilligt sich Arbeit auch für die Unternehmen, was deren Bereitschaft, die Beschäftigung auszuweiten, erhöhen würde. Die Gewerkschaften gelte es schließlich zu schwächen, um die im internationalen Vergleich anscheinend zu hohen Löhne in Einklang mit den Erfordernissen des globalen Wettbewerbs zu bringen. So viel zum Arbeitsmarkt.
Gleichzeitig wurde für den Staat ein massiver Sparkurs empfohlen, um die Fehlbeträge in den öffentlichen Haushalten zu vermindern. Die Befürworter dieses Ansatzes begründen das in erster Linie mit den Erfordernissen des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes, der eine obere Grenze für die Neuverschuldung des Staates von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vorsah. Diesen Grenzwert überschritt Deutschland in jener Zeit regelmäßig. Aus Sicht der meisten Ökonomen gefährdete dies aber die Stabilität der gemeinsamen Währung. Die Idee, der misslichen Lage mit konjunkturpolitischen Maßnahmen zu begegnen, welche die gesamtwirtschaftliche Nachfrage angeregt hätten, wurde gar nicht erst in Erwägung gezogen. Es war eben »old school«.
Der eingeschlagene Kurs, die öffentlichen Ausgaben zu kürzen, deckte sich außerdem perfekt mit der Forderung nach geringeren Sozialleistungen. Zwei Fliegen konnten mit einer Klappe geschlagen werden. Da die Ansprüche an das Rentensystem und die Arbeitslosenversicherung verringert wurden, konnte man öffentliche Mittel einsparen.3* Außerdem sollten Subventionen gekürzt werden, und |24|man plante, vor allem Personal im öffentlichen Dienst abzubauen. Diese Maßnahme stand zumindest auf den ersten Blick im Widerspruch zum Ziel einer höheren Beschäftigung. Wer sich jedoch in der Logik der reinen Lehre bewegt, sieht das ganz anders. Denn: Indem der Staat seine Beschäftigung abbaut, erhöht er den Druck auf die Löhne auf dem privaten Arbeitsmarkt, was die Beschäftigung dort steigert. Das grundlegende Argument ist, dass ein Rückzug des Staates aus dem Wirtschaftsgeschehen per se die Wirtschaft beflügelt. Demnach führt eine geringere Staatsquote, also ein geringerer Anteil der Staatsaugaben am Bruttoinlandsprodukt, zu einer effizienteren Verwendung der vorhandenen Ressourcen in einer Volkswirtschaft. So viel zur Rolle des Staates.
Diese wirtschaftspolitische Strategie kann man ökonomisch als angebotsorientiert bezeichnen. Alle diese Maßnahmen führen letztendlich dazu, dass das Angebot an Gütern und Dienstleistungen sich verbilligt. Es soll eben rentabler werden. Hinter diesen Überlegungen steht das Say’sche Theorem, demzufolge sich jedes Angebot an Gütern und Dienstleistungen seine Nachfrage schafft. Hält ein Unternehmen die Produktion eines Gutes für rentabel, dann stellt es Beschäftigte ein und entlohnt sie. Auf diese Weise kreiert es als Folge seiner Angebotsentscheidung auch Nachfrage. Entscheidend ist, dass ein Unternehmen zunächst ein solches Angebot für rentabel hält. Politisch würde man eine solche Strategie eher mit dem Etikett »neoliberal« versehen, wobei viele Verfechter einer solchen Politik auf der linken Seite des politischen Spektrums diese Bezeichnung zurückweisen würden. Wirtschaftspolitisch ist es aber durchaus gerechtfertigt.
Über all diese Punkte gab es in der Zeit der rot-grünen Koalition einen weitgehenden Konsens – das galt sowohl in der Wirtschaftswissenschaft als auch in der Wirtschaftspolitik und es kam in den parteiübergreifenden Reformbeschlüssen zur Agenda 2010 zum Tragen. Besonders markant manifestierte sich diese Sichtweise in den Gutachten des Sachverständigenrates und der von über 270 Ökonomen unterzeichneten Hamburger Erklärung (darunter fast all jene, die wie Hans-Werner Sinn die öffentlichen Debatten maßgeblich bestimmten). |25|Diese Erklärung forderte im Vorfeld der Bundestagswahl 2005 zu einer eindeutig angebotsorientierten Politik auf.
Erstaunlich war nur, dass der versprochene Aufschwung sowohl beim Wachstum als auch bei der Beschäftigung auf sich warten ließ. Tatsächlich erlebte Deutschland trotz der auch im internationalen Vergleich vielfältigen Reformbemühungen die längste Stagnationsphase der Nachkriegszeit. Im Nachklang der Agenda 2010 war außerdem die Arbeitslosigkeit sogar auf ein Rekordniveau von nahezu 5 Millionen gestiegen, und auch alle Sparbemühungen vermochten das hartnäckige Haushaltsdefizit nicht unter die Marke von 3 Prozent zu drücken.
Wie sah die Antwort der meisten Ökonomen und vieler Politiker auf diese missliche Situation aus? Statt ihren Ansatz zu hinterfragen, legten sie noch mal nach. Sie forderten noch mehr Reformanstrengungen in die gleiche Richtung, weil ja offensichtlich die bisherige Dosis nicht ausgereicht hatte. Gleichzeitig mehrten sich aber, vor allem im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik, die Zweifel. Das lag sicherlich eher daran, dass weite Teile der Bevölkerung gegenüber dem sogenannten Reformkurs immer skeptischer wurden – und weniger an einem Wechsel der Überzeugungen bei den meisten Wirtschaftspolitikern.
Umfragen ergaben, dass die wirtschaftspolitische Haltung der Deutschen überwiegend eher links anzusiedeln war.6 Damit stand die Meinung der Bevölkerung nicht nur in starkem Gegensatz zur ökonomischen Lehrmeinung, sondern auch zu den in den Medien veröffentlichten Überzeugungen. Vor allem aber bestand eine beträchtliche Kluft zur wirtschaftspolitischen Mehrheitsmeinung der im Bundestag vertretenen Parteien. Das hatte sich bereits bei zahlreichen Wahlentscheidungen angedeutet, bei denen die größte Regierungspartie, die SPD, herbe Verluste hinnehmen musste. Ein weiteres Menetekel der Veränderung war der Aufstieg der PDS und ihre Vereinigung mit der westdeutschen WASG (Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit), die vom ehemaligen SPD-Vorsitzenden Lafontaine und vielen vormals der SPD zugeneigten Gewerkschaftsmitgliedern |26|gegründet wurde. Das alles spricht eine deutliche Sprache: Hier schälte sich eine grundlegende Veränderung im deutschen Parteiensystem heraus, deren Wurzel eindeutig in der mangelnden Übereinstimmung zwischen den wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Wähler und der Gewählten lag.
Der halbe Kurswechsel der Großen Koalition
Mit dem Beginn der Großen Koalition 2005 veränderte sich die wirtschaftspolitische Tonlage. Schon in den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU/CSU wurde weniger Wert auf neue Reformanstrengungen auf der Basis angebotspolitischer Überlegungen gelegt. Stattdessen standen zunächst konjunkturpolitische Maßnahmen im Vordergrund, die im Gegensatz zum bisherigen Kurs das Ziel hatten, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stimulieren. So wurden zum Beispiel Abschreibungserleichterungen für Unternehmen und steuerliche Anreize für private Haushalte beschlossen. Sie sollten die Nachfrage nach Investitionsgütern oder nach die Energieeffizienz steigernden Baumaßnahmen anregen. Die Idee dahinter war, dass die Konjunktur nicht weiter durch staatliche Sparmaßnahmen belastet werden sollte. Vielmehr wollte man mit dem Rückwind der kräftigen weltwirtschaftlichen Dynamik auch die deutsche Wirtschaft in Schwung bringen. Mit einem Aufschwung im Rücken sollten dann über höhere Steuereinnahmen die Fehlbeträge in den öffentlichen Haushalten entscheidend reduziert werden. Das Motto lautete: Erst stimulieren, dann sanieren.
Darüber hinaus wurde ein leichter Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik vorgenommen. Auf Betreiben der SPD und gegen den Widerstand der CDU/CSU wurde die Einführung branchenspezifischer Mindestlöhne beschlossen – unter der Voraussetzung, dass die Tarifparteien in den entsprechenden Branchen dem zustimmten. Ursprünglich hatte die SPD einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn durchsetzen wollen. Das scheiterte jedoch am massiven Widerstand |27|des Koalitionspartners. In jedem Fall war das eine spürbare Abkehr von einer Politik, die die Verhandlungsposition der Gewerkschaften fortwährend schwächte.
Dieses Vorgehen traf auf wenig Gegenliebe in der ökonomischen Wissenschaft, deren Vordenker ja im Gegenteil eine verschärfte Fortsetzung des bisherigen Reformkurses im Rahmen der Hamburger Erklärung gefordert hatten. Der Sachverständigenrat hatte leitmotivisch noch im Titel seines Jahresgutachtens von 2005 verkündet: »Die Chance nutzen – die Reformen mutig fortsetzen«. Die Wirtschaftspolitik der Großen Koalition begann also unter dem Trommelfeuer der Kritik – ein Großteil der ökonomischen Zunft zeigte deutlich sein Missfallen am eingeschlagenen Kurs.
Erstaunlich war nur eines: Auch wenn der Kurswechsel der Großen Koalition alles in allem doch recht bescheiden ausfiel, funktionierte die neue Politik. Die verringerte Bremswirkung der heimischen Finanzpolitik ließ endlich den schon lange anhaltenden weltwirtschaftlichen Aufschwung auf Deutschland übergreifen. Im Jahr 2006 begann ein für die meisten Ökonomen völlig unerwarteter Aufschwung. Die gängigen Prognosen gingen hingegen von einem bescheidenen Wachstum von rund 1 Prozent7 aus. Stattdessen wuchs die deutsche Wirtschaft um 2,9 Prozent, ein Wert, den man angesichts der vermeintlich gravierenden Strukturprobleme des Landes für nahezu unmöglich gehalten hatte. Und ich finde es besonders bemerkenswert, dass genau jene Größen, an denen sich eine strukturelle Schwäche hätte zeigen müssen, besonders kräftig expandierten. So nahmen die Exporte um sagenhafte 12 Prozent zu, und die Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen stiegen um rund 8 Prozent. Ein medizinisches Wunder schien den kranken Mann Europas geheilt zu haben.
Dennoch war das Vertrauen der meisten Ökonomen in diesen Aufschwung gering. Der Sachverständigenrat plädierte noch im Herbst 2006 dafür, bei Tarifverhandlungen nur geringe Lohnsteigerungen zu vereinbaren.8 Dahinter stand die Überzeugung, dass weiterhin die Angebotsbedingungen durch eine gesteigerte Rentabilität verbessert |28|werden müssten – und das, obwohl eine fundamentale Schwäche bei den Exporten und Investitionen weniger denn je zu erkennen war. Zugleich sollte auch weiterhin die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exporteure verbessert werden. So gesehen entstand mit dem Machtantritt der Großen Koalition erstmals seit Jahren eine gewisse Distanz zwischen der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Bundesregierung und den meisten Ökonomen.
Diese blieb erstaunlicherweise auch bestehen, als die Bundesregierung begann, den zweiten Teil ihres Konzepts, die Sanierung des Staatshaushalts, in Angriff zu nehmen. Dabei war der Zeitpunkt optimal gewählt. Die Konjunktur brodelte und kochte, die deutsche Wirtschaft wuchs mit Raten um die 3 Prozent, und die Steuereinnahmen flossen reichlich. Um den Sanierungsprozess noch zu beschleunigen, beschloss die Bundesregierung zum Jahresbeginn 2007, die Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte zu erhöhen. Die Einnahmen in Höhe von 1 Prozentpunkt des Steuersatzes sollten dazu genutzt werden, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung abzusenken.
Das bedeutete im Klartext, dass vor allem die Konsumenten, also alle privaten Haushalte, die Last der beschleunigten Konsolidierung tragen mussten. Es handelte sich um eine in diesem Ausmaß bisher nicht bekannte zusätzliche Belastung breiter Bevölkerungskreise. Eine höhere Mehrwertsteuer trifft schlussendlich alle, die konsumieren. Sie trifft besonders jene, die besonders viel von ihrem Einkommen konsumieren. Das sind die Haushalte mit niedrigem Einkommen, die in der Regel all das, was sie an Gehalt oder sonstigen Einnahmen wie beispielsweise Wohngeld beziehen, für ihren Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen verwenden müssen. Wer ein höheres Einkommen bezieht, kann hingegen auch sparen und damit die höhere Mehrwertsteuerbelastung teilweise vermeiden. Gemildert wird diese ungleiche Belastung nur dadurch, dass der Mehrwertsteuersatz auf Nahrungsmittel, die einen hohen Anteil am Verbrauch von Haushalten mit niedrigen Einkommen ausmachen, reduziert ist und auch nicht angehoben wurde. Das fällt jedoch nicht so stark ins Gewicht.
Generell gesprochen vermindert eine höhere Mehrwertsteuer auf |29|breiter Basis die Kaufkraft der privaten Haushalte. Die Reaktion der Konsumenten ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Obwohl auch im Jahr 2007 die Wirtschaft in Deutschland insgesamt außerordentlich kräftig wuchs, ging der private Verbrauch zurück. Das hatte es in einem Aufschwungjahr bisher noch nicht gegeben. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer hat dazu beigetragen, dass in diesem jüngsten Aufschwung die Einkommen der Mehrheit der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Preissteigerungen nicht gestiegen sind. Auch das hatte es noch nicht gegeben. Der Begriff »Aufschwung« bekam eine neue Qualität:9 Es war ein Wachstum ohne Einkommenszuwachs. Und das allein hätte schon Anlass zur Sorge geben müssen.
Zum ersten Mal seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland waren breite Teile der Bevölkerung von einer wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung abgekoppelt. Das gesamtwirtschaftliche Wachstum kam nur noch wenigen zugute. Hier zeigte sich erneut die seit Ende der 1990er Jahre vorherrschende Tendenz, Reichtum zu schonen. Ein genauerer Blick enthüllt, dass die höhere Mehrwertsteuer aber nur einer von drei Gründen für die Einkommensbelastung war – man muss das genauer analysieren.
Weitere Ursachen waren die geringen Lohnzuwächse und die stark gestiegenen Importpreise für Rohstoffe und Energie. Der verstärkte Zugriff des Staates auf die Einkommen durch die höhere Mehrwertsteuer muss dabei auch mit Blick auf die Staatsfinanzen gesehen werden. Wenn die Steuern stärker steigen als das Bruttoinlandsprodukt, dann sichert sich der Staat einen höheren Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Angesichts der hohen Haushaltsdefizite in den Jahren zuvor und des Schuldenstands gemessen am Bruttoinlandsprodukt, der die im Vertrag von Maastricht festgelegte Obergrenze von 60 Prozent des BIP bereits seit Jahren überschritt, war es prinzipiell verständlich und auch richtig, dass die Steuern angehoben wurden. Indem man aber dafür die Mehrwertsteuer wählte, traf es vor allem die niedrigen und mittleren Einkommen besonders stark – das war das eigentliche Problem. Zwar wurde die Kaufkraft der Einkommen |30|durch die steuerlich bedingt höheren Preise insgesamt vermindert. Die wohlhabenderen Bevölkerungsschichten wurden aus bekannten Gründen jedoch nur mäßig belastet. Die reicheren Haushalte beteiligten sich, verglichen mit den weniger gut gestellten, somit in relativ geringerem Ausmaß an der Sanierung der Staatsfinanzen. Die Konsequenz? Eine zunehmende Ungleichheit.
Um diesen Effekt in seiner Größenordnung abzuschätzen, muss man den jüngsten Aufschwung im Vergleich zu früheren setzen. Daraus ergibt sich, dass wegen der höheren Mehrwertsteuer10 (zusammen mit Kürzungen von Transferzahlungen des Staates an die privaten Haushalte) die Preise um mehr als 1 Prozentpunkt höher waren. Die realen verfügbaren Einkommen fielen dagegen im Vergleich zum vorherigen Aufschwung als Folge dieser Politik um knapp 3 Prozent niedriger aus. Eigentlich eine ganz einfach Rechnung – aber offenbar war dieser Zusammenhang den Wirtschaftspolitikern nicht bekannt. Oder sie waren schlecht beraten.
In die gleiche Richtung wirkten auch die höheren Importpreise für Energie und Rohstoffe wie Öl, Gas oder Kupfer. Im Vergleich zum vorigen Aufschwung zogen diese Preise spürbar stärker an. Das hängt zum einen mit den zumindest auf mittlere Sicht immer knapper werdenden Vorräten an nicht erneuerbaren Rohstoffen zusammen. Zugleich nahm die Nachfrage nach genau diesen Rohstoffen im Zuge des industriellen Aufstiegs von Ländern wie China und Indien merklich zu. Allein das sind hinreichende Gründe für einen tendenziellen Anstieg dieser Preise. Sie erklären jedoch nicht das dramatische Ausmaß des Anstiegs und dessen hohe Volatilität.
Diese haben mit den veränderten Gegebenheiten auf den Finanzmärkten zu tun. Mit der Deregulierung dieser Märkte war es möglich, Wertpapiere zu konstruieren und zu emittieren, mit deren Hilfe man sich gegenüber künftigen Preisentwicklungen auf den Rohstoffmärkten absichern konnte. Das aber können nicht nur jene tun, die unmittelbar von diesen Tendenzen betroffen sind, weil sie mit Rohstoffen handeln, sondern prinzipiell alle Finanzmarktakteure. Und so wurden in der Folge auch bald unzählige Wetten auf Rohstoffpreise |31|abgeschlossenen, wodurch der Markt erheblich liquider wurde. Höhere Liquidität eines Marktes bedeutet, dass mehr Geld im Umlauf ist als vorher. Dies wiederum beschleunigte die zugrunde liegende Trendentwicklung in den Rohstoffpreisen, führte also zu einem beschleunigten Preisanstieg. Im Ergebnis bedeuten höhere Rohstoffpreise für ein Rohstoffimportland wie Deutschland einen Transfer von Wohlstand in Richtung Ausland – also eine Belastung der heimischen Wirtschaft.
Dieser Verlust ist kurzfristig weitgehend unvermeidbar und nur durch langfristig angelegte Energiesparpolitik zu vermindern. Der Wohlstandsverlust betraf vor allem die Verbraucher und damit die privaten Haushalte. Zwar wurden auch die Unternehmen durch die höheren Importpreise belastet. Doch sie konnten die höheren Kosten weitgehend auf die Verbraucher abwälzen. Im Ergebnis wurden die realen verfügbaren Einkommen im Vergleich zum vorherigen Aufschwung um 1 Prozent gedämpft.
Neben diesen Sondereffekten stelle ich jedoch schon seit über zehn Jahren einen deutlichen Trend zu nur noch sehr geringfügigen Lohnsteigerungen fest – und bin mit meiner Meinung da sicherlich nicht alleine. Dieser geringe Lohnanstieg ist der Hauptgrund für die schwache Kaufkraft. Gemessen an den prozentualen Zuwächsen in der Vergangenheit und vor allem gemessen am Zuwachs der Produktivität fielen die Lohnsteigerungen deutlich zu niedrig aus. Das Produktivitätswachstum ist aber der entscheidende Maßstab für die Höhe der Lohnsteigerungen. Bleiben die Reallöhne hinter dem Produktivitätszuwachs zurück, der nichts anderes ist als der Zuwachs der Wirtschaft an Leistungsfähigkeit, werden die erzielten Einkommen zugunsten der Gewinne umverteilt. Genau das ist in Deutschland über Jahre hinweg geschehen – auch im jüngsten Aufschwung. So sind die realen Nettolöhne je Beschäftigtem in dieser Zeit um gut 3 Prozent hinter dem Anstieg im vorigen Aufschwung zurückgeblieben. Das hat die realen Einkommen der Beschäftigten um rund 2,5 Prozent vermindert. In der gleichen Zeit sind die Gewinneinkommen entsprechend stark gestiegen. Das erzeugt nur noch mehr Ungleichheit. |32|Denn: Wenn die Gewinneinkommen den Lohneinkommen enteilen, profitieren Unternehmen und die Bezieher höherer Einkommen am meisten – und die anderen gehen leer aus.
Waren die Reformen erfolgreich?
Kaum ein anderes Thema hat die ökonomische Debatte in den vergangenen Jahren so aufgeheizt wie die Frage, ob die Arbeitsmarktreformen von 2003 und 2004 ein Erfolg waren oder nicht. Die geteilten Reaktionen waren wenig überraschend. Jene, die von Anfang an für die Reformen waren, denen sie vielleicht sogar nicht weit genug gingen, sprachen von großen Erfolgen. Diejenigen, die von Anfang an dagegen waren, kritisierten das Ergebnis zum Teil massiv.
Allerorten wird die jüngste positive Wirtschaftsentwicklung von damaligen Reformbefürwortern eben jenen Reformen zugeschrieben. Ich möchte die Resultate hier nun aus kritischer Distanz beurteilen – mit aller gebotenen Vorsicht, da die Ereignisse, über die wir hier sprechen, noch nicht so lange zurückliegen. Meine kritische Ausgangsposition ergibt sich aus einer anfänglich großen Skepsis gegenüber diesen Reformen. Als sie eingeführt wurden, hatten sie negative konjunkturelle Wirkungen – und das ließ nicht gerade auf bessere Zeiten hoffen.11 Ob sie als erfolgreich bezeichnet werden können, hängt jedoch noch von vielen anderen Dingen ab. Nun ist seit der Einführung der Reformen einige Zeit vergangen, und die Dramatik der Ereignisse auf den Finanzmärkten hat ihre Bedeutung in den Hintergrund gedrängt. Diese Aussage enthält an sich schon eine Wertung. Offensichtlich hing, entgegen den Behauptungen von Hans-Werner Sinn, die Rettung Deutschlands nicht von der Bereitschaft der Politik ab, den Arbeitsmarkt zu reformieren.12 Die Zustände auf den Finanzmärkten waren im Grunde viel wichtiger, wurden aber lange missachtet – ein schwerwiegendes Versäumnis.
Zunächst aber muss man sich fragen, woran der Erfolg überhaupt gemessen wird (und wie er überhaupt gemessen werden kann). Diese |33|Entscheidung ist alles andere als trivial. Im Kern geht es doch um folgende Fragen: Haben die Reformen die Arbeitslosigkeit reduziert oder haben sie die Beschäftigung erhöht? Im Idealfall hängt beides zusammen, dann wird die Arbeitslosigkeit durch mehr Beschäftigung abgebaut und Arbeitslose wechseln direkt aus der Arbeitslosigkeit in eine Beschäftigung.
Allerdings tritt dieser Idealfall nicht zwangsläufig ein. So kann die Arbeitslosigkeit auch deshalb abnehmen, weil bei gleichbleibender Beschäftigung aus demografischen Gründen der Zustrom an Arbeitswilligen auf den Arbeitsmarkt abnimmt. Dies hätte dann gar nichts mit den Reformen zu tun, wohl aber mit der demografischen Entwicklung. Oder: Die Reformen halten – infolge des erhöhten Drucks, eine Beschäftigung anzunehmen – eigentlich Arbeitsunwillige davon ab, sich arbeitslos zu melden und die Grundsicherung und andere Leistungen in Anspruch zu nehmen. Diese Arbeitslosen würden zwar keine Beschäftigung aufnehmen, stattdessen aber in die sogenannte Stille Reserve des Arbeitsmarktes eingehen. Zu dieser Gruppierung zählen all jene, die sich entmutigt vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben, obwohl sie noch im erwerbsfähigen Alter sind. Die Beschäftigung steigt in diesem Fall nicht. Man kann dies als Erfolg der Arbeitsmarktreformen werten, weil staatliche Mittel effizienter ausgegeben werden. Der »Erfolg« kann aber auch darin bestehen, dass Menschen gezielt entmutigt werden, weiter nach Arbeit zu suchen. Dies ist also ein durchaus ambivalentes Resultat, obwohl die Arbeitslosigkeit sinkt oder zumindest nicht steigt.
Anders sieht es für die Beschäftigung aus. Jede Zunahme dieser Größe ist ein Erfolg. Aber ist dieser Erfolg wirklich immer das Ergebnis der Reformen? Beschäftigung kann man außerdem auf unterschiedliche Weise messen. Die geläufigste Weise ist die in Köpfen. Es wird ermittelt, wie viele Menschen als Ergebnis der Reformen zusätzlich eine Stelle finden, also beschäftigt sind. Die Ökonomie hingegen verwendet als Maß für die Beschäftigung häufig die geleisteten Arbeitsstunden. Die Stundenzahl gibt den Umfang der gesamten Arbeitsleistung wieder, unabhängig davon, von wie vielen Menschen |34|