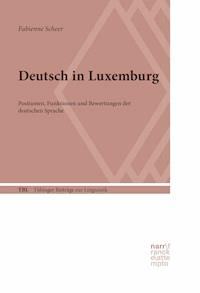
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Aus Sicht der Gesetzgebung ist Luxemburg ein dreisprachiges Land. Lëtzebuergesch ist die Nationalsprache, doch Französisch und Deutsch übernehmen seit jeher wichtige Funktionen. Dieser Band untersucht erstmals systematisch die deutsche Sprache in Luxemburg. Er beschreibt das Sprachwissen und Sprachhandeln der heterogenen Luxemburger Gesellschaft und gewährt den Lesern einen tiefen Einblick in den Stellenwert, die Funktionen und die Bewertung des Deutschen in Bereichen wie "Bildung", "Medien", "Integration", "Sprachpolitik", "Literatur" und "Werbung".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabienne Scheer
Deutsch in Luxemburg
Positionen, Funktionen und Bewertungen der deutschen Sprache
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-9097-8
Inhalt
Vorwort
Im Frühjahr 2012 führten mich meine Recherchen zunächst nach Luxemburg-Gasperich in das Archiv des Verlagshauses Saint-Paul, wo ich die Printausgaben des Luxemburger Worts, des Luxemburger Lands und des Le Jeudi von 1983 bis 2012 nach Artikeln durchsuchte, die mir mit Blick auf meinen Untersuchungsgegenstand, die deutsche Sprache in Luxemburg, relevant erschienen. Ein herzlicher Dank geht an die Archivare vor Ort für ihre bereitwillige Hilfe.
En cours de route stellte ich fest, dass die Analyse von Presseartikeln und Dokumenten nicht ausreichen würde, um den Stellenwert der deutschen Sprache im Land zu erfassen. Das war der Moment, in dem ich damit anfing, die ersten Interviews zu führen. Zuerst mit Journalisten, dann mit Grund- und Sekundarschullehrern, schlussendlich auch mit Experten für Literatur, Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Sprach(en)politik und Integration. Ein Großteil dieser ‚Praktiker’ wird im Verlauf dieses Buches namentlich genannt, andere bleiben anonym oder treten nur über das Material, das sie mir zur Verfügung stellten, in Erscheinung. Ihnen allen bin ich zu großem Dank verpflichtet.
Diese Arbeit wurde im Sommer 2016 von der Germanistischen Fakultät der Universität Luxemburg als Dissertation angenommen. Sie konnte nur aufgrund der finanziellen Unterstützung des luxemburgischen Staates, durch den Fonds national de la Recherche, realisiert werden und zu allen Momenten auf die fachliche Unterstützung ihres Betreuers, Prof. Dr. Heinz Sieburg, zurückgreifen. Bei ihm, bei Prof. Dr. Georg Mein, der die Zweitbetreuung übernahm, sowie allen Mitgliedern des Germanistischen Instituts an der Universität Luxemburg möchte ich mich bedanken für vier wertvolle Jahre, welche die Dissertation in die richtigen Bahnen gelenkt haben.
Zu guter Letzt gilt meiner Familie und meinen Freunden ein großes Merci für ihre Nervenstärke und ihre Unterstützung. Allen voran danken, möchte ich meinem Mann, der dieses Abenteuer mit mir durchgestanden hat, meinen Eltern, die mich in vielerlei Hinsicht entlastet und immer in meinen Entscheidungen bestärkt haben und meiner Großmutter, bei der ich die nötige Ruhe fand, um zu schreiben. Eine Woche vor der Geburt meines Sohnes setzte ich den Schlusspunkt. Merci, dass du noch so lange mit deiner Mama mitgeschrieben hast.
„Man kann Sprache nur verstehen, wenn man mehr als Sprache versteht.”
(Hörmann 1978/1994: 210)
I.Einleitung
Hubertus von Morr1: „Ich habe bei der Tagung, die wir an der Universität Luxemburg hatten, gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass das Deutsche hier in Luxemburg zurückgeht. Daraufhin hat mir Charles Berg in seinem Beitrag geantwortet und das fand ich sehr prägend:
„Das Deutsche in Luxemburg ist wie ein Eisberg. Der größte Teil ist unter Wasser.“
Das fand ich sehr gut. Das können Sie in der Arbeit verwenden. Das ist eine sehr geistreiche Bemerkung. […] Ja, es ist mehr da, als der oberflächliche Besucher so glaubt. Wenn hier die Busse ankommen und die Touristen gehen in die Stadt, dann treffen die da erst mal auf Französisch. Das nehmen die nicht wahr. Also das scheint mir die Lage sehr gut zu beschreiben. Ich habe ihm dann geantwortet, dass im Zeichen des Klimawandels Eisberge schmelzen.“ [lacht]
F.S.: „Daran habe ich jetzt auch gedacht.“
Die Eisberg-Metapher vereint zwei Aspekte, die die vorliegende Arbeit von Anfang an begleiteten: die vielfach unsichtbare Stellung der deutschen Sprache in Luxemburg und der oft geäußerte Eindruck, dass ihre Bedeutung im Land abnehme.
Aus Sicht der Gesetzgebung ist Luxemburg heute ein dreisprachiges Land. Am 24. Februar 1984 wurde in der loi sur le régime des langues festgeschrieben, dass das Lëtzebuergesche die Nationalsprache der Luxemburger ist. Die Sprache, die im Bewusstsein ihrer Sprecher längst National- und Muttersprache war, wurde damit auch offiziell über die beiden anderen Landessprachen erhoben. In Artikel II. des Gesetzes wurde die französische Sprache zur rechtsetzenden Sprache erklärt. Erst der dritte Artikel erwähnte ein Vorkommen der deutschen Sprache in Luxemburg. Es wurde vermerkt, dass Französisch, Deutsch und Luxemburgisch als Verwaltungs- und Gerichtssprachen im Land zugelassen sind. Der kommunikative Wert, welcher die deutsche Sprache hat, wurde damit anerkannt – mehr aber auch nicht (Kapitel VIII).
Gilles (2009: 197) konstatierte, dass es sich als besonders schwer gestalte die Rolle des Deutschen im Ensemble der luxemburgischen Mehrsprachigkeit zu erfassen. Jene Unsichtbarkeit, die das Vorkommen der deutschen Sprache in Luxemburg kennzeichnet, ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges politisch so gewollt. Die Zwangsangliederung des Landes an das Deutsche Reich und die damit verbundene Zwangsgermanisierung haben das Verhältnis zur Sprache nachhaltig verändert. In der politischen Außendarstellung nutzt Luxemburg seither weitestgehend die französische Sprache. Innerhalb der Bevölkerung werden die sprachgenealogischen Verbindungen zwischen der luxemburgischen und der deutschen Sprache gedanklich gelockert. Dass die Luxemburger die eigene Mundart einst als Onst Däitsch (Unser Deutsch) bezeichneten, wird aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen (Kapitel II, VIII). So erfüllt die deutsche Sprache seither vor allem rezeptive Funktionen im Land. Sie gilt als beliebte Mediensprache, ist die Alphabetisierungssprache in der öffentlichen Grundschule und eine der Bildungssprachen (Kapitel V, IX, X).
Die Aufgaben, die alle drei Landessprachen übernehmen, wurden nach dem Krieg neu geordnet. Wissenschaftliche Arbeiten, die versucht haben diese mehrsprachige Situation zu erklären, vor allem Hoffmann (1979) und Berg (1993), haben zumeist bei der domänenspezifischen Verteilung der Sprachen angesetzt, indem sie, vor dem Hintergrund des soziolinguistischen Diglossie-Konzeptes und der Kategorie der Domäne, darlegten, in welchem Bereich der Gesellschaft welche Sprache (Deutsch, Französisch oder Luxemburgisch) vorwiegend verwendet werde (Kapitel II). Beide Forschungsarbeiten beschränkten sich jedoch auf die Beschreibung des Sprachverhaltens der gebürtigen Luxemburger. Diese forschungspraktische Eingrenzung der Untersuchungsgruppe sollte eine Analyse der Sprachensituation in Luxemburg gegenwärtig nicht mehr vornehmen. Die hier vorgenommene Analyse zur Sprachensituation in Luxemburg wendet sich aus gutem Grund dezidiert von einer solchen Eingrenzung ab. Im Land leben mittlerweile 172 Nationalitäten (vgl. Statec 2014a). Der Zuwandereranteil liegt bei 45,9 % (vgl. Statec 2015: 10). Tagsüber bevölkern zusätzliche 168700 Grenzpendler aus dem deutschen, französischen und belgischen Sprachraum den 563000-Einwohner-Staat (vgl. ebd. 10; 13). Sie alle kommunizieren im Land in einer oder mehreren Sprachen. Ihr Wissen über den domänenadäquaten Sprachgebrauch und ihr Sprachverhalten sind je nach Sprachbiographie und Dauer ihres Aufenthalts verschieden ausgeprägt. Es gibt Zuwanderer und Grenzgänger, die alle drei Landessprachen erwerben und diese situations-/domänenadäquat einsetzen, andere die nur eine der drei ausbauen, in ihrer Herkunftssprache oder einer anderen Fremdsprache den Alltag in Luxemburg bestreiten. Die demographische Entwicklung hat die Position der französischen Sprache im Land gestärkt, denn ein Großteil der Zuwanderer entscheidet sich, aufgrund einer romanischen Erstsprache, dafür, die französische Sprache in Luxemburg zu verwenden. Statistiken zufolge ist sie die am meisten gesprochene Sprache im Land (vgl. Fehlen 2013a: 63). Als Integrationssprache, die das Potenzial hat die Gesellschaft zusammenzuhalten, wird allerdings mehrheitlich die luxemburgische Sprache geschätzt (Kapitel VI). Ein zunehmendes Interesse am Erwerb des Luxemburgischen als Fremdsprache und ihr Einsatz in Domänen, die ehedem der französischen und der deutschen Sprache vorbehalten waren, lassen vermehrt den Eindruck aufkommen, als ‚schmelze’ die Bedeutung der deutschen Sprache langsam dahin. Es wird mitunter angenommen, dass ihre Funktionen zunehmend von den beiden anderen Sprachen übernommen werden.
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das Sprachverhalten in ausgewählten Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens darzulegen und herauszufinden, welche Position die einzelnen Sprachen jeweils einnehmen. Die traditionelle Aufgabenverteilung an die drei Landessprachen ist im Begriff sich zu verändern. Die Arbeit wird deshalb von der Forschungsfrage geleitet, wie die dominierende, luxemburgische, Sprachgruppe auf die Hinfälligkeit ihrer Sprachverhaltensmuster reagiert und inwieweit sie sich von diesen löst bzw. zu lösen beginnt. Das von der luxemburgischen Sprachgruppe erworbene Sprachwissen und Sprachverhalten wird im theoretischen Teil der Arbeit mit dem Begriff des Mentalitätenwissens umrissen (Kapitel III).
Bislang liegt noch keine Monographie vor, die sich dezidiert der deutschen Sprache in Luxemburg zuwendet. Es existieren einzig wissenschaftliche Aufsätze, u.a. von Ammon (2015: 224–232), Kühn (2005, 2010), Newton (1987), Schmitz (2009) und Sieburg (u.a. 2009, 2012, 2013), die sich der Thematik ausschnitthaft widmen. Eine eigenständige und dringend erforderliche Untersuchung muss die Bewertungen, die über die deutsche Sprache kursieren, die Funktionen und Positionen, die diese in Luxemburg einnimmt, stets im Kontext der Mehrsprachigkeit betrachten. Eine Arbeit über die deutsche Sprache in Luxemburg ist zugleich eine Untersuchung über den Stellenwert der französischen, der luxemburgischen, der portugiesischen und der anderen Sprachen, die im Land gebraucht werden.
Die Arbeit versteht sich als diskursanalytische Untersuchung. Sie re-konstituiert ein Formationssystem, das als Diskurs über die deutsche Sprache in Luxemburg definiert werden kann und sich auf den Zeitraum von 1983 bis 2015 konzentriert. Der Diskursbegriff nach Foucault, wie er in der Linguistik verwendet wird, ist geeignet, um die Ansammlung von Sprachwissen in der Gesellschaft und eine sich zugleich zeigende Sprachpraxis zu untersuchen. Die Fragestellung der Arbeit erforderte die Zusammenstellung eines umfangreichen Untersuchungskorpus, das Einblicke in die verschiedenen Teilbereiche der Gesellschaft eröffnet. Es setzt sich aus einem Pressekorpus, aus von mir geführten Gesprächen mit Experten aus der luxemburgischen Öffentlichkeit, aber auch aus Statistiken, Schreibproben von Schülern, administrativen Schreiben, Buchbestsellerlisten, Werbeanzeigen und vielen weiteren „Zeichen des Flusses von Wissen durch die Zeit“ (Jäger/Jäger 2007; Jäger 2012) zusammen, die in Kapitel IV, mit der methodischen Verfahrensweise der Arbeit, ausführlich dargelegt werden.
Ein Blick auf die Gliederung deutet an, dass sich der empirische Teil der Arbeit, der die Kapitel V bis XI umfasst, in verschiedene Themenbereiche aufteilt, die oft, aber nicht immer, mit der soziolinguistischen Kategorie der (Gesellschafts-)Domäne oder der soziologischen Kategorie des sozialen Feldes2 übereinstimmen. Kapitel V behandelt den Bildungsdiskurs in Luxemburg. Die Schule ist der Ort, an dem alle Gesellschafts- und Sprachgruppen des Landes aufeinandertreffen und zugleich ein Ort, an dem die deutsche Sprache eine bedeutende Stellung einnimmt. Der Stellenwert der Schulsprache ‚Deutsch’ und die Didaktik des Deutschunterrichts in Luxemburg werden in diesem Bereich der Arbeit ausführlich behandelt und einer kritischen Betrachtung unterzogen. Kapitel VI fragt nach den verschiedenen Integrationssprachen im Land. Kapitel VII untersucht aufkommende Spannungen bei der Verwendung der verschiedenen Sprachen im Land. Kapitel VIII gibt Einblicke in die Sprach(en)politiken und in die politische Haltung zur ‚Landessprache’ Deutsch. Kapitel IX und X behandeln die Medien- und Literatursprachen der Bevölkerung, die Schreibsprachen Luxemburger Schriftsteller und die sprachlichen Ausrichtungen der Literaturverlage. Die Arbeit schließt mit einem Kapitel zum Thema ‚Öffentlichkeitsarbeit und Werbung’ (Kapitel XI), das behandelt, inwieweit die deutsche Sprache auch im öffentlichen Bereich genutzt wird, um die Bevölkerung zu erreichen und anzusprechen.
II.Historische Sprachentwicklung und soziolinguistische Erklärungsansätze
1Entwicklung der luxemburgischen Mehrsprachigkeit
„It is impossible to understand societal multilingualism fully without understanding something of the historical patterns that lead to its existence“ (Fasold 2004: 9).
Auf dem Gebiet, auf welchem sich das heutige Großherzogtum befindet, wurde über Jahrhunderte hinweg durch wechselnde Dynastien, durch Einwirkungen von außen und die Entstehung des Nationalstaates im Inneren, mal mehr der germanische und mal mehr der romanische Spracheinfluss gestärkt (vgl. Gilles 2009: 185).1
Die luxemburgische Territorialgeschichte begann im Jahr 963 als Siegfried aus dem Ardennergeschlecht einen Felsvorsprung an der Alzette erwarb. Entlang der kleinen Burg Lucilinburhuc, die er zwischen 963 und 987 dort errichten ließ, entwickelten sich eine Stadt und Siedlungen auf germanophonem Sprachgebiet (vgl. Trausch 1989: 19). Im Jahr 1136 erlosch die männliche Linie dieser ersten Luxemburger Dynastie (vgl. Bruch 1953: 64). Luxemburg fiel an das westlich orientierte Haus Namur und stand nun stärker unter romanischem Einfluss (vgl. Fröhlich/Hoffmann 1997: 1159).2 Während des 11., 12. und 13. Jahrhunderts dehnte sich die Grafschaft immer weiter nach Westen auf französisches Sprachgebiet aus (vgl. Thewes 2008: 2). Ende des 13. Jahrhunderts umfasste sie zwischen Maas und Mosel ein ausgedehntes Gebiet beiderseits der Sprachgrenze (vgl. ebd.). Im Westteil wurde Wallonisch und im Ostteil eine ‚luxemburgische’ Varietät des Deutschen gesprochen (vgl. Trausch 2008: 15). Unter dem Haus Namur und der Herrschaft Heinrich des VII. wurde die französische Sprache zur Amtssprache erhoben und trat damit an die Stelle des Lateinischen (vgl. Hoffmann 1979: 26). Mit der Regentschaft Johanns des Blinden, Sohn Heinrich des VII., gewann das Französische weiter an Boden (vgl. ebd.: 27). Aus sprachpolitischer Sicht nahm Johann der Blinde eine bedeutende Regelung vor: Er teilte das luxemburgische Gebiet im Jahr 1340 verwaltungstechnisch auf, in ein quartier wallon und in ein quartier allemand. Die territoriale Zweisprachigkeit wurde so auch von offizieller Seite bestätigt (vgl. ebd.). Unter Balduin von Luxemburg mussten Staatsurkunden wieder auf Latein oder Deutsch verfasst werden, was das gehobene Bürgertum jedoch nicht daran hinderte weiterhin Französisch zu benutzen (vgl. ebd.). Die Bevölkerung ging in beiden Sprachgebieten ihren sprachlichen Gewohnheiten nach (vgl. ebd.). Unter Wenzel dem I., Sohn Johanns des Blinden, wechselte die Sprachenpolitik erneut: Das Französische wurde im offiziellen Bereich wieder massiv vorangetrieben (vgl. ebd.). Mit Wenzel dem II. begann dann die Zeit der Pfandherrschaften in Luxemburg (vgl. Pauly 2011: 42). Offizielle Urkunden wurden wieder ausschließlich auf Deutsch verfasst (vgl. Hoffmann 1979: 28). Im Jahr 1443 eroberte Philipp der Gute von Burgund die Festung und erhob seinerseits erneut das Französische zur Verwaltungssprache und offiziellen Sprache (vgl. ebd.; Timm 2014: 17). Nach der burgundischen Herrschaft geriet Luxemburg in spanische Regentschaft, die 1648 von den Franzosen beendet wurde. Von 1697 bis 1714 fiel es erneut an Spanien, zwischen 1714 und 1795 war es in österreichischem Besitz, um danach wieder bis zum Zusammenbruch des Napoleonischen Reiches als Département des Forêts zu Frankreich zu gehören (vgl. ebd.). Unter allen Regentschaften behielt die französische Sprache ihre Stellung als Verwaltungs- und Amtssprache (vgl. Hoffmann 1979: 28). Sie war darüber hinaus in ganz Westeuropa zur Kultur- und Bildungssprache avanciert, galt als Ausdruck der Moderne und als höfische Sprache per excellence (vgl. Fehlen 2013: 38a). Sowohl im wallonischen als auch im deutschsprachigen Landesteil wurde sie als Prestigesprache kultiviert.
Nach dem Zusammenbruch des Napoleonischen Reiches wurde die europäische Landkarte 1815 neu geordnet (vgl. Thewes 2008: 4). Durch den Wiener Kongress wurde Luxemburg zum selbstständigen Nationalstaat (vgl. ebd.). Wilhelm der I. von Oranien-Nassau wurde zum König der Niederlande ernannt und zugleich zum Großherzog von Luxemburg erklärt. Ihm wurde aufgetragen, eine unabhängige Verwaltung in Luxemburg aufzubauen, in Wahrheit betrachtete er Luxemburg als 18. Provinz der Niederlande (vgl. Timm 2014: 17; Trausch 2008: 17). Er führte die niederländische Sprache ein und erhob sie neben der französischen zur Amtssprache (vgl. Pauly 2011: 67). Niederländisch und Französisch wurden in der Schule gefördert und der deutsche Einfluss eingedämmt (vgl. Fehlen 2008: 47). Die belgische Revolution von 1830 und der Wille der Luxemburger Teil Belgiens zu werden, führten zu einer sprachpolitischen Kehrtwende Wilhelms: Nicht mehr Preußen, sondern Belgien erschien ihm nun als die größere Gefahr (vgl. Bruch 1953: 89). Er setzte fortan alles daran, das luxemburgische Volk zu germanisieren, um es von diesem Anschlussgedanken abzubringen (vgl. Fehlen 2008: 47f.).
Bis heute wird das Jahr 1839 als Jahr der Unabhängigkeit Luxemburgs gefeiert. Sprachhistorische Überblicksdarstellungen setzen oft hier an. Die zwei ersten Teilungen Luxemburgs (nach dem spanischen Erbfolgekrieg im 17. Jahrhundert und 1815 im Zuge des Wiener Kongresses) änderten nichts an der territorialgebundenen Sprachenverteilung. 3 Das änderte sich mit dem Londoner Vertrag 1839. Das wallonische Sprachgebiet Luxemburgs, mitsamt der Marktgrafschaft Arlon und der Grafschaft Bouillon, fiel an Belgien (vgl. LW15: 18.04.1989).4 Luxemburg verlor sein französischsprachiges Gebiet und nahm mit 2586 km2 seine heutige Ausdehnung an.
En 1839, les Luxembourgeois germanophones se retrouvent avec un État qu’ils n’ont ni recherché ni même souhaité. Ils sont au nombre de 170000 sur un territoire de 2586 km2. Cet État est l’un des plus pauvres d’Europe, avec une agriculture peu productive et une industrie travaillant encore selon des procédés surannés, alors qu’au même moment la Belgique est en train d’accomplir sa révolution industrielle (Trausch 2003: 214).
1839 war Luxemburg ländlich und rückständig. Die Mehrheit der Luxemburger hatte keine Schulausbildung und sprach nichts anderes als ihren deutschen Dialekt (vgl. Trausch 2008: 21).5 Das Verwaltungspersonal, das nach der Teilung des Landes übrig blieb und beim Aufbau des Verwaltungsapparates behilflich sein sollte, hatte dagegen eine französische, niederländische oder belgische Ausbildung absolviert (vgl. Trausch 2008: 19). Die gebildeten Eliten pflegten ebenfalls Französisch zu sprechen. Die französische Sprache blieb somit die dominierende Verwaltungssprache und die Sprache der Obrigkeit (vgl. Gilles 2009: 186). Ein Bruch zwischen den einfachen Schichten und der Elite musste verhindert werden. Französischkenntnisse waren darüber hinaus überlebensnotwendig, „[pour] maintenir ouvert l’accès vers la France et la Belgique“ und, um sich eine Eigenheit zu bewahren, die vor einer Vereinnahmung durch den großen deutschen Nachbarn schützen sollte (Trausch 2003: 216f.). Deshalb wurde von der Bevölkerung verlangt, in der Grundschule intensiv Französisch zu lernen (vgl. Trausch 2008: 20). Im ersten Schulgesetz aus dem Jahr 1843 wurde der Erwerb der französischen Sprache für alle Primarschulkinder obligatorisch. Dieser sprachpolitische Eingriff in das Bildungswesen nahm eine entscheidende und dauerhafte Auswirkung auf die Entwicklung des Landes und dessen nationales Selbstverständnis. So schreibt Voss (2012: 56), dass die „von der Verwaltungselite 1843 eingerichtete zweisprachige Primärschule […] sich zu einer zentralen Institution der Luxemburger Identität entwickel[t] [habe].“
Fünf Jahre später, 1848, fand diese Zweisprachigkeit Eingang in die luxemburgische Verfassung. In Artikel 30 wurde der gleichberechtigte Gebrauch beider Sprachen, des Deutschen und des Französischen, fest verankert.6 Jedem Luxemburger wurde die Wahl überlassen eine Angelegenheit auf Deutsch oder auf Französisch zu verhandeln:
L’emploi des langues allemande et française est facultatif. L’usage n’en peut être limité. Der Gebrauch der deutschen und der französischen Sprache steht jedem frei; es darf derselbe nicht beschränkt werden
(Artikel 30 der Verfassung des Großherzogtums Luxemburg aus dem Jahr 1848) (Mémorial 1848: 395).7
Rechtlich gesehen war die Sprachenlage Luxemburgs damit die eines zweisprachigen Staates (vgl. LW15: 18.04.1989). Die Bevölkerung des 1839 gegründeten Nationalstaates hätte ihre Umgangssprache nie als ‚Lëtzebuerger Sprooch’, Luxemburger Sprache, bezeichnet, noch behauptet bei dieser Mundart handele es sich um etwas anderes als einen deutschen Dialekt. Sie bezeichnete sie als Letzebourger Deutsch, als eine Varietät des Deutschen, und sah darin kein politisches Statement:
Certes, les Luxembourgeois de 1840, de 1870 ou de 1890 ont conscience de ne parler qu’un dialecte d’origine allemande – le ‘Moselfränkisch’ des linguistes, le ‘Letzebuerger-Deitsch’ de l’homme de la rue. Le recours au français et à l’allemand pour tout ce qui dépasse les réalités de la vie quotidienne leur paraît comme allant de soi, mais aussi comme étant dépourvu de toute signification politique. Ils vivent tranquilles à l’abri de la neutralité, dont ils ont sans doute tort de surestimer la protection, et pour le reste travaillent dur (LL10 : 11.10.1985).
Als der neu gewählte Abgeordnete C.M. Spoo am 10. November 1896 seine erste Rede in der luxemburgischen Abgeordnetenkammer in ebendiesem Dialekt hielt, reagierten die Anwesenden teils erheitert, teils aufgebracht über seinen Fauxpas (vgl. LW15: 18.04.1989). Spoo erreichte jedoch, dass am 9. Dezember 1896 eine Debatte in der Abgeordnetenkammer über die Verwendung des Letzebourger Deutschs im politischen Raum stattfand (vgl. Hoffmann 1979: 35). Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte dabei gegen die Verwendung des Dialekts (vgl. ebd). Es blieb dabei, dass in dieser prestigebesetzten Domäne entweder Hochdeutsch oder – besser noch – Französisch benutzt werden sollte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Artikel 30 der Verfassung nicht mehr tragbar. Die luxemburgische Verfassung musste geändert werden. Mit Artikel 29 wird am 6. Mai 1948 folgender Passus eingefügt:
La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire
(Artikel 29 der Verfassung des Großherzogtums Luxemburg, Verfassungsänderung im Jahr 1948) (Mémorial 1948: 685).
Der zweifache Überfall durch den deutschen Nachbarn und die Germanisierungsversuche der nationalsozialistischen Besatzung führten zu einer nachhaltigen Degradierung des Stellenwerts der deutschen Sprache in Luxemburg.8 Das Letzebourger Deutsch, das in den Köpfen der Luxemburger lange nichts anderes gewesen war als ein deutscher Dialekt, emanzipierte sich infolge dieser Erfahrungen aus dem deutschen Varietätengefüge. Luxemburgisch wurde und wird mit politischer Förderung ausgebaut.9 Es wird 36 Jahre dauern bis auf die Ankündigung vom 6. Mai 1948, die loi sur le régime des langues folgt, das Gesetz, welches der Sprachensituation in Luxemburg bis heute ihr gesetzliches Fundament gibt. 1984 wurde das Lëtzebuergesche zur offiziellen Nationalsprache der Luxemburger erklärt und die komplexe Sprachensituation, die Teil des nationalen Selbstverständnisses der Nation ist, erklärt. Dieser Gesetzestext wird in Kapitel VIII. ausführlich untersucht.
Loi du 24. février 1984 sur le régime des langues :
Art. 1er. Langue nationale
La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.
Art. 2. Langue de la législation
Les actes législatifs et leurs règlements d’exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d’une traduction, seul le texte français fait foi. Au cas où des règlements non visés à l’alinéa qui précède sont édictés par un organe de l’Etat, des communes ou des établissements publics dans une langue autre que la française, seul le texte dans la langue employée par cet organe fait foi. Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables en matière de conventions internationales.
Art. 3. Langues administratives et judiciaires
En matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.
Art. 4. Requêtes administratives
Lorsqu’une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l’administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.
Art. 5. Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les dispositions suivantes : Arrêté royal grand-ducal du 4 juin 1830 contenant des modifications aux dispositions existantes au sujet des diverses langues en usage dans le royaume ; Dépêche du 24 avril 1832 à la commission du gouvernement, par le référ. intime, relative à l’emploi de la langue allemande dans les relations avec la diète ; Arrêté royal grand-ducal du 22 février 1834 concernant l’usage des langues allemande et française dans les actes publics […] (Mémorial 1984: 196f.).
2Herausbildung und Bestand eines domänenspezifischen Sprachgebrauchs
Soziolinguistische Ansätze: Diglossie, Bilingualismus, Domäne
Die Bevölkerung, die 1839 nach dem Wegfall des wallonischen Sprachgebiets übrigblieb, sprach einen moselfränkischen Dialekt. Ihr wurde beigebracht, sich schriftlich nicht im Dialekt, sondern auf Hochdeutsch und Französisch zu äußern und ganz allgemein für formelle Kontexte eher die Standardsprachen und vorzugsweise die französische Sprache zu benutzen. Aufgrund der historischen Entwicklungen hat sich, mithilfe des Bildungssystems, eine Dreisprachigkeit (Deutsch-, Französisch- und Luxemburgischkenntnisse) entwickelt. Diese drei Sprachen werden nicht willkürlich, sondern nach bestimmten Regeln eingesetzt. Solange das Land nicht durch jene verstärkte Immigration gekennzeichnet war, die es gegenwärtig erfährt, konnte das Sprachverhalten der Bevölkerung relativ einfach entschlüsselt und beschrieben werden: Luxemburgisch wird in der mündlichen Interaktion zwischen Luxemburgern verwendet, Deutsch und Französisch teilen sich die schriftsprachlichen Domänen (vgl. Gilles 2009: 187; Gilles 2011: 43). So schreibt Hoffmann (1996: 107), dass das Besondere an der luxemburgischen Sprachensituation seit jeher „in the discrepancy between oral and written modes of communication“ liege und Horner (2004: 1) argumentiert in ihrer Dissertation:
The spoken/written distinction has always been pivotal to understanding language use in Luxembourg, with spoken functions being dominated by the use of Luxembourgish and written functions carried out primarily in French and German.
Dieses ‚Sprachhandlungswissen’, das von der Sprachgemeinschaft geteilt wird, kann soziolinguistisch als diglossisch, bzw. aufgrund der drei Sprachen Luxemburgs, als triglossisch bezeichnet werden. Das Diglossie-Konzept geht zurück auf Charles A. Ferguson (1959) und wurde anschließend mehrfach erweitert und verändert. Ferguson beobachtete, dass in Sprachgemeinschaften in manchen Situationen die Non-Standard-Varietät erwünscht ist und in anderen Situationen eine ihr übergeordnete standardisierte Varietät (vgl. Dittmar 1997: 139). Die Non-Standard-Varietät bezeichnete er als Low-variety (= die Sprache der niedrigen Funktionen bzw. L-Varietät, Volkssprache), die Standard-Varietät als High-variety (= Sprache der hohen Funktionen bzw. H-Varietät) (vgl. Clyne 1994: 261; Sinner 2001: 126). Die H-Varietät wird in formellen Kontexten eingesetzt, die L-Varietät dagegen in informellen Kontexten, in mündlicher, intimer und ungezwungener Atmosphäre (vgl. Clyne 1994: 265; Sinner 2001: 126; Fasold 2004: 35). H- und L-Varietät sind bei Ferguson Varietäten einer einzigen Sprache oder zweier genetisch eng verwandter Sprachen (vgl. Kremnitz 2004: 159). „The attitude of speakers in diglossic communities is typically that H is superior, more elegant, and more logical language“, so Fasold (2004: 36). „L is believed to be inferior even to the point that its existence is denied“, erklärt er weiter (ebd.). Eine Wertung, die lange Zeit kennzeichnend für das Verhältnis der Luxemburger gegenüber ihrer Muttersprache war.1 Joshua Fishman entwickelt um 1964 den Ansatz von Ferguson weiter. Unter Bilingualismus versteht er eine Charakterisierung des persönlichen (individuellen) Sprachverhaltens, während Diglossie für ihn eine sprachliche Ordnung auf soziokultureller Ebene ist (vgl. Sinner 2001: 126). Er lässt die Bedingung der genetischen Verwandtschaft fallen und spricht stattdessen allgemein von zwei verschiedenen Sprachformen (vgl. ebd.).2 Auch in Fishmans Diglossie-Modell gibt es also eine H-Varietät für formellere Zwecke und eine L-Varietät für weniger formelle und private Zwecke (vgl. Fasold 2004: 43). Er verbindet diese Überlegungen mit dem soziolinguistischen Begriff der Domäne, einem Begriff für den kontextspezifischen Sprachgebrauch (vgl. Clyne 1994: 261). Die Kategorisierungshilfe der Domäne wird von Iwar Werlen (2004: 335) folgendermaßen definiert:
Domänen (engl. domains) des Sprachgebrauchs oder der Sprachwahl sind definiert als abstrakte Konstrukte, die durch zu einander passende Orte, Rollenbeziehungen und Themen bestimmt sind […]; sie bestimmen die Wahl einer Sprache oder einer Variante in einer mehrsprachigen Sprachgemeinschaft mit. Beispiele für Domänen sind Familie, Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Kirche und staatliche Verwaltung. Art und Anzahl der Domänen können je nach Sprachgemeinschaft und Kultur variieren.
Domänen können somit für die Sprachwahl verantwortlich sein (vgl. ebd.: 338). Sprecher tendieren dazu in mehrsprachigen Ländern (in denen die Sprachenverwendung nicht primär regional zu erklären ist), basierend auf ihrem Wissen über das erwünschte Verhalten in der Gesellschaft, die einen Sprachen/Sprachvarietäten „in one kind of circumstance [zu benutzen und] another variety [/Sprache] under other conditions“, so Fasold (2004: 34). Er schlägt in The Sociolinguistics of Society (2004) eine breite Definition des Diglossie-Begriffs vor:
BROADDIGLOSSIA is the reservation of highly valued segments of a community’s linguistic repertoire (which are not the first to be learned, but are learned later and more consciously, usually through formal education), for situations perceived as more formal and guarded; and the reservation of less highly valued segments (which are learned first with little or no conscious effort), of any degree of linguistic relatedness to the higher valued segments, from stylistic differences to separate languages, for situations perceived as more informal and intimate (ebd.: 53).
Für das berufliche und private Vorankommen kann es entscheidend sein, über das passende Sprachverhalten in den verschiedenen Gesellschaftsdomänen Bescheid zu wissen. Es ist davon auszugehen, dass unter den Bewohnern Luxemburgs ein solches Domänenwissen besteht, das ihnen bei der Entscheidung hilft, welche Sprache sie in welchem Kontext vorzugsweise auswählen sollen. Entscheidende Entwicklungen haben jedoch dazu geführt, dass dieses Wissen, von außen betrachtet, nur noch schwer zu dechiffrieren ist. Luxemburgisch ist nicht mehr ohne Weiteres als L-Varietät einzustufen, da die Sprache in H-Domänen (wie etwa der Politik) zum Einsatz kommt und der sprachsystemische Ausbau mittlerweile so weit vorangeschritten ist, dass sie sich zunehmend auf den Schriftbereich ausweitet. Die französische Sprache ist mit der demographischen Entwicklung des Landes zu einer lingua franca geworden, der im mündlichen und im schriftlichen Bereich eine hohe kommunikative Reichweite zugeschrieben wird. Neben dem Standardfranzösischen, das in schriftbasierten H-Domänen verwendet wird, hat sich, aufgrund der verstärkten nationen- und milieuübergreifenden Verwendung, auch eine standardferne Varietät des Französischen ausgebildet, die als Umgangssprache, als L-Varietät, im Land gesprochen wird.3 Stellenwert und kommunikative Reichweite der deutschen Sprache werden, aufgrund des hohes Anteils an Zuwanderern, die die französische Sprache als Kommunikationssprache in Luxemburg auswählen, vermehrt angezweifelt. Auf den einzelnen Feldern der Gesellschaft bewegen sich verschiedene Sprachgruppen, die über jeweils unterschiedliche Sprachkenntnisse verfügen und auf der Basis ihrer Kompetenzen individuelle Strategien entwickeln, um sich in Luxemburg mitzuteilen. Sie lernen die Kontexte kennen, in denen eine H-Varietät verwendet werden muss und in denen eine L-Varietät verwenden werden kann. Es hängt von ihrer Sprachbiographie und ihrem Sprachrepertoire ab, ob sie die erwünschte Sprache bzw. lediglich eine ‚tolerierte’ auswählen können. Durch ihre Strategien verändern sie die sprachliche Ordnung auf der soziokulturellen Ebene.
Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Koch/Oesterreicher)
Verschiedene Sprachen (und nicht mehr nur die drei Sprachen ‚Luxemburgisch, Deutsch, Französisch’) tauchen gegenwärtig in der alltäglichen mündlichen oder schriftlichen Kommunikation in Luxemburg auf. Welche Positionen, Bewertungen und Funktionen dabei der deutschen Sprache zuteil werden, wird diese Arbeit Schritt für Schritt aufzeigen. Um die komplexe funktionale Verteilung der Sprachen erfassen zu können, wird im weiteren Verlauf an einigen Stellen auf die Terminologie von Peter Koch und Wulff Oesterreicher (1985; 1994) zurückgegriffen. Koch/Oesterreicher haben den Begriffen ‚mündlich’ und ‚schriftlich’ mehr Trennschärfe verliehen. Sie unterscheiden zwischen der medialen Realisierung von Sprache und ihrer Konzeption. Medial bezieht sich auf die phonische oder graphische Realisierung des Sprachlichen. Eine Äußerung wird entweder medial-mündlich (mit Lauten, phonisch) oder medial-schriftlich (mit Schriftzeichen, graphisch) übermittelt. Von der medialen Realisierung zu unterscheiden ist die in einer Äußerung gewählte Ausdrucksform. Unabhängig davon, ob sie phonisch oder graphisch realisiert wird, kann sie eher mündlich, d.h. eher informell, oder stärker schriftlich, d.h. formell, konzipiert werden. Während der phonische Kode klar vom graphischen Kode zu unterscheiden ist, weist die Konzeption einer Äußerung zahlreiche Abstufungen auf (vgl. Koch/Oesterreicher 1985: 17). Am äußersten Pol konzeptioneller Mündlichkeit liegt etwa das Alltagsgespräch unter Freunden, am äußersten Pol konzeptioneller Schriftlichkeit zum Beispiel der Gesetzestext, dazwischen verschiedene Text-/Gesprächssorten (vgl. Gilles 2011: 50). Kommunikationssituationen können wie folgt gestaltet sein:
Medial-mündlich und konzeptionell-mündlich (z.B. Telefongespräch unter Freunden)
Medial-mündlich aber konzeptionell-schriftlich (z.B. Vorlesung an der Universität)
Medial-schriftlich und konzeptionell-schriftlich (z.B. Bewerbungsschreiben)
Medial-schriftlich aber konzeptionell-mündlich (z.B. Grußkarte aus dem Urlaub)
(vgl. ebd.: 48).
Für diese verschiedenen Kommunikationssituationen kommen in Luxemburg unterschiedliche Sprachen/Varietäten infrage. Die Sprachwahlentscheidung fällt abhängig von der Sprecherkompetenz, der Sprachbiographie und basierend auf dem Domänenwissen, das auch Wissen über die Sprachkompetenzen möglicher Rezipienten beinhaltet.
Nähe-Sprache, Distanz-Sprache
Ein weiteres Begriffspaar, das Koch und Oesterreicher (1985) eingeführt haben, ist das der Sprache der Nähe und der Sprache der Distanz. Die Endpole konzeptionell-schriftlich und konzeptionell-mündlich wurden mit Hilfe dieser Begriffe markiert (vgl. ebd.). Für konzeptionelle Schriftlichkeit sprechen die Kommunikationsbedingungen ‚Monolog’, ‚Fremdheit der (Gesprächs-)Partner’, ‚raumzeitliche Trennung’, ‚Themenfixierung’, ‚Öffentlichkeit’, ‚Reflektiertheit’, ‚Situationsentbindung’, ‚Objektivität’ und die Versprachlichungsstrategien ‚Endgültigkeit’, ‚Informationsdichte’, ‚Kompaktheit’, ‚Elaboriertheit’, ‚Planung’, ‚Komplexität’ etc. (vgl. Koch/Oesterreicher 1985: 23).
Den Mündlichkeitspol kennzeichnen demgegenüber die Kommunikationsbedingungen ‚raum-zeitliche Nähe’, ‚Privatheit’, ‚Vertrautheit’, ‚Emotionalität’, ‚Situations- und Handlungseinbindung’, ‚kommunikative Kooperation’, ‚Spontaneität’ etc. (vgl. Koch/Oesterreicher 1994: 588). Folgende Versprachlichungsstrategien kennzeichnen den Nähebereich: ‚Prozesshaftigkeit’, ‚Vorläufigkeit’, ‚geringere Informationsdichte’, ‚geringe Kompaktheit’, ‚geringe Elaboriertheit’, ‚geringere Planung’, ‚geringere Komplexität’ etc. (vgl. Koch/Oesterreicher 1985: 23). In der vorliegenden Arbeit wird das Begriffspaar Sprache-der-Nähe/Sprache-der-Distanz vor allem metaphorisch verwendet unter dem Teilaspekt der sozialen,emotionalen Nähe und Vertrautheit (vgl. Koch/Oesterreicher 1994: 588). Es wird deutlich werden, dass Sprachen in bestimmten Situationen als vertraute Nähesprachen eingestuft werden und in anderen Situationen aus bestimmten Gründen emotional in die Distanz rücken.
3Typologisierung von Sprachgruppen
„Immigrants, of course, arrive speaking their native languages, thus adding to the host nation’s multilingualism“, so Fasold (2004: 9). Jede Migrantengruppe bringt ihre Sprache(n) in die Zielgemeinschaft mit. Durch Migration formieren sich neue Sprechergruppen, die sich an die dominierende Sprachgemeinschaft und an deren Muster, zumindest so weit wie im Alltag erforderlich, anzupassen versuchen. So erfolgt zum einen eine Anpassung des Sprachwissens der Zuwanderer an das Sprachverhalten der Zielpopulation und zum anderen verändern die Zuwanderer durch die mitgebrachten Sprachen auch die relativ stabile Sprachsituation im Zielland. Bereits in der ersten Baleine-Studie von 1998 stellte sich nach der Auswertung von Umfrageergebnissen die Frage, ob „[f]ace à la présence accrue de francophones et à la montée du français comme langue véhiculaire de la société luxembourgeoise, […] deux communautés linguistiques distinctes étaient en train de naître“ (Fehlen 2009:218). Von zwei verschiedenen Sprachgemeinschaften in Luxemburg zu sprechen, erweckt die Vorstellung von zwei oder mehr Parallelgesellschaften, die nebeneinander existieren und ihre eigenen Sprachgewohnheiten ausbilden oder fortführen. In der 2009 publizierten Folgestudie BaleineBis wird mit Eindrücken einer gesellschaftlichen Segregation aufgeräumt:
Même si le Luxembourg forme, d’un point de vue économique et démographique, un bloc de moins en moins homogène, sa société ne s’est pas scindée en deux sociétés parallèles, ce qui n’empêche que les mêmes phantasmes existent toujours (ebd. : 219).
Nichtsdestotrotz treten hier Menschen mit unterschiedlichen Sprachhintergründen in Kontakt und diese Sprachkontakte wirken sich auf die gesamte Sprachensituation aus. Fishman (1964: 32) betont etwa in seinem Aufsatz Language Maintenance and Shift, dass
The basic datum of the study of language maintenance and language shift is that two linguistically distinguishable populations are in contact and that there are demonstrable consequences of this contact with respect to habitual language use.
Dittmar (1997: 135) weist darauf hin, dass
Sprecher […] mehreren Sprachgemeinschaften angehören [und deshalb] […] zwischen primärer, sekundärer etc. Zugehörigkeit zu unterscheiden [sei]. Die in einer Sprachgemeinschaft geltenden Synchronisierungen von sozialen Mehrfachidentitäten und sprachlichem Repertoire müssen erkannt werden.
Ein Sprecher kann sowohl über Kenntnisse des Lëtzebuergeschen, des Deutschen und des Französischen verfügen und diese so situationsadäquat und mit einer Intonation anwenden, dass man ihn für einen Luxemburger hält, als auch ein Portugiesisch beherrschen, das ihn als Teil der portugiesischen Gemeinschaft kennzeichnet. Er kann daher mehreren Sprachgemeinschaften zugerechnet werden. Den Terminus der Sprachgemeinschaft im Plural zu verwenden und von unterschiedlichen Sprachgemeinschaften (speech communities) zu sprechen, ist in der Soziolinguistik nicht unumstritten. Ich möchte also stattdessen von einer großen luxemburgischen Sprachgemeinschaft ausgehen, die in sich äußerst heterogen ist, aber zugleich einige gemeinsame Strategien entwickelt hat, um miteinander zu kommunizieren. Dort, wo es möglich sein wird, werde ich mit dem Begriff der Sprachgruppe arbeiten, um Unterscheidungen im Sprachwissen und Sprachverhalten herausstellen zu können, ohne jedoch auch hier eine vollkommene Homogenität im Sprachverhalten einer Sprachgruppe zu unterstellen. Es wird davon ausgegangen, dass unterschiedliche Sprachgruppen in Luxemburg agieren, die sich typologisieren lassen. Wie diese sich verhalten, ist nicht immer anhand ihrer Staatsangehörigkeit zu erklären. Meistens kann das Sprachverhalten besser über die jeweilige(n) Familiensprache(n) erklärt werden und damit, ob die Schulausbildung und das Sprachwissen in Luxemburg oder außerhalb Luxemburgs erworben wurden. Esmein (1998: 98) teilte die luxemburgische Bevölkerung gemäß ihres Sprachverhaltens in „deux ensembles sociaux polyglottes“ ein, „l’un germanophone et l’autre romanophone, avec des besoins distincts et qui ne prennent pas les langues du pays dans le même ordre.“ Gerald Stell (2006:37) fragte sich, ob:
the main linguistic contrast in the country may perhaps be found in the coexistence of two types of diglossia. The first type of diglossia we are dealing with is an increasing cross-medial use of Luxembourgish as an in-group code among Luxembourgers with French still in use as a token of upper-class membership. The second type of diglossia is a French/Romane functional diglossia, increasingly practiced by the upcoming generations of Romanophone foreign residents.
Bernard Esmein und Gerald Stell gehen beide davon aus, dass die meisten Sprecher in Luxemburg mehrsprachig, ihre sprachlichen Repertoires jedoch verschieden sind und sich dadurch auch ihr Sprachhandeln unterscheidet.1 Esmein (vgl. 1998: 98) gibt den Hinweis, dass die Sprecher je nachdem über welches Sprachrepertoire sie verfügen, die verschiedenen im Land gebräuchlichen Sprachen jeweils anders hierarchisieren. Aus diesem Hinweis ließe sich ableiten, dass die Sprecher, die über ein eher romanisch geprägtes Sprachrepertoire verfügen, den Stellenwert der deutschen Sprache im Land anders bewerten und folglich auch ein anderes Sprachverhalten zeigen als diejenigen, die zuhause Luxemburgisch sprechen und mit der deutschen Sprache, vielleicht als ‚Fernsehsprache’, aufgewachsen sind.
EXKURS: Migrationsbewegungen
Vom 9. bis zum 19. Jahrhundert verliefen Migrationsbewegungen nicht nach Luxemburg hinein, sondern meist aus Luxemburg hinaus (vgl. Willems/Milmeister 2008: 64). Das Gebiet galt als arm und rückständig und erlebte mehrere Auswanderungswellen. Allein zwischen 1841 und 1891 verließen rund 72000 Luxemburger ihr Land – fast die Hälfte der Bevölkerung (vgl. Thewes 2008: 10). Mit dem Beitritt zum Deutschen Zollverein entwickelte sich ab 1842 ein Auslandsmarkt. Im selben Jahr wurde im Süden des Landes Eisenerz entdeckt. Zwischen 1870 und 1880 nahm die Stahlproduktion stetig zu (vgl. Hoffmann 2002: 60). Die nun benötigten Arbeitskräfte kamen zunächst aus Deutschland, Belgien und Frankreich, kurz darauf aus Polen und Italien (vgl. ebd.; Hausemer 2008a: 3). Ab 1892 bestand ein allgemeiner Trend zur Einwanderung nach Luxemburg (vgl. Willems/Milmeister 2008: 65).1 Für die schlecht bezahlten Arbeiten in den Minen, Hüttenwerken und in der Baubranche wurden gezielt italienische Gastarbeiter angeworben (vgl. Pauly 2011: 118).2 Das für den Aufbau des Stahlsektors benötigte Kapital, das notwendige Know-how und der Absatzmarkt kamen überwiegend aus Deutschland (vgl. ebd.; Trausch 2003: 227). Bis zum ersten Weltkrieg machten die Deutschen über die Hälfte der in Luxemburg wohnenden Ausländer aus (vgl. Willems/Milmeister 2008: 66). Nach dem ersten Weltkrieg zog Luxemburg sich aus dem Zollverein zurück und fand nicht sofort einen neuen Wirtschaftspartner (vgl. Hoffmann 2002: 65). Die ausländischen Arbeitskräfte waren als erste von Entlassungen betroffen. Als sich die Wirtschaft wieder erholt hatte, wurden sie erneut angeworben (vgl. ebd.: 66). Es waren hauptsächlich Italiener, die im Stahlsektor und in der Baubranche arbeiteten (vgl. ebd.). Mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 sank der Anteil an ausländischen Arbeitskräften wieder (vgl. ebd.).
Die deutsche Immigration brach mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ab (vgl. Pauly 1985: 11). Der Fremdenanteil in der Bevölkerung betrug 1947 nur noch 10 %. Das änderte sich bald, da Aufbauhelfer benötigt wurden (vgl. ebd.). 1948 wurde ein erstes bilaterales Arbeitskräfte-Abkommen zwischen Luxemburg und Italien unterzeichnet, das in regelmäßigen Abständen bis 1957 erneuert wurde (vgl. Hausemer 2008a: 3; vgl. Scuto 2012: 285). 1947 waren 7622 italienische Aufbauhelfer im Land, 1960 stieg die Zahl italienischer Gastarbeiter auf 15708 an (vgl. Hoffmann 2002: 67).3
Ab 1949 wurde eine Diversifizierung der Wirtschaft angestrebt, um die Abhängigkeit von der Stahlbranche zu verringern (vgl. Pauly 2011: 107). Die Niederlassung des Reifenherstellers Goodyear im Jahr 1951 war richtungsweisend (vgl. Trausch 2003: 262; Weides et al. 2003: 11). Immer mehr Firmen zog es daraufhin nach Luxemburg. Angelockt durch steuerliche Vorteile, eine Politik der kleinen Wege, politische Stabilität und sozialen Frieden ließen sich zwischen 1959 und 1972 rund fünfzig Unternehmen in Luxemburg nieder (vgl. ebd.). Als die italienische Wirtschaft in den fünfziger Jahren einen Aufschwung erlebte, ließ die Zuwanderung der Italiener nach, zumal diese zunehmend nach Deutschland oder in die Schweiz auswanderten (vgl. Pauly 2010: 68; Pauly 2011: 119). Luxemburg ging dazu über eine aktive Immigrationspolitik zu betreiben (vgl. Scuto 2012: 296). Als Anreiz wurde die Familienzusammenführung ermöglicht, die aber nicht von den Italienern, sondern von Portugiesen, Kapverdiern mit portugiesischem Pass und Spaniern genutzt wurde. 1972 wurden bilaterale Abkommen mit Portugal und dem ehemaligen Jugoslawien in der Abgeordnetenkammer ratifiziert (vgl. Scuto 2012: 296f.; Pauly 2010: 68).41972 wurde auch das erste Zuwanderungsgesetz in Luxemburg verabschiedet (loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers) und eine nationale Einwanderungsbehörde (Service Social de l’Immigration) geschaffen (vgl. Kollwelter 1994: 6). Als Portugal 1986 der EU beitrat, wurde es für portugiesische Zuwanderer noch einfacher nach Luxemburg zu kommen.
Ab Mitte der 1970er Jahre entwickelte sich der Finanzsektor zum wichtigsten Träger der luxemburgischen Wirtschaft (vgl. Pauly 2011: 112; Thewes 2008: 19).5 Der Finanzplatz Luxemburg und die Präsenz der europäischen Behörden hat die Migration verändert. Neben den traditionellen Arbeitsmigranten kommt hochqualifiziertes Personal. Der Finanzsektor zieht Grenzgänger nach Luxemburg, die heute in allen Wirtschaftssparten, aber vor allem im Finanzbereich, in Industrie und Handel sowie im Gesundheitswesen tätig sind (vgl. Trausch 2003: 283).
Luxemburg ist heute ein Einwanderungsland. Bei einer Gesamtbevölkerung von 563700 Einwohnern haben 258700 Bürger keinen luxemburgischen Pass (vgl. Statec 2015: 9). Die Portugiesen liegen mit 92100 Zuwanderern an der Spitze, gefolgt von 39400 Franzosen, 19500 Italienern, 18800 Belgiern, 12800 Deutschen, 6000 Briten, 4000 Niederländern, weiteren 29600 Zuwanderern aus der Europäischen Union und 36500 Nicht-EU-Bürgern (vgl. Statec 2015: 10). Durch Zuwanderung und Globalisierung erfuhr und erfährt der luxemburgische Sprachraum Veränderungen. Die Regeln des Sprachverhaltens in Luxemburg und der Stellenwert der einzelnen Sprachen im Land beruhen auf einem Wissen, einer spezifischen Logik, das/die dem einzelnen Bürger bei der Entscheidung, welche Sprache er in welcher Situation benutzen sollte, behilflich ist. Ich setze bei diesem spezifischen Wissen der Sprecher an, wenn es darum geht, den Stellenwert der deutschen Sprache in Luxemburg zu erschließen. Es ist ein Wissen, das je nach Sprachgruppenzugehörigkeit verschieden ausgeprägt und ausgebildet ist, aber darüber entscheidet, welche Sprachen aus den jeweils verfügbaren Sprachrepertoires ausgewählt werden dürfen und darüber informiert, wie in Luxemburg über einzelne Sprachen gedacht wird. Ausgehend von der Frage, was das Sprachwissen einer mehrsprachigen Gesellschaft, und konkreter, der luxemburgischen, eigentlich kennzeichnet, stellt sich in einem weiteren Schritt die Frage, inwiefern Migrationsbewegungen dieses Wissen verändern.
Im nun folgenden theoretischen Kapitel wird dieser Wissensbegriff mit der Hinzunahme von Theorien aus Soziologie, Geschichtswissenschaft und Sozio- und Kulturlinguistik umrissen. Zunächst wird zur Bezeichnung dieses ‚Orientierungswissens’ beim Begriff Denken-wie-üblich von Alfred Schütz angesetzt, der um den Begriff Handeln-wie-üblich ergänzt wird. Später kann das Wissen dann treffender als Mentalitätenwissen definiert werden. Anschließend wird der Foucaultsche Diskursbegriff vorgestellt, um das Wissen, das in der Gesellschaft über die Positionen, Funktionen und Bewertungen der einzelnen in Luxemburg vorkommenden Sprachen zirkuliert, mittels der Analyse von Sprecheraussagen, bzw. über die Analyse von Aussagen und Äußerungen von Diskursteilnehmern, zu erfassen.
III.Das Wissen der Sprecher – Theoretische Grundlagen
1Über Mentalitätenwissen, Sprachdenken und Sprachhandeln
1.1„Dieses ‚Denken-wie-üblich‘, wie wir es nennen möchten […]“1
Als ich mich in der Recherchearbeit befand, nach und nach das Untersuchungskorpus zusammenstellte und die ersten Expertengespräche führte, wurde mir des Öfteren gesagt, ich würde eine zentrale Voraussetzung mitbringen, um mich an das Thema ‚Deutsch in Luxemburg’ heranzuwagen, nämlich das teils bewusste, teils unbewusste Wissen über. Hierbei handelt es sich um ein Wissen, das durch die Sozialisation in Luxemburg erworben wird und das weit über die reine Kenntnis der drei offiziellen Landessprachen hinausgeht. Eine erste Definition dieses sogenannten intuitiven Wissens sowie ein Porträt des ‚Un-Wissenden’ formulierte Alfred Schütz in seinem Beitrag Der Fremde. Ein sozialpsychologischer Versuch (1972). Schütz beschreibt hier die Ausgangssituation, in der sich ein Fremder befindet, wenn er „versucht, sein Verhältnis zur Zivilisation und Kultur einer sozialen Gruppe zu bestimmen und sich in ihr neu zurechtzufinden“ (ebd.: 53). Den Fremden bezeichnet er als einen Erwachsenen, der sich als Immigrant in der „Situation der Annäherung [an eine neue Gesellschaft befindet], die jeder möglichen sozialen Anpassung vorhergeht und deren Voraussetzungen enthält“ (ebd.: 54). Fremde betreten als Unwissende ein neues Feld bzw. mehrere neue soziale Felder, deren Denk- und Handlungsgewohnheiten ihnen zunächst einmal nicht vertraut sind (vgl. ebd.: 55). Immigranten müssen für alle gesellschaftlichen Bereiche das passende Sozialverhalten neu erwerben oder überprüfen. Vorwissen über etwaige Verhaltensmuster der Zielgemeinschaft muss gegebenenfalls revidiert werden.
Der Begriff des lebensweltlichen Wissens bezeichnet bei Schütz den Wissensvorrat eines Menschen. Er fasst den Begriff zunächst weit, indem er annimmt, dass darin Traumwissen, Phantasiewissen, religiöses Wissen und Alltagswissen enthalten sind (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 178). Das Alltagswissen stellt dabei den Kernbereich des lebensweltlichen Wissensvorrats dar und dient als Orientierungsgrundlage (vgl. ebd.; Schütz 1972: 55). Es handelt sich hierbei in erster Linie um Wissen über Denk- und Verhaltensmuster, vergangene Ereignisse, Erfahrungen, individuelle und tradierte Verhaltensroutinen und Verhaltenserwartungen. Das Alltagswissen ist nicht frei von Widersprüchen. Schütz erklärt, dass das „erworbene System des Wissens – so inkohärent, inkonsistent und nur teilweise klar, wie es ist – […] für die Angehörigen der in-group den Schein genügender Kohärenz [hat]“ (ebd.). Die Integration eines Fremden in die Zielgesellschaft ist nur dann vollends gelungen, wenn dieser deren Denk- und Handlungsmuster nicht nur passiv nachvollziehen kann, sondern sie auch aktiv beherrscht und weiß, wie er sich in unterschiedlichen Situationen ‚alltagstypisch’ zu verhalten hat (vgl. ebd.: 63,65):
Au sens psycho-social, l’intégration désigne le processus d’intériorisation qui permet à un individu de réagir conformément aux normes et aux valeurs qui régissent le groupe (Brémond/Gélédan 2002: 294; eigene Hervorh.).
Der Fremde muss in gewisser Weise lernen so zu denken, wie es in der Zielgesellschaft üblich ist. Lernen zu Denken-wie-üblich, bedeutet die inneren Gesetze oder – mit Schütz gedacht – die Rezepte der Gruppe so zu verinnerlichen, dass sie bei den eigenen Handlungen miteinbezogen werden (vgl. Schütz 1972: 58).2 Dieses ‚Rezeptwissen’ stellt intuitiv Lösungen für Probleme, Erlebnisabläufe und Wissen über das gesellschaftlich akzeptierte Verhalten in bestimmten Situationen bereit – und so auch Wissen über das in bestimmten Situationen akzeptierte Sprachverhalten (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 159).
1.2Makrokontext ‚Luxemburgische Mentalität‘
Der gesellschaftliche Wissensvorrat kann mit dem Schützschen Begriff Denken-wie-üblich umrissen werden. Nützliche theoretische und methodische Anknüpfungspunkte für die Erforschung solcher in einer Nation historisch gewachsenen Orientierungsmuster, Deutungs- und Handlungsrahmen, stellen die Geschichtswissenschaften bereit. Sie bedienen sich nicht des Begriffs Denken-wie-üblich, sondern fragen nach der zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte gültigen Mentalität. Die Elemente jenes Wissens, die sich auf das individuelle Denken über Sprachen und Sprachhandeln in Luxemburg auswirken, indem sie Handlungsvorlagen bereitstellen, werden als Teil des in Luxemburg gültigen und wandelbaren Mentalitätenwissens betrachtet.
1.2.1Mentalität im Sinne der historischen Mentalitätsforschung
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts richtete sich das Interesse der Historiker zunehmend auf die konkreten Lebensumstände der Menschen in dem Zeitalter, das sie erforschen wollten (vgl. Burguière 2006: 13). Das Forschungsinteresse der Geschichtswissenschaft fokussierte somit wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte. Alltagsgeschichte, Mikrogeschichte, Kulturgeschichte, Mentalitätsgeschichte und Diskursgeschichte erfuhren innerhalb des Fachs eine Aufwertung. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit mentalitätsgeschichtlichen Aspekten beschränkte sich allerdings zunächst auf den französischen Raum. Auch der wissenschaftliche Terminus mentalité etablierte sich vorerst nur dort (vgl. Chartier 1987: 69).1 Ende der siebziger Jahre wurde die Mentalitätsgeschichte dann auch im deutschsprachigen Raum rezipiert (vgl. Spitzmüller 2005: 56f.). Mentalität ist als ‚Suchbegriff’ zu verstehen (vgl. Hermanns 1995: 73). Bei der Erforschung historischer Ereignisse und Vorgänge soll auch das spezifische Denken der Zeit, welches die menschlichen Handlungen prägte, mitberücksichtigt werden (vgl. ebd.; Küçükhüseyin 2011: 22). Le Goff erklärt, dass
der anfängliche Reiz der Mentalitätsgeschichte gerade in ihrer Unschärfe und in ihrem Anspruch [bestand], den Bodensatz der historischen Analyse, jenes ‚Irgendwo auch’ der Geschichte, ausfindig zu machen (vgl. Le Goff 1987: 18).
Um eine klare Definition von Mentalität formulieren zu können, ist es wichtig, das wissenschaftliche Verständnis des Begriffs klar vom umgangssprachlichen abzugrenzen. Umgangssprachlich bedeutet Mentalität eine „[…] besondere […] Art des Denkens oder Fühlens eines einzelnen Menschen, einer sozialen Gruppe oder eines Volkes […]“ (vgl. Scharloth 2000: 42; 2005b: 44).2 Hervorgehoben werden demnach die charakterlichen Eigenarten eines Menschen, einer sozialen Gruppe oder eines Volkes (vgl. Scharloth 2005a: 120). In der Geschichtswissenschaft wird der Begriff jedoch anders verstanden. Mentalitäten bezeichnen hier die üblichen Denkweisen. Dinzelbacher (1993) definiert das Verständnis des Begriffs aus Sicht der Mentalitätsgeschichte wie folgt:
Historische Mentalität ist das Ensemble der Weisen und Inhalte des Denkens und Empfindens, das für ein bestimmtes Kollektiv in einer bestimmten Zeit prägend ist. Mentalität manifestiert sich in Handlungen (Dinzelbacher 1993: XXIV; Hervorh. im O.).
Die Definition von Dinzelbacher hat sich in der Mentalitätsgeschichte etabliert. Sie deckt sich mit der von Fritz Hermanns (vgl. 1995: 77), die hier an zweiter Stelle angeführt wird, da der Sprachwissenschaftler einen bedeutenden Beitrag zur Übertragung des Mentalitätsbegriffs und der damit verbundenen Konzepte in die Linguistik leistete:3
Eine Mentalität im Sinne der Mentalitätsgeschichte ist, so hat es sich ergeben: 1.) die Gesamtheit von 2.) Gewohnheiten bzw. Dispositionen 3) des Denkens und 4.) Fühlens und 5) Wollens oder Sollens in 6.) sozialen Gruppen (ebd.).
Beide Definitionen weisen Parallelen zum Begriff der sozialen Einstellung auf. So meint Hermanns (2002: 81), dass „[e]ine Mentalität […] die Gesamtheit aller usuellen Einstellungen in einer sozialen Gruppe“ (2002: 81) sei und „[…] insofern […] die Mentalitätsgeschichte auch und insbesondere als Geschichte von sozialen Attitüden“ zu verstehen sei (1995: 77f.). Scharloth (2000: 45) bezieht sich auf Sellin (1985) und meint: „Die Gesamtheit der kollektiven Einstellungen konstituiert danach die gruppenspezifische Mentalität.“4 Ich teile Hermanns (2002: 81) Sicht nicht, wenn er meint, die Mentalitätsgeschichte lasse „sich ohne weiteres ersetzen durch die schlichtere Bezeichnung ‚Einstellungsgeschichte’.“ Der Mentalitätsbegriff erfasst viel deutlicher den kollektiven Wissensbestand, dieses Denken-wie-üblich und das damit verbundene Handeln-wie-üblich innerhalb einer Gesellschaft, als der Begriff der Einstellung.5 So hat der Mentalitätsbegriff eine Doppelstruktur; er ist zugleich Gewohnheit und Disposition. In der historischen und linguistischen Forschung führt dies einerseits zu Arbeiten, die mit einem engen, kategorial-epistemischen Mentalitätsbegriff arbeiten und andererseits zu Anwendungen eines weiten, substanziellen Mentalitätsbegriffs (vgl. Scharloth 2005a: 121). Arbeiten, die einen substanziellen Mentalitätsbegriff applizieren, versuchen das Alltagswissen zu erfassen, suchen nach den Inhalten des üblichen Denkens (vgl. ebd.). Kategorial-epistemische Arbeiten versuchen die kollektiven Weisen der Wissensverarbeitung und der Wissensorganisation zu erschließen (vgl. ebd.). Mentalitäten sind vielschichtiger als kollektive Einstellungen und scheinen diesen konzeptuell übergeordnet zu sein. Sie werden empirisch anhand von Einstellungsäußerungen sichtbar.6 Ich betrachte kollektive Einstellungen also in gewisser Weise als Teilmengen von Mentalitäten.7
Der Einfluss des Mentalitätenwissens auf das individuelle Handeln variiert. Es ist in jeweils unterschiedlichem Ausmaß eine Hilfe bei der Entscheidung, wie man sich in diversen sozialen Situationen zu verhalten hat (vgl. Dinzelbacher 1993: XXIX). So stellt es beispielsweise abrufbare Informationen darüber bereit, ob bestimmte Handlungen in der Gesellschaft erwünscht sind. Mentalität ist, in Anlehnung an Lucien Febvre, ein outillage mental und beinhaltet als solches „die Summe der Orientierungsangebote, die in einem Kollektiv jeweils aktuell sind“ (vgl. ebd.: XXIXf.). Der Einzelne ist nicht nur Träger einer Mentalität mit einer Summe x an Orientierungsangeboten des kollektiven Denkens, Fühlens, Sollens und Wollens, sondern ist Träger von multiplen Mentalitäten mit multiplen Orientierungsangeboten und Deutungsmöglichkeiten, die in unterschiedlichem Ausmaß genutzt werden. Somit greift jeder Mensch nicht nur auf das in einer Mentalität gespeicherte Wissen zurück, „Mentalitäten gibt es nicht nur auf einer Komplexitätsebene, in einer bestimmten Konsistenz und immer denselben Ausdrucksformen“, sondern auf eine Vielzahl, die auf den verschiedenen Ebenen des sozialen Zusammenlebens entstehen (Kuhlemann 1996: 183). Da das Individuum in einer Pluralität von Mentalitäten denkt, benutze ich Mentalität auch stets im Plural. Je nach Situation werden jeweils andere Mentalitätenebenen aktiviert. Die Komplexität von Mentalitäten und die Reichweite ihrer Handlungsvorlagen werden anhand des Mehrebenenmodells von Kuhlemann (vgl. 1996: 193f.) verständlich. Dieser unterscheidet drei aufeinander bezogene Mentalitätenebenen:
Totalmentalität: die epochalen, mehr oder weniger von allen Zeitgenossen (weltweit oder eines Kulturraumes je nach Forschungsperspektive) geteilten Einstellungen und Selbstverständlichkeiten.
Makromentalitäten (Großgruppenmentalitäten): betrifft die Mentalität(en) größerer je nach Forschungsperspektive umgrenzter Kollektive (Nationen, Gesellschaften, Konfessionsgruppen …).
Innerhalb der Makromentalitäten können weitere Partikular- bzw. Mikromentalitäten unterschieden werden (etwa Mentalitäten der Inner- oder Teilgesellschaft: Familie, Schule, Peergroup, Partei …) (vgl. ebd.; vgl. Spitzmüller 2005: 60).
Wichtig ist in Bezug auf Mentalitäten von dieser Mehrebenenstruktur auszugehen. Die vorliegende Arbeit richtet sich in erster Linie auf die Ebene der Großgruppenmentalität, berücksichtigt aber immer auch das bestehende Interdependenzverhältnis zwischen den einzelnen Mentalitätenebenen. Der Versuch von einer isolierten Kultur auszugehen und diese mit dem Staat (der Nation) Luxemburg gleichzusetzen, würde die Realität verkennen – gerade in einer Gesellschaft, die von Mehr- und Interkulturalität im besonderen Maße geprägt ist. Darüber hinaus muss nicht darauf hingewiesen werden, dass die Bevölkerung eines jeden Landes, als Teilgemeinschaft einer globalisierten Welt, in einer Pluralität von Mentalitäten denkt.
Menschen unterscheiden sich voneinander. Sie handeln schon aus diesem Grund unterschiedlich und interpretieren Situationen jeweils anders (vgl. Spitzmüller 2005: 59). Trotzdem ist vieles, was als eine individuelle Meinungsäußerung ausgesprochen wird, im Grunde genommen gesellschaftlich (vgl. Rehbein 2011: 97). Mit Bourdieu ist jedes Individuum immer schon gesellschaftlich gewesen (s. a. ebd.: 87 vgl. Krais/Gebauer 2002: 66,). „Was tue ich, was kein anderer Mensch tut?“ und „Was tue ich, was ich nirgendwo erfahren oder gelernt habe?“, fragt Rehbein (2011: 97).
Gegenstand dieser Arbeit ist ein spezifischer Teilbereich von kollektiven Wissens- und Handlungsvorgängen, nämlich diejenigen, die sich auswirken auf die Bewertungen, die Funktionen und die Positionen, die den Sprachen in Luxemburg und der deutschen Sprache im Besonderen zugeschrieben werden. ‚Mentalität’ als Schlüsselelement der Untersuchung erlaubt es eine Brücke zwischen Wissen und Verhalten herzustellen. Die Sozialpsychologie betrachtet den Einfluss von Einstellungen auf das Verhalten kritisch (vgl. Scharloth 2000: 45). Eine eingehendere Betrachtung des sozialpsychologischen Konzepts der Einstellung kann Auskunft darüber geben, inwieweit Mentalitäten tatsächlich in das Handeln des Einzelnen einfließen.
EXKURS: Einstellungen und Verhalten
Einstellungen werden sozial geteilt. Es existieren zahlreiche Definitionen, die zu erfassen versuchen, was Einstellungen sind und wie sie genau entstehen. Die meisten rekurrieren nach wie vor auf die bereits im Jahr 1935 von Gordon Allport formulierte Definition:
An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive and dynamic influence upon the individual’s response to all objects and situations with which it is related (Allport 1935: 810).
Einstellungen entstehen durch Erfahrungen, die im Verlauf des eigenen Lebens gemacht werden. Sie sind gesellschaftlich gewachsene Bewertungsvorlagen, die sich in der sozialen Interaktion (dem familiären Umfeld, der Peergroup, Bildungsinstitutionen, Medien …) bilden (vgl. Arendt 2010: 8). Indem der Einstellungsträger seine Einstellung gegenüber einem Einstellungsgegenstand abruft, erhält er eine Bewertungs- bzw. Reaktionstendenz. Während einfache Erklärungsmodelle der Einstellungsforschung nur diesen Bewertungsaspekt herausstellen und Einstellungen als evaluatives Maß auf einer eindimensionalen Richtungsskala veranschaulichen, die von maximal negativ bis maximal positiv reicht, ergänzen andere die Erklärungskomponente (nicht mögen – mögen), um eine kognitive Komponente (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2009: 150). Sie verdeutlichen, dass Einstellungen vielschichtiger sind und eine geäußerte Bewertung noch lange nicht den Blick auf sämtliche vorhandenen Gedankengänge und Wissensbestände freilegt, die das Einstellungsobjekt betreffen könnten. Seit den 1960er Jahren wird das Drei-Komponenten-Modell zur Erklärung von Einstellungen (nach Rosenberg/Hovland und Katz/Scotland) in der Einstellungsforschung favorisiert (vgl. Hermanns 2002: 74). Die Gründe, die zur Entwicklung einer bestimmten Einstellung geführt haben und auch die Form, in der sich die Einstellung äußert, können, diesem Modell zufolge, kognitive, affektive und/oder konative Züge aufweisen.1
Die kognitive Komponente umfasst das Hintergrundwissen, das, bezogen auf das Einstellungsobjekt, erworben und gespeichert wurde. Man könnte auch von Vorstellungen, Informationen, Schemata (auch von auf bestimmte Situationen passenden Argumentationsschemata), Stereotypensets und vorgefassten Meinungen sprechen (vgl. ebd.: 75). Die Kognitionen beruhen auf früherem Verhalten, auf Erfahrungen und Erlerntem. Die affektive Komponente beinhaltet ablehnende oder zuwendende Dispositionen gegenüber dem Einstellungsobjekt (vgl. Vandermeeren 1996: 693). Auch diese Komponente geht aus Erlerntem, aus Erfahrungen und Erlebnissen hervor. Die behaviorale Komponente beinhaltet zum einen die Auffassung darüber, welche Handlungen, bezogen auf das Einstellungsobjekt, ausgeführt werden sollten und zum anderen den Handlungsvollzug (vgl. Spitzmüller 2005: 68). Arendt (2010: 10) hat vorgeschlagen konativ (oder auch: behavioral) durch volitiv zu ersetzen, da die Einstellung lediglich zu einem bestimmten Verhalten prädisponiere, das sich nicht zwingend mit dem daran anschließenden, tatsächlichen Verhalten in einer bestimmten Gesprächssituation decke. Auch Allport (1935: 805) führt diesen Gedanken aus:
In one way or another each regards the essential feature of attitude as a preparation or readiness for response. The attitude is incipient and preparatory rather than overt and consummatory. It is not behaviour, but the precondition of behaviour (Allport 1935: 805, Hervorh. im O.).
Einstellungen erfüllen bestimmte Funktionen, die von Smith, Brunner und White (1956), Katz (1967) und McGuire (1969) benannt worden sind (vgl. Casper 2002: 38):
Die Wissensfunktion: Im Alltag müssen fortwährend Entscheidungen getroffen werden, was nicht zu bewältigen wäre, wenn bei allem, was wahrgenommen wird, das dazugehörige Vorwissen immer wieder aufs Neue gesammelt und dann sorgfältig ausgewertet werden müsste. Aufgabe der Einstellungen ist es als Bewertungs- und Handlungsvorlagen zu fungieren, auf die bewusst oder unbewusst zurückgegriffen werden kann (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2009: 149; 151).
Instrumentelle, utilitaristische oder auch Anpassungsfunktion: Diese Funktion basiert auf dem Wissen, dass Einstellungsäußerungen positive oder negative Folgen haben (vgl. Casper 2002: 39). Es geht um Bewertungen des Einstellungsobjekts hinsichtlich seiner Brauchbarkeit für das Erreichen beruflicher Ziele, für die Selbstverwirklichung des Individuums (instrumentell) oder für die Integration in eine bestimmte Gruppe (integrativ) (vgl. ebd.: 55).
Die Ich-Verteidigungsfunktion: Einstellungen sind wichtig für den Erhalt des eigenen Selbstwertgefühls.
Expressive Funktion: Einstellungen geben die Möglichkeit zur Selbstdefinition und zur Selbstdarstellung. Sie vermitteln u.a. Zugehörigkeit, Identität, Konformität, Charakter und Gruppenzugehörigkeit und formen die eigenen Wertvorstellungen.





























