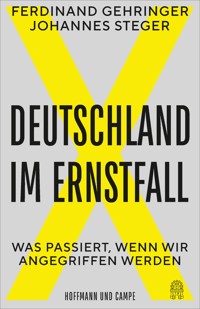
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Szenario ist real und wird in der Politik vielfach durchgespielt: Deutschland wird in einen Krieg verwickelt. Gäbe es dann genügend Schutzräume für die Zivilbevölkerung? Ausreichend Medikamente? Wären unsere Daten sicher? Könnte das Internet ausgeschaltet werden? Und wer träfe die strategischen Entscheidungen? Mit viel Insiderwissen und Detailkenntnis schildern die Autoren, was passiert, wenn unser Alltag einer allumfassenden Bedrohung ausgesetzt ist und Infrastruktur, Versorgung, Information und politischer Apparat sabotiert und angegriffen werden, ja gänzlich ausfallen. Ein packender und gleichsam seriöser Report über Ernstfallstrategien und die lebensweltliche Verteidigung unserer Demokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ferdinand Gehringer | Johannes Steger
Deutschland im Ernstfall
Was passiert, wenn wir angegriffen werden
Vorwort
Ein Tag in der Vergangenheit: Am 24. Februar 2022 beginnt Russland seine vollumfängliche Invasion gegen die Ukraine. Frieden in Europa wird von einer verlässlichen Selbstverständlichkeit zu einer verblassenden Errungenschaft. Während der Entstehung dieses Buchs spitzte sich zudem die Lage im Nahen Osten zu. Es kam zu einem wechselseitigen Raketenbeschuss zwischen Israel und Iran, und auch die USA führten eine Operation gegen Iran durch. Ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist zudem noch immer nicht in Sicht.
Mit diesen Entwicklungen einher geht die schmerzhafte Erkenntnis: Freiheit, Sicherheit und Wohlstand sind verletzlich. Mithin Werte, die geschützt, verteidigt und vor allem vorbereitet werden müssen.
Die geopolitisch angespannte Lage und hybride Bedrohungen – Cyberangriffe, Desinformationskampagnen oder Sabotageakte gegen kritische Infrastrukturen – zeigen, dass Sicherheit nicht nur eine militärische Frage ist. Sie betrifft vielmehr unser gesellschaftliches Zusammenleben, unsere demokratischen Institutionen und die zivile Infrastruktur. Sie betrifft unser alltägliches Leben.
Was also passiert mit Deutschland, wenn sich ein bewaffneter Konflikt in Europa zuspitzt? Wie reagieren unsere staatlichen Strukturen – und wie reagiert unsere Gesellschaft? Welche Folgen hätte ein solcher Ernstfall für unsere Demokratie, unsere Freiheit und unseren Alltag?
Für Deutschland betrachten Vertreterinnen und Vertreter von Bundeswehr oder Sicherheitsbehörden vor allem vier Bedrohungslinien. Zum einen ist das der Einsatz von Desinformationen, mit denen eine gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben werden soll, bis hin zum Schüren von sozialen Unruhen. Ebenfalls als Bedrohungslinie identifiziert sind Cyberangriffe, etwa um digitale Infrastrukturen zu überlasten oder lahmzulegen. Ein dritter Aspekt ist die Ausspähung von kritischen Infrastrukturen, militärischen Anlagen, Schlüsselindustrien oder politischen Einrichtungen, was sowohl durch digitale Werkzeuge als auch durch Mittel wie Drohnen bewerkstelligt werden kann. Außerdem rechnen Sicherheitsexperten im Ernstfall mit Sabotageakten – das können Mordanschläge sein, ein gezieltes Ausschalten von Transport- oder Telekommunikationsinfrastrukturen oder der Einsatz etwa von Brandanschlägen, um die Kapazitäten von Rettungskräften zu binden. Alle vier Bedrohungslinien können dabei ineinander übergehen.
In Deutschland im Ernstfall entwickeln wir Szenarien, die die Eskalation eines bewaffneten Konflikts in Europa zur Grundlage haben und sich in den oben genannten Bedrohungslinien äußern. Sie speisen sich zum Teil aus realen Geschehnissen und Bewertungen von Vertreterinnen und Vertretern von Sicherheitsbehörden, der Bundeswehr sowie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. In der Gesamtbetrachtung sind sie fiktiv, zugespitzt und müssen in dieser Form nicht eintreten. Sie sind verdichtet und in ihren Abläufen bewusst als Kettenreaktion zu verstehen und werden so aller Voraussicht nach nicht unmittelbar eintreten.
Zentral für unsere angenommenen Situationen sind nicht strategische oder militärische Überlegungen, sondern vor allem die Auswirkungen auf das zivile Leben, auf Freiheit, auf Sicherheit und auf die Demokratie: Wie robust ist unsere Notfallversorgung? Was leisten Zivilschutz und Katastrophenhilfe in einem Szenario, in dem kritische Infrastrukturen – Strom, Wasser oder Telekommunikation – ausfallen? Und wie kann Informationssicherheit gewährleistet werden, wenn gezielte Desinformation und Cyberangriffe das Vertrauen in staatliche Institutionen erschüttern?
Wir glauben, dass Freiheit verstanden, geschützt und im Ernstfall, auch in unserem Ernstfall, verteidigt werden muss – nicht nur durch die Bundeswehr, sondern durch alle Bürgerinnen und Bürger. Nach Gesprächen mit zahlreichen Sicherheitsexpertinnen und -experten wird deutlich: Raketenbeschuss oder Bombenangriffe auf Deutschland sind eher unwahrscheinlich, genauso wie ein bewaffneter Konflikt auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Das sind Vorstellungen von einem Krieg in Deutschland, die veraltet und nicht mehr realistisch sind. Dennoch kann anhand der vier beschriebenen Bedrohungslinien großer Schaden angerichtet werden.
Deutschland und Europa sind, um es klar zu formulieren, nicht unvorbereitet. Erlebt haben wir zahlreiche Menschen in Behörden, Politik, Organisationen und Unternehmen, die den Ernstfall durchdenken, sich einsetzen und an entsprechenden Vorkehrungen arbeiten – sei es, um den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels zu begegnen, eines technischen Fehlers oder eben einer geopolitischen Krise. Auch das starke Ehrenamt hierzulande und die damit verbundene gesellschaftliche Solidarität sind ein wichtiger Baustein der gesamtgesellschaftlichen Resilienz. Dennoch wurde in vielen Gesprächen deutlich: Der Investitionsbedarf in den Bevölkerungsschutz und damit in den Zivil- und Katastrophenschutz ist hoch und gehört zu den zentralen Herausforderungen, denen sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft endlich stellen müssen.
Mit diesem Buch wollen wir politische Entscheidungsprozesse, gesellschaftliche Reaktionen und infrastrukturelle Herausforderungen skizzieren, um Denkraum zu schaffen und Vorbereitung zu fördern. Deutschland im Ernstfall hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt Maßnahmen, die wir nicht antizipiert haben, Prozesse, die Expertinnen und Experten sehr unterschiedlich einschätzen, Gesetze, die zum Zeitpunkt des Entstehens noch nicht beschlossen waren, oder Dinge, die den Leserinnen und Lesern vielleicht noch darüber hinaus in den Sinn kommen mögen.
Unser Buch (mit unseren Szenarien) will keine Prepper aus Ihnen machen, wir wollen keine Panik schüren, sondern die Diskussion über gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit versachlichen. Wir sind der Meinung, dass Vorbereitung auf einen wie auch immer gearteten Ernstfall oder auf eine Krise, ob aufgrund von Umweltereignissen, Kriegen oder geopolitischen Zusammenhängen, genau das verhindern kann.
Wir möchten aufklären, sensibilisieren und motivieren. Denn eine widerstandsfähige Demokratie lebt von einer informierten und handlungsfähigen Gesellschaft. Im Ernstfall entscheidet sich die Resilienz eines Landes nicht nur in den politischen und militärischen Lagezentren, sondern im Alltag seiner Bürgerinnen und Bürger: in der Funktionsfähigkeit von Zivilschutz und Notfallversorgung, im Zugang zu verlässlichen Informationen, im Vertrauen in staatliches Handeln – und in der psychologischen Widerstandskraft der Menschen. Resilienz ist dabei Ausdruck demokratischer Reife und rationalen Handelns. Der Schweizer Schriftsteller und Architekt Max Frisch erkannte: »Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.«
Mit Deutschland im Ernstfall möchten wir zum Auseinandersetzen, Abwägen und Handeln anregen. Es ist eine Einladung. Eine Einladung zum Nachdenken über den Ernstfall – damit wir heute darüber sprechen können, was morgen möglich sein könnte. Und damit wir als Gesellschaft die Stärke entwickeln, auch in der Krise frei, demokratisch und handlungsfähig zu bleiben. Denn Vorbereitung auf Krisen beginnt mit der Vorstellungskraft – und mit der Bereitschaft, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen.
IEin Tag in der Zukunft – Ausgangslage
Der Ernstfall deutet sich an
Ein Februar in der Zukunft: In den europäischen Hauptstädten geht das Leben seinen gewohnten Gang. Doch in den Schaltzentralen von Berlin, Paris, London oder Brüssel herrscht Unruhe. Geheimdienste beobachten Truppenbewegungen in Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad. Die Führungen in Moskau und Minsk wiegeln ab – doch Experten warnen: Die Bewegungen ähneln denen der groß angelegten Manöver im Rahmen der Militärübungen »Zapad«, mit denen die beiden Staaten bereits in der Vergangenheit die Geduld der Nato-Staaten testeten und im Vorfeld des Ukrainekriegs Truppen verlegten.
Die Nato startet den Konsultationsmechanismus nach Artikel 4 des Nato-Vertrags auf Verlangen der baltischen Staaten und Finnland. Deutschland versetzt Einheiten der Bundeswehr in erhöhte Bereitschaft, insbesondere Logistik- und Pioniereinheiten, um im Fall einer Eskalation schnell unterstützen zu können. US-amerikanische Streitkräfte verlegen zusätzliche Truppen über Ramstein und den Lufttransportstützpunkt Wunstorf. Die Nato erhöht den Bereitschaftsstatus der schnellen Eingreiftruppe (VJTF) und verlegt zusätzliche Aufklärungseinheiten sowie AWACS-Flugzeuge an die Ostflanke. Deutsche Marineeinheiten werden in Richtung Ostsee beordert, während die Luftwaffe im Verbund mit anderen Ostsee-Anrainern verstärkte Präsenz vor der Küste des Baltikums zeigt. Mehrere Zwischenfälle mit russischen und Nato-Kampfflugzeugen führen zu einer angespannten Atmosphäre.
Über soziale Netzwerke und anonyme Nachrichtenkanäle tauchen nun Desinformationskampagnen auf, die gezielt Misstrauen gegenüber der deutschen Bundesregierung und Nato-Partnern säen. Immer wieder gibt es Meldungen über angeblich anrückende Truppen, eine Generalmobilmachung oder bevorstehende Evakuierungen, die zwar als falsch identifiziert werden, sich aber mitunter schnell verbreiten. Demonstrationen und erste Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften sind die Folge. Auch gezielte Deepfakes von Politikerinnen und Politikern werden gestreut, die das Misstrauen verstärken sollen.
In Grenzregionen von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg treten koordinierte Sabotageakte an Bahntrassen, Sendemasten und Stromleitungen auf. Geheimdienstkreise sprechen von der Möglichkeit »schlafender Zellen« oder eingeschleuster Spezialkräfte (»Spetsnaz-ähnlich«), die im Rahmen eines umfassenderen hybriden Angriffsplans aktiv wurden. In Polen, Finnland und den baltischen Staaten wird der Schutz kritischer Infrastrukturen durch das Militär verstärkt.
Auch in Deutschland hat die Zahl der Ereignisse, die eine klare Handschrift der russischen hybriden Kriegsführung tragen, zugenommen: Cyberangriffe auf kommunale Verwaltungen, ein hochrangiger Dax-Manager entgeht nur knapp einem Attentat, auf dem Produktionsgelände eines deutschen Rüstungsunternehmens kommt es zu einer großen Explosion. Selbst offizielle Stellen sprechen nun von »koordinierten Zwischenfällen«.
Trotz der militärischen Gegenmaßnahmen bleibt unklar, ob es sich um die Vorbereitung eines konventionellen Angriffs handelt oder um eine Eskalationsstrategie zur Destabilisierung und Erpressung. Kanzleramt und Nato-Generalsekretariat sprechen jedenfalls von einer »beispiellosen hybriden Bedrohungslage«, wie sie Europa seit Jahrzehnten nicht erlebt habe. Die baltischen Staaten sowie Polen versetzen ihre Truppen in Alarmbereitschaft. Die Bundesrepublik Deutschland ruft den Spannungsfall aus.
Deutschland ruft den Spannungsfall aus
In unserem Szenario ruft die Nato den Konsultationsmechanismus nach Artikel 4 des Nato-Vertrags aus. In diesem Artikel 4 heißt es: »Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.«[1]
Sie können sich das Ganze wie in einer Nachbarschaft vorstellen. Ein Nachbar hört nachts verdächtige Geräusche aus einem der gegenüberliegenden Gärten. Er weiß aber nicht genau, woher sie kommen. Er macht das Flutlicht an und ruft die Anwohnenden zusammen. Ob da Einbrecher sind, wissen sie noch nicht, aber es kommen alle zusammen, beraten und entscheiden dann, was sie tun wollen. Bei Artikel 4 kann ein Mitgliedstaat die übrigen Nato-Staaten zu Gesprächen einberufen, wenn dieser sich bedroht fühlt oder seine Sicherheit gefährdet sieht. Als Nato-Mitglied ist Deutschland zwar anders betroffen als etwa Litauen mit einer gemeinsamen Grenze zu Belarus, hat sich aber durch den Nato-Vertrag zur Kooperation verpflichtet.
Angesicht der Truppenbewegungen in Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad fühlen sich vor allem Litauen, Estland, Lettland und Finnland in ihrer Sicherheit bedroht. Die drei baltischen Staaten und Finnland haben also in unserem Szenario eine gemeinsame Erklärung gegenüber dem Nato-Generalsekretär abgegeben, dass solche Gespräche stattfinden sollten. Daraufhin lädt der Nato-Generalsekretär kurzfristig zu einer Sitzung des Nordatlantikrats (North Atlantic Council, NAC) ein, dem alle 32 Mitgliedstaaten der Nato angehören. Eine solche Sitzung kann innerhalb weniger Stunden einberufen werden, im Zweifel noch am selben Tag. Dann diskutieren sämtliche Mitglieder im NAC die Lage. Im NAC wird jeder Staat von einem Ständigen Vertreter repräsentiert, der Botschafterrang hat. Der Nordatlantikrat kann ebenso auf höherer Ebene, also auf Ebene der Verteidigungs- und Außenminister oder der Staats- und Regierungschefs, zusammenkommen. Konsultationen bedeuten nicht automatisch, dass es einen gemeinsamen Beschluss oder einen Einsatzbefehl gibt. Es ist auch keine Kriegserklärung.
So haben in der Vergangenheit Polen und die baltischen Staaten Artikel 4 bereits angerufen, Polen zum Beispiel nach der Annexion der Krim 2014 oder die baltischen Staaten nach der russischen Vollinvasion 2022. Die Türkei hat Artikel 4 mehrfach aktiviert, etwa im Zusammenhang mit dem Irakkrieg oder dem Bürgerkrieg in Syrien, als türkische Soldaten durch einen Angriff aus Syrien getötet wurden.[2]
Die Konsultationen können zu politischen Maßnahmen, zu gemeinsamen Erklärungen oder Signalen (etwa zur Abschreckung), zu einer verstärkten Überwachung, Aufklärung oder Truppenverlegungen führen. Auch weitere Schritte, wie zum Beispiel ein Verfahren nach Nato-Artikel 5 (der Nato-Bündnisfall), sind denkbar.
In unserem Fall werden die Konsultationen dazu führen, dass man sich auf die Nato-Operation »Defend East« verständigt hat (siehe nächstes Kapitel). Rund 30000 Soldaten werden nach Polen, Litauen und Rumänien verlegt. Außerdem wird ein Manöver angesetzt, ein Test, um die Belastbarkeit der Infrastruktur zu überprüfen (mehr dazu im nächsten Kapitel).
Gemeinsame Manöver und Operationen außerhalb des Ernstfalls gab es bisher einige. »Air Defender 23« im Juni 2023 war zum Beispiel die größte Luftwaffenübung Europas seit Nato-Bestehen. Organisiert von Deutschland, nahmen 10000 Soldaten aus 25 Nationen und rund 250 Flugzeuge daran teil. Ziel war die schnelle Verlegung und Einsatzbereitschaft im europäischen Luftraum.[3]2024 fand mit »Steadfast Defender 2024« das größte Nato-Manöver seit dem Kalten Krieg mit rund 90000 Soldaten statt.[4] Als Teil dieses Großmanövers verlegte die Bundeswehr in der Übung »Quadriga« unter anderem eine Panzerdivision nach Litauen.[5] Im Herbst 2024 folgte »Northern Coasts« als multinationales Marine-Manöver unter deutscher Führung in der Ostsee.[6] Auch für den Cyber- und Informationsraum gibt es übrigens solche gemeinsamen Übungen, um die Zusammenarbeit und Verteidigungsfähigkeit der Nato-Staaten zu verbessern.
In unserem Szenario spitzt sich die Lage zu, es gibt aber keinen unmittelbaren Angriff auf Deutschland – und ein solcher steht auch nicht unmittelbar bevor. Als Vorstufe zum Verteidigungsfall sieht die Verfassung den Spannungsfall vor (Artikel 80a Grundgesetz, GG). Dieser fußt auf der Überlegung, dass bestimmte Maßnahmen und Vorbereitungen erforderlich sind, um die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands noch vor dem Verteidigungsfall zu erhöhen.
Der Spannungsfall ist Teil der Notstandsverfassung des Grundgesetzes. Denn für besonders außergewöhnliche Lagen gibt es die Notstandsregelungen. Der Sicherheitsschalter im Maschinenraum der Demokratie: Man darf ihn nur im Ernstfall umlegen. Ist der aber gegeben, soll er dabei helfen, Schaden vom Ganzen abzuwenden, wenn nichts anderes mehr hilft. In unserer Verfassung sind vier Zustände des »äußeren Notstands«[7] geregelt, die die Notstandsverfassung bilden: der Verteidigungsfall (Artikel 115a GG), der Spannungsfall, der Zustimmungsfall und der Bündnisfall (jeweils verankert in Artikel 80a GG). Die Ausnahmezustände ermöglichen es dem Staat, in Krisen- oder Katastrophenlagen mit besonderen Befugnissen zu handeln, ohne unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aufzugeben. Ergänzt werden diese durch die Notstandsgesetze.
Deutschland hat bislang nie vollständig vom verfassungsrechtlich geregelten Notstandsrecht Gebrauch gemacht, insbesondere nicht von den Artikeln 115a ff. GG über den Verteidigungsfall. Auch der Spannungsfall wurde noch nie offiziell festgestellt. Das liegt einerseits an der grundsätzlichen politischen Zurückhaltung im Umgang mit Notstandsmaßnahmen, andererseits daran, dass es seit Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 keine Situation gab, die diese Maßnahmen in vollem Umfang notwendig gemacht hätte. Selbst während der Coronapandemie wurde nicht das verfassungsrechtliche Notstandsrecht aktiviert. Stattdessen griff man auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) zurück, das keine Notstandsregelung im Sinne des Grundgesetzes ist, sondern ein einfaches Bundesgesetz. Es ermöglichte weitreichende Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschließungen oder Versammlungsverbote.
Trotz der weitreichenden Befugnisse, die der Staat im Notstand erhält, sind zentrale verfassungsrechtliche Prinzipien davon unberührt. Die Menschenwürde (Artikel 1GG) bleibt zum Beispiel unantastbar und darf unter keinen Umständen verletzt werden. Wie zur Coronazeit sind Gerichte handlungs- und entscheidungsfähig und kontrollieren staatliches Handeln.
Deutschland ruft also den Spannungsfall aus. Mit dessen Feststellung werden die Notstandsgesetze in Deutschland aktiviert. Hierzu zählen zahlreiche bundesrechtliche Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze. Sie liegen vorbereitet in der Schublade für den Fall der Fälle. Deshalb werden sie Schubladengesetze genannt. Solange sie nicht aktiviert wurden, entfalten sie noch keine Wirkung, und keiner kann auf sie zugreifen. Wir merken also nicht, dass sie eigentlich die ganze Zeit fertig in den Schubladen der Regierung liegen.
Die Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze sollen im Wesentlichen der Vorbereitung und Aufrechterhaltung der staatlichen Handlungsfähigkeit und der Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- oder Verteidigungsfall dienen. Sie regeln, wie der Staat auf Ressourcen, Infrastruktur und Personal zugreifen kann – sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Sie sind wie Werkzeuge in einem normalerweise gut abgeschlossenen Werkzeugkasten. Wird der Werkzeugkasten aufgeschlossen, liegen dort verschiedene Werkzeuge, mit denen der Staat die Versorgung der Bevölkerung und zentrale Bereiche der Wirtschaft sicherstellen kann. Dazu gehören etwa Vorrangregelungen: Betriebe können verpflichtet werden, zuerst für lebenswichtige Bereiche wie Gesundheit, Ernährung oder Energie zu produzieren, bevor sie anderen Aufträgen nachgehen. Ebenso kann der Staat Unternehmen anweisen, bestimmte Vorräte zu halten oder im Notfall bestimmte Leistungen zu erbringen.
Ein weiteres Werkzeug ist die Möglichkeit, den Verkehr zu steuern – etwa durch das Freihalten von Transportwegen für Hilfsgüter oder durch Einschränkungen im Individualverkehr, wenn Straßen für Einsatz- oder Rettungskräfte gebraucht werden (siehe Kapitel IV). Auch der Zugriff auf Lagerbestände, Rohstoffe oder technische Infrastruktur ist möglich, allerdings nur gegen Entschädigung und auf gesetzlicher Grundlage. In besonders schweren Fällen kann der Staat sogar Menschen verpflichten, in systemrelevanten Bereichen mitzuarbeiten, etwa in der Logistik, der medizinischen Versorgung oder der Energieversorgung. Viele der Maßnahmen sind gesetzlich geregelt. Sie dürfen nur unter klar definierten Bedingungen angewendet werden, nicht willkürlich.
Wer einen Blick hineinwerfen sollte, bitte nicht erschrecken. Die Texte wurden vor allem während des Kalten Krieges verfasst, um auf einen möglichen Verteidigungsfall vorbereitet zu sein. Das kann man an einigen Formulierungen auch schnell erkennen. Seitdem wurden sie nur vereinzelt angepasst, und da stellt sich berechtigterweise die Frage, ob diese nicht neu verfasst werden sollten. Für Aspekte wie die Verkehrsregelung sind sie noch halbwegs tragfähig, doch denken wir bloß an das Internet, die Digitalisierung, an die Privatisierung von Bahn, Post oder vieler Krankenhäuser oder den Wandel von klassischen zu hybriden Bedrohungen (etwa durch Desinformation oder Cyberangriffe) – das alles sind Veränderungen, die in der derzeitigen Form nicht berücksichtigt sind. Auch ging man bei der Schaffung der meisten Gesetze davon aus, dass Deutschland ein Frontstaat ist, weil die innerdeutsche Grenze eine mögliche Frontlinie darstellte. Das ist heute im Rahmen des Nato-Bündnisses nicht mehr der Fall. Durch die Nato-Osterweiterung und den Beitritt von Ländern wie Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die baltischen Staaten liegt Deutschland in der Mitte des europäischen Nato-Gebiets.
Die internationale Verflechtung der Wirtschaft ist ebenfalls in den heutigen Gesetzen kaum abgebildet. Viele Regelungen basieren auf der Vorstellung nationaler Produktionskapazitäten und einer Vorratshaltung, während heutige Lieferketten global, komplex und anfällig für Störungen sind. Eine Anpassung wäre notwendig, um im Ausland liegende Produktions- oder Lieferverträge rechtlich besser absichern und strategisch steuern zu können. Die Gesetze müssen weitestgehend aktualisiert und angepasst werden. Es braucht aber dringend auch Regelungen, die wir bereits heute zur Vorsorge und Vorbereitung anwenden können und nicht erst im Spannungsfall.
Was sind die wichtigsten Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze? Da gibt unter anderem das Wirtschaftssicherstellungsgesetz (WiSiG)[8], das Ernährungsvorsorgegesetz (ESVG)[9], das Verkehrsleistungsgesetz (VerkLG)[10], das Verkehrssicherstellungsgesetz (VerkSiG)[11], das Energiesicherungsgesetz (EnSiG)[12], das Bundesleistungsgesetz (BLG)[13], das Arbeitssicherstellungsgesetz (ASG)[14] und das Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)[15]. Eine ganze Menge an Möglichkeiten, Sonderregelungen für den Krisenfall zu treffen (auf einige gehen wir noch genauer ein).
Gesamtverteidigung heißt militärisch und zivil
Der Spannungsfall ist wie das Gelb vor dem Rot an der Ampel – ein deutliches Warnsignal: Noch ist nichts passiert, aber der Staat muss sich jetzt vorbereiten – mit klaren Regeln, abgestimmten Maßnahmen und unter parlamentarischer Kontrolle.
Theoretisch könnten entweder das Parlament oder die Bundesregierung die Initiative ergreifen und sagen, wir empfinden die Sicherheitslage als derart angespannt und gehen davon aus, dass bald ein Angriff auf Deutschland droht, deshalb möchten wir den Spannungsfall aktivieren. Einen Antrag auf Ausrufung können entweder fünf Mitglieder des Bundestags, eine Bundestagsfraktion oder die Bundesregierung stellen.[16] Dieser muss dann mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen im Bundestag verabschiedet werden – und der Spannungsfall ist aktiviert. Der Bundesrat, also die Vertretung der Länder, muss nicht mitwirken. »So ein Spannungsfall kann in bestimmten Fällen auch verfassungsrechtlich unbedenklich für ein halbes Jahr andauern«, erklärt Michael Brenner, Professor für Verfassungsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Es muss sich bei einem Spannungsfall letztlich um eine »schwere außenpolitische Konfliktsituation« mit »erhöhten internationalen Spannungen« handeln, die eine gesteigerte Verteidigungsbereitschaft Deutschlands erfordert. Zugleich muss ein Angriff auf das Bundesgebiet Deutschlands drohen. Das können Truppenbewegungen an den Grenzen sein, eine massive Bedrohung durch einen Gegner im Ausland oder eine politisch instabile Lage, die schnell eskalieren könnte.
Wurde der Spannungsfall ausgerufen, werden die Notstandsgesetze aktiviert. Das ist der gut abgeschlossene Werkzeugkasten, der nur im absoluten Ausnahmefall geöffnet wird. Die Werkzeuge darin sorgen dafür, dass der Staat funktioniert, schützt und handlungsfähig bleibt, ohne aus der Verfassung auszubrechen. Das gilt übrigens und erst recht für den Verteidigungsfall. Im Friedensfall bleibt der Werkzeugkasten verschlossen. Ist der Kasten auf und werden Maßnahmen ergriffen, kann der Bundestag aber jederzeit die Aufhebung von Maßnahmen verlangen und kontrolliert somit, was da in der Krise alles beschlossen wird (Artikel 80a Absatz 2GG).
Dann gibt es auch noch den Zustimmungsfall. Er ist eine leise Vorbereitung auf den Ernstfall, angepasst an die konkrete Lage. Der Zustimmungsfall erlaubt es dem Bundestag, in außenpolitischen Krisen einzelne Notstandsmaßnahmen freizugeben, selbst wenn noch kein Spannungsfall festgestellt wurde. Er ist eine abgestufte Vorwarnstufe: Statt alle Notstandsregeln auf einmal zu aktivieren, kann das Parlament gezielt das in der konkreten Situation jeweils erforderliche Notstandsrecht freigeben und verhältnismäßig reagieren – etwa durch das Einberufen von Reservisten oder das Anordnen von Vorratshaltung. Für die Zustimmung reicht meist die einfache Mehrheit im Bundestag, der Bundesrat ist nicht beteiligt.
Und noch mal in aller Kürze: Freigabe aller Notstandsregelungen mit parlamentarischer Zweidrittelmehrheit im Spannungsfall; Freigabe einzelner Regelungen mit einfacher Mehrheit im Zustimmungsfall.
Letzterer Fall liegt in unserem Szenario nicht vor. Die Lage ist deutlich gravierender, und man hat bewusst auf die leise Variante verzichtet. Schließlich braucht man vermutlich mehr Maßnahmen. Und zugleich muss man der Bevölkerung signalisieren, dass die Lage ernst ist.
Denn es geht jetzt um die Gesamtverteidigung. Gemeint ist damit etwas eigentlich sehr Einfaches: Gerät der Staat in eine ernste Krise – sei es durch Krieg, Terror, Sabotage oder eine Naturkatastrophe –, dann müssen alle an einem Strang ziehen, Staat und Verwaltung, Wirtschaft, Medien und die Gesellschaft, also wir Bürgerinnen und Bürger.
Gesamtverteidigung bedeutet somit die abgestimmte und umfassende Vorbereitung auf Krisen oder Bedrohungen, bei der nicht nur das Militär, sondern alle staatlichen und gesellschaftlichen Ressourcen mobilisiert werden. Sie umfasst sowohl die militärische Abwehr eines Angriffs als auch den Schutz der Bevölkerung, die Sicherstellung der Grundversorgung (Strom, Wasser, medizinische Versorgung) und die Aufrechterhaltung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. Es geht also nicht nur um Panzer, Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste, sondern ebenso um Stromnetzbetreiber, Journalisten, IT-Expertinnen, Pflegekräfte oder Supermarktleiterinnen. Kurzum: Es geht um das Zusammenwirken aller in der Gesellschaft, damit der Staat selbst unter Extrembedingungen funktionsfähig bleibt. Das haben wir ja in bestimmten Formen während der Pandemie erlebt.
Die Gesamtverteidigung stützt sich auf verschiedene Grundlagen. Zuallererst ist sie im Grundgesetz, insbesondere in den Artikeln 80a und 115a zum Spannungs-, Bündnis- und Verteidigungsfall, angelegt. Eine wesentliche Aufgabe des Staats ist die Verteidigung des Bundesgebiets gegen Angriffe von außen und der Schutz der Bevölkerung. Auch deshalb steht die Verteidigung im Grundgesetz. Zur Verteidigung gehören die militärische und die zivile Verteidigung. Sie bilden die beiden Säulen.
Beide Säulen haben, je nachdem, ob Deutschland sich im Friedens-, im Spannungs- oder im Verteidigungsfall befindet, unterschiedliche Aufgaben. Was die einzelnen Fälle unterscheidet, wie diese zustande kommen beziehungsweise was die Voraussetzungen hierfür sind, darauf werden wir noch näher eingehen. Doch erst einmal ein ausführlicherer Blick auf die zwei Pfeiler der Gesamtverteidigung.
Was ist militärische Verteidigung?
Die Gesamtverteidigung kann man sich als einen menschlichen Körper vorstellen, wobei die militärische Verteidigung der Panzer und das äußere Schild darstellen, die Angriffe gegen den Körper von außen abwehrt. Wird Deutschland unmittelbar mit einem bewaffneten Angriff konfrontiert, hat die Bundeswehr den klaren Auftrag der nationalen territorialen Verteidigung. Ihre Aufgabe ist die Abwehr feindlicher Streitkräfte. Das steht auch so in Artikel 87a Grundgesetz. Ziel ist es, die territoriale Integrität Deutschlands zu verteidigen, strategisch wichtige Räume zu sichern und die staatliche Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Seit der vom damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 2022 konstatierten »Zeitenwende« steht die Bundeswehr deutlich stärker im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Bedrohungslage hat sich verändert. Nach Jahren des Sparens und Reduzierens soll sie nun wieder für die Landes- und Bündnisverteidigung bereit sein. Das beschreibt die Bundeswehr in ihrer »Konzeption der Bundeswehr« (KdB), in der die Landes- und Bündnisverteidigung nach vielen Jahren des Fokus auf Auslandseinsätze wieder betont wird.[17] Sie ist »das Dachdokument der Gesamtkonzeption der militärischen Verteidigung Deutschlands«.[18] Daran anknüpfend hat das Bundesministerium der Verteidigung 2023 die Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) veröffentlicht.[19] Die Richtlinien geben die strategischen Prioritäten der Verteidigungspolitik vor.
Im Friedens- und teilweise im Spannungsfall hingegen sehen die Aufgaben der militärischen Seite etwas anders aus. Im Friedensfall bereitet sich die Bundeswehr darauf vor, dass sie zur Verteidigung eingreifen muss. Sie erhält die Verteidigungsfähigkeit aufrecht. Dazu zählen insbesondere die Ausbildung und Übung der Streitkräfte, die Modernisierung von Ausrüstung und Strukturen sowie die strategische Lagebeobachtung und Frühwarnung. Indem sich die Bundeswehr aktiv in die Strukturen und Einsätze der Nato einbringt, trägt sie zur Abschreckung potenzieller Gegner bei. Das Ziel ist, glaubhaft deutlich zu machen, dass ein Angriff auf Deutschland oder seine Nato-Bündnispartner mit erheblichen Kosten und Risiken verbunden wäre und daher aussichtslos ist. Durch ihre Einsatzbereitschaft, moderne Ausrüstung und regelmäßige Übungen signalisiert sie potenziellen Gegnern die Fähigkeit und den Willen zur Verteidigung. Besonders im Rahmen der Nato leistet die Bundeswehr mit Beiträgen zur schnellen Eingreiftruppe, der Präsenz in Litauen sowie Luftsicherungsmissionen im Baltikum einen wichtigen Beitrag zur kollektiven Abschreckung.
Auch im Cyber- und Informationsraum zeigt sie mit spezialisierten Einheiten, dass sie auf hybride Angriffe reagieren kann. Nicht zuletzt stärkt die Bundeswehr durch die zivil-militärische Zusammenarbeit die gesellschaftliche Resilienz – ein entscheidender Faktor, um Angriffe auf Staat und Gesellschaft unattraktiv zu machen. Im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit erfüllt sie Hilfeleistungen (die sogenannte Amtshilfe) und Heimatschutzaufgaben. Im Bereich der Amtshilfe wird sie regelmäßig bei der Bewältigung von Katastrophen und in Krisenfällen aktiv. Ein Beispiel ist die Hochwasserhilfe im Jahr 2021, als sie nach den verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit Soldaten und Ausrüstung unterstützte. Sie half beim Sandsackaufbau, der Evakuierung von betroffenen Gebieten und der Bereitstellung von Hilfsgütern. Und während der COVID-19-Pandemie stellte sie medizinisches Personal zur Verfügung, half bei der Einrichtung von Impfzentren und transportierte medizinische Ausrüstung, um die zivilen Gesundheitsbehörden zu entlasten.
Heimatschutzaufgaben der Bundeswehr umfassen dabei Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, der Infrastruktur und des Staatsgebiets im Inland. Dazu gehören unter anderem der Objektschutz, die Unterstützung bei Naturkatastrophen oder Großschadenslagen sowie die Sicherung kritischer Infrastrukturen. Diese Aufgaben werden häufig in Zusammenarbeit mit zivilen Behörden erfüllt. So unterstützte sie beispielsweise beim G7-Gipfel 2022 in Bayern oder bei der Fußballeuropameisterschaft 2024 die Sicherheitsbehörden bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit von Delegationen und Besucherinnen und Besuchern. Hierfür wurde im April 2025 die Heimatschutzdivision mit rund 6000 Soldatinnen und Soldaten aufgestellt. Sie setzt sich aus einer Kombination von aktiven Soldatinnen und Soldaten sowie Reservistinnen und Reservisten zusammen und ist ausschließlich auf deutschem Staatsgebiet tätig. Die Division fasst alle Heimatschutzkräfte der Bundeswehr unter eine einheitliche Führung. Dadurch gewährleistet sie eine gezielte Ausbildung, eine effizientere Einsatzkoordination und eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit. So entsteht eine strukturierte, flexibel einsetzbare Truppe, die insbesondere auf den Schutz des Heimatgebiets ausgerichtet ist.
Im Spannungsfall übernehmen militärische Kräfte erweiterte Aufgaben. Im Vordergrund steht dann die Erhöhung der Einsatzbereitschaft und gegebenenfalls die Mobilmachung zusätzlicher Kräfte, einschließlich der Reservisten. Die Streitkräfte verstärken den Schutz verteidigungsrelevanter und kritischer Infrastrukturen, sichern Verkehrs- und Kommunikationswege und intensivieren ihre Zusammenarbeit mit zivilen Behörden, insbesondere bei der Gefahrenabwehr und im Objektschutz. Gleichzeitig tritt die Bundeswehr verstärkt in die operative Bündniskoordination mit Nato-Partnern ein, etwa durch Truppenverlegungen oder multinationale Planungen zur Abschreckung. Ziel ist es, durch glaubhafte Verteidigungsbereitschaft und koordinierte Maßnahmen gegenüber potenziellen Gegnern klarzumachen, dass ein Angriff auf Deutschland oder seine Bündnispartner erhebliche Konsequenzen hätte.
Das Operative Führungskommando der Bundeswehr ist im Rahmen der Gesamtverteidigung für die militärische Führung im Inland verantwortlich. Zugleich ist es die zentrale Schnittstelle zwischen militärischer und ziviler Verteidigung. Es koordiniert Einsätze, unterstützt zivile Einrichtungen und stellt die Zusammenarbeit mit Behörden sicher. Zudem organisiert es die logistische Unterstützung verbündeter Streitkräfte (Host Nation Support) und übernimmt im Verteidigungs- oder Krisenfall die operative Führung auf deutschem Staatsgebiet.
Die Bundeswehr ist derzeit nicht ausreichend für die militärische Verteidigung aufgestellt. Auch Jahre nach der Krim-Annexion und dem russischen Großangriff auf die Ukraine fehlt es an Einsatzfähigkeit. Rund 20000 Soldaten fehlen, die Reserve ist zum Teil nicht erfasst und nicht im vorgesehenen Umfang ausgebildet. Großverbände sind nicht kaltstartfähig, das Heer ist nicht ausreichend digitalisiert, Munition, Flugabwehr und weitreichende Waffen sind ungenügend vorhanden. Ballistische Raketen, Hyperschallwaffen und bewaffnete Drohnen fehlen. Mittel zur Drohnenabwehr und zu einer elektronischen Kriegsführung sind kaum vorhanden. Logistisch ist die Bundeswehr eingeschränkt verlegefähig – unter anderem durch Abgaben an die Ukraine. Notwendig sind eine schnelle Vollausstattung, eine digitale Führungsfähigkeit, eigene Drohnen- und Raketenkompetenzen sowie eine deutlich stärkere Logistik. Entscheidend ist eine tiefgreifende Reform des Beschaffungswesens: weniger Bürokratie, schnellere Verfahren, strategische Planung.
Was ist zivile Verteidigung?
Wenn wir beim Bild des Körpers bleiben, ist die zivile Verteidigung so etwas wie das Immunsystem. Versucht ein Virus oder versuchen Bakterien den Körper lahmzulegen, sorgt sie dafür, dass er nicht völlig zusammenbricht. Sie wehrt weitere Gefahren ab, repariert und kümmert sich darum, dass der Körper noch arbeiten kann. Genauso verläuft auch die zivile Verteidigung in einem Land: Sie erkennt die Gefahren für die Bevölkerung, organisiert die Abwehrreaktion über Sirenen, Notfallpläne und Evakuierungsstrategien. Sie will garantieren, dass Deutschland, die Krankenhäuser, die Versorgung mit Strom und Wasser oder die Verwaltung weiter funktionieren. Die »Konzeption Zivile Verteidigung« (KZV) aus dem Jahr 2016 beschreibt, was alles zur zivilen Verteidigung gehört.[20] Viele dieser Strukturen wurden in den Jahrzehnten nach dem Kalten Krieg stark zurückgebaut. Sirenen wurden abgeschaltet, Notunterkünfte umfunktioniert, Vorräte aufgelöst. Erst die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 und der Beginn des Ukrainekriegs 2022 führten dazu, dass dieser Bedarf wieder ermittelt wird.
Im Friedensfall konzentriert sich die zivile Seite vor allem auf Vorsorge, Planung und den Aufbau von Resilienz. Das bedeutet, dass Behörden auf Bundes- und Landesebene Krisenpläne erarbeiten, Lagezentren technisch und personell ausstatten und regelmäßig Übungen durchführen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. So trainieren etwa Landratsämter gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei und dem Technischen Hilfswerk (THW) regelmäßig Szenarien wie großflächige Stromausfälle oder Evakuierungen. Betreiber kritischer Infrastrukturen – Stromnetzbetreiber, Wasserwerke oder große Logistikunternehmen – sind gesetzlich verpflichtet, Sicherheits- und Notfallkonzepte zu erstellen, die auch im Fall einer krisenhaften Zuspitzung den Weiterbetrieb ermöglichen sollen. Im IT-Bereich sorgt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durch Beratung, Unterstützung und im Rahmen seiner gesetzlich festgelegten Kompetenzen dafür, dass Cyberangriffe abgewehrt und Systeme geschützt werden können.





























