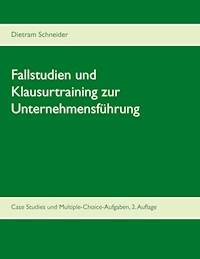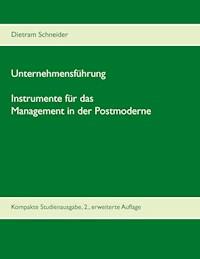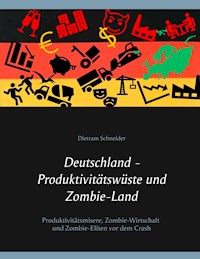
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sinkendes Wachstum, stagnierende Produktivität und steigende Zombifizierung prägen Deutschland. Das Buch zeigt u. a. auf der Basis von Verdoorn-Kurven, wie sich die Produktivitäts- und damit die Wettbewerbsposition Deutschlands sowohl im Zeitvergleich als auch im Vergleich mit den EU-Mitgliedstaaten immer weiter verschlechtert hat. Gleichzeitig bildete sich eine Kaskade an Zombies heraus: Sie reicht von Zombie-Unternehmen, -Belegschaften und -Haushalten bis zu Zombie-Eliten und ihren Nachahmern. Sie setzen alte ökonomische Gesetzmäßigkeiten und bürgerliche Tugenden außer Kraft. Die Eliten sind gefangen im Würgegriff der selbst produzierten Widersprüche und der postmodernen UFO-Falle: Unsicherheit (U), Fäulnis von Institutionen (F) und Opportunismus (O) machen sich breit. Dies entzieht Deutschland die Kraft und die Fähigkeit, die zukünftigen Herausforderungen aus einer Position der Stärke heraus anzugehen. Das Gespenst eines Crashs geht um. Der Verlust der Zukunft wird provoziert. Erstmals in der Nachkriegsepoche könnte es den Kindern schlechter als den Eltern gehen. Nicht die verheißungsvolle Zukunft, sondern die bessere Vergangenheit entwickelt sich damit zum Hoffnungsraum. Rückwärtsgewandte und vergangenheitsverklärte Retrotopia könnte gegenüber Utopia obsiegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriftenreihe des Kompetenzzentrums für Unternehmensentwicklung und -beratung, KUBE e.V.
Bisher erschienene Werke:
Hauke, W.; Opitz, O. (2003): Mathematische Unternehmensplanung, 2. Auflage
Boes, S. (2004): Die Anwendung der Konzepte probabilistischer Bevölkerungsmodelle auf Prognosen für den Hochschulbereich
Pflaumer, P. (2004): Klausurtraining Deskriptive Statistik
Pflaumer, P. (2005): Klausurtraining Finanzmathematik
Schneider, D.; Amann, M. (2005): Benchmarking von Beratungsgesellschaften mit Success Resource Deployment – ein empirischer Vergleich von Accenture über BCG bis McKinsey aus Kundensicht
Hagenloch, T. (2007): Value Based Management und Discounted Cash Flow-Ansätze. Eine verfahrens- und aufgabenorientierte Einführung
Rauch, K. (2007): Steuern in der Sozialwirtschaft – Steuern und Gemeinnützigkeit
Hagenloch, T. (2009): Grundzüge der Entscheidungslehre
Kummer, S. (2009): SWOT-gestützte Analyse des Konzepts der Corporate Social Responsibility – Die soziale und ökologische Verantwortung der Unternehmen
Söhnchen, W. (2010): Operatives Controlling. Grundlagen und Instrumente
Hagenloch, T. (2010): Die Seminar- und Bachelorarbeit im Studium der Wirtschaftswissenschaften – Ein kompakter Ratgeber
Henning, S. (2013): Kosten und Leistungsrechnung, Grundlagen und praxisorientierte Anwendungsbeispiele aus der Betriebs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Bd. I: Betriebliches Rechnungswesen und klassische Kosten-/Leistungsrechnung
Hänle, M.; Schneider, D. (2014): Raum- und Immobilienmanagement – Fallstudien und Klausurtraining
Schneider, D. (2016): Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre – kompaktes Basiswissen, 2. Auflage
Schneider, D. (2016): Klausurtraining Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 3. Auflage
Henning, S. (2017): Aufgaben zur Kosten- und Leistungsrechnung
Hagenloch, T.; Söhnchen, W. (2017): Strategisches Controlling und Kostenmanagement
Hagenloch, T. (2018) Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Theoretische Grundlagen, Rechnungswesen und Managementlehre, 2. Auflage
Schneider, D. (2018): Theoretische Grundlagen und Ansätze der Betriebswirtschaftslehre – Von Basiskonzepten über Theorieansätze zum neoklassischen Abgrund
Schneider, D. (2019): Unternehmensführung – Instrumente für das Management in der Postmoderne, Kompakte Studienausgabe, 3. Auflage
Schneider, D. (2019): Fallstudien- und Klausurtraining zur Unternehmensführung – Case Studies und Multiple-Choice-Aufgaben für Manager, Controller und Berater, 3. Auflage
Schneider, D. (2020): Deutschland – Produktivitätswüste und Zombie-Land. Produktivitätsmisere, Zombie-Wirtschaft und Zombie-Eliten vor dem Crash
Schneider, T. (2020): Erosion von Institutionen in darwinistisch-opportunistischen Zeiten – Kritische Rekonstruktion des Darwiportunismus in der postmodernen Arbeitswelt (erscheint demnächst)
Vorwort
Seit Jahren beobachten wir die Entwicklung der Produktivität. Nach zahlreichen Produktivitätsstudien für Unternehmen und Branchen haben wir in jüngerer Zeit den Blick auf die Produktivitätsentwicklung auf volkswirtschaftlicher Ebene gerichtet. Dies geschah vor allem auf der Basis von methodischen Überlegungen und empirischen Studien des niederländischen Ökonomen Petrus Johannes Verdoorn (1911 - 1982). Die Anwendung der so genannten Verdoorn-Kurven auf der Grundlage empirischer Längsschnittanalysen zeigt für Deutschland eine prekäre Entwicklung – gerade auch im europäischen Vergleich. Ein klares Ergebnis ist, dass die Erreichung von Produktivitätsfortschritten eine Steigerung des Wachstums (beispielsweise gemessen am Bruttoinlandsprodukt) voraussetzt. Bleibt das Wachstum aus, so ist mit einer Stagnation oder gar mit einem Rückgang der Produktivität zu rechnen. In einem solchen Stadium ist Deutschland inzwischen längst angekommen.
Parallel dazu hat sich bis heute im Sog des „billigen Geldes“ ein nicht unerheblicher Anstieg so genannter Zombie-Unternehmen ergeben. Beide Entwicklungen – sinkende Produktivitätsraten und immer mehr Zombie-Unternehmen – sind nicht nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Sondern in Kombination führen sie zu einer sich gegenseitig stimulierenden Abwärtsspirale. In Zeiten sinkenden Wachstums und nachlassender Produktivitätsraten soll eine expansive Geldpolitik als Gegenmittel fungieren. Sie produziert aber als Begleiterscheinung eine Zombifizierung der Wirtschaft und letztlich der gesamten Gesellschaft. Mit der lockeren Geldpolitik und den Zombies entstehen außerdem ihrerseits negative Ausstrahlungseffekte auf Wachstum und Produktivität, die einen Crash provozieren.
Die Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen, vor denen Deutschland – aber auch Europa – steht, wäre unter günstigen Wachstums- und Produktivitätsbedingungen ambitioniert genug. Der Umbau der Automobilindustrie, die Restrukturierung und materielle Verbesserung der Ausstattung der Bundeswehr, die Behebung der infrastrukturellen Mängel, die Einhaltung der Klimaziele bis 2030, die weitere Umstellung auf erneuerbare Energien, die Integration von Flüchtlingen und Asylanten, die Aufrechterhaltung der sozialen Sicherungssysteme u. a. vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der Zuwanderung usw. treffen jedoch derzeit auf rezessive Erscheinungen mit ihren destruktiven Wirkungen für die Produktivität.
Überdies setzt die Zombifizierung seit geraumer Zeit ökonomische wie gesellschaftliche Regeln außer Kraft. Eine Zombie-Pandemie, die nicht nur Staaten, Banken und Unternehmen, sondern auch Belegschaften und (private) Haushalte ergriffen hat und das Produktivitätsniveau zusätzlich gefährdet, scheint sich unaufhaltbar ihren Weg zu bahnen. In weiten Teilen der Bevölkerung geht die Angst vor einem bevorstehenden Crash um. Die Verantwortlichen, die so genannten Eliten, sind gefangen in den postmodernen Widersprüchen und wirken weitgehend hilf- und kraftlos, um eine positive Zukunftsvision zu entwickeln. Damit steht Deutschland in der Gefahr, die Zukunft zu verlieren.
Januar 2020
Dietram Schneider
Inhaltsverzeichnis:
Deutschland – Produktivitätwüste und Zombie-Wirtschaft
– kritische Vorbemerkungen
Die Produktivität Deutschlands im Zeitvergleich und im Benchmarking mit EU-Ländern
– der anhaltende Niedergang der Produktivitätsentwicklung
Produktivität versus Wirtschaftlichkeit
– kurze basale Vorbemerkungen
Produktivitätsentwicklung Deutschlands im Zeitvergleich
– erste Signale für die schleichende Produktivitätsmisere
Produktivitätsentwicklung Deutschlands im Benchmarking mit den EU-Mitgliedstaaten
– der Aufstieg der Konkurrenten und der Abstieg Deutschlands
Deutschland im Würgegriff zwischen Wachstum und Produktivität
– im Fadenkreuz von Verdoorn
Deutschlands Verdoorn-Kurve und Pro-Bench-Reg-Marks
– die beklagenswerte Allianz aus Wachstums- und Produktivitätsmisere
Deutschlands Produktivität im Verdoorn-Benchmarking mit ausgewählten EU-Staaten
– keine Entwarnung, sondern zusätzliche Alarmsignale für die deutsche Produktivitätsmisere sowie den Aufstieg der Konkurrenten und den Abstieg Deutschlands
Deutschlands Produktivität im EU-Verdoorn-Benchmarking mit allen EU-Staaten
– von den singulären länderspezifischen Alarmsignalen zur europäischen Durchreiche nach unten
Vom Niedergang der Produktivitätsentwicklung in Deutschland zur Entstehung von Zombies
– oder umgekehrt: Wie die Zombie-Wirtschaft die Produktivitätsverwüstung befeuert
Erste kasuistische Versuche einer Ursachenforschung
– von der ökonomischen Oberfläche über Migration und Zombie-Unternehmen bis zu Zombie-Eliten
Zombie-Unternehmen
– Firmenpleiten auf Halde
Zombie-Exkurs
– vom Versagen der wettbewerblichen Selektion zur Fehlallokation von Ressourcen
Zombie-Belegschaften
– Arbeitslose im Wartestand
Zombie-Haushalte
– eine bedrohliche Zinsfütterung
Zombie-Eliten und ihr Nachwuchs
– ursächliches und flankierendes Versagen in Zeiten der Geldflut und von der Dekonstruktion der Vorbilder zum Zombie-Nachwuchs
Gefangen in der postmodernen UFO-Falle, der Verlust der Zukunft und die Untergrabung des deutschen Erfolgsmodells
Literatur
I Deutschland – Produktivitätswüste und Zombie-Wirtschaft
– kritische Vorbemerkungen
Wer in Anbetracht des aktuellen Produktivitätsniveaus in Deutschland von einer „Produktivitätswüste“ spricht, provoziert unweigerlich den Vorwurf einer maßlosen Übertreibung und Schwarzmalerei. „Es geht uns doch gut, wir sind ein reiches Land“, so der vielstimmige Chor, der sich dem kritischen Bild der Produktivitätswüste entgegenstemmt. Ohne die vielfältigen Untersuchungsergebnisse zur Situation und Entwicklung der Produktivität in Deutschland und im EU-Vergleich an dieser Stelle vorwegzunehmen, denen sich insbesondere das Kapitel II widmet, lässt sich ein derartiger Vorwurf mit einigen Hinweisen jedoch schon eingangs schnell entkräften:
Nimmt man für das Jahr 2018 den Durchschnitt über alle 28 EU-Länder mit einem Index von 100 als Maßgabe, so liegt Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Arbeitsstunde zwar bei rund 123. Allerdings darf bei einer solchen Betrachtung nicht vergessen werden, dass sich die EU-28-Länder aus immerhin 13 jüngeren Ländern (EU-Beitritte erst ab 2004) mit vormals planwirtschaftlicher Organisation und sozialistisch-kommunistischer Führung zusammensetzen. Ohne diese Länder läge der EU-Durchschnitt bei 118 Indexpunkten, also lediglich 5 Punkte schlechter. Von den 15 älteren EU-Mitgliedstaaten liegen immerhin sechs Länder (darunter Frankreich) besser und acht (darunter Portugal und Griechenland) schlechter als wir. Deutschland liegt also lediglich im Mittelfeld. Bezieht man das BIP auf die Erwerbstätigen, so liegen wir mit einem Wert von 104,8 zwar auch über dem EU-28-Durchschnitt von 100. Allerdings rutscht Deutschland dann um weitere vier Plätze nach hinten und landet nur noch auf dem elften Rang. Konzentriert man sich wiederum auf die 15 älteren EU-Länder, unterzieht Deutschland also einem sinnvollen und realistischen Vergleich, dann weisen diese Länder einen durchschnittlichen Produktivitätsindex von 119 auf. Deutschland hinkt dann dem Mittelfeld bereits 14 Indexpunkte hinterher! Und richtet man den Blick auf die Produktivitätszuwächse seit der letzten Finanzkrise, so sind über alle 28 EU-Mitgliedstaaten betrachtet nur acht schlechter, aber 19 (!) besser als Deutschland. Überdies liegen bei einer sehr wichtigen Produktivitätskennzahl, die wir noch eingehend behandeln (Kapitel II), nämlich der so genannten Basisproduktivität, inzwischen 25 Länder der EU vor Deutschland, das hier den drittletzten Platz einnimmt. Weil die erzielbaren Produktivitätsgewinne Deutschlands im Gegensatz zu fast allen EU-Staaten außerdem überdurchschnittlich stark vom Wachstum abhängen, während aktuell und zukünftig die Zeichen eher auf Stagnation und Rezession stehen, trüben sich die Aussichten für die Zukunft noch zusätzlich ein. Zusammen mit den vielen Einzelergebnissen in Kapitel II steht Deutschland also in der Gefahr, in der Europäischen Union nach unten durchgereicht zu werden.
Vor diesem hier nur rudimentär skizzierten Hintergrund ist daher der Vorwurf, von einer Produktivitätswüste zu sprechen, nur insofern berechtigt, weil er lediglich eine metaphorische Zustandsbeschreibung zum Ausdruck bringt. Besser wäre daher, man würde eine Verlaufsbeschreibung wählen, die außerdem die zukünftige Entwicklung einbezieht: wie wäre es daher mit „Produktivitätsverwüstung“?
Der kritische Blick auf die Produktivitätsentwicklung in Kapitel II offenbart einen sukzessiven Niedergang und lässt für die Zukunft wenig Hoffnung aufkeimen. Freilich stößt man auch in Wüsten immer wieder auf Oasen, in denen eine gedeihliche Entwicklung zu beobachten ist. Aber in Deutschland von einer prosperierenden Produktivitätsentwicklung zu sprechen, die uns auch für die Zukunft unsere Wettbewerbsfähigkeit, unseren Wohlstand und unsere aufgebauten Sozial-und Alterssicherungssysteme erhält, käme einer Fata Morgana gleich – eine gefährliche Wahrnehmungstäuschung, der wir unterlägen.
Wie Wüstenwanderer durch den lockeren Sand unter ihren Füßen kaum vom Fleck kommen, so tritt Deutschland bei der Produktivität auf der Stelle. Wir brauchen mindestens ein Wachstum von einem Prozent, um Produktivitätsfortschritte zu erreichen. Bleibt das Wachstum darunter, was angesichts der aktuellen Prognosen zu erwarten ist, so sind die Produktivitätsraten negativ und wir rutschen bei der Produktivität zurück (vgl. Kapitel II).
Hinzu kommt, dass Sand nicht nur unter unseren Füßen, sondern auch Sand – vielleicht sogar Kies und vereinzelt Felsbrocken – im Getriebe ist. Hiervon ist vor allem in Kapitel III die Rede, wenn es um die wuchernden Zombies geht. Dabei handelt es sich am Rand zum tödlichen Absturz taumelnde „Untote“, die nur deshalb unter den Lebenden ausharren können, weil sie durch das „billige Geld“ aufgrund der Niedrig- und Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) in Verbindung mit der Liquiditätsschwemme am Leben gehalten werden. Problematisch für eine fruchtbare Produktivitätsentwicklung entpuppt sich dabei u. a. der Umstand, dass gesunde Unternehmen sowohl auf den Absatzmärkten als auch auf den Beschaffungsmärkten in Konkurrenz mit den Zombie-Unternehmen treten müssen. Auf der Absatzseite rivalisieren sie um Kunden. Auf der Beschaffungsseite rivalisieren gesunde Unternehmen um finanzielle, materielle und vor allem um personelle Ressourcen, was sich angesichts des vielfach beklagten Fach- und Arbeitskräftemangels schon isoliert betrachtet als Hemmschuh für die Gewinnung von Produktivitätsfortschritten erweist. Auf beiden Märkten müssen gesunde Unternehmen wiederum die gegen die Konkurrenz von Zombie-Unternehmen beschafften finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen einsetzen, um gegen die Zombies zu bestehen. Würden Zombies liquidiert, würden gesunden Unternehmen auf der Beschaffungsseite weniger Ressourcen entzogen bzw. diese könnten sich aufgrund der geringeren Konkurrenz (preis-) günstiger mit Ressourcen versorgen, während sie auf den Absatzmärkten weniger Ressourcen einsetzen müssten, weil sich durch den Wegfall der Zombies eine verringerte Wettbewerbsintensität ergäbe. Da aber durch das billige Geld und die Liquiditätsflut der marktlich-wettbe-werbliche Selektionsmechanismus ebenso wie die Allokationsmechanismen für Ressourcen außer Kraft gesetzt werden, hängen die Zombies den gesunden Unternehmen für die Erzielung von Produktivitäts-und Wachstumsfortschritten wie schwere Mühlsteine um den Hals.
Zum Sand unter den Füßen und den Kieselsteinen im Getriebe gesellt sich vielfach auch noch Sand in den Augen. Billiges Geld und Liquiditätsschwemme sowie das Gerede von Helikoptergeld und dergleichen rücken die finanzwirtschaftliche Sphäre in den Vordergrund und trüben den Blick für die Realwirtschaft und für Produktivitätsfragen. Daneben wirken sie wie Beruhigungspillen und nähren die Illusion, dass sich die realwirtschaftlichen (Konjunktur- und Struktur-) Probleme sowie rezessive Erscheinungen mit Niedrigst- bis Negativzinsen und Finanzspritzen kompensieren ließen. Wie in der Wüste Verschollene, so scheinen die (finanz- und wirtschaftspolitischen) Eliten nicht nur Sand in den Augen zu haben, sondern auch noch ohne Kompass unterwegs zu sein. Sie stehen in der Gefahr, sich in den vielfältigen Widersprüchen der postmodernen Epoche, die sie selbst gezüchtet haben, zu verirren und sich immer mehr den Richtungsanweisungen der vielen Stakeholder zu unterwerfen. Für den kritischen Beobachter entsteht der Eindruck, dass die Zombie-Kaskade nicht nur Staaten, Banken, Unternehmen, Belegschaften und (private) Haushalte umfasst. Sondern die Zombifizierung reicht offensichtlich bis hinauf zu den Eliten und lässt einen Crash unausweichlich erscheinen (Kapitel III).
So analysiert und belegt das nachfolgende Kapitel II zunächst den Niedergang der Produktivitätsentwicklung aus verschiedenen Perspektiven. Wer sich die nicht immer leicht zu verdauende Kost partiell ersparen möchte, dem sei ein rudimentäres Überfliegen der zahlreichen Berechnungen und Abbildungen erlaubt.
Kapitel III widmet sich der Zombie-Wirtschaft und ihren Trägern. Ausgehend von Zombie-Unternehmen behandelt es die Zombie-Belegschaften und -Haushalte sowie die Zombie-Eliten in ihrer Eigenschaft als „Vorbilder“ für den Nachwuchs. Dabei wird sich die Zombie-Wirtschaft mit ihren Trägern als ein meist unterschätzter und subtil wirkender Antreiber und Begleiter der Produktivitätsmisere erweisen.
Kapitel IV beschreibt die Zombifizierung und die prekäre Produktivitätsentwicklung als eine zwangsläufige Konsequenz der so genannten UFO-Falle im Rahmen der postmodernen Epoche.
II Die Produktivität Deutschlands im Zeitvergleich und im Benchmarking mit EU-Ländern
– der anhaltende Niedergang der Produktivitätsentwicklung
In verschiedenen Studien haben wir uns in der Vergangenheit in unserem S&S*-Publi-Think-Tank und in Studien des Kompetenzzentrums für Unternehmensentwicklung und -beratung (KUBE e.V., Kempten/ Allgäu) mit der Entwicklung der Produktivität von einzelnen Unternehmen und ganzen Branchen befasst. Im Wirtschaftssektor der B2B-Dienstleistungen erfolgte dies u. a. in Kooperation mit dem europaweit agierenden Marktanalyse- und -forschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder (Mindelheim). Wir haben damit die Absicht verfolgt, der Praxis empirisches Material für das Benchmarking der Produktivität bereitzustellen und die praktische wie theoretische Diskussion anhand von Studien anzuregen.1
Die meisten dieser Untersuchungen und Studien bauten auf Überlegungen des niederländischen Ökonomen Petrus Johannes Verdoorn (1911 - 1982) auf. Die von ihm konzipierten und nach ihm benannten „Verdoorn-Kurven“ werden in diesem Kapitel noch ein wichtiges analytisches Instrumentarium für die Untersuchung der Produktivität bilden.
Ausgehend von derartigen unternehmens- und branchenorientierten Untersuchungen haben wir uns in jüngster Vergangenheit auf die Analyse der Produktivitätsentwicklung in unterschiedlichen Volkswirtschaften im EU-Raum konzentriert. Ein zentrales Ziel lag dabei darin, die Produktivitätsentwicklung Deutschlands mit den anderen EU-Ländern einem Benchmarking zu unterziehen.2 Dabei mussten wir feststellen, dass die Entwicklung der Produktivität in Deutschland weder Anlass für Freudenschreie, noch für optimistische Blicke in die Zukunft bietet. Vielmehr gibt sie Anlass dazu, dass sich auf der Stirn des Beobachters und besonders der verschiedenen Verantwortlichen – und hier sind in erster Linie die wirtschafts- und finanzpolitischen Eliten gemeint – tiefe Sorgenfalten verbreiten müssten.
Zu den Eliten und ihrer Verantwortung bzw. Verantwortungslosigkeit kommen wir allerdings erst im dritten Kapitel. Dieses zweite Kapitel geht der Entwicklung der Produktivität Deutschlands in verschiedenen Zeitvergleichen nach. Außerdem befasst es sich ausgiebig mit produktivitätsanalytischen Benchmarks, welche die Grundlagen für den Vergleich Deutschlands mit den anderen EU-Ländern bilden. Folgende inhaltliche Punkte stehen dabei in den nächsten sieben Abschnitten im Mittelpunkt:
In
Abschnitt 1
finden sich einige kurze und grundlegende Vorbemerkungen zur Produktivität und deren Beziehungen zur Wirtschaftlichkeit.
Der daran anschließende
Abschnitt 2
befasst sich mit der Produktivitätsentwicklung Deutschlands mittels einfacher Zeitvergleiche, wie sie für längsschnittorientierte Betrachtungen auf volkswirtschaftlicher Ebene typisch sind. Hier drängen sich bereits Hinweise für die Verschlechterung der Wachstums- und Produktivitätsentwicklung in Deutschland auf.
Danach widmen wir uns in
Abschnitt 3
einem ersten Vergleich des Produktivitätsgebarens Deutschlands mit den EU-Mitgliedstaaten. Auch die Ergebnisse dieses länderorientierten „Horizontalvergleichs“ fallen für Deutschland wenig erfreulich aus. Der dafür herangezogene Zeitabschnitt erstreckt sich bis vor die Zeit der einstigen Finanz- und Wachstumskrise mit ihren verschiedenen Verwerfungen und umfasst die letzten zwölf Jahre (2007 - 2018).
Bereits die bis
Abschnitt 3
offerierten Auswertungen des herangezogenen empirischen Materials zusammen mit den Ergebnissen der damit gespeisten und letztlich vereinfachten längs- und querschnittsbezogenen Vergleichsanalysen fallen für Deutschland insgesamt betrachtet alles andere als schmeichelhaft aus. Die anschließenden Untersuchungen auf der Basis der analytisch anspruchsvolleren Verdoorn-Kurven belegen diesen beklagenswerten Befund erneut und mit Nachdruck. So zeigt
Abschnitt 4
zunächst eine für Deutschland eher unkomfortable und sehr starke Beziehung zwischen Wachstumsveränderungen und der Entwicklung der Produktivität. Genau eine solche Beziehung stand auch in den empirisch fundierten Studien von Verdoorn im letzten Jahrhundert im Mittelpunkt.
Auf das analytische Instrumentarium von Verdoorn wird im anschließenden
Abschnitt 5
aufgebaut. In
Abschnitt 5
konstruieren wir die Verdoorn-Kurve für Deutschland. Das dafür mobilisierte empirische Material umfasst einen Zeitraum von fast 50 Jahren, von 1971 bis 2018. Außerdem bieten wir in
Abschnitt 5
mehrere Verdoorn-Kurven und verdoornspezifische Kennzahlen – so genannte „Pro-Bench-Reg-Marks“
3
– für vier verschiedene Zeitabschnitte innerhalb des Zeitraums dieser letzten nahezu 50 Jahre. Die Zerlegung in die einzelnen Zeitabschnitte offenbart den sukzessiven Niedergang der Produktivitätsentwicklung in Deutschland.
Nach diesen verdoornorientierten Zeitvergleichen unterzieht
Abschnitt 6
Deutschland einem querschnittsbezogenen Benchmarking mit ausgewählten älteren und neueren EU-Mitgliedstaaten. Auch dies geschieht anhand von Verdoorn-Kurven und „Pro-Bench-Reg-Marks“. Daraus ergeben sich einerseits punktuelle Alarmsignale für die deutsche Produktivitätsentwicklung. Andererseits zeigen sie den Aufstieg von Konkurrenten und den Abstieg Deutschlands.
Abschnitt 7
bietet ein zusammenfassendes EU-Verdoorn-Benchmarking. Ausgehend von den punktuellen Ländervergleichen in
Abschnitt 6
fließen hierfür nun für alle 28 EU-Staaten sieben „Pro-Bench-Reg-Marks“ sowie die Produktivitätsniveaus aller EU-Länder ein. Wer in
Abschnitt 6
noch glaubte, es handle sich lediglich um zufällige und punktuelle Alarmsignale, wird nun eines schonungslosen Besseren belehrt. Der Eindruck der beklagenswerten Produktivitätsentwicklung Deutschlands wird durch den Vergleich im EU-Gesamtmaßstab nochmals eindringlich bestätigt.
Mit Abschnitt 7 schließt dieses zweite Kapitel. Das zusammenfassende Fazit fällt deutlich negativ sowie für die Zukunft reichlich pessimistisch aus. Es ist unübersehbar, dass sich in Deutschland über viele Jahre hinweg eine nachhaltige Prekarisierung der Produktivitätsentwicklung den Weg gebahnt hat. Sie gipfelt inzwischen in einer Produktivitätsmisere mit allen damit verbundenen und ausgelösten Problemen. Sie reichen von der nachlassenden Standortattraktivität über die sinkende Wettbewerbsfähigkeit bis zur Gefährdung der Stabilität der sozialen Sicherungssysteme.
Neben diesem und hier schon rudimentär zusammengefassten Fazit beschäftigt sich das nachfolgende Kapitel III mit einer Ursachenforschung und stellt dabei die Zombifizierung von Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt des Interesses.
* Schneider & Schneider
1 Vgl. z. B. Schneider u. a. (2002), Schneider (2008), Lünendonk u. Schneider (2009), Schneider u. Demmler (2013).
2 Vgl. z. B. Schneider (2019), S. 99-112; Schneider T. (2019a).
3 Der Begriff „Pro-Bench-Reg-Marks“ bezieht sich auf eine unserer Studien, die diesen Untertitel trug und bei der wir ein Produktivitätsbenchmarking mit Regressionskurven vornahmen, das für die Anwendung von Verdoorn-Analysen typisch ist.
1 Produktivität versus Wirtschaftlichkeit
– kurze basale Vorbemerkungen
Folgt man ökonomischen Lehrbüchern, dann handelt es sich bei der Produktivität um eine mengenorientierte Betrachtung.4 Für die korrekte Bestimmung der Produktivität sind den Outputmengen die zugehörigen Inputmengen, die für die Erzielung des Outputs erforderlich waren, gegenüberzustellen. Stellt man den Verlauf dieses Verhältnisses über mehrere Zeitperioden hinweg dar, so ergibt sich die Produktivitätsrate von Periode zu Periode. Durch Bewertung der Output- und Inputmengen mit Geldeinheiten ergibt sich die Wirtschaftlichkeit. Im Gegensatz zur Produktivität bringt sie ein Wertverhältnis zum Ausdruck. Steigen (sinken) zum Beispiel die Werte bzw. Preise des Outputs, während die Werte bzw. Preise des Inputs konstant bleiben, so kann die Wirtschaftlichkeit trotz gleichbleibender Produktivität von Periode zu Periode steigen (sinken).
Über lange Zeitreihen hinweg sowie im Rahmen von Unternehmens-, Branchen- und Ländervergleichen fehlen häufig Mengenangaben. Oder sie sind oft nur lückenhaft vorhanden. Problematischer ist jedoch, dass aus Gründen der Vergleichbarkeit eine wertbezogene Out-putkumulierung über die vielfältigen Outputs (z. B. produzierte Autos, Kubikmeter Bauvolumina, Kilowattstunden an Strom und Gas, getätigte Abschlüsse von Versicherungsverträgen) nötig ist. Die Outputmengen können daher bei fehlenden Wertangaben nicht addiert werden. Daher sind in der Praxis für Zwecke von Produktivitätsbeurteilungen auf der Outputseite vor allem Wertangaben zu finden. Damit entsteht für Produktivitätsvergleiche genau betrachtet oft eine „pragmatische Mischvariante“ aus Wertangaben (im Zähler) und Mengenangaben (im Nenner) bzw. eine „Mischung“ aus Wirtschaftlichkeit und Produktivität. Eine derartige „Mischung“ ist sowohl bei zeitbezogenen firmeninternen als auch bei querschnittsbezogenen zwischenbetrieblichen Benchmarkingprojekten und Branchenvergleichen die Regel.
Ein typisches Substitut für eine derartige Produktivitätskennzahl ist der Umsatz pro Mitarbeiter. Allerdings führt sie meist zu fehlerhaften Schlüssen. Bei einer Reduktion der Fertigungstiefe bzw. Eigenerstellungsquote eines Unternehmens – wodurch aufgrund des Outsourcings das Beschaffungsvolumen steigt, während gleichzeitig weniger Personal für den gleichen Umsatz erforderlich wird – weist diese Kennzahl eine positive Veränderung auf. Diese ist jedoch lediglich auf die Verringerung der Fertigungstiefe zurückzuführen. Insofern ist die – in der Praxis eher seltenere – Kennzahl Wertschöpfung pro Mitarbeiter als „produktivitätsnäher“ und im Hinblick auf die Produktivität als aussagefähiger einzustufen. Vereinfacht ergibt sich die Wertschöpfung aus der Differenz zwischen dem Umsatz und den Vorleistungen, die Lieferanten erbringen. Diese Kennzahl ist daher von Fehlschlüssen hinsichtlich der Produktivitätssituation und -entwicklung aufgrund von Fertigungstiefenentscheidungen weitgehend befreit.
Die Beurteilung von Produktivitätsverhältnissen auf volkswirtschaftlicher Ebene basiert meist auf dem (realen) Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Erwerbstätigen oder pro Arbeitsstunde. Für Ländervergleiche wäre grundsätzlich ein Bezug auf die Arbeitsstunde aussagekräftiger, weil die unterschiedlichen länderspezifischen Teilzeitquoten berücksichtigt würden.5 Andererseits ist die Erfassung von Teilzeitquoten unter Beachtung verschiedener Teilzeitvolumina (z. B. fünf, zehn oder 20 Stunden pro Woche?) und deren Kumulierung äußerst schwierig. Daneben zeigt das empirische Material, dass das Bruttoinlandsprodukt in Anlehnung an die Erwerbstätigen mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde (die aufgrund der o. g. Probleme letztlich nur grob geschätzt werden kann) sehr stark korreliert (vgl. Abschnitt 2). Weil außerdem die Argumentation in Kapitel III auf die Anzahl der Erwerbstätigen abstellt, wird in den folgenden Ausführungen i.d.R. das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen herangezogen.6
4 Vgl. z. B. Wöhe u. Döring (2013), S. 38; Hagenloch (2018), S. 36-41; Schneider (2018), S. 41f.
5 Vgl. dazu z. B. Eurostat (2019a/b).
6 Vgl. dazu auch die jüngste Produktivitätsstudie von Gillmann u. a. (2019).
2 Produktivitätsentwicklung Deutschlands im Zeitvergleich
– erste Signale für die schleichende Produktivitätsmisere
Schon alleine den methodisch wenig anspruchsvollen Zeitvergleichen, die zum gängigen Repertoire von Produktivitätsanalysen gehören, sind klare Indizien für einen schrittweisen Niedergang der Produktivitätsentwicklung in Deutschland zu entnehmen. Bild 1 zeigt hierzu die jährlichen Veränderungsraten der Produktivität (reales BIP pro Erwerbstätigen) in einer Längsschnittbetrachtung von 1971 bis 2018.7
Bild 1: Jährliche Produktivitätsraten (Deutschland, 1971 - 2018)
Die mit den einzelnen Werten ermittelbaren gleitenden 10er-Durchschnittswerte sowie die damit zu bildende Trendlinie in Bild 2 machen den langfristigen Niedergang der Produktivitätsraten in den letzten knapp 50 Jahren bereits deutlich sichtbar. So weist die Trendlinie der Produktivitätsveränderungen eine klare negative Steigung auf.
Bild 2: Gleitende 10er-Durchschnitte der Produktivitätsraten (Deutschland, 1971 - 2018)
Eine weitere Aufspaltung des Gesamtzeitraums von fast 50 Jahren in vier einzelne separate Zeitabschnitte (T1, T2, T3 und T4) kommt für Deutschland zu ähnlichen ernüchternden Ergebnissen (Bild 3).
Bild 3: Entwicklung der Produktivitätsraten segmentiert in Zeitabschnitte (Deutschland, 1971 - 2018)
Die durchschnittliche Produktivitätssrate der einzelnen Zeitabschnitte sank von 2,2% in T1 über 1,9% in T2
4 Deutschland im Würgegriff zwischen Wachstum und Produktivität
–im Fadenkreuz von Verdoorn
Aus den umfangreichen und auf volkswirtschaftlicher Ebene betriebenen empirischen Analysen des niederländischen Ökonomen Petrus Johannes Verdoorn (1911-1982) ist bekannt, dass die Produktivitätsentwicklung eines Landes ganz wesentlich von der Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums (gemessen anhand des realen Bruttoinlandsprodukts) bestimmt wird.11
Diesen Zusammenhang konnten wir mit unseren zahlreichen empirischen Produktivitätsstudien für einzelne Unternehmen und Unternehmenscluster sowie in verschiedenen Branchen in gleicher Weise feststellen: beispielsweise in Pharma- und Dienstleistungsunternehmen, in der Automobil- und Beratungsbranche, in der Eisenbahnverkehrstechnik und in der Airlinebranche, bei Management- und IT-Beratungsunternehmen sowie in der Nahrungsmittelindustrie.12 Das Wachstum, das in Unternehmen zum Beispiel durch die Umsatz- und/oder Absatzveränderungen oder die Entwicklung der (eigenen) Wertschöpfung operationalisierbar ist, beeinflusst auch dort ganz wesentlich die Entwicklung der Produktivität (Arbeitsproduktivität).
Im praktischen Alltag kann man in Unternehmen die Erfahrung machen, dass in Zeiten der Unterauslastung Arbeit häufig einfach „geschoben“ wird. Sogar bei der Büroarbeit vernehmen unbedarfte Lehrlinge und Neuankömmlinge in Abteilungen oft den Rat älterer Kollegen, wonach immer etwas Arbeit (Schriftstücke, Tabellen usw.) auf dem Schreibtisch sein sollte, wodurch man bei Überraschungsbesuchen von Vorgesetzten Beschäftigung und Aktivität vorgeben (besser „heucheln“) könnte. Gleiches ist beobachtbar bei drohenden bzw. bevorstehenden Entlassungswellen: hier wundert man sich häufig über