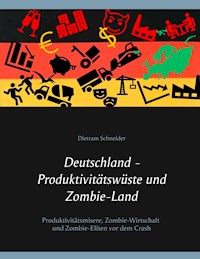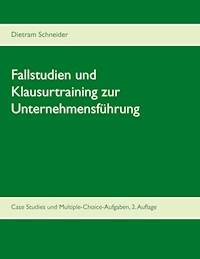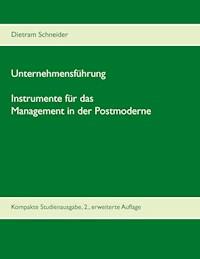Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist für Studierende, Lehrende, Forschende und Praktiker auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften konzipiert, die in kompakter Form einen vertieften Einblick in theoretische Grundlagen und Ansätze der Betriebswirtschaftslehre erhalten wollen. Der Leserschaft bietet sich ein breites grundlagentheoretisches Spektrum (BWL im Wissenschaftssystem, Zielsystem, Rationalprinzip und seine Kritik, betriebliche Umwelt, Betriebstypen, Drei-Sektoren-Hypothese usw.). Ferner zeichnet es sich dadurch aus, dass es zwölf theoretische Ansätze der BWL behandelt. Dabei werden auch Erweiterungen, Beziehungen und gegenseitige Befruchtungen aufgezeigt: Neoklassik; Austrianismus; Unternehmertheorien; mechanistischer, faktortheoretischer, systemorientierter, situativer, sozial- und verhaltensorientierter, entscheidungsorientierter Ansatz. Auch Theorieansätze, die dem (Neo-) Institutionalismus zuzurechnen sind, werden behandelt: Transaktionskostenansatz, Property-Rights- und Principal-Agent-Ansatz. Hierfür wird u. a. eine erweiterte Systematisierung opportunistischen Verhaltens geboten. Überdies erfolgt für den Property-Rights- und den Principal-Agent-Ansatz in Anlehnung an die Kapitalarten von Bourdieu ein Einbezug von Machtaspekten in Verbindung mit Phänomenen wie Bestechung, Korruption und Wirtschaftskriminalität. Die einzelnen Ansätze sind im Sinne einer betriebswirtschaftlichen Theoriegenese als Weiterentwicklungen der Neoklassik aufzufassen, die immer realitätsnähere Vorstellungen über die (Wirtschafts- und Geschäfts-) Welt produzieren. Vor diesem Hintergrund geht das Buch der evolutionären Hypothese nach, ob und inwieweit dieser Theorieentwicklung eine Entwicklung der realen Verhältnisse gegenübersteht, wonach sich die reale Welt den idealisierten neoklassischen Vorstellungen immer näher kommt. Damit ließe sich ein ständiges Abschmelzen des Abstands der Realität von der Neoklassik indizieren - und das Ideal der Neoklassik wäre der denkbare Endpunkt der Evolution. Er wird zwar nie erreicht, aber es gibt Indizien dafür, dass sich die Realität asymptotisch der Neoklassik annähert. Hierfür werden die Konsequenzen anhand von Entwicklungsszenarien behandelt: Der optimistischen "Befreiungs- und Optimierungshypothese" stellt der Autor die kritische Hypothese der "UFO-Falle" entgegen, die am Abgrund zur Neoklassik droht - steigende Unsicherheit ("U") durch zunehmende Erosion und Fäulnis von Institutionen ("F"), die auf ungezügeltem Opportunismus ("O") beruht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriftenreihe des Kompetenzzentrums für Unternehmensentwicklung und -beratung, KUBE e.V.
Bisher erschienene Werke:
Hauke, W.; Opitz, O. (2003): Mathematische Unternehmensplanung, 2. Auflage
Boes, S. (2004): Die Anwendung der Konzepte probabilistischer Bevölkerungsmodelle auf Prognosen für den Hochschulbereich
Pflaumer, P. (2004): Klausurtraining Deskriptive Statistik
Pflaumer, P. (2005): Klausurtraining Finanzmathematik
Schneider, D.; Amann, M. (2005): Benchmarking von Beratungsgesellschaften mit Success Resource Deployment – ein empirischer Vergleich von Accenture über BCG bis McKinsey aus Kundensicht
Hagenloch, T. (2007): Value Based Management und Discounted Cash Flow-Ansätze. Eine verfahrens- und aufgabenorientierte Einführung
Rauch, K. (2007): Steuern in der Sozialwirtschaft – Steuern und Gemeinnützigkeit
Hagenloch, T. (2009): Grundzüge der Entscheidungslehre
Kummer, S. (2009): SWOT-gestützte Analyse des Konzepts der Corporate Social Responsibility – Die soziale und ökologische Verantwortung der Unternehmen
Söhnchen, W. (2010): Operatives Controlling. Grundlagen und Instrumente
Hagenloch, T. (2010): Die Seminar- und Bachelorarbeit im Studium der Wirtschaftswissenschaften – Ein kompakter Ratgeber
Henning, S. (2013): Kosten und Leistungsrechnung, Grundlagen und praxisorientierte Anwendungsbeispiele aus der Betriebs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Bd. I: Betriebliches Rechnungswesen und klassische Kosten-/Leistungsrechnung
Hänle, M.; Schneider, D. (2014): Raum- und Immobilienmanagement – Fallstudien und Klausurtraining
Schneider, D. (2015): Unternehmensführung – Instrumente für das Management in der Postmoderne, Kompakte Studienausgabe, 2. Auflage
Schneider, D. (2015): Fallstudien- und Klausurtraining zur Unternehmensführung – Case Studies und Multiple-Choice-Aufgaben für Manager, Controller und Berater, 2. Auflage
Schneider, D. (2016): Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre – kompaktes Basiswissen, 2. Auflage
Schneider, D. (2016): Klausurtraining Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 3. Auflage
Henning, S. (2017): Aufgaben zur Kosten- und Leistungsrechnung
Hagenloch, T.; Söhnchen, W. (2017): Strategisches Controlling und Kostenmanagement
Hagenloch, T. (2018) Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Theoretische Grundlagen, Rechnungswesen und Managementlehre, 2. Auflage
Schneider, D. (2018): Theoretische Grundlagen und Ansätze der Betriebswirtschaftslehre – Von Basiskonzepten über Theorieansätze zum neoklassischen Abgrund
Vorwort und Vorgehensweise
Das vorliegende Buch wendet sich einerseits an Lehrende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften – besonders der Betriebswirtschaftslehre. Ihnen bietet sich in kompakter Form ein Einblick in die theoretischen Grundlagen und in zwölf Theorieansätze der Betriebswirtschaftslehre. In der Ansatzpluralität ist das Anliegen des Autors zu sehen. Der Leserschaft soll ein möglichst breites grundlagentheoretisches Spektrum dargestellt sowie Beziehungen und Komplementaritäten zwischen den betriebswirtschaftlichen Theorieansätzen aufgezeigt werden.
Andererseits soll das Buch für jene von Nutzen sein, die sich aus einem allgemeinen Interesse heraus oder forschend mit grundlegenden wirtschaftswissenschaftlichen Fragen beschäftigen. Denn das Buch führt nicht nur in die ökonomisch-theoretischen Basiskonzepte ein, sondern es bietet an mehreren Stellen Ergänzungen und Erweiterungen. Selbst wenn diese im Einzelfall hypothetischen und spekulativen Charakter haben mögen (etwa besonders im Hinblick auf die Interpretation der Neoklassik als Fix- und Endpunkt der Evolution), so liegt darin in Verbindung mit der Ansatzvielfalt ein wesentliches Differenzierungsmerkmal im Vergleich zur bereits vorliegenden Literatur.
Der erste Hauptteil befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (Kapitel I). Ihre Verortung im System der Wissenschaften bildet dafür die Ausgangsbasis (Abschnitt 1).
Als Realwissenschaft unterscheidet sich die Betriebswirtschaftslehre von anderen Wissenschaften einerseits durch bestimmte „Gegenstände“. Gegenüber anderen Wissenschaften lässt sich die Betriebswirtschaftslehre ferner anhand ihrer Methoden, Modelle und Aussagen kennzeichnen (Abschnitt 2). Der Bezug auf „Gegenstände“, Methoden, Modelle und Aussagen dient nicht nur der Separierung der Betriebswirtschaftslehre von anderen Disziplinen. Vielmehr ist ein derartiger Bezug auch in der Lage, Verbindungen zu und Gemeinsamkeiten mit anderen Wissenschaften aufzuzeigen.
Eine zentrale Spezifität der Betriebswirtschaftslehre – wie letztlich der Wirtschaftswissenschaften allgemein – stellt das wirtschaftliche Verhalten bzw. das Rationalprinzip dar (Abschnitt 3). In der betrieblichen Praxis lässt sich das Rationalprinzip durch ökonomische Ziele weiter operationalisieren.
Ziele können jedoch nicht unabhängig von einem Umsystem verfolgt werden. Daher ist die kontextuelle Einbindung des Unternehmens (als Hauptgegenstand der Betriebswirtschaftslehre) zu beachten. Durch Umwelt-, Güter- und Finanzbeziehungen kommen die Kontextfaktoren zum Ausdruck (Abschnitt 4).
Kapitel I schließt mit der Vorstellung verschiedener Betriebs- bzw. Unternehmenstypen (Abschnitt 5).
Kapitel II bietet eine Einführung in insgesamt zwölf betriebswirtschaftliche Theorieansätze. Dabei liegt die Zielsetzung weniger in einer jeweils separaten bzw. separierenden Darstellung. Eher liegt eine wichtige Absicht zunächst darin, die Theorieansätze angesichts ihres Potenzials für eine realitätsgerechte Abbildung der „Hauptgegenstände“ der Betriebswirtschaftslehre einzuschätzen (nämlich Unternehmen, wirtschaftliches Handeln bzw. Transaktionen und Menschen). Außerdem liegt ein Ziel in der Offenlegung von Beziehungen und Interdependenzen zwischen den einzelnen Theorieansätzen, um Sensibilität für gegenseitige Befruchtungsmöglichkeiten zu schaffen.
So erweist sich der neoklassische Ansatz (Abschnitt 1) im Hinblick auf die Abbildung realer Phänomene als äußerst kritikwürdig. Andererseits liegt in der Kritik u. a. eine Schubkraft für die Entwicklung überlegener Ansätze. Die österreichische Schule bzw. der Austrianismus – besonders in seiner neueren und angloamerikanischen Prägung (Abschnitt 2) – konstruiert beispielsweise das Konzept des findigen Unternehmertums als expliziten Gegenpol zum neoklassischen Menschenbild des homo oeconomicus.
Zeitlich schon weit vor den Überlegungen der Anhänger des Austrianismus gab es in England und Frankreich theoretische Konzepte zum Unternehmertum. Im Zuge der herausragenden Arbeiten von Joseph A. Schumpeter vor und nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten diese älteren Auffassungen wieder eine erneute Aufmerksamkeit. Daher befasst sich Abschnitt 3 im Anschluss an den Austrianismus in einem Exkurs mit verschiedenen Theorieansätzen zum Unternehmertum.
Während die Neoklassik das Unternehmen als Produktionsfunktion und damit letztlich als „black box“ betrachtet, erstreckt sich das Interesse des mechanistischen Ansatzes (Abschnitt 4) u. a. auf das Innenleben und die organisatorischen Strukturen von Institutionen. Dies gilt sowohl für den Bürokratieansatz von Max Weber als auch für die Organisationsprinzipien von Frederic W. Taylor und Henri Fayol.
Auch der nachfolgende faktortheoretische Ansatz (Abschnitt 5) ist letztlich einer eher mechanistischen Tradition zuzuordnen. Er wird allerdings in einem eigenen Abschnitt behandelt. Denn Erich Gutenberg, einer der zentralen Vertreter dieser Richtung, war der wichtigste Promotor für die Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Daher sei „seinem“ faktortheoretischen Ansatz ein gesonderter Abschnitt gewidmet. Durch das von ihm entwickelte und genutzte System betriebswirtschaftlicher Produktionsfaktoren, das gleichzeitig eine Abkehr von den volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren bedeutet, läutete er eine nachhaltige Emanzipation der Betriebs- von der Volkswirtschaftslehre ein.
Besonders durch Arbeiten von Hans Ulrich werden der Betriebswirtschaftslehre ab den 1970er Jahren systemorientierte Perspektiven eröffnet (Abschnitt 6). Anhänger des systemorientierten Ansatzes nutzen die disziplinübergreifende Anwendbarkeit der Systemtheorie für betriebswirtschaftliche Zwecke und begreifen das Unternehmen – z. B. ganz im Gegensatz zur Neoklassik – als offenes System.
Etwa zur gleichen Zeit und unter Bezug auf den Bürokratieansatz von Max Weber entsteht der situative Ansatz (Abschnitt 7). Danach bestimmen Kontextfaktoren die Organisationsstruktur und diese zusammen das Verhalten der Organisationsmitglieder, wovon die Effizienz von Organisationen abhängig ist.
Der in Abschnitt 8 beschriebene sozial- und verhaltensorientierte Ansatz kritisiert (wie der Austrianismus) u. a. das in der Neoklassik vorherrschende Menschenbild. Dem homo oeconomicus stellen die Vertreter des sozial- und verhaltensorientierten Ansatzes das Menschenbild des complex man gegenüber. Mit dem sozial- und verhaltensorientierten Ansatz entwickelt sich für die Betriebswirtschaftslehre eine Theorierichtung, in der der arbeitende Mensch – mit allen seinen Unzulänglichkeiten – im Mittelpunkt steht.
Für den entscheidungsorientierten Ansatz (Abschnitt 9) eröffnete der sozial- und verhaltensorientierte Ansatz aufgrund des realitätsnäheren Menschenbilds eine wichtige Perspektive. Im Zentrum stehen Entscheidungen von Menschen im betriebswirtschaftlichen Kontext. Das Grundkonzept des entscheidungsorientierten Ansatzes, wie er in Deutschland vor allem von Edmund Heinen und seinen zahlreichen Schülern ab ca. 1970 vorangetrieben wurde, bedient sich dafür sowohl fachübergreifender Auffassungen (z. B. Organisations- und Systemtheorie) als auch verschiedener Nachbarwissenschaften (z. B. Volkswirtschaftslehre, Soziologie). Der entscheidungsorientierte Ansatz umfasst eine präskriptive („wie soll man sich entscheiden“) und eine deskriptive („wie wird entschieden“) Ausprägung.
Die initiale Ausgangsbasis des nachfolgenden transaktionskostentheoretischen Ansatzes (Abschnitt 10) liegt in einem von Ronald H. Coase bereits im Jahre 1937 veröffentlichten Aufsatz mit dem Titel „The Theorie of the Firm“. Aber erst mit der fast nicht mehr überschaubaren Flut an transaktionskostentheoretisch fundierten Arbeiten von Oscar E. Williamson in den 1970er und 1980er Jahren werden die basalen Überlegungen von Coase einem breiteren Publikum bekannt. Im deutschsprachigen Raum sorgten vor allem Arbeiten von Arnold Picot und seinen Schülern für eine Diffusion des transaktionskostentheoretischen Ansatzes. Im Zentrum stehen die für die Abwicklung von Transaktionen bzw. Tauschhandlungen aufzuwendenden Transaktionskosten, die ihrerseits von vielfältigen Informationsproblemen und ihren Treibern abhängig sind. Während der Markt bzw. die marktliche Koordinationsform in der Neoklassik als einzige Abwicklungsform von Transaktionen fungiert, hat die Transaktionskostentheorie auch hierarchische Koordinationsformen im Blick. Versagt der „Markt“, ist aus Effizienzgründen der Übergang zur „Hierarchie“ erforderlich – und umgekehrt: bei Hierarchieversagen sind marktliche Koordinationsformen zu wählen. Für die Stabilisierung von Transaktionsbeziehungen und die Überwindung von Informationsproblemen bietet sich der Einsatz institutioneller Regelungen an (Normen, Satzungen, Verträge, Gesetze usw). Ihr Aufbau, ihre Entwicklung und ihr Abbau sind transaktionskostentheoretisch interpretierbar. Gleiches gilt für Institutionen im Sinne von Unternehmen, Verbänden, nationalen und supranationalen Organisationen (z. B. Parteien, Gewerkschaften, Universitäten, Europäische Union, UNO). Die Transaktionskostentheorie bildet daher ein oft genutztes Fundament für institutionenökonomische Analysen. Die Beziehungen zwischen Transaktionskostentheorie und Neoklassik werden oft verkannt. Allerdings kann die Transaktionskostentheorie einerseits als Erweiterung der Neoklassik aufgefasst werden. Andererseits lässt sich die Neoklassik aus Sicht der Transaktionskostentheorie als modellhafter und idealisierter Endpol eines Kontinuums realer Welten interpretieren, weil es in der neoklassischen Modellwelt u. a. aufgrund der Vorstellung des vollkommen informierten homo oeconomicus keine Informationsprobleme und keine Institutionen mehr gibt. Die Neoklassik stellt daher eine Idealwelt ohne Transaktionskosten und ohne institutionelle Regelungen dar.
Auch der in Abschnitt 11 dargestellte Property-Rights-Ansatz bietet für die Neoklassik verschiedene Erweiterungen. Danach stellen beispielsweise nicht Güter an sich – wie in der Neoklassik –, sondern die sie charakterisierenden Rechtskomponenten (z. B. Eigentums- bzw. Verfügungsrechte) die Transaktionsobjekte dar. Die wie der Transaktionskostenansatz dem (neuen) ökonomischen Institutionalismus zuzuordnende Property-Rights-Theorie liefert daher wesentliche Präzisierungen für Tauschobjekte, die auch für den transaktionskostentheoretischen Ansatz bedeutsam sind. Weil der Property-Rights-Ansatz Machtfragen meist ausblendet und deshalb Kritik erfährt, wird in diesem Abschnitt ein Versuch der Integration machtspezifischer Aspekte unternommen.
Abschnitt 12 befasst sich mit dem Principal-Agent-Ansatz. Er stellt ebenfalls eine Ausprägung des institutionentheoretischen Paradigmas dar. Wiederum im Gegensatz zur Neoklassik – aber wie der sozial- und verhaltensorientierte sowie der entscheidungsorientierte Ansatz und der Transaktionskostenansatz – geht der Principal-Agent-Ansatz von unvollkommen informierten Akteuren aus. Sie stehen sich als Auftraggeber (Principal) und Auftragnehmer (Agent) gegenüber. Beide Akteure wollen ihren Nutzen steigern und versuchen daher, ihre Informationsvorteile bzw. bestehende Informationsasymmetrien in opportunistischer Weise – und auch zum Schaden des Tauschpartners – zu nutzen. Wie im transaktionskostentheoretischen Ansatz sieht der Principal-Agent-Ansatz in institutionellen Regelungen und eher hierarchischen Koordinationsformen Möglichkeiten zur Behebung von Informationsproblemen bzw. -asymmetrien und damit für die Eindämmung von opportunistischen Verhaltensweisen. Allerdings vernachlässigt auch der Principal-Agent-Ansatz Machtphänomene, die in Abschnitt 12 explizit problematisiert werden.
Der Darstellung der zwölf Theorieansätze folgt in Kapitel III ein Rückblick und ein hypothetischer Ausblick. Hier entsteht zunächst die Frage, ob das gebotene Spektrum nicht noch um zusätzliche Ansätze ergänzt werden müsste, was zur höchst brisanten Anschlussfrage führt, welche Anforderungskriterien erfüllt sein sollten, um tatsächlich von einem theoretischen Ansatz der Betriebswirtschaftslehre sprechen zu können. Im Ausblick steht die Hypothese im Vordergrund, dass sich aus einer evolutionären Perspektive deutliche Indizien für eine Annäherung der realen Welt an die idealisierte neoklassische Modellwelt abzeichnen und die Gefahr eines Abrutschens in den neoklassischen Abgrund droht.
August 2018
Dietram Schneider
Inhaltsverzeichnis
Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen
Betriebswirtschaftslehre im System der Wissenschaften
1.1 Allgemeine Ziele von Wissenschaften
1.2 Systematik der Wissenschaften
1.3 Gliederung der Betriebswirtschaftslehre
1.4 Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre
Gegenstände, Methoden, Modelle und Aussagen der Betriebswirtschaftslehre
2.1 „Gegenstände“
2.2 Methoden
2.3 Modelle
2.4 Aussagen
Wirtschaftliches Verhalten und ökonomische Ziele
3.1 Wirtschaftliches Verhalten und Rationalprinzip
3.2 Ziele – ökonomische und andere
3.2.1 Zieldimensionen
3.2.2 Zielbeziehungen
Umwelt-, Güter- und Finanzbeziehungen
4.1 Systematik der Umweltbeziehungen – Stakeholder
4.2 Güter- und Finanzströme
Gliederung der Unternehmen – Betriebstypologien
5.1 Drei-Sektoren-Typologie als Rahmenkonzept
5.2 Möglichkeiten der Bildung von Betriebstypologien
5.3 Wirtschaftszweig- bzw. Branchentypologie
5.4 Klein-, Mittelstands- und Großbetriebe
5.5 Handwerks- und Industriebetriebe
Theoretische Ansätze der Betriebswirtschaftslehre
Neoklassischer Ansatz
1.1 Allgemeines
1.2 Kritik
1.3 Heuristische Rehabilitierung
Austrianischer prozesstheoretischer Ansatz
Exkurs: Theorieansätze zum Unternehmertum
Mechanistischer Ansatz
Faktortheoretischer Ansatz
5.1 Allgemeines
5.2 Produktions- und Kostenfunktion des Ertragsgesetzes (Typ A)
5.3 Würdigung von Typ A
5.4 Produktions- und Kostenfunktion vom Typ B
5.5 Sonderproblem Kostenspaltung
5.6 Gesamtwürdigung
Systemorientierter Ansatz
6.1 Allgemeines
6.2 Regelungs- und Steuerungssysteme
6.3 Fähigkeiten von Systemen
6.4 Würdigung
Situativer Ansatz
7.1 Allgemeines
7.2 Forschungskonzept
Sozial- und verhaltensorientierter Ansatz
8.1 Allgemeines
8.2 Anreiz-Beitrags-Theorie
Entscheidungsorientierter Ansatz
9.1 Allgemeines
9.2 Grundkonzept des entscheidungsorientierten Ansatzes
9.3 Präskriptive und deskriptive Entscheidungstheorie
9.3.1 Präskriptive Entscheidungstheorie
9.3.1.1 Entscheidung unter Sicherheit
9.3.1.2 Entscheidung unter Risiko
9.3.1.3 Entscheidung unter Unsicherheit
9.3.2 Deskriptive Entscheidungstheorie
9.3.2.1 Entscheidungsprozess
9.3.2.2 Phänomene im praktischen Entscheidungsverhalten
Transaktionskostentheoretischer Ansatz
10.1 Allgemeines
10.2 Arten von Transaktionskosten
10.3 Einflussgrößen von Transaktionskosten
10.4 Koordinationsformen zwischen „Markt“ und „Hierarchie“
10.5 Evolution von Transaktionskosten und ihre Folgen: Neoklassik
Property-Rights-Ansatz
11.1 Allgemeines
11.2 Anwendungsbereiche
11.3 Property-Rights-Ansatz und Machtfragen
Principal-Agent-Ansatz
12.1 Allgemeines
12.2 Informationsasymmetrien zwischen Principal und Agent
12.3 Informationsasymmetrien und Systematik opportunistischen Verhaltens
12.4 Principal-Agent-Ansatz und Machtfragen
Rückblick und Ausblick -
von der Neoklassik über betriebswirtschaftliche Theorieansätze zum neoklassischen Abgrund
Literaturverzeichnis
I Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen
1 Betriebswirtschaftslehre im System der Wissenschaften
Die Betriebwirtschaftslehre ist eingebunden und wird beeinflusst von anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Daher sollen in diesem Abschnitt neben den allgemeinen Zielen der wissenschaftlichen Betätigung (1.1) vor allem die Abgrenzungen und die Schnittstellen zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen aufgezeigt werden. Hierbei gestaltet sich insbesondere eine „Abgrenzung“ als schwierig. Denn die Betriebswirtschaftslehre begreift sich inzwischen u. a. als interdisziplinäre Wissenschaft, die auf viele Nachbarwissenschaften zurückgreift und von diesen in vielfältiger Weise befruchtet wird. Trotzdem soll eine Systematik der Wissenschaften – die zwangsläufig Aspekte der Abgrenzung beinhaltet – geboten werden (1.2). Außerdem zeigt dieses Kapitel Gliederungsmöglichkeiten der Betriebswirtschaftslehre auf (1.3) und gibt einen kurzen Überblick über ihre Entwicklung (1.4).
1.1 Allgemeine Ziele von Wissenschaften
Allgemein liegt das zentrale Ziel jeder Wissenschaft (und damit auch der Betriebswirtschaftslehre) in der Hilfe zur menschlichen Daseinsbewältigung (Heinen, 1982). Schon in der ersten Auflage zur „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ schreibt Heinen (1968, S. 11): „Der Mensch ist in eine ihm fremde Welt hineingeboren, die ihn täglich vor neue Probleme der Daseinsbewältigung stellt. Seit jeher wird es als die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft angesehen, dem Menschen bei der Bewältigung seiner existentiellen Probleme zu helfen. Hier liegen somit Ausgangs- und Bezugspunkt allen wissenschaftlichen Bemühens um Erkenntnis.“
So trefflich eine solche Zielbeschreibung auch sein mag, sie bleibt letztlich allgemein, weshalb weitere Konkretisierungen notwendig sind. Überdies weist Heinen selbst auf das „Bemühen um Erkenntnis“ als eine weitere – u. U. nach seiner Diktion untergeordnete – Zielkategorie hin. Bemüht man sich um weitere Konkretisierungen, so ist festzustellen, dass je nach Autor sowie dessen Überzeugungen und Einstellungen unterschiedliche Operationalisierungen angeboten werden, die sich zum Teil stark überschneiden. In Anlehnung an Schanz (1982) stehen zum Beispiel die Orientierungsleistung und die Wahrheitserkenntnis in Verbindung mit der Entwicklung von Vorgehensweisen und Instrumenten zur Daseinsgestaltung (Gestaltungsanspruch der Wissenschaften) im Vordergrund. Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Daseinsbewältigung und Daseinsgestaltung könnte die Daseinsbewältigung als erforderliche Basis für die Daseinsgestaltung angesehen werden.
Um „tiefgehende und wichtige“ Hinweise für die Orientierung (z. B. was sind die drängendsten Zukunftsprobleme der Menschheit, die gelöst werden sollen?) und die instrumentell unterstützte Gestaltung (z. B. womit und in welche Richtung soll gestaltet werden?) zu gewinnen, ist Wahrheitserkenntnis unverzichtbar. Daher könnte Wahrheitserkenntnis im Vergleich zur Orientierungsleistung und Daseinsgestaltung einer höheren Ebene zugeordnet werden. Auf der anderen Seite erweist sich häufig erst der empirische Beweis im Zuge der konkreteren Prozesse der Daseinsgestaltung als durchschlagender Motor für die Wahrheitsgewinnung. Dies gilt insbesondere auch in der betriebswirtschaftlichen Praxis. So werden individuelle Überzeugungen und singuläre Hypothesen nicht selten im Deckmantel von Wahrheiten verkündet („Preissenkungen bei Produkten führen zu Absatzsteigerungen“). Ihre Entlarvung folgt häufig erst im oder nach Vollzug der Gestaltungsprozesse durch die Realität bzw. den Test in der Empirie und somit in der realen Situation (im konkreten Fall: „Preissenkungen führen zum Absinken der Absatzzahlen aufgrund einer atypischen Nachfrage“).
Raffée (1989) verweist auf Albert (1976), der in den Funktionen Aufklärung (allgemein) und Steuerung (anwendungsorientiert) zentrale Ziele von Wissenschaften sieht. Nach Raffée lässt sich dabei die Aufklärung insbesondere der kritischen Funktion der Wissenschaft zuordnen, während die Steuerung zur heuristischen Funktion der Wissenschaften gehört. Er sieht in der kritischen und heuristischen Wissenschaftsfunktion auch die utopische Wissenschaftsfunktion enthalten. Sie bzw. so genannte „gezähmte Utopien“ (Petri 1976) leisten insofern einen wichtigen Beitrag dazu, prinzipiell realisierbare Gestaltungsalternativen zu entwerfen, um das „Jetzt“ mit besseren, günstigeren, wünschbareren usw. Zukunftsbildern (Szenarien) zu konfrontieren. Damit wird – explizit oder implizit – beispielsweise auf die Orientierung und Steuerung von Gesellschaften, ihre wichtigsten Institutionen (z. B. Parlamente, Regierungen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen) und die politischen Interessenvertreter sowie selbstverständlich auch auf die Wissenschaften und den Wissenschaftsbetrieb insgesamt Einfluss genommen.
Schon diese kurze Beschreibung macht deutlich, wie schwierig eine Strukturierung der Ziele von Wissenschaften ist – insbesondere sobald Beziehungen zwischen den Zielen hergestellt und Unter-/Überordnungsverhältnisse geklärt werden sollen. Es überrascht daher kaum, wenn entsprechende Zieldiskussionen in einer einfachen Aufzählung von Zielen oder in einer groben Zielkasuistik münden.
1.2 Systematik der Wissenschaften
Die Betriebswirtschaftslehre ist den Realwissenschaften zuzuordnen „Realwissenschaft“ bedeutet, dass es sich um eine Wissenschaft handelt, die sich den in der realen Welt vorhandenen Sachverhalten und Phänomenen widmet. Die Realwissenschaften lassen sich in die Natur- und Geisteswissenschaften separieren (vgl. hierzu Bild 1, ähnlich z. B. Vahs u. Schäfer-Kunz 2015, ferner Hagenloch 2018). Die Naturwissenschaften (ingenieurwissenschaftliche Disziplinen, Chemie, Physik) beschäftigen sich vor allem mit physischen Gegenstandsbereichen. Im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses der Geisteswissenschaften (Kulturwissenschaften) stehen dagegen psychische, soziale und/oder psychophysische Gegenstandsbereiche (z. B. Sprach- und Rechtssowie Geschichtswissenschaften). Diese Gegenstandsbereiche der Geisteswissenschaften sind (wie diejenigen der Naturwissenschaften) in der Wirklichkeit, also real, vorhanden – und zwar unabhängig davon, ob sich das menschliche Denken mit ihnen tatsächlich beschäftigt oder nicht (Wöhe). Sie existieren entweder ohne das bewusste oder unbewusste Agieren des Menschen; oder sie wurden bzw. werden vom Menschen bewusst oder unbewusst geschaffen.
Die Gegenstandsbereiche der Idealwissenschaften werden dagegen gedanklich erschaffen und sind nicht unabhängig vom Denken gegeben (Wöhe). Dazu gehören die Mathematik und die Logik. Beherrscht man ihre Regeln, dann können beispielsweise mathematische Aufgaben exakt gelöst und die Richtigkeit der Ergebnisse mit Sicherheit bestätigt oder verworfen werden (Determinismus).
Grundsätzlich lässt sich die Betriebswirtschaftslehre den Realwissenschaften zuordnen. Zwar basieren viele Kalküle der Betriebswirtschaftslehre auf mathematischen Überlegungen und/oder haben sehr enge Beziehungen zur Mathematik (z. B. im faktortheoretischen Ansatz typische Durchschnitts-, Grenzertrags- oder Grenzkostenbetrachtungen, vgl. Kapitel II, Punkt 5). Allerdings wäre es falsch, die Betriebswirtschaftslehre deshalb als Idealwissenschaft zu bezeichnen. Denn letztlich verbleiben in sämtlichen betriebswirtschaftlichen Gegenstandsbereichen zumindest „Reste“ realer Gegenstandsbereiche – auch wenn sie im Einzelfall aus pragmatischen Gründen stark vereinfacht werden (z. B. in den typischen Gleichgewichtsmodellen der Neoklassik; oder wenn vom Menschenbild des homo oeconomicus ausgegangen wird, vgl. Kapitel II, Abschnitt 1). Allenfalls lässt sich behaupten, dass im Einzelfall der jeweilige betriebswirtschaftliche Gegenstandsbereich einen intensiven idealwissenschaftlichen Charakter aufweist.
Bild 1: Systematik der Wissenschaften
Auch die Volkswirtschaftslehre ist eine Realwissenschaft. Die Klärung des Verhältnisses zwischen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft ist in der Literatur in einer kaum noch überschaubaren Flut an Büchern und Fachartikeln diskutiert worden (z. B. Raffée 1989, Neus 1998). Vereinfacht behandelt die Betriebswirtschaftslehre das Innenleben von Unternehmen und seine Beziehungen zur Unternehmensumwelt (z. B. Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, Behörden, Staat). Sie konzentriert sich folglich auf die Einzelwirtschaft oder weist in bestimmten Teilbereichen mesoökonomische Eigenschaften auf, wenn Cluster von Einzelwirtschaften betrachtet werden (z. B. bei Branchenanalysen). Dagegen dreht es sich in der Volkswirtschaftslehre um die Gesamtwirtschaft, die nicht nur aus der Summe aller Einzelwirtschaften entsteht, sondern ihre eigenen Problemstellungen besitzt (z. B. Entstehung und Verteilung des Volkseinkommens), die ihrerseits sowohl für die Unternehmen als auch für die Betriebswirtschaft als Lehre als Datum angesehen werden oder nur sehr schwer von Einzelwirtschaften veränderbar bzw. beeinflussbar sind. Dazu gehören neben makroökonomischen Betrachtungen auch mikroökonomische Konzepte (z. B. Tausch- und Grenznutzenmodelle), welche häufig die Basis für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und Konzepte darstellen (z. B. Preistheorie, Preis-Absatz-Funktionen).
Neben den Ideal- und Realwissenschaften – häufig jedoch nicht nur nebensondern vor allem auch übergeordnet – gibt es die metaphysischen Wissenschaften (Philosophie, Theologie). Soweit es die Theologie zusammen mit den Religionswissenschaften betrifft, werden daraus häufig bekennend-normative Aussagensysteme diskutiert und abgeleitet (vgl. dazu Punkt 2.4), die auch auf die Real- und Idealwissenschaften ausstrahlen können (z. B. sehr plakativ: „Gewinne sind Teufelszeug“, „Mathematische Rationalität zerstört Menschlichkeit“). Gleiches gilt für die Philosophie, wenn beispielsweise ethische oder moralische Fragestellungen zu problematisieren sind. So gibt es an betriebswirtschaftlichen Fakultäten nicht selten spezielle Lehrstühle sowie Fächer, die sich speziellen Themen und Problemen der Wirtschafts- und Unternehmensethik widmen. Und im Rahmen der Darstellungen zur Unternehmensführung kann u. a. die Herstellung von Bezügen zur Philosophie der Postmoderne („Konstruktion und Dekonstruktion von Strategien und Unternehmensplänen“, „die Wahrheit liegt oft in der Umkehrung“) oder zur Existenzphilosophie („Reflexion als Voraussetzung existenziellen Denkens“) denkbar und sinnvoll sein (vgl. z. B. Schneider 2015a).
1.3 Gliederung der Betriebswirtschaftslehre
Nach der Standortfestlegung der Betriebswirtschaftslehre (vgl. 1.2) im Außenverhältnis zu anderen Wissenschaften kann eine weitere Strukturierung innerhalb der Betriebswirtschaftslehre vorgenommen werden (vgl. Bild 2, ähnlich Schneider 2016, Weber u. a. 2018, Hagenloch 2018)).
Bild 2: Betriebswirtschaftslehre, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Ansatzpunkte für die Bildung spezieller Betriebswirtschaftslehren – Beispiele
Die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre behandelt einerseits die betriebswirtschaftliche Theoriebildung und thematisiert den grundsätzlichen Umgang mit sowie die Beziehungen zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre konzentriert sich außerdem auf die Betriebs- bzw. Unternehmenspolitik (bzw. -führung und -strategie). Sie behandelt damit Fragestellungen und Themenbereiche der Betriebswirtschaftslehre, die allen speziellen Betriebswirtschaftslehren (mehr oder minder) gemeinsam sind.
Die Bildung spezieller Betriebswirtschaftslehren baut auf Unterscheidungskriterien auf, die in der Disziplin von herausragender Bedeutung sind. Sie kann institutionen-, funktions- und verfahrensorientiert erfolgen. So gibt es betriebswirtschaftliche Institutionenlehren, die auf die Eigenheiten von Branchen abzielen. Zu nennen sind beispielsweise Versicherungslehre, Bankbetriebslehre und Handelslehre. So genannte Funktionslehren konzentrieren sich auf die Besonderheiten betrieblicher Funktionen (z. B. Beschaffung, Produktion, Absatz). Im Mittelpunkt von Verfahrenslehren stehen typische Verfahren, die für die Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme eingesetzt werden (z. B. Buchhaltung, Kostenrechnung, Finanzmathematik, EDV, Netzplantechnik).
Durch die Verknüpfung der einzelnen Dimensionen ergibt sich eine immer feinere Verästelung in speziellere Betriebswirtschaftslehren bzw. in betriebswirtschaftliche Inhaltsbereiche – so zum Beispiel spezielle EDV-Anwendungen im Industriebetrieb für die Beschaffungssteuerung oder die Finanzmathematik für die Absatzplanung im Versicherungsbetrieb.
Durch weitere (sinnvolle) Dimensionen bzw. Unterscheidungskriterien sind noch viel mehr spezielle Betriebswirtschaftslehren generierbar, als dies durch den oben skizzierten dreidimensionalen Würfel zum Ausdruck kommt. Das Kriterium der Betriebsgröße wird oft herangezogen, um spezielle Betriebswirtschaftslehren für KMU (Klein- und Mittelstandsunternehmen) einerseits und für Groß- und Konzernunternehmen andererseits zu rechtfertigen (z. B. Albach 1989, Rehkugler 1989). Internationalisierung und Globalisierung haben zum Plädoyer für und zur Herausbildung eine(r) Internationalen Betriebswirtschaftslehre oder Fächern wie Internationales oder Globales Management geführt (z. B. Pausenberger 1989). Ferner kann methodisch eher eine mathematisch-systemorientierte Vorgehensweise (Operations Research) oder ein stärker empirisch gestütztes Verfahren (Empirische Forschung) gewählt werden.
Aus einer genetischen Perspektive eines Curriculums für die Betriebswirtschaftslehre als Studienfach an Hochschulen und Universitäten übernehmen die Inhalte der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für ein Studium eine öffnende und schließende Funktion, während die speziellen Betriebswirtschaftslehren (zusammen mit Wahl-/Nebenfächern) „dazwischen“ liegen (Bild 3):
Bild 3: Verortung der Allgemeine Betriebswirtschaftslehre im (genetischen) Curriculum der Betriebswirtschaftslehre
Im Wissenschafts- und Lehrbetrieb ergibt sich durch die Separierung in Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und den jeweiligen speziellen Betriebswirtschaftslehren eine Arbeitsteilung. Sie spart u. a. an Hochschulen und Universitäten Ressourcen, weil in den speziellen Betriebswirtschaftslehren durch diese Bündelung „des Allgemeinen und der Grundlagen“ inhaltliche Redundanzen sinken. Außerdem schafft sie sowohl für Fachneulinge als auch für Fachkenner Orientierung und verringert Informations- und Kommunikationskosten. Allerdings ist im Verhältnis zwischen den speziellen Betriebswirtschaftslehren und der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre eine enge Verzahnung erforderlich, wodurch sich zwangsläufig Überschneidungen und „Grenzstreitigkeiten“ zwischen den Beteiligten und Betroffenen (auch in der Lehre) provoziert werden können (vgl. in Bild 3 die Überlappungen der speziellen Betriebswirtschaftslehren und den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre bzw. der Unternehmensführung). Andererseits könnte man von fruchtbaren Konfliktzonen sprechen, die den wissenschaftlichen Diskurs anregen.
1.4 Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre
Kaufmännischer Schriftverkehr, Buchhaltung und kaufmännisches Rechnen wurden schon im Mittelalter betrieben. In der Genese wissenschaftlicher Betrachtungen auf einzelwirtschaftlicher Basis kommen der Kameralwissenschaft und der Buchhaltungslehre zentrale Bedeutung zu. Wichtige Ansätze für die doppelte Buchführung finden sich bereits um 1500 in den Arbeiten des Franziskanermönches und Mathematikers Luca Pacioli. In sehr fundierten Arbeiten hat sich vor allem Dieter Schneider (1985) um die Aufarbeitung dieser historischen Fundstellen vom Mittelalter bis heute in seinem Buch „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ um die Nachzeichnung der historischen Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Theoriebildung außerordentlich verdient gemacht. Auch bei Wöhe finden sich intensive entwicklungsgeschichtliche Ausführungen, die bis in das Mittelalter zurückreichen.
Als wissenschaftlich eigenständige und von der Volkswirtschaftslehre weitgehend unabhängige Disziplin hat sich die Betriebswirtschaftslehre erst im letzten Jahrhundert entwickelt. Ausgangspunkt waren die Gründungen der ersten Handelshochschulen in Leipzig, Aachen und Wien um 1900. Anschließend war die weitere Entwicklung vor allem mit den Namen Schmalenbach (Buchführung und Kalkulation im Fabrikgeschäft, 1899), Nicklisch (Allgemeine Betriebslehre als Privatwirtschaftslehre des Handels und der Industrie, 1912; außerdem das von Nicklisch in fünf Bänden herausgegebene Handwörterbuch der Betriebswirtchaft 1926 - 1928) sowie Rieger (Einführung in die Privatwirtschaftslehre, 1928) und nach dem zweiten Weltkrieg vor allem Gutenberg (Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Band 1, Die Produktion, 1951) verbunden.
Kapitel II beschreibt unter dem Titel „Theoretische Ansätze der Betriebswirtschaftslehre“ die einzelnen Ansätze vor allem entlang einer zeitlichen Abfolge. Die Darstellung muss jedoch Kompromisse eingehen, weil sich die Ansätze inhaltlich und zeitlich partiell überschneiden. Allerdings findet der Leser jeweils noch sehr viel konkretere Hinweise zur historischen Entwicklung, zu den wesentlichen Vertretern und vor allem zu den inhaltlichen Dimensionen und den Interdependenzen der einzelnen betriebswirtschaftlichen Ansätze, die sich im Zeitablauf im Zuge der betriebswirtschaftlichen Theorieentwicklung herausgebildet haben.
2. Gegenstände, Methoden, Modelle und Aussagen der Betriebswirtschaftslehre
Die Gegenstände (2.1), Methoden (2.2), Modelle (2.3) und Aussagen (2.4) sowie ihre spezifischen Ausgestaltungsformen können als wesentliche Abgrenzungskriterien sowie als Beurteilungsmaßstäbe für die Verwandtschaft wissenschaftlicher Disziplinen dienen. Dies gilt besonders für die Betriebswirtschaftslehre im Verhältnis zu anderen Wissenschaften – letztlich jedoch auch innerhalb der Betriebswirtschaftslehre im Verhältnis zwischen den einzelnen speziellen Betriebswirtschaftslehren.
2.1 „Gegenstände“
Eine Möglichkeit der Bestimmung der Gegenstände der Betriebswirtschaftslehre läge darin, sich an den zwei Wortbestandteilen zu orientieren – Betrieb und Wirtschaft (z. B. Neus 2015). Während der Begriff „Wirtschaft“ zunächst institutionell interpretierbar ist, betrifft der (eher tätigkeitsbezogene) Begriff „Wirtschaften“ das ökonomische Handeln bzw. Verhalten, weshalb an dieser Stelle auf die wirtschaftlichen Verhaltensprinzipien in Abschnitt 3.1 verwiesen werden kann. Der Betrieb wäre demnach im Sinne des im Mittelpunkt der Betriebswirtschaftslehre liegenden empirischen Phänomens als so genannter Erfahrungsgegenstand aufzufassen. Der eher tätigkeitsbezogene Begriff des Wirtschaftens zeigt auf, aus welchen Perspektiven und angesichts welcher Fragestellungen heraus der Erfahrungsgegenstand betrachtet werden kann (beispielsweise kostentheoretische, personalwirtschaftliche oder logistische Perspektive). Das Wirtschaften wäre daher insofern als Erkenntnisgegenstand zu bezeichnen (vgl. z. B. Hagenloch 2018) und erhält beispielsweise durch unterschiedliche Ausgestaltungsformen des Wirtschaftlichkeits- bzw. Rationalprinzips und durch ökonomische Ziele sowie deren Operationalisierungen (z. B. Gewinn, Umsatz- und Kapitalrendite) weitere inhaltliche Präzisierungen (vgl. Abschnitt 3).
Was den Begriff „Betrieb“ anbelangt, so wird auf das empirische Phänomen im institutionellen Sinne abgestellt. Er verlangt allerdings eine weitere Konkretisierung. Nach Wöhe (1978, S. 2) ist der Betrieb „eine planvoll organisierte Wirtschaftseinheit..., in der Sachgüter und Dienstleistungen erstellt und abgesetzt werden“. Was aber unterscheidet den Betrieb vom Unternehmen bzw. der Unternehmung