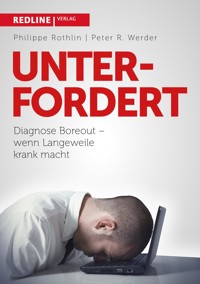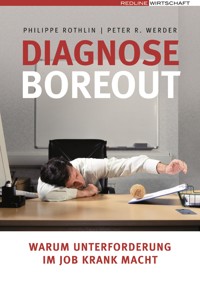
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die schleichende Gefahr - wie Langeweile und Unterforderung bei der Arbeit krank machen. Burnout kennt jeder - aber was ist Boreout? Die Autoren Philippe Rothlin und Peter Werder beschreiben anschaulich das weit verbreitete, aber bisher totgeschwiegene Phänomen: Boreout durch Desinteresse, Langeweile und Unterforderung am Arbeitsplatz. Die Auswirkungen sind eindeutig: Unzufriedenheit, ständige Müdigkeit und Verlust der Lebensfreude. Das Erschreckende dabei: Es kann jeden von uns treffen, der sich im Job unterfordert oder schlicht "fehl am Platze" fühlt. Diagnose Boreout ist ein Buch für alle, die aktiv und offensiv mit dem neuen Phänomen umgehen wollen. Neues Phänomen in der Arbeitswelt: Boreout. Erste Publikation über dieses Thema. Konkrete Ansätze für Betroffene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe Rothlin | Peter R. Werder
Diagnose Boreout
Für Blanca. Für Nicole.
Philippe Rothlin | Peter R. Werder
Diagnose Boreout
Warum Unterforderung im Job krank macht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-636-01462-7 | Print-Ausgabe
ISBN 978-3-86881-183-4 | E-Book-Ausgabe (PDF)
E-Book-Ausgabe (PDF): © 2009 by Redline Verlag, FinanzBuch Verlag GmbH, München.www.redline-verlag.de
Print-Ausgabe: © 2007 by Redline Wirtschaft, Redline GmbH, Heidelberg. Ein Unternehmen von Süddeutscher Verlag | Mediengruppe.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Marit Borcherding, Göttingen Umschlaggestaltung: Uhlig, www.coverdesign.net Umschlagabbildung: Kelvin Murray, The Image Bank Satz: Jürgen Echter, Redline GmbH Druck: Ebner & Spiegel, Ulm Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts: vom Burnout zum BoreoutDer Boreout – Begriff, Elemente und EntwicklungDas Verhältnis des Boreout zum BurnoutElement 1: Die UnterforderungElement 2: Das DesinteresseElement 3: Die LangeweileBoreout ist nicht gleich FaulheitWie entwickelt sich der Boreout?Die Boreout-StrategienDie Komprimierungsstrategie Die Flachwalzstrategie Die strategische VerhinderungDie Aktenkofferstrategie und der HOLDie Pseudo-Burnout-Strategie sowie die LärmstrategieDas Boreout-ParadoxDie Ursachen des BoreoutSpaß für alle?Die falsche BerufswahlDer falsche OrtNoch einmal: die StrategienBessere Alternativen zur ArbeitNormal, aber schlechtDie Symptome des BoreoutLässt sich der Boreout von außen beobachten?Wenn Menschen innerlich am Boreout leidenWer ist betroffen – und wer nicht?Was schützt vor dem Boreout – Hierarchie oder Eigentum?.Boreout-Treiber am SchreibtischWenig Chancen für den Boreout Die Industrialisierung und die Spezialisierung: zwei Entwicklungen mit FolgenDie verschiedenen Stadien des BoreoutFünf Typologien Scheinlösungen helfen nichtAn der Faulheit gibt es nichts zu entdeckenMit Kontrolle gegen den Boreout?Eigenverantwortung als Mittel gegen BoreoutDer qualitative LohnArbeit als milde KrankheitDie Elemente des qualitativen LohnsWir suchen SinnWir beurteilen die ZeitWir verlangen GeldFassen wir zusammenSchlusswortLiteraturverzeichnisZu den AutorenDankDie Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts: vom Burnout zum Boreout
Stress am Arbeitsplatz gehört heute einfach dazu. Wer nicht gestresst ist, ist scheinbar nicht wichtig. Deshalb wird Stress oft übertrieben dargestellt. Natürlich gibt es sie, die gestressten Arbeitnehmer, die vom Unternehmen ausgequetscht werden wie eine Zitrone. Aber es gibt auch das Gegenteil. Davon handelt dieses Buch. Aussagen zum Thema Stress sind also mit Vorsicht zu genießen – er gehört nicht nur einfach zum guten Ton, sondern ist sozial erwünscht und hat einen wesentlich höheren Unterhaltungswert als zum Beispiel Langeweile.
Das Thema Arbeitsstress dominiert viele Feierabendgespräche. Doch wenn es nicht beim oberflächlichen Geplänkel bleibt und die Unterhaltung eher in die Tiefe geht, stellt sich plötzlich heraus, dass viele Arbeitnehmer meilenweit davon entfernt sind, gestresst zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sind unterfordert, desinteressiert und unendlich gelangweilt – keine Spur von Herausforderung oder Interesse an dem, was sie täglich tun. Gemäß einer Umfrage von Kelly Services, einem internationalen Personalvermittlungs-Unternehmen, liegt der gesamteuropäische Durchschnitt der Arbeitnehmer, die sich gestresst fühlen, bei 27 Prozent.
Uns interessieren in diesem Buch die restlichen 73 Prozent – jene Arbeitnehmer, die sich irgendwo zwischen „Stressaufkommen gerade richtig“ und „unterfordert“ verorten. Es geht also nicht um Stress, sondern um das Gegenteil davon: Es geht nicht um den Burnout, sondern um den Boreout.
Unterforderung, Desinteresse und Langeweile als wesentliche Elemente der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts? Wahrscheinlich denken Sie jetzt, das sei in Zeiten der Globalisierung doch gänzlich unmöglich. Wir müssten doch eher über- statt unterfordert sein. Wer kennt denn schon Langeweile bei der Arbeit? Vergegenwärtigen Sie sich aber auch einmal Ihr berufliches Umfeld: Haben Sie keinen
Arbeitskollegen, bei dem Sie nicht genau wissen, was er den ganzen Tag über tut? Was eigentlich seine Aufgaben sind? Der vielleicht sogar den Anschein erweckt, gestresst zu sein, es aber unter Umständen gar nicht ist? Vielleicht überzeugen Sie die Resultate der folgenden zwei Umfragen:
Eine Untersuchung der Gallup Organization besagt, dass sich in Deutschland 87 Prozent aller Beschäftigten gering oder gar nicht an ihr Unternehmen gebunden fühlen. Die Studie sieht die Ursachen unter anderem darin, dass sieben von zehn Befragten keine Position ausfüllen, die ihnen wirklich liegt. Für Salary.com und AOL befragte Dan Malachowski im Jahr 2005 mehr als 10.000 Arbeitnehmer zum Thema Zeitverschwendung am Arbeitsplatz. Das Resultat: 33,2 Prozent dieser Gruppe sagten aus, sie hätten bei der Arbeit nicht genug zu tun, sind also unterfordert.Mit anderen Worten: Unzählige Arbeitnehmer sind keinesfalls im Stress, obwohl immer so viel davon geredet wird, sondern verfügen tatsächlich über „Freizeit“ bei der Arbeit. Und diese Zeitspanne ist nicht so gering, wie man meinen könnte. Um nochmals die Untersuchung von Salary.com und AOL zu zitieren: Die Umfrage zeigt, dass die unterforderten Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz und während ihrer Arbeitszeit täglich zwei Stunden private Dinge erledigen – Dinge, die nichts mit dem zu tun haben, wofür sie eigentlich bezahlt werden: Sie schreiben unzählige private E-Mails, surfen zum eigenen Vergnügen im Internet und nutzen das enorme Angebot an Websites, die dabei behilflich sind, die Präsenzzeiten am Arbeitsplatz irgendwie zu überbrücken. Da gibt es Sites mit Spielen, bei denen es beispielsweise für ein Rennen mit dem Bürostuhl Punkte gibt, Tipps zur Überbrückung von langweiligen Meetings – Bullshit Bingo ist in dieser Hinsicht wohl die bekannteste Unterhaltung – oder brandneue Videos, die erklären, wie man mit einer Packung Pfefferminzdragees aus einer Cola-Flasche einen Springbrunnen machen kann. Manche der gelangweilten Arbeitnehmer entwickeln gar eine eigene Geschäftsidee und planen dann ihre zukünftige Selbstständigkeit am Arbeitsplatz. Dass all dies nicht mehr unter die Kategorie der kreativen Pausen am Arbeitsplatz fällt, erklärt sich wohl von selbst.
Es gibt Softwarefirmen, die können haargenau ausrechnen, wie viel Zeit sich mit schnelleren Programmen oder Rechnern sparen ließe. Auf 500 Mitarbeitende kommen dann schnell zwei Arbeitsstellen in einem Jahr – und das allein wegen der Wartezeiten, die durch zu langsame Hard- und Software entstehen. Trotz allem sprechen wir aber nur von ein paar Sekunden pro Tag und Mitarbeiter. Eine lächerliche Größe, verglichen mit der Zeit, in der viele Menschen ganz einfach nicht arbeiten und trotzdem im Büro sitzen. Da gehen täglich Stunden verloren, weil sie anderes tun, als sich der eigentlichen Arbeit zuzuwenden.
Salary.com und AOL haben ausgerechnet, dass die USA das oben beschriebene Phänomen über 750 Milliarden Dollar oder über 5.000 US-Dollar pro Arbeitnehmer und Jahr kostet. Gemäß der Gallup-Studie belaufen sich die Schätzungen des gesamtwirtschaftlichen Schadens in Deutschland auf über 250 Milliarden Euro. Auch wenn die Zahlen hoch gegriffen sind: Unterforderung, Desinteresse und Langeweile sind offenbar – der Globalisierung zum Trotz – wesentliche Elemente der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts und stellen in ihren Auswirkungen einen erheblichen Kostenfaktor dar.
Weil die vielen unzufriedenen Arbeitnehmer lieber private Dinge an ihrem Arbeitsplatz erledigen, statt gegen ihr missliches Gefühl anzuarbeiten, könnte man sich verleitet fühlen, ihnen selbst die Schuld für ihre Misere in die Schuhe zu schieben und sie gar als grundsätzlich faul zu bezeichnen. Davor sollten Sie sich jedoch hüten. Denn die genannten Umfragen zur Unzufriedenheit lassen auch erkennen, dass gerade unterforderte Arbeitnehmer die unzufriedensten sind – sie würden gerne mehr leisten. Doch entweder sind sie im falschen Beruf gelandet, oder ihr Unternehmen lässt sie genau dies nicht tun.
Paradoxerweise wendet der unzufriedene Arbeitnehmer verschiedene Verhaltensstrategien an, um beschäftigt zu wirken und sich zusätzliche Arbeit vom Leibe zu halten. Paradox ist dieses Verhalten deshalb, da genau diese Strategien den Zustand der Unzufriedenheit zementieren. Der Arbeitnehmer tut dies, weil er davon ausgeht, es sei erstrebenswert, bei der Arbeit wenig bis nichts zu tun. Die Wahrheit lautet jedoch anderes: Ein über längere Zeit andauerndes Nichtstun bei der Arbeit ist nicht mehr und nicht weniger als der blanke Horror. Immer nur vorzuspiegeln, man sei beschäftigt, wird mit der Zeit anstrengend und ist vor allem unbefriedigend. Herausforderung und Anerkennung fehlen. Seine Unzufriedenheit schleppt der Arbeitnehmer nach Arbeitsschluss auch noch mit nach Hause.
Ist ein Arbeitnehmer unterfordert, desinteressiert und unendlich gelangweilt und versucht zudem – paradoxerweise – diesen Zustand aktiv zu erhalten, dann leidet er eindeutig am Boreout.
Mit Hilfe der folgenden Fragen finden Sie heraus, ob Sie selbst oder Bekannte von Ihnen vom Boreout betroffen sind. Antworten Sie mit Ja oder Nein. Ein Ja setzen Sie immer dann ein, wenn Sie mehrmals im Monat die abgefragten Dinge tun oder empfinden.
Nr.FrageAntwort 1 Erledigen Sie private Dinge während der Arbeit? 2 Fühlen Sie sich unterfordert oder gelangweilt? 3 Tun Sie ab und zu so, als ob Sie arbeiten würden – tatsächlich haben Sie aber nichts zu tun? 4 Sind Sie am Abend müde und erschöpft, obwohl Sie überhaupt keinen Stress hatten? 5 Sind Sie mit Ihrer Arbeit eher unglücklich? 6 Vermissen Sie den Sinn in Ihrer Arbeit, die tiefere Bedeutung? 7 Könnten Sie Ihre Arbeit eigentlich schneller erledigen, als Sie dies tun? 8 Würden Sie gerne etwas anderes arbeiten, scheuen sich aber vor dem Wechsel, weil Sie dabei zu wenig verdienen würden? 9 Verschicken Sie während der Arbeit private E-Mails an Kollegen? 10 Interessiert Sie Ihre Arbeit nicht oder wenig?Wenn Sie mehr als viermal ein Ja eingesetzt haben, leiden Sie am Boreout oder sind auf dem schlechtesten Weg dorthin. Mit diesem Buch können Sie in Erfahrung bringen, was das ist und was Sie dagegen tun können.
Der Boreout – Begriff, Elemente und Entwicklung
Der Begriff Boreout besteht aus den beiden englischen Wörtern „bore“ – Langweiler – und „out“ – außen. Die Kombination beider Wörter ergibt so etwas wie ein Ausgelangweilt-Sein. Demnach ist ein vom Boreout betroffener Arbeitnehmer gewissermaßen ein Ausgelangweilter. Das heißt selbstverständlich nicht, dass mit dem Ausgelangweilt-Sein die Langeweile beendet wäre und somit wieder Abwechslung und Spannung vorherrschen würden. Im Gegenteil: Die Langeweile wird dermaßen unerträglich, dass sich für den Betroffenen neue, viel schlimmere Dimensionen auftun.
Der Boreout als das Gegenteil des Burnout besteht aus den drei Elementen Unterforderung, Desinteresse und Langeweile am Arbeitsplatz. Damit verknüpft sind langfristig angelegte Verhaltensstrategien, die der Arbeitnehmer anwendet, um bei der Arbeit ausgelastet zu wirken und sich Arbeit vom Leibe zu halten. Einerseits hat jedes der drei erwähnten Elemente seinen eigenen Charakter und seine eigenen Wirkungen:
Bei der Langeweile geht es um Lustlosigkeit und um einen Zustand der Ratlosigkeit, weil man nicht weiß, was man tun soll. Die Unterforderung beschreibt das Gefühl, mehr leisten zu können, als von einem gefordert wird. Und beim Desinteresse schließlich steht die fehlende Identifikation mit der Arbeit im Vordergrund.Andererseits sind alle drei Elemente immer auch irgendwie miteinander verbunden und stehen in Wechselwirkung: Wer permanent unterfordert ist, den beginnt seine Arbeit zu langweilen. Wer sich konstant langweilt, der verliert früher oder später das Interesse an dem, was er macht. Die Boreout-Strategien sind in diesem Zusammenhang unentbehrlich. Denn wenn jemand sich bei der Arbeit langweilt, kann er dies nicht einfach so zur Schau stellen. Wer kann es sich erlauben, zum Beispiel einfach auf seinem Stuhl zu sitzen und Löcher in die Luft zu starren? Ein Arbeitnehmer kann dies keinesfalls. Er muss also zwangsläufig zu Verhaltensweisen greifen, die bei anderen den Eindruck erwecken, er sei beschäftigt und ausgelastet. Würde er diese Verhaltensweisen, genauer gesagt, diese Strategien nicht anwenden, stünde er in der Gefahr, entlassen zu werden.
Die Lektüre dieses Buches wird Sie in die Welt des Boreout führen – wie er entsteht und wie er aussieht. Sie werden nachvollziehen können, wie man sich fühlt, wenn man am Boreout leidet, sowie die daraus resultierenden Verhaltensstrategien und ihren paradoxen Charakter näher kennenlernen. Und zum Schluss werden wir Ihnen unsere Lösung vorstellen, die dabei helfen soll, aus dem Boreout-Schlamassel herauszufinden oder ihm vorzubeugen.
Der Boreout ist eine ernste Sache. Dennoch ist es bei der Beschäftigung damit wichtig, den Humor nicht zu verlieren, denn der Boreout hat paradoxerweise sogar lustige Seiten. Damit Sie auch etwas davon haben, wird ein Herr namens Alex Sie bei Ihrer Lektüre begleiten und Ihnen manch unterhaltsame Geschichte erzählen. Schließlich ist er ein profunder Kenner des Boreout. Alex wendet die Strategien bereits so perfekt an, dass er seinen Arbeitsprozess beliebig steuern und sich Arbeit vom Leibe halten kann. Sein Chef merkt nichts davon, der ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Alex ist 31 Jahre alt, arbeitet irgendwo auf dieser Welt in irgendeinem Büro – an irgendeinem Schreibtisch. Alex könnte fast überall auftauchen. In vielen von uns steckt etwas von Alex.
Das Verhältnis des Boreout zum Burnout
Obwohl der Boreout das Gegenteil des Burnout ist, stehen sie in einer engen Beziehung zueinander. Wie bei der Beziehung zweier Brüder gibt es neben den Unterschieden auch viele Gemeinsamkeiten. Zudem sind Brüder – selbstverständlich – miteinander verwandt. So verhält es sich auch beim Boreout und Burnout: Wer am Burnout leidet, ist gestresst, hat zu viel Arbeit und opfert sich bis zum Kollaps für das Unternehmen und seine Arbeit auf. Für Boreout-Betroffene hingegen existiert das Wort Stress nicht, sie sind meilenweit davon entfernt, sich bei der Arbeit auch nur ansatzweise verausgaben zu müssen. Vielmehr wissen sie meistens gar nicht, was sie überhaupt tun sollen. Das ist das Gegensätzliche unserer beiden Brüder. Gemeinsam haben sie viele der Symptome, die sich aufgrund der unbefriedigenden Situation am Arbeitsplatz bemerkbar machen. Das Verwandtschaftliche der beiden tritt schließlich klar zutage, wenn wir betrachten, wie sich die zwei Brüder in einem Team verhalten, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und dass sie ähnlich wie Yin und Yang in einer Beziehung zueinander stehen.
Betrachten wir deshalb den Boreout und den Burnout als Bestandteile eines Systems. Das System ist ein Team, das aus einem Chef und seinen Mitarbeitenden besteht. Dieses Team muss eine bestimmte Menge an Arbeit erledigen. Doch einige Personen des Teams neigen dazu, mehr zu arbeiten, als sie eigentlich müssten. Damit nehmen sie ihren Kollegen auch Arbeit weg. Mit der Zeit verausgaben sie sich derart, dass sie beginnen, am Burnout zu leiden. Ihre Kollegen wiederum haben das Problem, dass immer weniger Arbeit für sie übrig bleibt. Sie beginnen sich zu langweilen, sind unterfordert und desinteressiert. Die frei gewordenen Zeit nutzen sie für andere, private Dinge, an denen sie vorerst mehr Gefallen finden: im Internet surfen, Spiele spielen, Anrufe erledigen und ein Buch lesen oder sogar schreiben – wir haben es weiter oben schon aufgezählt. Sie leiden am Boreout. Gleichzeitig beginnen sie, den Eindruck zu vermitteln, stets beschäftigt zu sein. Das Ziel ist, sich zusätzliche Arbeit möglichst vom Leibe zu halten. Denn diese neue freie Zeit gefällt ihnen, zumindest zu Beginn – sie verfallen dem süßen Gift des Nichtstuns. Die Rechnung geht meistens auf: Weil sie ausgelastet erscheinen, erhalten sie entsprechend weniger Arbeit. Und genau diese Arbeit wird wieder durch die gestressten Arbeitnehmer erledigt, die dadurch noch gestresster werden. Es entsteht ein Kreislauf, der sich selbst am Leben erhält und durch das Verhalten der involvierten Personen eine Eigendynamik entwickelt.
Die vorangehende Grafik zeigt diese grundsätzlichen Zusammenhänge der Arbeitsverteilung in einem Team im Lichte der beiden Phänomene Burnout und Boreout. Hier beeinflusst das Verhalten des einen das Verhalten des anderen: Der Stress desjenigen, der am Burnout leidet, bedingt die Langeweile des Kollegen mit einem Boreout. Und umgekehrt. Eine Beziehung, in der Ursache und Wirkung in der Spirale oder im Teufelskreis verwischen.
Vergessen wir jetzt jedoch den Burnout und betrachten wir die einzelnen Elemente des Boreout einmal genauer. Wir werden sehen, was sie genau ausmacht, wie ein betroffener Arbeitnehmer Momente der Unterforderung, des Desinteresses und der Langeweile wirklich erlebt und was ihm dabei den lieben langen Tag durch den Kopf schwirrt.
Element 1: Die Unterforderung
Ein Arbeitnehmer ist unterfordert, wenn er das Gefühl hat, bei der Arbeit eigentlich mehr leisten zu können, als dies gerade der Fall ist. Anders ausgedrückt: Was vom Unternehmen an Arbeitsleistung gefordert wird, liegt unter den Möglichkeiten des Arbeitnehmers. Die Unterforderung besteht aus zwei Elementen, einem quantitativen und einem qualitativen.
Das quantitative Element betrifft das Wieviel an Arbeit. In diesem Falle hat der Arbeitnehmer einfach zu wenig zu tun, es gibt zu wenig Arbeit oder die vorhandene Arbeit ist auf die immer gleichen Personen verteilt, zu denen er nicht oder nur am Rande gehört. Eigentlich erwartet man, dass es so etwas in einer von Stress und Verdichtung dominierten Arbeitswelt gar nicht gibt. Doch die bereits zitierte US-amerikanische Umfrage von Salary.com und AOL bestätigt, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer über zwei Stunden Stunden pro Tag mit Surfen oder Plaudern „verplempert“. Die Befragten liefern die Erklärung, warum sie über so viel freie Zeit am Arbeitsplatz verfügen, gleich mit: Ein Drittel von ihnen gab an, der Grund sei der Mangel an genügend Arbeit.
Das qualitative Element betrifft das Was, den Inhalt der Arbeit. Für einen unterforderten Arbeitnehmer ist das, was er erledigen soll, zu einfach, oder er bekommt keine wirkliche Verantwortung, etwas zu gestalten oder zu verändern. Er könnte aber aufgrund seines Wissens und seiner Fähigkeiten mehr für das Unternehmen leisten. Die Betonung liegt auf „könnte“, denn das Unternehmen lässt ihn nicht. Stattdessen muss er die wenig herausfordernden Aufgaben übernehmen, Routinearbeiten, immer das Gleiche, während die wirklich spannenden und verantwortungsvollen Tätigkeiten auf den Schreibtischen anderer Personen landen, oft auch bei den Chefs höchstpersönlich.
Wie fühlt sich der unterforderte Arbeitnehmer? In erster Linie unzufrieden. Gemäß der Umfrage von Kelly Services stellen die unterforderten Arbeitnehmer mit 44 Prozent die größte Gruppe der Unzufriedenen, sie sind in der Summe noch unzufriedener als die gemäß eigener Aussage gestressten Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer fühlt sich nutzlos, da er sein Bedürfnis, seine Fähigkeiten einzusetzen, nicht befriedigen kann. Wer auf Dauer keine Möglichkeit hat, sich zu profilieren, wird schnell unterschätzt und erhält keine Bestätigung. Klar: Nicht jeder hat damit ein Problem. Diejenigen, die kein Bedürfnis nach Sinnstiftung haben, können gut mit der Unterforderung umgehen. Andere jedoch bekommen schnell ein Problem, wenn ihnen immer zu wenig oder das Falsche zugemutet wird. Für diesen unterforderten Arbeitnehmer stiftet die Arbeit schnell keinen Sinn mehr. Eine vormals positive Grundeinstellung wird ersetzt durch die „Es-bringt-ja-ohnehin-nichts“-Einstellung.
Auch Alex tut immer dasselbe. Tagein, Tagaus. Zwar meinten bereits die alten Römer, die Wiederholung sei die Mutter der Studien. Aber für Alex ist sie eben auch die Mutter seiner Unterforderung.
Am Bleistift zu kauen ist an und für sich nichts Problematisches. Viele Menschen bearbeiten ihre Schreibstifte auf diese Art, wenn sie nachdenken. Bei Alex besteht der Unterschied darin, dass er seine Bleistifte päckchenweise zerkaut. Es ist keineswegs so, dass er dies nur beim Nachdenken tut: Bei ihm ist es ein Zeichen von akuter Unterforderung. Alex erledigt seine Projekte wie ein Fließbandarbeiter. Gerade eben hat er von seinem Chef einen neuen Auftrag erhalten: Er soll einen Kostenvoranschlag machen. Sein Chef ist – wie immer bei potenziellen Kunden – hell begeistert. Alex sieht jedoch nur die tausendste Wiederholung des Immer-gleichen. „Wir machen es nicht einfach nur über den Preis, sondern über die Qualität und den Preis. Dann sind wir unschlagbar!“ Alex hört abwesend seinem Chef zu, der diese Kombination für einmalig und völlig innovativ hält, und gähnt innerlich. Natürlich sind seine Offerten gut und er holt auch laufend neue Kunden, aber der Trick ist einfältig und nicht neu: Für die repetitiven Arbeiten werden günstige Studenten eingestellt, deren Löhne weit unter denjenigen liegen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Mit dem Gewinn daraus werden die restlichen Positionen quersubventioniert. Wie spannend. Alex schreibt den Kostenvoranschlag – wie immer – im Copy-Paste-Verfahren. Für das Unternehmen hat konstante Unterforderung mit der immer gleichen Aufgabe natürlich einen großen Vorteil: Man wird extrem effizient. Alex jedoch kann Kostenvoranschläge nicht mehr sehen, sie hängen ihm zum Hals raus. Zum Glück gibt’s Sudoku online, da kann er Multitasking betreiben.