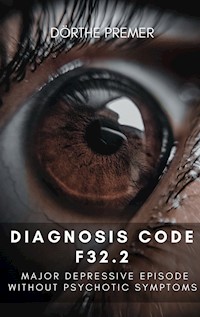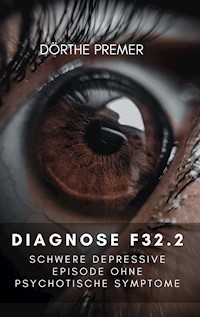
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
PSYCHOPATHOLOGISCHER BEFUND Die Patientin ist wach, bewusstseinsklar und voll orientiert. Gepflegtes Erscheinungsbild. Aufmerksamkeitsstörungen. Keine mnestischen Defizite. Formales Denken eingeengt auf depressive Inhalte. Gedankenabreißen. Äußerungen nehmen beinahe zerfahrende Ausmaße an. Grübeln. Gedankendrängen. Zukunftsängste. Kein Wahn. Keine Halluzinationen. Keine Ich-Störungen. Im Affekt ratlos. Gefühl der Gefühllosigkeit. Insuffizienzerleben. Ambivalenz. Antrieb reduziert. Psychomotorik reduziert. Kein selbstverletzendes Verhalten. Äußerungen von Lebensüberdruss. Konkrete Suizidgedanken nicht auszuschließen. Nicht sicher von akuter Suizidalität distanziert. Kein Hinweis für Fremdgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WIDMUNG
Dieses Buch widme ich allen, die die beschissene Diagnose F32.2 erhalten haben. Ihr kommt aus der Scheiße wieder raus!
Auch wenn ihr nicht dran glaubt. Haltet durch und baut keinen Mist!
An alle Angehörigen: Seid geduldig und besonders für eure Liebsten da! Nur mit euch werden sie es schaffen!
INHALT
PROLOG
FREIER FALL
EASY LEBEN
SCHLAFLOS
DAS ENDE DER WELT
RÜCKZUG
WAISENHAUS, TESTAMENT, VERHUNGERT
ANZIEHUNGSKRAFT
EINLIEFERUNG
TAG X, 12.12.2021
EXPLOSION
TEILGESCHLOSSENE ANSTALT
PILLEN, PILLEN, PILLEN
THERAPIEN
WEIHNACHTEN UND SILVESTER IN DER KLAPSE
DER WEG RAUS
FAHRLÄSSIG
MEHR ÄRZTE
STOPP!
HEILUNG
PROLOG
Da saß ich also. Im Wohnzimmer meiner Eltern, im tiefsten Loch meines Gehirns gefangen. Ein leerer Blick, tief in der Hocke. Nur noch der Gedanke an diese beschissene Nagelschere, die ich mir einfach irgendwie in die Unterarme rein rammen könnte.
Dieses kleine, silberne, spitze Stück würde schon reichen, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich müsste sie nur tief genug rein stechen und einen Schlitz entlang der Pulsader ziehen. Am Besten in der Dusche und wenn meine Eltern dann vom Spaziergang mit meiner kleinen Tochter zurückkommen würden, wäre ich einfach nicht mehr da.
Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr…
FREIER FALL
EASY LEBEN
Es gab überhaupt keinen Grund, in eine Depression zu rutschen. Ich hatte in meinem Leben bisher Go-Kart-Crashs, Verletzungen im Leistungsturnen, die heftigsten „Wipeouts” beim Surfen, Erdbeben, Denguefieber, eine Hundeattacke und eine Hausgeburt überlebt. Dass ich ausgerechnet in eine psychische Krankheit rutschen würde und an dieser fast gestorben wäre, hätte ich niemals für möglich gehalten.
Eigentlich hatte ich alles, was ich wollte, sogar noch etwas mehr als das. Ich hatte alle Ziele, die ich mir unterbewusst gesetzt hatte, erreicht. Mein Kindheitswunsch, irgendwann bei BMW zu arbeiten und dann auch noch im Design Bereich, war geschafft.
Ich hatte meine Wohnung in München, ein tolles Auto und ein easy Single Leben, eine tolle Familie und viele Freunde. Noch dazu reichlich Geld.
Doch irgendwie hatte ich trotzdem seit Montags darauf gewartet, dass endlich wieder Wochenende war.
Die Arbeit hatte mich maximal zwei Jahre am selben Ort und beim gleichen Arbeitgeber bleiben lassen. Wirklich Spaß hatte ich kaum dabei. Wobei das Mittagessen bei BMW und die Ritter Sport nachmittags schon ziemlich gut waren. Auch die Kollegen waren top. Die Arbeit an sich war nicht wirklich „Arbeit“. Ich hatte eigentlich nur versucht, die Zeit rumzubringen, um so schnell wie möglich wieder Feierabend machen zu können.
Irgendwann hatte mich das Surffieber gepackt und der Moment, an dem mir klar wurde, wie absurd eigentlich die Arbeit war, die ich den ganzen Tag „erledigte“, hatte mein Leben radikal verändert.
Es war der Moment, als ich in einem abgefuckten Jeep auf Fuerteventura mit Surfboards auf dem Dach saß und das „Kombi“ (Anzeige hinter dem Lenkrad) anstarrte. Dort gab es nur drei verschiedene analoge Anzeigen: Den Tank-füllstand, die Geschwindigkeitsanzeige und die Motortemperatur. Alle drei Nadeln auf „0“, trotz fahrendem Auto. Keiner hatte sich beschwert.
Am nächsten Tag saß ich wieder schick gekleidet in München bei BMW im Meeting und es wurde darüber diskutiert, ob der Kunde im „Kombi“ bemerken würde, dass die digitale Anzeige zwei Pixel nach rechts verschoben und mit etwas kräftigerem Grün versetzt war. „What the fuck!“ Jetzt reichte es, ich machte Schluss und wollte kündigen. In dem Moment wurde mir einfach klar, wie sinnlos die Arbeit war (zumindest für mich). Ja, der Geldtropf war stark… Aber sollte ich mal ans Limit kommen, könnte ich ja jederzeit wieder anfangen. Trotzdem hatte es vier Monate gedauert, bis ich tatsächlich einen Schlussstrich unter BMW zog und meine Kündigung einreichte.
Tränen waren geflossen. Der Abschied war sehr schwer aber schön und mit vielen Kollegen und Kolleginnen. Es gab einige, von denen hätte ich nicht gedacht, dass eine Reaktion auf meine Abschiedsmail kommen würde. Viele mit Respekt und vielleicht ein bisschen Neid, dass ich diesen Schritt wagte. Klar, ich hatte nicht viel zu verlieren. Keinen Partner oder Kinder. Trotzdem immer noch eine Wohnung in München, die bezahlt werden wollte.
Ich fing in einem kleinen Surf Café in München an zu arbeiten. Just for fun. Ich kannte die Besitzer aus meiner Kindheit und die ganze Arbeit hatte mich mehr mit dem Surfen verbunden. Obwohl es nur um Kaffeekochen ging. Egal, irgendwie hatte es Spaß gemacht. Viele „BMWler“ kamen hin und wieder zu Besuch, um den besten Kaffee Münchens bei ein paar Surfvideos zu genießen. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem auch das keinen Spaß mehr machte. Ich war immer noch nicht am Meer sondern in einer Großstadt, nur jetzt mit der Hälfte des Gehalts. Der Fun-Faktor schwand. Außerdem hatte ich bisher kaum etwas von der Welt gesehen. Der Gedanke, einmal alles zu kündigen, was ich so im Leben hatte und einfach loszuziehen ohne Plan wuchs…
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich alles was ich hatte, kündigte.
Meine Wohnung, meine Berufsunfähigkeitsversicherung, meine Handyversicherung, sämtliche Verträge. Alles, bis auf meinen Handyvertrag und meine Krankenversicherung. Es fühlte sich verdammt gut an.
Befreiend, minimalistisch.
Ich war noch nie die Person, die wirklich viele Gegenstände besessen hat. Auch die Anzahl an Kleidung war überschaubar. Mit den letzten paar Umzugskartons bin ich also wieder zu Hause bei meinen Eltern eingezogen und habe ein One-Way Ticket nach Sri Lanka gebucht.
Das Ziel: Einmal mit dem Surfboard um die Welt, ohne Plan.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin in Portugal hängen geblieben. Dort habe ich meinen Verlobten kennengelernt und wir haben eine kleine Tochter bekommen. Ich wollte nie Mutter werden und erwartete nicht, dass ich mal eine sein würde. Meinem Mann ging es ebenso. Wir waren uns in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Aber wir entschieden uns definitiv für den kleinen Wurm und zweifelten keinen Moment daran, sie in die Welt zu setzen. Wir waren beide Surfer aus Leidenschaft, waren viel gereist, hatten viele verschiedene Arbeitgeber und sind letztendlich im Surf- und Tourismusbereich hängen geblieben.
Theoretisch schien alles perfekt.
Wir hatten eine kleine Wohnung direkt hinter der Düne an Portugals Silver Coast in Peniche, der „Hauptstadt der Wellen“, einem perfekten Ort zum Surfen. Der Ort, an dem ich das erste Mal in meinem Leben den Moment erlebte, etwas gefunden zu haben, was mir wirklich Spaß machte. Der Moment purer Zufriedenheit.
Das war 2017 während meines zweiten Surfurlaubs überhaupt. Drei Jahre später, nach vielen Abenteuern (ich berichte gerne) wohnte ich dort mit Mann und Kind. Die Geburt fand in Deutschland statt und nach knapp vier Wochen sind wir wieder nach Portugal geflogen. Ich dachte, so ein Kind schleppt man einfach mit.
Dachte ich, bis alles den Bach runter ging.
SCHLAFLOS
Ich war noch nie die beste Schläferin, geschweige denn eine Person, die viel Schlaf benötigte, um den Tag fit zu überstehen. Fünf bis sechs Stunden pro Nacht reichten und der Tag konnte kommen. Ich erinnere mich, mal als Kind in einem Kidscamp gewesen zu sein und nächtelang wach gelegen zu haben. Alle konnten schlafen, nur ich nicht. Ich lag bis morgens um sechs Uhr wach da, um dann für eine Stunde kurz weggenickt gewesen zu sein und danach wieder fit den Tag zu meistern. Als stillende Mutter kam mir das zu Gute.
Ich hatte kaum ein Problem, Kraft für den Tag zu haben nachdem ich drei Mal für jeweils eine Stunde nachts gestillt oder gewickelt hatte. Auch vor der Mutterrolle hatte ich unfassbar schlecht geschlafen. Nachts hatte mich das zwar genervt, wenn alle schnarchend da lagen und super erholt aufgewacht waren, aber tagsüber hatte ich das meistens wieder vergessen.
Wenn ich schlafen konnte, musste es stockfinster sein und mucksmäuschenstill. Selbst das kleinste Stand-by-Lichtchen störte mich. Leider hatten wir in unserer winzigen Wohnung in Peniche nur ein kleines „Loch“ zum Schlafen. Der Besitzer hatte einfach eine Wand zwischen Wohnzimmer und „Schlafzimmer“ hochgezogen mit verein-zelten Glaslichtbausteinen versetzt, damit etwas Licht in den fensterlosen Raum kam.
Die Tür mussten wir aushängen, da ansonsten das Babyreisebett nicht reingepasst hätte. Mein Mann liebte es, bis spät nachts Fernsehen zu schauen, während ich versuchte sobald die Kleine in den Schlaf gefallen war, selbst schlafen zu gehen. Ich wusste ja, dass ich alle zwei Stunden wieder aufstehen musste, um zu stillen. Meine Licht- und Geräuschempfindlichkeit, vor allem wenn es um Schlaf ging, wurde extrem herausgefordert. Bis ich fast komplett ausgeflippt wäre.
Mich hatte es einfach so krass auf die Palme gebracht, den wenigen Schlaf den ich bekommen hatte, auch noch zu erkämpfen. Die Reizbarkeit wurde auch tagsüber immer größer. Mein Mann, der meistens ewig lange Sessions Surfkurse draußen am Strand gegeben hatte und ich, die als Hausfrau daheim mit kleinem Baby saß. Das war wirklich nicht das, was ich mir erträumt hatte. Das Surfen kam auch viel zu kurz. Klar, ich war nicht fit (logisch nach einer Geburt). Ich versuchte aber irgendwie auch raus zu gehen. Ich hatte mich kilometerlangen Strandspaziergängen gewidmet statt dem Wochenbett. Hatte alle belächelt, die einen Rückbildungskurs gemacht oder sich ewig im Bett auskuriert hatten. Das hatte ich nicht nötig (dachte mein Hirn).
Ich lief bis zu zwölf Kilometer pro Tag mit der Kleinen in der Trage. Dazwischen immer mal wieder Pause zum Stillen und Wickeln.
Ab und zu mal eine Surfsession, bei der jeder „Wipeout“ Schmerzen im Becken bedeutete.
Und dann war da noch Corona. Ein Thema, bei dem die Meinungen drastisch auseinandergingen. Dass es einen irgendwann mal erwischt, haben glaube ich die Meisten mittlerweile begriffen. Dass man nicht unbedingt davon sterben muss, auch. Irgendwann hatte es bei uns dann auch zugeschlagen. Ich war an einem Wochenende mit meinem Mann und der Kleinen bei der Schwiegermutter zu Besuch (ca. 100 km von zu Hause). Morgens hatte ich schon gemerkt, dass mein ganzer Körper kaputt war und mir alles weh tat. Wir wollten eigentlich nur unseren Campervan abholen und ein bisschen sauber machen.
Für mich selbst war es allerdings eine Tortur. Meine Lunge hatte den Tag vorher beim Strandspaziergang auch schon weh getan. Abends wollten wir dann wieder heimfahren. Mein Mann den Van und ich unser Auto. Die Kleine hatte extrem gestresst während dem ganzen Trip und ich war einfach nur noch fertig. Fieber hatte ich mittlerweile auch. Ich war einfach nur froh, dass sie als wir heim kamen, einfach eingeschlafen war. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich fiel direkt ins Bett und schlief, genauso wie sie. Normalerweise bin ich kaum bis nie krank und wenn, dann ein, zwei Tage mal schlapp und Fieber. Das Gleiche hatte ich zu der Zeit auch. Meinem Mann ging es noch ein paar Tage gut und dann hatte es ihn komplett zerlegt.
Ich selbst war mittlerweile wieder fit. War zwei Tage kaputt, dann ging’s wieder. Ich hatte auch keinen Test gemacht, da ich ehrlicherweise keine Unterstützerin der Coronatests war und das alles für übertrieben hielt.
Mein Mann war zu der Zeit noch etwas anderer Meinung. Als es ihn dann richtig zerlegt hatte, ging er direkt zum Testen und war natürlich „positiv“. Das bedeutete Quarantäne für die komplette Familie für 10 Tage. Ich war ausgerastet. Wer sollte mich in eine kleine Wohnung einsperren, noch dazu gesund? Der Hauptscherz kam aber noch.
Das portugiesische Gesundheitsamt hatte bei uns bis zu vier Mal am Tag angerufen, um zu wissen, wie es uns ging und um unsere Quarantäne zu überprüfen. Mir hatte es endgültig gereicht. Dann kam noch ein Anruf, bei dem sie meinem Mann klarmachen wollten, dass ich noch zum Testen gehen sollte. Dafür dürfte ich die Wohnung verlassen. Nur die Post durfte ich nicht reinholen, geschweige denn, den Müll rausbringen (verstehe einer die Logik).
Und das i-Tüpfelchen: Meine Quarantäne sollte noch fünf Tage länger dauern, als die von meinem Mann. Ich habe weder irgendein Schreiben bekommen, noch eine sinnvolle Antwort auf folgende Fragen:
1. Warum ist meine Quarantäne länger als seine?
2. Wofür dann ein Test?
3. Was ist, wenn ich positiv bin?
4. Was ist, wenn ich negativ bin?
Und so weiter.
Da war für mich alles aus. Den Test hatte ich dann doch gemacht, weil ich einfach Ruhe haben und auch die Beziehung nicht gefährden wollte. Zehn Tage zu Hause auf engstem Raum hinter den Dünen in der Hochsaison. Mit kleinem Baby, das dann auch noch krank wurde. Und so begann der Absturz.
Von Tag zu Tag hatten wir weniger gemacht.
Mein Schlaf wurde immer schlechter. Ich konnte kaum noch schlafen und irgendwann dann gar nicht mehr. Die Quarantäne war für meinen Mann vorbei und ich hatte ihn zur Wahl gestellt. Entweder er würde mich aus der Wohnung gehen lassen, oder ich würde mich einliefern lassen, da ich zusehends verrückt wurde.
Also hatte er sich dazu bringen lassen, dass wir wieder raus gegangen sind (gegen die „offizielle“