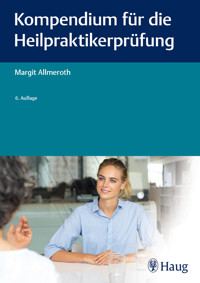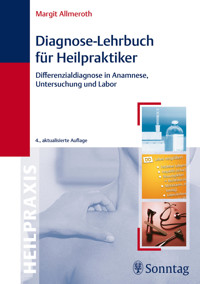
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sonntag, J
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kurz und knapp - aber doch verständlich - das relevante Wissen zur Diagnostik für die Heilpraktikerprüfung. Alles Wichtige von der klinischen Anamneseerhebung über die körperlichen Untersuchungsmethoden bis hin zur laborchemischen Differenzialdiagnose. Die mündlichen, körperlichen und labortechnischen Befunde werden jeweils differenzialdiagnostisch dokumentiert. Mit dem Fragentrainer das spezielle Wissen für die Prüfung lernen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Diagnose-Lehrbuch für Heilpraktiker
Differenzialdiagnose in Anamnese, Untersuchung und Labor
Margit Allmeroth
4., aktualisierte Auflage
75 Abbildungen
Sonntag Verlag · Stuttgart
Bibliografische Information
der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Anschrift der Autorin:
Margit Allmeroth
Hermannstr. 8
40233 Düsseldorf
1. Auflage 2002
2. Auflage 2004
3. Auflage 2006
© 2009 Sonntag Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH + Co. KG Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart
Unsere Homepage: www.sonntag-verlag.com
Umschlaggestaltung: Thieme Verlagsgruppe
Umschlagfotos: Julia Schaub, Photodisc
Fotografien im Text von Julia Schaub
eISBN: 978-3-8304-9321-1
1 2 3 4 5 6
Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht.
Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Klassische Anamneseerhebung mit differenzialdiagnostischen Überlegungen
1 Anamneseerhebung
1.1 Aufnahme der persönlichen Daten
1.2 Abklärung eines dringend therapiebedürftigen Geschehens
1.3 Ermittlung der aktuellen Symptomatik
1.4 Verschaffung eines Systemüberblicks
1.5 Psychosoziale Aspekte
1.6 Medikamentenanamnese
1.7 Die Frage nach Vorerkrankungen
1.8 Familienanamnese
1.9 Auslandsanamnese
2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
2.1 Fieber
2.1.1 Fiebertypen
2.2 Nachtschweiß
2.3 Schmerzen
2.3.1 Rückenschmerzen
2.3.2 Kopfschmerzen
2.3.3 Thoraxschmerzen
2.3.4 Bauchschmerzen
2.3.5 Extremitätenschmerzen
2.4 Veränderung des Körpergewichts
2.4.1 Gewichtszunahme
2.4.2 Gewichtsverlust
2.5 Essverhalten
2.5.1 Appetitlosigkeit (Anorexie)
2.5.2 Heißhunger
2.6 Übelkeit/Erbrechen
2.6.1 Bluterbrechen (Hämatemesis)
2.7 Stuhlverhalten
2.7.1 Diarrhoe
2.7.2 Obstipation
2.7.3 Farbveränderungen des Stuhls
2.7.3.1 Melaena (Teerstuhl)
2.7.3.2 Hämatochezie (Blutstuhl)
2.7.3.3 Dunkler Stuhl
2.7.3.4 Entfärbter bzw. heller Stuhl
2.8 Trinkverhalten
2.8.1 Polydipsie
2.8.2 Vermindertes Trinkverhalten
2.9 Urinverhalten
2.9.1 Polyurie
2.9.2 Anurie
2.9.3 Nykturie
2.9.4 Farbveränderungen des Urins
2.10 Atemnot (Dyspnoe)
2.11 Husten
2.12 Sputum
2.13 Schluckbeschwerden (Dysphagie)
Körperliche Untersuchungsmethoden mit differenzialdiagnostischen Überlegungen
1 Überprüfung der Vitalzeichen
1.1 Blutdruckmessung
1.2 Pulsprüfung
1.3 Atemfrequenz
1.4 Körpertemperatur
2 Kopf und äußerer Hals
2.1 Schädel
2.1.1 Untersuchung der Nervenaustrittspunkte (N. trigeminus)
2.1.2 Palpation der Arteria temporalis
2.1.3 Perkussion der Schädelkalotte
2.2 Mund und Rachen
2.2.1 Lippen
2.2.2 Mundschleimhaut
2.2.3 Zunge
2.2.4 Rachen
2.3 Augen
2.3.1 Augenlider
2.3.2 Konjunktiven/Skleren
2.3.3 Augenbulbi (Augäpfel)
2.3.4 Pupille
2.3.5 Augenbulbi
2.4 Ohren
2.4.1 Palpation des Tragus und des Mastoids
2.4.2 Hörweitenprüfung
2.4.3 Differenzierung zwischen Schallleitungs- und Schallempfindungsstörungen
2.4.4 Prüfung der Tubendurchlässigkeit
2.4.5 Gleichgewichtstest
2.5 Nase und Nasennebenhöhlen
2.5.1 Palpation der Nasennebenhöhlen
2.6 Äußerer Hals
2.6.1 Palpation der Schilddrüse
2.6.2 Auskultation der Schilddrüse
2.6.3 Auskultation der Gefäße
2.6.4 Prüfung der Halswirbelsäulenmotilität
3 Thorax
3.1 Der knöcherne Thorax und Lunge
3.1.1 Die Suche nach schmerzhaften Bereichen
3.1.2 Die Beurteilung der Atemexkursion
3.1.3 Die Beurteilung des Stimmfremitus
3.1.4 Beurteilung des Klopfschalls
3.1.5 Prüfung der respiratorischen Verschieblichkeit der Lungengrenzen
3.1.6 Die Abgrenzung der Lungen von umgebenen Organen
3.1.7 Rasselgeräusche und pleurale Nebengeräusche
3.1.8 Vesikulär- und Bronchialatmen
3.1.9 Bronchophonie
3.2 Herz
3.2.1 Palpation des Herzspitzenstoßes
3.2.2 Relative und absolute Herzdämpfung
3.2.3 Herztöne
3.2.4 Herzgeräusche
3.2.5 Herzfrequenz
3.2.6 Pulsdefizit
3.3 Die Untersuchung der Brust
3.3.1 Weibliche
3.3.1.1 Palpation der Mamma
3.3.1.2 Palpation der Achselhöhle
3.3.2 Männliche
4 Abdomen
4.1 Verdauungsorgane
4.1.1 Leichte Palpation
4.1.2 Tiefe Palpation
4.1.3 Palpation der Leber
4.1.4 Palpation der Gallenblase
4.1.5 Palpation bei Verdacht auf Appendizitis
4.1.6 Palpation der Milz
4.1.7 Nachweis von Aszites
4.1.8 Mechanischer Ileus
4.1.9 Paralytischer Ileus
4.2 Urogenitalsystem
4.2.1 Harnsystem
4.2.1.1 Palpation der Nieren
4.2.1.2 Palpation der ableitenden Harnwege
4.2.1.3 Perkussion der Nieren
4.2.1.4 Perkussion der Harnblase
4.2.2 Geschlechtsorgane
5 Peripheres Gefäßsystem
5.1 Arterien
5.1.1 Prüfung der Hauttemperatur
5.1.2 Pulsprüfung
5.1.3 Testverfahren bei Verdacht auf Durchblutungsstörungen
5.2 Venen
5.2.1 Verdacht auf Phlebothrombose
5.2.2 Verdacht auf chronisch venöse Insuffizienz
6 Lymphknoten
6.1 Die Lymphknoten des Halses und Kopfes
6.2 Axilläre Lymphknoten
6.3 Inguinale Lymphknoten
7 Bewegungsapparat
7.1 Wirbelsäule
7.1.1 Seitenansicht
7.1.2 Rückseitige Ansicht
7.1.3 Vorderansicht
7.1.4 Palpation der Dornfortsätze
7.1.5 Palpation der paravertebralen Muskulatur
7.1.6 Überprüfung des Geradestandes
7.1.7 Perkussion der Dornfortsätze
7.1.8 Stauchung der Wirbelsäule
7.1.9 Testverfahren zur Beweglichkeit der Wirbelsäule
7.2 Gelenke
7.2.1 Schultergelenk
7.2.2 Ellenbogengelenk
7.2.3 Handgelenk
7.2.4 Fingergelenke
7.2.5 Hüftgelenk
7.2.6 Kniegelenk
7.2.7 Fuß- und Zehengelenke
7.2.8 Überprüfung der Temperatur
7.2.9 Palpation des Schultergelenks
7.2.10 Palpation des Ellenbogengelenks
7.2.11 Palpation des Handgelenks
7.2.12 Palpation der Fingergelenke
7.2.13 Palpation des Hüftgelenks
7.2.14 Palpation des Kniegelenks
7.2.15 Palpation der Fuß- und Zehengelenke
7.2.16 Beweglichkeitsprüfung bestimmter Gelenke
8 Nervensystem
8.1 Psychischer Befund
8.2 Körperlicher Befund
8.2.1 Untersuchung des Gangverhaltens
8.2.2 Untersuchung der Hirnnerven
8.2.3 Untersuchung der Reflexe
8.2.4 Untersuchung der Motorik
8.2.5 Untersuchung der Sensibilität
8.2.6 Spezielle Methoden
9 Haut und Hautanhangsgebilde
9.1 Haut
9.2 Haut- und Schweißdrüsen
9.3 Nägel
9.4 Haare
Laborchemische Differenzialdiagnose
Blutdiagnostik
1 Hämatologische und klinisch-chemische Laborparameter
2 Entzündungsparameter
2.1 Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG)
2.2 C-reaktives Protein (CRP)
3 Hämatologische Untersuchungen
3.1 Erythrozyten
3.2 Leukozyten
3.3 Thrombozyten
3.4 Mittlerer korpuskulärer Hämoglobingehalt (MCH)
3.5 Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV)
3.6 Mittlere korpuskuläre Hämoglobin-Konzentration (MCHC)
3.7 Hämatokrit (HKT)
3.8 Hämoglobin (Hb)
3.9 Retikulozyten
4 Blutausstrichdifferenzierung
4.1 Neutrophile Granulozyten
4.2 Basophile Granulozyten
4.3 Eosinophile Granulozyten
4.4 Lymphozyten
4.5 Monozyten
5 Weitere wichtige Laborparameter
5.1 Leberenzyme
5.1.1 Gamma Glutamyltransferase (γ-GT)
5.1.2 Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT)
5.1.3 Glutamat-Oxalazetat-Transaminase (GOT)
5.1.4 Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)
5.1.5 Cholinesterase (CHE)
5.1.6 Leuzin-Aminopeptidase (LAP)
5.2 Pankreasenzyme
5.2.1 Alpha-Amylase
5.2.2 Lipase
5.3 Kardiale Diagnostik
5.3.1 Cardiales Troponin T (cTnT)
5.3.2.1 CK-MB
5.3.3 Lactat-Dehydrogenase (LDH)
5.3.3.1 Alphahydroxybutyrat-Dehydrogenase (α-HBDH)
5.4 Nierenfunktion
5.4.1 Kreatinin
5.4.2 Harnstoff
5.5 Lipidstoffwechsel/Harnsäure
5.5.1 Triglyceride
5.5.2 Cholesterin
5.5.3 Low density lipoprotein (LDL)
5.5.4 High density lipoprotein (HDL)
5.5.5 Very low density lipoprotein (VLDL)/Chylomikronen
5.5.6 Harnsäure
5.6 Proteine
5.6.1 Protein gesamt
5.6.2 Albumin
5.6.3 Alpha1- und Alpha2-Globuline
5.6.4 Beta-Globuline
5.6.5 Gamma-Globuline
5.7 Serumelektrolyte
5.7.1 Natrium
5.7.2 Kalium
5.7.3 Calcium
5.8 Tumormarker
5.8.1 Carcinoembryonales Antigen (CEA)
5.8.2 Alpha-Fetoprotein (AFP)
5.8.3 Prostataspezifisches Antigen (PSA)
5.8.4 CA 19–9
5.9 Phosphatasen
5.9.1 Saure Phosphatase
5.9.2 Alkalische Phosphatase
5.10 Leberstoffwechsel
5.10.1 Bilirubin gesamt
5.11 Glukosestoffwechsel
5.11.1 Glukose
5.11.2 Oraler Glukose Toleranztest (OGTT)
6 Blutlabor verschiedener Erkrankungen
Urindiagnostik
1 Parameter-quantitative Urinuntersuchung
2 Harnanalyse mit differentialdiagnostischen Überlegungen
2.1 Dichte (spezifisches Gewicht)
2.2 pH-Wert
2.3 Leukozyten
2.4 Nitrit
2.5 Eiweiß
2.6 Glukose
2.7 Keton
2.8 Urobilinogen
2.9 Bilirubin
2.10 Erythrozyten/Hämoglobin
3 Übersicht Urinbefunde verschiedener Erkrankungen
Spezielles Prüfungs- und Praxiswissen
1 Fragentraining zur Anamnese und Differenzialdiagnose
2 Lösungen
3 Fragentraining zur körperlichen Untersuchung und Differenzialdiagnose
4 Lösungen
5 Fragentraining zu Labor und Differenzialdiagnose
6 Lösungen
Anhang
Über die Autorin
Literatur
Sachverzeichnis
Klassische Anamneseerhebung mit differenzialdiagnostischen Überlegungen
Definition
Unter einer Anamneseerhebung versteht man das Erfassen der Krankengeschichte, die im Gespräch mit dem Patienten (Eigenanamnese) oder dessen Angehörigen (Fremdanamnese) erfragt wird.
Zielsetzung
Ziel der Anamneseerhebung ist in erster Linie das Sammeln von Informationen, die über den Gesamtzustand des Patienten eine Auskunft geben. Idealerweise lässt der Untersuchende den Patienten im Vorfeld frei formulieren und geht währenddessen und/oder anschließend mit Fragen auf ihn ein. Durch das Gespräch sollen nicht nur ein Vertrauensverhältnis zum Patienten aufgebaut, sondern auch erste wichtige Hinweise zur Diagnosestellung gefunden werden.
Bedeutung
Da ein vom Patienten geschildertes Symptom für viele Krankheiten sprechen kann, sind differenzialdiagnostische Kenntnisse von äußerster Wichtigkeit. Stellt sich der Patient z. B. mit Bauchschmerzen vor, so könnte eine ganze Bandbreite von Erkrankungen verantwortlich gemacht werden. Durch gezieltes Fragen kann sich der Untersuchende jedoch an die mögliche Erkrankung herantasten. Neben Einfühlungsvermögen und Verständnis sollte der Untersuchende über ein breites klinisches Wissen verfügen.
1 Anamneseerhebung
1.1 Aufnahme der persönlichen Daten
Grundsätzlich nimmt man im Vorfeld neben dem Tagesdatum die persönlichen Daten des Patienten auf. Diese umfassen
den Namen,
das Alter,
das Geschlecht,
Adresse, Telefonnummer,
Familienstand und
Beruf.
Sowohl das Alter, der Beruf und das Geschlecht kann bei der Diagnosefindung richtungweisend sein. Viele Erkrankungen zeigen einen Altersgipfel auf und treten daher in einem bestimmten Alter wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher auf. Stellt sich z. B. die Symptomenkombination einer zervikalen Lymphknotenschwellung und Fieber bei einem 60-Jährigen und einem 6-Jährigen dar, so liegt bei dem 6-Jährigen wahrscheinlich eine Infektion des Hals-Kopf-Gebietes vor. Bei dem 60-Jährigen sollte hingegen nach einer chronisch lymphatischen Leukämie oder einem Hodgkin-Lymphom gefahndet werden.
Von besonderer Bedeutung ist auch das Geschlecht des Patienten. Manche Krankheiten sind beim männlichen und andere beim weiblichen Geschlecht häufiger, ohne dass in jedem Falle ein Grund bekannt ist. Männer erkranken z. B. im Verhältnis 10:1 häufiger an M. Bechterew als Frauen. Frauen hingegen leiden dreimal häufiger an rheumatoider Arthritis als Männer.
Auch der Beruf des Patienten vermag diagnostische Anhaltspunkte zu geben. Die Berufsanamnese gibt nicht nur Auskunft über die aktuelle Tätigkeit des Patienten, sie erfasst auch eine mögliche medizinisch relevante Exposition, wie z. B. chronische Stressfaktoren am Arbeitsplatz oder der ständige Kontakt mit Quarzstaub, Asbest oder anderen Berufsgiften. Einige berufsbedingte Erkrankungen können akut auftreten, wie z. B. das Kontaktekzem des Friseurs oder sich erst nach langer Karenz entwickeln (z. B. Asbestose, Silikose). Die berufsbedingten Krankheiten können je nach Gefahrenstoff bzw. Erreger eine Vielzahl von Organen treffen. Die Schäden reichen von Krebserkrankungen über Infektionen bis zu Durchblutungsstörungen.
1.2 Abklärung eines dringend therapiebedürftigen Geschehens
Nach Erledigung der Formalitäten beginnt der Untersuchende mit der Frage nach der jetzigen Erkrankung, das heißt mit welchen aktuellen Problemen begibt sich der Patient in die Behandlung? Genau an dieser Stelle, direkt zu Beginn, stellt sich neben der Blickdiagnose die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Notfallpatienten handelt oder nicht. Findet sich z. B. ein Patient mit starken Thoraxschmerzen in der Praxis ein, die vor einer halben Stunde aufgetreten sind, so müssen sich die Fragen, Untersuchungen und gegebenfalls sofortige Therapie auf das aktuelle Problem konzentrieren. In diesem Falle spielen Fragen z . B. nach dem Stuhl- und Urinverhalten oder nach dem psychosozialen Umfeld keine Rolle. Die Erhebung der Anamnese muss also an die aktuelle Situation des Patienten und die Dringlichkeit seines Krankheitsbildes angepasst sein.
Es ist sicherlich auch von Nutzen von vornherein den Blutdruck und den Puls zu überprüfen. Der ermittelte Wert kann auf einen Notfall hinweisen, spielt aber grundsätzlich bei der Diagnosefindung eine wichtige Rolle (siehe Untersuchungsmethoden, Prüfung der Vitalzeichen).
1.3 Ermittlung der aktuellen Symptomatik
Stellt sich die Problematik des Patienten nicht als Notfall dar, so ist Zeit für die Erhebung einer vollständigen Krankengeschichte, die bei jeder Erstuntersuchung vorgenommen werden sollte. Der Kontakt zwischen Untersuchendem und Patient wird am schnellsten hergestellt, wenn der Patient die ihn am meisten beschäftigenden Beschwerden zu Beginn anspricht. Die Gesprächseröffnung des Untersuchenden sollte möglichst offen sein, um den Patienten zu einem freien Bericht zu motivieren. Der Untersuchende konzentriert sich hierbei auf die geschilderten Leitsymptome, also Symptome mit hoher diagnostischer Signifikanz, und versucht diese durch Fragen an den Patienten genauer definieren zu lassen:
Beginn und Art der Beschwerden
Wann haben die Beschwerden begonnen?
Gab es ein auslösendes Ereignis?
Existieren Faktoren, die die Symptome verstärken oder erleichtern?
War der zeitliche Verlauf allmählich, akut oder periodisch?
Lokalisation
Wo genau befinden sich die Beschwerden? (Man lässt den Patienten am besten auf die Stelle zeigen.)
Strahlen die Beschwerden aus, sind sie eher oberflächlich oder tief?
Intensität
Wie sind die Beschwerden (Schmerzen) beschaffen? Dumpf, spitz, bohrend?
Gibt es Begleiterscheinungen?
Welche Umstände bessern die Beschwerden?
1.4 Verschaffung eines Systemüberblicks
Nachdem die Hauptbeschwerden erfasst worden sind, gilt es neben den Leitsymptomen und deren Nebenaspekten mit einigen Fragen auf alle Organsysteme einzugehen. Man kann sich hier auf wenige, für das jeweilige Organsystem charakteristische Fragen beschränken, die jedoch im Falle eines Befundes ebenfalls vertiefend abgefragt werden sollten. Dies ist nicht nur der Vollständigkeit halber erforderlich, sondern auch, um Fehldiagnosen zu vermeiden, da sich hinter den vom Patienten anfangs beschriebenen Symptomen möglicherweise andere Krankheiten verbergen können, als anfangs vermutet wird.
Die nachfolgend in Kurzform dargestellten Fragen ermitteln neben den persönlichen Fragen den Allgemeinzustand der wichtigsten Organsysteme:
Anamnese-Leitfaden
1.5 Psychosoziale Aspekte
Jedes Erstgespräch sollte neben medizinischen auch psychosoziale Informationen enthalten. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, den Patienten besser kennen zu lernen und sein medizinisches Problem in einem psychosozialen Zusammenhang zu sehen.
Sexualverhalten
Fragen hinsichtlich der Sexualität spielen bei vielen medizinischen Problemen eine Rolle. Patienten mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern neigen eher zu Erkrankungen wie AIDS oder Hepatitis B und C. Dies gilt auch für homosexuelle Patienten. Weiterhin können viele Krankheiten für ein vermindertes Sexualverhalten bzw. Impotenz verantwortlich gemacht werden.
Lebensgewohnheiten
In diesem Zusammenhang spielt der Konsum von Alkohol, Nikotin und Drogen eine Rolle. Alkoholiker leiden typischerweise an Schäden der Leber und des Nervensystems. Das Rauchen ist hingegen für die Entstehung von Gefäß- (KHK, arterielle Verschlusskrankheiten) und Pulmonalerkrankungen (Bronchialkarzinom, chronische Bronchitis, Lungenemphysem) verantwortlich. Bei Drogensüchtigen fällt eine Häufung von speziellen Krankheitsbildern in so genannten Risikogruppen auf, z.B. Virushepatitis B und C, AIDS.
Freizeitgestaltung
Neben Berufskrankheiten müssen auch Freizeitkrankheiten berücksichtigt werden. Beispielsweise ist eine gehäufte Aussetzung von Sonnenstrahlen prädisponierend für das maligne Melanom, Jogging lässt an Arthrose denken, das Aufsuchen von Whirlpool und Sauna kann infektiöse Hauterkrankungen verursachen.
1.6 Medikamentenanamnese
Zur Erfassung der aktuellen Einnahme von Medikamenten ist es am sinnvollsten, den Patienten zu bitten, alle Präparate mitzubringen, da er sich an die Namen oft nicht erinnern kann. Es sollte auch gezielt nach Medikamenten gefragt werden, die vom Patienten oft nicht als solche gewertet werden, z. B. die Einnahme der Anti-Baby-Pille, Abführmittel oder Schlaftabletten.
Der sehr hohe und multiple Medikamentenkonsum kann zu Erkrankungen oder akuten Verschlechterungen des Gesundheitszustandes führen. Häufig werden den Patienten von unterschiedlichen Ärzten verschiedene Medikamente gleichzeitig verordnet, die sich möglicherweise in ihrer Wirkung verstärken oder aufheben.
Gelegentlich findet sich die Ursache einer Erkrankung in Form einer Über- oder Unterdosierung von Präparaten, aber auch Nebenwirkungen können für das aktuelle Krankheitsbild verantwortlich gemacht werden. Auch im Rahmen der Therapie sollten die verordneten Präparate mit der bestehenden Medikamenteneinnahme harmonieren (z. B. keine Calciumgabe bei digitalisierten Patienten!).
1.7 Die Frage nach Vorerkrankungen
Es ist besonders wichtig nach früheren Erkrankungen zu fragen, um einen eventuellen Zusammenhang mit der jetzigen Erkrankung herstellen zu können. Stellt sich z. B. heraus, dass der Patient schon seit einiger Zeit an rezidivierenden Gastritiden leidet, aktuell mit dem Symptom »Teerstuhl« die Sprechstunde aufsucht, so ist es möglich, dass sich komplizierend ein Ulcus ventrikuli entwickelt hat.
Darüber hinaus sollte auch systematisch nach früheren Krankenhausaufenthalten, Operationen, Unfällen, Kinderkrankheiten, Allergien und anderen schwerwiegenden Erkrankungen gefragt werden.
1.8 Familienanamnese
Zur Komplettierung einer vollständigen Anamnese zählen auch die Informationen über die Familie. Die Kenntnis über die Erkrankungen, Todesursachen und des Alters der Blutsverwandten lässt wichtige medizinische Rückschlüsse auf die Erkrankung des Patienten und seiner Prognose zu. Von besonderem Interesse sind
genetisch bedingte Erkrankungen
Krankheiten mit familiärer Häufung
Infektionskrankheiten
Gezielt und systematisch sollte nach Erkrankungen innerhalb der Familie gefragt werden, vor allem nach Herzinfarkt, Apoplexie, Hypertonie, Diabetes mellitus, Steinleiden, Missbildungen, Ulkuskrankheiten, Nerven- und Geisteskrankheiten, Allergien und Krebs.
1.9 Auslandsanamnese
In Abhängigkeit der vom Patienten beschriebenen Symptomatik sollte die Frage nach Auslandsaufenthalten gestellt werden. Die Region, wo der Patient sich aufhielt, lässt möglicherweise auf eine für das Gebiet typische Infektionskrankheit schließen. Unter Berücksichtigung der Inkubationszeit können mögliche Krankheiten in Erwägung gezogen, aber auch ausgeschlossen werden.
2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
Zur Diagnosestellung sind nicht nur gründliche Kenntnisse über die einzelnen Krankheitsbilder erforderlich, sondern auch die Fähigkeit, einem Symptom die verschiedenen Krankheitsbilder zuzuordnen. Nachfolgend werden die wichtigsten Leitsymptome differenzialdiagnostisch beschrieben, die Orientierung erfolgt anhand des auf den Seiten 5–6 aufgeführten Anamnese-Leitfadens.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!