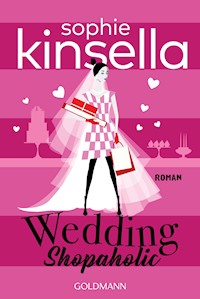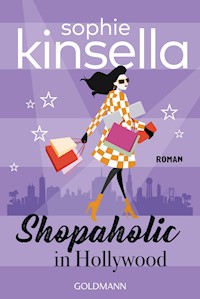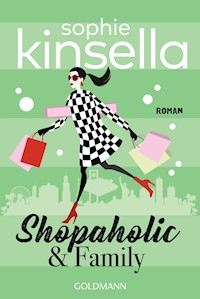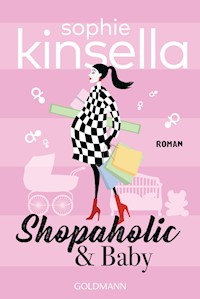3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fixie führt den Tante-Emma-Laden ihrer chaotischen Familie in London. Für mehr hat sie eigentlich keine Zeit – außer für Ryan, den besten Freund ihres Bruders, zu schwärmen. Als sie den Laptop eines Fremden vor einer einstürzenden Decke rettet, ist das ihre Chance, Ryan nahezukommen. Denn der Jungunternehmer Sebastian besteht darauf, Fixie einen Gefallen für ihre gute Tat zu schulden. Und so bittet sie ihn kurzerhand, den arbeitslosen Ryan einzustellen. Die Bitte stellt sich jedoch als fatal heraus, denn in Sebs Unternehmen zeigt Ryan sein wahres Gesicht. Und so ist es plötzlich Fixie, die dem charismatischen Sebastian einen Gefallen schuldet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Fixie Farr kann es einfach nicht lassen. Ob es nun darum geht, einen Fleck wegzuwischen, ein Bild geradezurücken oder einem Freund aus der Patsche zu helfen – sie muss immer alles in Ordnung bringen. Als ein Fremder sie in einem Coffeeshop bittet, kurz auf seinen Laptop aufzupassen, kann sie daher nicht anders, als sich über den Computer zu werfen, um ihn vor der einstürzenden Decke zu bewahren. Wasserschaden. Dankbar für ihre selbstlose Hilfe besteht der Jungunternehmer Sebastian darauf, ihr einen Gefallen zu tun. Und obwohl Fixie nicht vorhat, diesen einzulösen, tritt noch am selben Abend Ryan wieder in ihr Leben und verändert alles: Ryan, der beste Freund ihres Bruders, in den sie schon immer verliebt war und der auf Jobsuche ist. Kurzerhand bittet sie Sebastian, ihn in seiner Firma einzustellen. Doch Ryan vernascht lieber die Mitarbeiterinnen, als sich der Arbeit zu widmen. Und so erkennt Fixie endlich, was sich hinter seiner hübschen Fassade verbirgt – und schuldet nun dem charismatischen Sebastian einen Gefallen …
Weitere Informationen zu Sophie Kinsella sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Sophie Kinsella
________________________
Dich schickt der Himmel
Roman
Aus dem Englischen von Jörn Ingwersen
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »I owe you one« bei Bantam Press, London, an imprint of Transworld Publishers.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der ErstveröffentDeutsche Erstveröffentlichung
Copyright © der Originalausgabe by Sophie Kinsella
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: FAVORITBÜRO, München
Umschlagmotiv: shutterstock/Vjom
shutterstock/Nestor Rizhniak
Redaktion: Kerstin Ingwersen
MR · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22606-0V004
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
KAPITEL EINS
Mein Problem ist, dass ich über manches nur schwer hinwegsehen kann. Wenn mich etwas nervt, bin ich darauf so fixiert, dass ich es unbedingt aus der Welt schaffen muss – und zwar fix. Nicht umsonst ist mein Spitzname Fixie.
Manchmal ist das auch gut so. Zum Beispiel bei der Hochzeit meiner Freundin Hannah. Als ich zur Feier kam, habe ich gleich gesehen, dass nur auf der Hälfte der Tische Blumen standen. Ich bin gleich losgerannt und habe mich darum gekümmert, bevor die anderen Gäste eintrafen, und in ihrer Rede hat Hannah sich bei mir dafür bedankt, dass ich ein »Dekodesaster« verhindert habe. In dem Fall war es also okay.
Dann wieder gab es da diese Situation, als ich einmal einer Frau, die neben mir am Pool saß, einen Fussel vom Oberschenkel gewischt habe. Ich wollte nur helfen. Leider stellte sich heraus, dass es gar kein Fussel war, sondern ein Schamhaar auf Abwegen. Und dann habe ich alles nur noch schlimmer gemacht, indem ich rief: »O Verzeihung! Ich dachte, es wäre ein Fussel.« Sie lief puterrot an, und zwei Frauen, die mich gehört hatten, sahen neugierig zu uns herüber …
Ich hätte lieber gar nichts sagen sollen. Das ist mir jetzt auch klar.
Egal. Das ist jedenfalls mein Spleen. Mein Tick. Manches stört mich eben. Und was mich in diesem Augenblick stört, ist eine Coladose. Jemand hat sie auf dem obersten Regal in der Freizeitabteilung unseres Ladens stehen lassen, direkt vor einem Schachbrett, das dort aufgebaut ist. Und nicht nur das. Das Schachbrett ist total vollgekleckert. Offensichtlich hat irgendwer die Dose aufgerissen, sie zu energisch abgestellt, alles vollgespritzt und dann nicht weggewischt. Wer war das?
Als ich mich ärgerlich umsehe, habe ich sofort Greg in Verdacht, unseren dienstältesten Verkäufer. Greg trinkt den ganzen Tag über alles Mögliche. Wenn er keine Dose in der Hand hält, dann ekligen Filterkaffee in einem Thermobecher mit Tarnmuster, als wäre er beim Militär und arbeitete nicht in einem Haushaltswarenladen in Acton. Überall lässt er seine Getränke herumstehen. Manchmal drückt er sie sogar einem Kunden in die Hand, mit den Worten: »Halt mal kurz!«, um ihm einen Kochtopf aus dem Schaufenster zu holen. Ich habe ihm schon so oft gesagt, er soll das lassen.
Egal. Nicht der richtige Moment für Schuldzuweisungen. Wer auch immer diese Coladose dort abgestellt hat (Greg, definitiv Greg) … Fest steht, dass da hässliche Flecken drauf sind, ausgerechnet jetzt, wo wir wichtigen Besuch erwarten.
Ja, ich weiß, das Schachbrett steht im obersten Regal. Ich weiß, dass es kaum auffällt. Ich weiß, die meisten Leute würden die Achseln zucken. Sie würden sagen: Das ist doch keine große Sache. Nun bleib mal auf dem Teppich.
Aber das konnte ich noch nie besonders gut.
Ich gebe mir alle Mühe, nicht so genau hinzusehen, und konzentriere mich lieber auf den Rest des Ladens, der an Sauberkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Er mag etwas chaotisch wirken, aber das ist auch der Stil, den wir in unserem kleinen Kaufhaus pflegen. (In Familienbesitz seit 1985 steht draußen am Schaufenster.) Wir führen alles Mögliche im Sortiment – Messer, Schürzen, Kerzen – und das muss schließlich alles irgendwohin.
Da fällt mir in der Küchenabteilung ein alter Mann im Regenmantel auf. Mit zitternder Hand greift er nach einem schlichten weißen Becher, und ich eile hin, um ihm zu helfen.
»Hier, bitte schön!«, sage ich freundlich lächelnd. »Ich bringe Ihnen den Becher gleich zur Kasse. Brauchen Sie noch mehr davon? Oder kann ich Ihnen sonst wie behilflich sein?«
»Nein danke, Liebes«, sagt er mit zittriger Stimme. »Ich brauche nur diesen einen Becher.«
»Ist Weiß denn ihre Lieblingsfarbe?«, frage ich etwas vorlaut. Der Wunsch nach einem einzelnen weißen Becher strahlt eine solche Einsamkeit aus, dass ich es kaum ertragen kann.
»Nun …« Zweifelnd streift sein Blick über das Angebot. »Ein brauner würde mir wohl auch gefallen.«
»Der hier vielleicht?« Ich nehme einen braunen Keramikbecher aus dem Regal, den der Mann vermutlich gar nicht wahrgenommen hat, weil er ohnehin außer Reichweite stand. Er ist stabil und hat einen großen Griff. Sieht aus wie ein Becher, mit dem man gemütlich vor dem Kamin sitzen möchte.
Die Augen des Mannes leuchten auf, und ich denke: ›Wusst ich’s doch!‹ Wenn einem im Leben alles nicht mehr so leichtfällt, dann wird selbst die Becherwahl zur großen Sache.
»Der kostet allerdings etwas mehr«, erkläre ich ihm. »Vier Pfund neunundneunzig. Wäre das okay?«
Weil man nie irgendwas für selbstverständlich nehmen sollte. Man darf nichts voraussetzen. Das hat mein Dad mir beigebracht.
»Aber ja, Liebes.« Er lächelt mich an. »Natürlich.«
»Na, wunderbar! Dann bitte hier entlang!«
Vorsichtig führe ich ihn durch den schmalen Gang, behalte mögliche Gefahrenpunkte im Auge. Was keine ganz so selbstlose Geste ist, wie es scheinen mag – dieser Mann ist ein Umkipper. Man sieht es sofort. Zitternde Hände, unsicherer Blick, schäbiges altes Einkaufswägelchen, das er hinter sich herzieht … alles Anzeichen eines klassischen Umkippers. Und zerschlagenes Geschirr kann ich jetzt am allerwenigsten brauchen. Wenn doch jeden Moment Jakes Besuch kommt.
Ich schenke dem Mann ein strahlendes Lächeln, verberge, was ich insgeheim denke, obwohl die Tatsache, dass der Name Jake mein Hirn durchstreift, mir ein flaues Gefühl im Magen beschert. Das passiert mir andauernd. Ich denke Jake, und mir wird flau im Magen. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, auch wenn ich nicht weiß, ob es eigentlich normal ist. Keine Ahnung, wie andere Leute über ihre Geschwister denken. Meine beste Freundin Hannah ist ein Einzelkind, und schließlich stellt man diese Frage nicht wahllos irgendwelchen Leuten, oder? »Wie ist Ihnen zumute, wenn Sie an Ihre Geschwister denken? Irgendwie ängstlich, angespannt und argwöhnisch?« Denn genauso geht es mir, wenn ich an meinen Bruder Jake denke. Denke ich an Nicole, bin ich zwar nicht ängstlich, aber angespannt bin ich doch, und oft genug würde ich am liebsten etwas kaputtschlagen.
Kurz gesagt vermitteln mir beide kein sonderlich gutes Gefühl.
Vielleicht liegt es daran, dass beide älter sind als ich und es nicht so leicht war, in ihre Fußstapfen zu treten. Als ich mit elf auf die weiterführende Schule kam, war Jake sechzehn und der Star der Fußballmannschaft. Nicole war fünfzehn, bildschön und bereits als Model entdeckt worden. Jeder in der Schule wollte mit ihr befreundet sein. Ehrfürchtig wurde ich gefragt: »Jake Farr ist dein Bruder? Nicole Farr ist deine Schwester?«
Nicole war damals schon genauso unverbindlich wie heute, aber Jake dominierte alles. Er war zielstrebig. Hellwach. Unbeherrscht. Ich werde nie vergessen, wie er mal mit Mum Streit hatte und spätabends draußen auf der Straße laut fluchend eine Dose herumkickte. Ich habe ihn von meinem Fenster aus beobachtet, etwas verschreckt und doch fasziniert. Inzwischen bin ich siebenundzwanzig, aber irgendwie kann man sein elfjähriges Ich doch nie ganz abschütteln, oder?
Und natürlich gibt es auch noch andere Gründe, sich neben Jake klein und mies zu fühlen. Handfeste Gründe. Finanzielle Gründe.
An die ich jetzt nicht denken werde. Stattdessen lächle ich den alten Herrn an und versuche, ihm das Gefühl zu vermitteln, dass ich alle Zeit der Welt habe. So wie Dad es auch getan hätte.
Morag tippt den Preis in die Kasse ein, während der Mann ein altes Lederportemonnaie zückt.
»Fünfzig …«, höre ich ihn murmeln, während er eine Münze mustert. »Ist das ein Fünfzig-Pence-Stück?«
»Zeigen Sie doch mal her«, sagt Morag auf ihre beruhigende Art. Morag ist seit sieben Jahren bei uns. Ursprünglich war sie nur eine Kundin, bis sie eines Tages unseren Aushang im Laden sah und sich daraufhin beworben hat. Mittlerweile ist sie als leitende Angestellte verantwortlich für den Grußkarteneinkauf – sie hat einen fabelhaften Blick dafür. »Nein, das sind zehn Pence«, sagt sie freundlich zu dem alten Mann. »Haben Sie da drinnen vielleicht noch eine Pfundmünze?«
Mein Blick schweift zurück zu Coladose und Schachbrett. Die Flecken sind nicht so schlimm, sage ich mir. Dafür ist jetzt keine Zeit. Unser Besuch wird schon nichts merken. Die wollen uns schließlich ihr Sortiment an Olivenölen vorführen, nicht den Laden inspizieren. Denk einfach nicht daran, Fixie.
Denk nicht daran.
O Gott, das kann ich aber nicht. Es macht mich kirre.
Immer wieder schweift mein Blick dorthin. Meine Finger tun, was sie immer tun, wenn ich irgendwas unbedingt in Ordnung bringen möchte, wenn die eine oder andere Situation mich in den Wahnsinn treibt. Sie trommeln unruhig aufeinander ein. Und mit den Füßen tripple ich nervös auf der Stelle: vorwärts-seitwärts-ran, vorwärts-seitwärts-ran.
So war ich schon als Kind. Es ist stärker als ich. Ich weiß, es wäre Quatsch, jetzt eine Leiter rauszuholen, einen Eimer mit Wasser zu besorgen und die Flecken wegzuwischen, weil jeden Moment unser Besuch kommt. Ich weiß es ja.
»Greg!« Als er hinter dem Glaswarenregal auftaucht, kann ich nicht mehr an mich halten und rufe: »Schnell! Die Leiter! Ich muss diese Flecken da oben wegwischen!«
Greg sieht, wohin ich deute, und zuckt schuldbewusst zusammen, als er die Coladose bemerkt.
»Das war ich nicht!«, sagt er sofort. »Bestimmt nicht!« Dann stutzt er und fügt hinzu: »Und falls doch, dann nicht mit Absicht.«
Dazu muss gesagt werden, dass Greg eine wirklich treue Seele ist und unendlich viele Überstunden macht, also verzeihe ich ihm so manches.
»Ist doch jetzt egal, wer es war«, sage ich eilig. »Nur weg damit!«
»Okay …«, sagt Greg, als gäbe es da was zu überlegen. »Na gut. Aber kommen denn nicht gleich diese Leute?«
»Ja, und deshalb müssen wir schnell machen! Wir müssen uns beeilen!«
»Okay«, sagt Greg wieder, ohne sich vom Fleck zu rühren. »Ja. Verstanden. Wo ist Jake?«
Eine sehr gute Frage. Immerhin ist Jake derjenige, der den Kontakt zu diesen Olivenöl-Leuten hergestellt hat. Offenbar in einer Bar. Er hat den Termin für heute vereinbart. Und wer ist jetzt nicht da?
Allein meine Loyalität der Familie gegenüber hält mich davon ab, es laut auszusprechen. Sie spielt in meinem Leben eine große Rolle. Vielleicht die größte. So mancher folgt der Stimme des Herrn. Ich folge der Stimme meines Vaters. Ich höre noch, wie er, kurz bevor er starb, mit seinem schweren East-End-Akzent sagte: Familie ist das Wichtigste, Fixie. Familie ist das, was uns antreibt. Familie geht vor.
Loyalität gegenüber der Familie ist im Grunde unsere Religion.
»Immer wieder wälzt er alles auf andere ab, dieser Jake«, murmelt Greg. »Nie weiß man, wann er auftaucht. Man kann sich einfach nicht auf ihn verlassen. Und heute sind wir auch noch so schwach besetzt, weil eure Mutter sich den Tag freigenommen hat.«
Das mag ja alles richtig sein, und doch höre ich Dads Worte in meinem Kopf: Familie geht vor, Fixie. In der Öffentlichkeit müsst ihr zusammenhalten. Tragt es später aus, untereinander.
»Jake teilt sich seine Arbeitszeit selbst ein«, rufe ich Greg in Erinnerung. »So ist es vereinbart.«
Alle Farrs arbeiten in unserem Laden – Mum, ich, Jake und meine Schwester Nicole –, aber nur Mum und ich arbeiten Vollzeit. Jake bezeichnet sich als »Berater«. Er hat noch sein eigenes Geschäft, macht online gerade seinen Abschluss als Betriebswirt und schaut rein, wenn er Zeit hat. Nicole besucht von montags bis freitags einen Yogalehrer-Kurs, sodass sie nur an den Wochenenden kommen kann. Was sie auch manchmal tut.
»Ich gehe davon aus, dass er unterwegs ist«, füge ich eilig hinzu. »Wie dem auch sei. Wir müssen es nehmen, wie es ist. Also los! Her mit der Leiter!«
Während Greg die Trittleiter über den Ladenboden schleift, haste ich in unser Hinterzimmer und lasse heißes Wasser in einen Eimer laufen. Ich muss nur fix die Leiter rauf, den Fleck wegwischen, mir die Dose greifen, wieder runterklettern und alles wegräumen, bevor der Besuch kommt. Ein Klacks.
Die Spielzeugabteilung wirkt ein wenig deplatziert, umzingelt von Küchenhandtüchern und Einmachsets. Aber Dad hat sie so eingerichtet, also haben wir nichts daran verändert. Dad war ein großer Freund von Brettspielen. Er meinte, Brettspiele seien für einen Haushalt ebenso unerlässlich wie Löffel. Die Kunden kamen, um einen Kessel zu kaufen, und gingen mit einem Monopoly-Spiel unterm Arm.
Und seit er vor neun Jahren gestorben ist, bemühen wir uns, den Laden so zu erhalten, wie er ihn aufgebaut hat. Nach wie vor verkaufen wir Lakritzkonfekt. Nach wie vor haben wir eine Eisenwarenabteilung. Und nach wie vor bestücken wir die Spielzeugabteilung mit Brettspielen, Bällen und Wasserpistolen.
Dad konnte jedem alles verkaufen. Er war ein Charmeur. Aber kein halbseidener, unaufrichtiger Charmeur. Er glaubte an jedes einzelne Produkt, das er verkaufte. Er wollte die Menschen glücklich machen. Und er hat die Menschen glücklich gemacht. In dieser kleinen Ecke im Westen von London hat er eine echte Gemeinschaft geschaffen (er bezeichnete sich selbst als »Einwanderer«, weil er im Osten Londons geboren wurde), und diese Gemeinschaft lebt weiter. Auch wenn die Kunden, die Dad noch persönlich kannten, von Jahr zu Jahr weniger werden.
»Okay«, sage ich und haste mit dem Eimer raus in den Laden. »Dauert nur eine Sekunde.«
Eilig steige ich die Leiter hinauf und reibe an den braunen Flecken herum. Ich sehe Morag unter mir, wie sie einer Kundin ein Schälmesser erklärt, und unterdrücke den Drang, mich in das Gespräch einzumischen. Mit Messern kenne ich mich aus. Ich habe an einem Kochlehrgang teilgenommen. Aber man kann ja nicht überall gleichzeitig sein und …
»Sie sind da!«, verkündet Greg. »Draußen auf dem Parkplatz hält ein Wagen.«
Jake hat darauf bestanden, dass wir unseren einzigen Parkplatz für diese Olivenöl-Leute freihalten. Wahrscheinlich haben sie gefragt: »Kann man bei Ihnen denn parken?«, und er wollte nicht sagen: »Nur einer zurzeit«, weil er dafür zu großspurig ist, also wird er leichthin gesagt haben: »Selbstverständlich!«, als hätten wir eine Tiefgarage.
»Kein Problem«, sage ich atemlos. »Ich bin so weit. Alles gut.«
Ich werfe den Lappen in den Eimer und will zügig runterklettern, mit der Coladose in der Hand. Das ging doch ruckzuck, und jetzt nervt es mich nicht mehr und …
»Vorsicht auf der Leiter!«
Zwar höre ich Greg reden, aber er gängelt uns ständig mit irgendwelchen unsinnigen Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen, die er aus dem Internet hat, also bleibe ich bei meiner Hast, bis er »Nicht!« ruft, was ehrlich besorgt klingt.
»Fixie!«, kreischt Stacey, auch eine unserer Verkäuferinnen, drüben an der Kasse. Ihre schneidende, nasale Stimme ist nicht zu überhören. »Pass auf!«
Abrupt wende ich mich um, aber es dauert einen Moment, bis ich begreife, was los ist. Ich bin mit dem Ärmel an einem Korbballring hängen geblieben, der wiederum gegen den Griff einer großen Wanne voller Flummis gestoßen ist. Und diese Wanne kippt gerade vom Regal … und ich kann nichts dagegen tun. Verdammt …
»O mein Gott!«
Ich hebe meine freie Hand, um mich vor der Lawine kleiner Gummibälle zu schützen. Sie hüpfen mir auf den Kopf, auf die Schultern, durch den ganzen Laden. Wieso haben wir überhaupt so viele von diesen Dingern?
Als ich von der Leiter steige, sehe ich mich erschrocken um. Es ist direkt ein Wunder, dass nichts kaputtgegangen ist. Allerdings liegen überall Flummis herum.
»Schnell!«, rufe ich Greg und Stacey zu. »Teamwork! Sammelt sie ein! Ich geh rüber und lenk den Besuch ab.«
Während ich zur Tür laufe, habe ich nicht den Eindruck, dass Greg und Stacey etwas von Teamwork verstehen. Genau genommen wirken sie wie ein Anti-Team. Ständig rempeln sie sich fluchend gegenseitig an. Als ich sehe, wie er die Bälle eilig vorn in sein Hemd und in die Hosentaschen stopft, rufe ich ihm zu: »Wirf sie wieder in die Wanne!«
»Mir waren die Colaflecken gar nicht aufgefallen«, meint Stacey achselzuckend, als ich an ihr vorüberhaste. »Du hättest sie ruhig lassen können.«
Soll das jetzt eine Hilfe sein?, möchte ich erwidern. Tue ich aber nicht. Stacey ist eine gute Mitarbeiterin, die ich nicht verärgern möchte. Man muss sich nur mit dem arrangieren, was Mum und ich ihre »SBB« nennen (Staceys Blöde Bemerkungen).
Aber natürlich sage ich vor allem nichts, weil sie recht hat. Ich hätte den Fleck nicht wegwischen müssen. Aber ich kann es nun mal nicht lassen, für Ordnung zu sorgen. Das ist meine Macke. So bin ich eben.
KAPITEL ZWEI
Unser Besuch sieht vornehm aus. Kein Wunder. Mein Bruder Jake umgibt sich gern mit vornehmen Leuten. Er war von jeher ehrgeizig, schon als kleiner Junge. Erst wollte er unbedingt zum Fußballteam gehören. Als älterer Teenager trieb er sich dann mit reicher Leute Kinder herum – und plötzlich waren ihm unser Haus, unsere Urlaubsreisen und – bei einer furchtbaren Gelegenheit – einmal sogar Dads Akzent peinlich. (Da gab es gleich wieder einen Riesenstreit. Mum hat sich schrecklich aufgeregt. Ich werde nie vergessen, wie die lauten Stimmen von unten noch in meinem Zimmer zu hören waren.)
Er hat als Immobilienmakler in Fulham gearbeitet – bis er sich vor drei Jahren selbstständig machen konnte –, und da hat das vornehme Gehabe noch mehr auf ihn abgefärbt. Jake umgibt sich gern mit Typen, die allesamt Budapester tragen, mit Einheitsfrisur und zu lauter Stimme. Im Grunde kann er es kaum ertragen, nicht in Chelsea geboren zu sein. Nicht einer von diesen lärmenden Spießern aus dem Fernsehen zu sein, die mit Mitgliedern der Königsfamilie feiern und sechsmal im Jahr Urlaub machen. Aber da er es nun mal nicht ändern kann, verbringt er so viel Zeit wie möglich in den Pubs auf der King’s Street mit Typen, die Rupert heißen.
Die beiden braun gebrannten Männer, die da aus ihrem Range Rover steigen, gehören offensichtlich zu dieser Szene, mit Polohemd und Segelschuhen. Offen gesagt schüchtern mich solche Typen etwas ein, aber ich reiße mich zusammen und gehe zielstrebig auf sie zu, um sie zu begrüßen. Ich sehe, wie der eine den Laden stirnrunzelnd mustert, und merke, dass sich mir die Nackenhaare aufstellen. Okay, wir haben nicht die allerhübscheste Ladenfront – das Gebäude ist ein Zweckbau aus den 1970er-Jahren –, aber die Schaufenster sind frisch geputzt, und die Auslage der Küchentextilien sieht einfach toll aus. Für einen Laden an der High Street haben wir ziemlich viel Platz, und wir wissen ihn zu nutzen. Im Eingangsbereich stehen mehrere Warentische, und insgesamt gibt es drei Gänge. Alles da.
»Hi!«, begrüßt mich der Größere der beiden. »Clive Beresford. Sie sind Felicity?«
Viele Leute hören Fixie und denken Felicity. Das bin ich schon gewohnt.
»Fixie.« Ich lächle und schüttle seine Hand. »Willkommen bei Farrs.«
»Simon.« Der andere Typ grüßt mit einer Hand, dann hebt er eine schwere Kiste aus dem Range Rover. »Da sind wir! Guter Standort, den Sie hier haben!«
»Ja.« Ich nicke. »Wir können uns glücklich schätzen.«
»Aber wir sind hier nicht in Notting Hill, oder?«
»Notting Hill?«, wiederhole ich verwundert.
»Jake meinte, Sie hätten einen Familienbetrieb in Notting Hill.«
Ich verziehe den Mund. Das sieht Jake mal wieder ähnlich. Zu behaupten, dass unser Laden in Notting Hill liegt. Wahrscheinlich hat er auch behauptet, dass Hugh Grant bei uns Stammkunde ist.
»Nein, wir sind hier in Acton«, sage ich höflich.
»Aber Sie wollen in absehbarer Zeit nach Notting Hill expandieren?«, erkundigt sich Clive, als wir reingehen. »Das hat Ihr Bruder uns jedenfalls erzählt.«
Nach Notting Hill expandieren? So ein Quatsch. Wahrscheinlich wollte Jake die beiden nur beeindrucken. Und doch höre ich Dads Stimme in meinem Kopf: Familie geht vor, Fixie.
»Möglich«, sage ich freundlich. »Wer weiß?« Ich geleite die beiden in den Laden, dann breite ich die Arme aus und präsentiere all die Kochtöpfe, Plastikboxen und Tischtücher. »Das also ist unser Laden!«
Die beiden schweigen. Ich spüre, dass sie etwas anderes erwartet hatten. Simon betrachtet unser Angebot an Weckgläsern. Clive tritt einen Schritt vor und mustert ein Monopoly-Spiel. Im nächsten Moment fällt ihm ein roter Flummi auf den Kopf.
»Autsch!« Er blickt auf. »Was zum …?«
»Entschuldigung!«, rufe ich eilig. »Keine Ahnung, wie das passieren konnte!«
Mist. Da müssen wir wohl einen übersehen haben.
»Und Sie wollen also einen Luxus-Delikatessenladen daraus machen?« Simon wirkt verwundert. »Führen Sie denn überhaupt Lebensmittel?«
Ich merke, wie sich mir schon wieder die Nackenhaare aufstellen. Keine Ahnung, was Jake denen für einen Bären aufgebunden hat, doch dafür kann ich nichts.
»Aber sicher.« Ich nicke. »Öl, Essig, Gewürze, alles Mögliche. Stellen Sie die Kiste ruhig ab.«
»Perfekt.« Er setzt sie auf eine Vitrine, die wir vorher freigeräumt haben. (Normalerweise würden wir ins Hinterzimmer gehen, aber da steht alles voller Kartons mit Duftkerzen, die wir unbedingt noch auspacken müssen.)
»Lassen Sie mich Ihnen einen kleinen Einblick vermitteln, womit wir uns beschäftigen. Wir sind auf ein Sortiment von Olivenölen gestoßen, das doch sehr besonders ist.« Er sagt es so vornehm – seeehr besonders. »Sie werden begeistert sein!«
Währenddessen holen beide Männer große Flaschen aus kleineren Holzkisten. Eilig verteilt Simon ein paar Schälchen auf dem Tisch, und Clive zaubert frisch geschnittene Brotwürfel hervor.
Er erzählt von irgendeinem Gutshof in Italien, aber ich höre gar nicht richtig zu, denn voller Entsetzen starre ich Greg an. Eben taucht er auf – die Hosentaschen voller Flummis. Sein gesamter Unterleib wirkt mächtig und klumpig und einfach … unförmig. Wieso hat er die Bälle nicht weggepackt?
Wütend rolle ich mit den Augen, was ihm sagen soll: Wieso hast du die Flummis immer noch in den Hosentaschen? Sofort antwortet mir Greg mit eigenem Augenrollen, was offensichtlich heißen soll: Glaub mir, dafür gibt es triftige Gründe.
Ich glaube ihm kein Wort. Greg handelt in guter Absicht, das bezweifelt niemand, aber seine Logik ist entnervend kopflos. Er ist wie ein überforderter Computer, der problemlos funktioniert, bis er plötzlich beschließt, deinen gesamten Posteingang nach Venezuela zu mailen.
»Möchten Sie probieren?«
Abrupt wird mir bewusst, dass Clives Geschwätz vorbei ist und er Brotwürfel mit Olivenöl bereithält.
Während ich dippe und koste, denke ich: »Typisch Jake, diesen Vertreterbesuch auf den einzigen Tag zu legen, an dem Mum nicht im Laden ist. Glaubt er etwa, dass er dieses ach so tolle Olivenöl einfach an ihr vorbeischummeln kann? Dass sie davon nichts mitkriegt? Mum kriegt alles mit. Jeden Verkauf, jeden Umtausch, jede E-Mail. Alles.«
Da bemerke ich, dass den beiden Typen Gregs ausgebeulter Unterleib nicht entgangen ist. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Der Anblick ist verstörend.
»Verzeihen Sie Gregs seltsamen Aufzug!«, sage ich lachend. »Normalerweise sieht er nicht so aus! Es ist nur, dass er …«
»Hormonstörung.« Nickend fällt Greg mir ins Wort, und fast verschlucke ich mich an meinem Brot. Wieso … was meint er mit »Hormonstörung«? »Unangenehm«, fügt er bedeutungsvoll hinzu.
Ich bin ja an Gregs Eigenheiten gewöhnt, aber manchmal verschlägt es selbst mir die Sprache.
»Komische Geschichte«, fügt Greg hinzu, ermutigt durch die Aufmerksamkeit. »Mein Bruder kam mit nur einer halben Bauchspeicheldrüse zur Welt. Und meine Mum, die hat so eine nichtsnutzige Niere …«
»Danke, Greg!«, falle ich ihm verzweifelt ins Wort. »Danke für … danke.«
Die beiden gelackten Typen wirken nur noch angewiderter. Greg dagegen wirft mir einen selbstzufriedenen Blick zu, der vermutlich sagen soll: »Die Kurve hab ich doch gut gekriegt, oder?«
Zum hundertsten Mal frage ich mich, ob wir Greg nicht mal zu einem Kurs anmelden sollten. Zu einem Kurs, bei dem er lernt, nicht Greg zu sein.
»Wie dem auch sei!«, flöte ich, als Greg sich zum Gehen wendet. »Diese Öle sind fantastisch.« Und dabei bin ich nicht nur höflich, es stimmt wirklich. Sie sind köstlich, vollmundig und aromatisch, besonders das dunkle mit grünem Pfeffer. »Was würden die im Einkauf kosten?«
»Die Preise sind hier ausgewiesen«, sagt Simon und reicht mir eine Liste. Ich überfliege die Zahlen – und falle fast hintenüber. Normalerweise bleibe ich in solchen Situationen ziemlich gelassen, aber ich höre mich direkt aufstöhnen.
»Fünfundneunzig Pfund?«
»Selbstverständlich ist es ein ausgesprochen hochwertiges High-End-Produkt«, sagt Clive einschmeichelnd. »Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen ganz besonderen Olivenhain, und der Herstellungsprozess ist absolut einzigartig …«
»Aber kein Mensch bezahlt fünfundneunzig Pfund für eine Flasche Öl!« Fast möchte ich lachen. »Nicht in diesem Laden. Tut mir leid.«
»Aber wenn Sie Ihre Filiale in Notting Hill eröffnen …«, übernimmt Simon. »Ganz andere Klientel. Der Name ›The Notting Hill Family Deli‹ gefällt uns übrigens besonders gut.«
Ich versuche, meinen Schock zu verbergen. Bitte was? Unser Geschäft heißt Farrs. Dad hat es so genannt, weil er Michael Farr hieß, und daran wird sich auch nie etwas ändern.
»Das ist das Öl, das wir anbieten.« Greg stellt unvermittelt eine Flasche Öl auf den Tisch. »Kostet fünf neunundneunzig.« Seine grauen Glubschaugen mustern die beiden Schnösel. »Wollte ich nur gesagt haben.«
»Aha«, sagt Simon nach einem Moment. »Nun, das ist natürlich ein völlig anderes Produkt als unseres. Ich möchte nicht rüde klingen, aber im direkten Vergleich werden Sie zweifelsohne einen deutlichen Qualitätsunterschied herausschmecken. Darf ich?«
Mir fällt auf, wie geschickt er Greg ins Gespräch mit eingebunden hat. Jetzt gießt er unser billiges Öl in eine Schale und dippt Brotwürfel hinein. Als ich probiere, weiß ich sofort, was er meint. Unser Öl schmeckt im Vergleich nicht halb so vollmundig.
Aber man muss seine Kunden kennen. Man muss wissen, wo ihre Grenzen liegen. Eben will ich Simon erklären, dass unsere Kundschaft aus praktischen, pragmatisch denkenden Menschen besteht, die nie im Leben fünfundneunzig Pfund für Olivenöl bezahlen würden, als die Tür aufgeht und Jake hereinspaziert kommt.
Er ist eine echte Erscheinung. War er schon immer. Er hat Dads entschlossenes Kinn und Dads blitzende Augen, und er kleidet sich ausgesprochen elegant. Immobilienmaklermäßig. Dunkelblauer Blazer, teure, glänzende Schuhe. Manschettenknöpfe.
Bei seinem bloßen Anblick überkommen mich altbekannte Gefühle, umflattern mich wie aufgescheuchte Raben. Unfähig. Minderwertig. Nichtsnutzig.
Das ist nichts Neues. Diese Gefühle weckt mein großer Bruder immer in mir, und wie sollte er auch nicht? Es gibt nur ein Motto, das mir ebenso wichtig ist wie Familie geht vor, und das ist: Fair bleiben. Ich versuche immer, fair und aufrichtig zu sein, so weh es auch tun mag.
Und es tut weh, dass Jake ein ewiger Sieger ist und ich eine ewige Verliererin. Er ist derjenige, der eine Im- und Export-Firma gegründet hat, ohne einen Penny von irgendwem. Er ist derjenige, der ein Vermögen verdient hat mit einer neuen Marke von nahtlosen Slips, die er an einen Discounter verkaufen konnte. Er ist derjenige, der den schicken Wagen fährt und die Visitenkarten und das BWL-Diplom hat (fast).
Ich bin diejenige, die sich bei Mum Geld leihen musste (von »unserem Erbe«, wie Jake es nennt), um einen Catering-Service aufzubauen, was nicht geklappt hat. Und die das Geld immer noch nicht zurückzahlen konnte.
Ich bin nicht das schwarze Schaf der Familie. Das wäre glamourös und interessant. Ich bin nur das blöde, das bescheuerte Schaf, das unter seinem Bett immer noch einen Stapel dunkelgrüner Schürzen aufbewahrt, bestickt mit meinem Logo: Farr’s Food. (Alles andere habe ich verkauft, aber die Schürzen wollte keiner haben.) Und wenn Jake in der Nähe ist, komme ich mir noch blöder und bescheuerter vor. Ich mache so gut wie nie den Mund auf, und wenn ich es doch tue, fange ich an zu stottern.
Ich habe eine Meinung, ich habe Ideen. Habe ich wirklich. Wenn ich im Laden allein das Sagen habe – oder zusammen mit Mum –, kann ich durchaus Anweisungen geben. Ich kann mich durchsetzen. Aber in Jakes – und manchmal auch Nicoles – Gegenwart überlege ich zweimal, bevor ich sage, was ich denke. Denn unausgesprochen hängt immer in der Luft: Was weißt du denn schon? Du bist doch pleitegegangen.
Nur Mum gibt mir das Gefühl, dass ich trotz allem etwas wert bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles ohne sie ausgehalten hätte.
»Männer!«, begrüßt Jake seine Besucher. »Da seid ihr ja schon! Ciao!«
Ciao. So redet er mit denen. Wir sind in derselben Familie aufgewachsen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass aus mir jemals ein Mensch werden könnte, der ciao sagt.
»Jake!« Clive klopft ihm auf die Schulter. »Mein Freund.«
»Das nennst du Notting Hill?«, spottet Simon, während er Jakes Hand schüttelt. »Wir sind hier mitten in Acton!«
»Das ist erst der Anfang des Imperiums«, sagt Jake mit breitem Grinsen. Dann wirft er mir einen ultrakurzen Blick zu, den ich voll und ganz verstehe. Er soll mir sagen: »Du hast mich doch nicht reingeritten, oder?«
Ich antworte ihm mit einem entsprechenden Blick, der sagen soll: »The Notting Hill Family Deli?« Aber da ignoriert er mich auch schon wieder.
Jake ignoriert mich oft, wenn seine feinen Freunde dabei sind. Wahrscheinlich hat er Angst, dass ich ihn bei einem seiner Lügenmärchen bloßstelle. Was ich zwar niemals tun würde – Familie geht vor –, aber ich merke natürlich, wenn er die Wahrheit verbiegt. Zum Beispiel, wo er zur Schule gegangen ist. (Er bezeichnet sich selbst als »Oberschüler«, aber er war auf einer Gesamtschule.) Und dann seine Andeutungen auf unsere »kleine Hütte im Grünen«. Ich habe keine Ahnung, was diese »kleine Hütte« sein soll – vielleicht das alte Plumpsklo am Ende von Mums Garten?
»Das sind also die berühmten Öle!«, ruft Jake. »Fantastico!«
»Du musst unbedingt mal mitkommen und dir diesen Gutshof ansehen«, sagt Simon begeistert. »Absolut atemberaubend.«
»Unbedingt«, meint Jake. »Ich liebe diesen Teil der Welt.«
Ich kann mich nicht erinnern, dass Jake in seinem Leben jemals in Italien gewesen wäre, aber darauf werde ich jetzt selbstverständlich nicht hinweisen.
»Wusstest du, dass dieses Öl fünfundneunzig Pfund pro Flasche kostet?«, frage ich Jake vorsichtig. »Ich glaube nicht, dass unsere Kunden sich das leisten können, oder?«
Ärgerlich verzieht er das Gesicht, und ich weiß auch, wieso. Er möchte nicht an unsere preisbewusste Kundschaft erinnert werden. Er wünscht sich Millionäre.
»Aber wenn ihr High End wollt, dann ist das der Markt.« Clive tippt an die Flasche. »Dieser Geschmack ist phänomenal. Da wird mir Fixie sicher zustimmen.«
»Schmeckt sehr gut «, sage ich. »Sehr lecker. Ich weiß nur nicht … na ja. Wissen unsere Kunden das zu schätzen?«
Und natürlich fängt meine Stimme an zu zittern. Ich stelle schon wieder Fragen, statt meine Meinung zu vertreten. So geht es mir immer, wenn Jake dabei ist. Und ich hasse mich dafür, weil es klingt, als wäre ich unsicher, obwohl ich es gar nicht bin. Bin ich nicht.
»Sie werden es schon schätzen lernen«, fährt Jake mir über den Mund. »Wir veranstalten Probierabende und so was …« Er wendet sich an Clive und Simon. »Wir werden definitiv was bestellen. Die Frage ist nur, wie viel.«
Ich werde kurz panisch. Wir können unmöglich jetzt gleich was bestellen, vor allem, weil Mum nicht da ist.
»Jake, sollten wir das nicht lieber vorher besprechen?«, frage ich.
»Da gibt es nichts zu besprechen«, schnauzt er mich an, und sein Blick sagt mir überdeutlich: Halt die Klappe.
Wild schlagen mir die Raben ihre Flügel ins Gesicht, aber ich darf mich auf keinen Fall unterkriegen lassen. Für Mum.
»Ich wollte nur …« Schon wieder zittert meine Stimme, und ich räuspere mich. »Unsere Kunden wollen vernünftige, preiswerte Produkte. Die kaufen keine Luxuslebensmittel.«
»Na, vielleicht können wir sie ja umerziehen«, schnauzt Jake mich an. »Es ihnen beibringen. Ihre mittelmäßigen Geschmacksknospen an feinere Noten gewöhnen.« Er nimmt sich einen Brotwürfel, dippt ihn ins billige Öl, und bevor irgendwer was sagen kann, hat er ihn sich schon in den Mund geworfen. »Also, wenn das nicht himmlisch schmeckt …«, nuschelt er beim Kauen. »Das ist eine ganze andere Nummer. Das nenne ich nussig, vollmundig … man kann die Qualität schmecken … Jungs, was soll ich sagen? Glückwunsch! Ich bin echt beeindruckt.«
Er hält ihnen die Hand hin, doch weder Simon noch Clive greifen zu. Beide sind wie versteinert.
»Und welches Öl war das jetzt?«, fragt Jake, als er den Bissen endlich hinuntergeschluckt hat. »Das teuerste?«
Alles schweigt. Ich kann gar nicht hinsehen. Mit jeder Faser meines Körpers schäme ich mich für Jake.
Aber Hut ab, was die beiden Typen angeht: Ihre Manieren sind tadellos. Clive zuckt mit keiner Wimper, als er bereitwillig die Situation rettet.
»Ich bin mir nicht ganz sicher, welches es war«, sagt er stirnrunzelnd.
»Ich auch nicht.« Simon versteht den Wink. »Ich glaube, die Schälchen wurden vertauscht, also …«
»Wir hätten lieber nicht ganz so viele mitbringen sollen.«
»Absolut«, stimmt Simon mit ein. »Irgendwann schmeckt alles gleich!«
Sie sind so nett zu Jake, der nichts von alledem mitbekommt, dass ich am liebsten sagen möchte: Danke, ihr Schnösel. Danke, dass ihr so nett zu meinem ahnungslosen Bruder seid.
Aber das sage ich natürlich nicht. Simon und Clive tauschen Blicke und scheinen sich wortlos einig zu sein, dass sie loswollen. Alle lächeln und plaudern, während die beiden ihre Sachen zusammenpacken und vorschlagen, dass wir uns erst mal untereinander einig werden. Sie würden sich wieder bei uns melden.
Als sie draußen vor dem Laden mit ihrem Range Rover losfahren, nehmen Jake und ich gleichzeitig Anlauf, etwas zu sagen – aber er kommt mir zuvor.
»Na bravo, Fixie!«, sagt er genervt. »Du hast sie verschreckt. Ganz toll.«
»Hör mal, Jake, es tut mir leid«, setze ich an, dann verfluche ich mich für die Entschuldigung. Warum tue ich das immer? »Ich wollte nur … Ich denke wirklich …«
»Ich weiß, was du denkst.« Verächtlich fällt er mir ins Wort. »Aber ich bin hier derjenige, der versucht, diesen Laden strategisch für die Zukunft auszurichten. Größer. Besser. Profitabler. High End.«
»Ja, aber fünfundneunzig Pfund für eine Flasche Olivenöl, Jake!«, flehe ich. »Das kann unmöglich dein Ernst sein!«
»Wieso nicht?«, fährt er mich an. »Harrods führt es auch.«
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Harrods?
Ich merke, dass Greg zu uns herüberschaut, und setze hastig ein Lächeln auf. Dad würde uns umbringen, wenn er wüsste, dass wir unseren familieninternen Streit im Laden austragen.
»Jakey?« Ich wende mich um und sehe, dass Leila, Jakes Freundin, den Laden betritt, in einem zauberhaften gelben Kleid, mit einer Sonnenbrille auf dem Kopf. Leila erinnert mich immer an Bambi. Sie hat lange, gertenschlanke Beine, trägt hohe, spitze Sandaletten, die klippediklappern wie Hufe, und betrachtet die Welt durch ihre langen Wimpern, als könnte sie nicht sicher sein, ob gleich von irgendwo auf sie geschossen wird. Sie ist wirklich süß, und ich kann mich unmöglich in ihrem Beisein mit Jake streiten.
Nicht nur weil sie süß ist, sondern weil die Familie vorgeht. Leila gehört nicht zur Familie. Nicht zum inneren Kreis der Familie. Noch nicht. Seit drei Jahren ist sie mit Jake zusammen – die beiden haben sich in einem Club kennengelernt –, und ich habe noch nie erlebt, dass sie sich streiten. Es scheint nicht Leilas Art zu sein, obwohl sie Jake doch manchmal auch böse sein muss, oder? Erwähnt hat sie allerdings noch nie etwas. Einmal meinte sie sogar: »Jake ist ein echter Softie, was?« Da blieb mir glatt die Spucke weg. Jake? Ein Softie?
»Hi, Leila«, sage ich und gebe ihr ein Küsschen. Sie ist dünn und klein wie ein Kind. Ich staune, dass sie überhaupt so viele glitzernde Einkaufstüten tragen kann. »Shoppingtour?«
»Meiner besseren Hälfte soll es an nichts mangeln«, sagt Jake großspurig. »Wir haben auch Mums Geschenk besorgt.«
Jake nennt Leila immer seine »bessere Hälfte«, obwohl die beiden nicht mal verlobt sind. Manchmal frage ich mich, ob ihr das eigentlich etwas ausmacht, aber andererseits habe ich noch nie erlebt, dass Leila irgendwas etwas ausmacht. Einmal kam Jake zum Familienrat in den Laden, und erst nach einer Stunde haben wir erfahren, dass Leila draußen im Auto wartete, weil er im Halteverbot parkte. Sie war kein bisschen genervt – saß nur da, spielte mit ihrem Telefon herum und summte vor sich hin. Als Mum meinte: »Jake! Wie kannst du Leila da draußen so sitzen lassen?«, zuckte er nur mit den Schultern und meinte: »Es war ihre Idee.«
In diesem Moment hält mir Leila ihre glänzende Christian-Dior-Tüte hin, was mir einen Stich versetzt. Ich kann es mir nicht leisten, Mum Parfum von Christian Dior zu schenken. Egal. Das Zeug von Sanctuary mag sie auch, und das kriegt sie von mir. Und schon beruhigt mich der bloße Gedanke an Mum. Ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen – Mum wird sich um alles kümmern. Sie wird mit Jake sprechen, auf ihre ruhige, entschlossene Art. Sie wird nicht zulassen, dass er lächerlich teures Olivenöl einkauft.
Mum hat das Sagen in der Familie, im Haushalt, im Geschäft … im Grunde überall. Sie ist der Boss. Unser Anker. Als Daddy plötzlich an einem Herzinfarkt starb, war es, als würden ungeahnte Kräfte freigesetzt, als konzentrierte sich die ganze negative Energie ihrer Trauer auf den Entschluss, dass weder das Geschäft noch die Familie oder sonst irgendwas daran zerbrechen durfte. Sie hat uns mit ihrer Kraft durch die letzten neun Jahre gebracht und nebenher Zumba gelernt, und niemandem gelingt der Blätterteig so wie ihr. Sie ist unglaublich. Sie sagt, sie denkt jeden Abend an Dad und bespricht mit ihm alles, bevor sie etwas tut. Was seltsam klingt – und doch glaube ich ihr.
Normalerweise steht sie von morgens bis abends im Laden. Heute ist sie nur nicht hier, weil sie am Abend ihren Geburtstag feiert und sich den Tag zum Kochen freigenommen hat. Und ja, manche Frauen in ihrem Alter – in jedem Alter eigentlich – würden an ihrem Geburtstag andere Leute für sich kochen lassen. Nicht so Mum. Sie hat Würstchen im Schlafrock gemacht, Waldorf-Salat und gedeckten Apfelkuchen, wie an jedem 2. August, seit ich denken kann. Es hat Tradition. Wir Farrs, wir sind eine einzige große Tradition.
»Übrigens habe ich das mit deiner Rechnung für die Autoreparatur geklärt«, sagt Jake zu Leila. »Hab den Typen angerufen und gesagt: ›Du willst meine Freundin über den Tisch ziehen? Das kannst du vergessen.‹ Er hat in allen Punkten nachgegeben.«
»Jake!« seufzt Leila. »Du bist mein Held!«
»Und ich denke, du bräuchtest mal was Besseres«, fügt Jake beiläufig hinzu. »Kaufen wir dir ein neueres Modell! Am Wochenende sehen wir uns mal um.«
»Ach Jakey.« Leilas Augen leuchten, und sie wendet sich mir zu. »Ist er nicht ein Schatz?«
»Äh … ja.« Matt lächle ich sie an. »Total.«
In diesem Moment kommt Morag mit einer Kundin – einer Frau in mittleren Jahren – zur Kasse. Augenblicklich schaltet Jake in seinen Kundenservice-Modus, strahlt sie an und fragt: »Haben Sie alles gefunden, was Sie suchen? Oh, ein Schälmesser. Nun, ich fürchte, ich muss Ihnen eine delikate Frage stellen: Sind Sie schon über achtzehn?«
Die Frau kichert und errötet, und selbst ich muss grinsen. Jake kann ziemlich charmant sein, wenn er will. Als sie geht, rufen wir ihr alle mehrmals Auf Wiedersehen hinterher und lächeln, bis sich die Tür hinter ihr schließt. Dann holt Jake seine Autoschlüssel aus der Tasche und spielt damit herum, so wie er es schon immer getan hat, seit seinem allerersten Auto.
Ich weiß genau, was ich am liebsten zu ihm sagen möchte. Fast kann ich sehen, wie sich die Worte vor meinen Augen in einer Denkblase herausbilden. Klare, leidenschaftliche Worte über unseren Laden. Über das, was wir hier tun. Über Dad. Aber irgendwie scheint es mir unmöglich, die Worte aus der Denkblase in die Freiheit zu entlassen.
Jake wirkt abwesend, und ich bin klug genug, ihn nicht zu unterbrechen. Aufmerksam steht Leila da und wartet, so wie ich, die Augenbrauen ängstlich zusammengeschoben.
Leila ist so hübsch. Hübsch und sanft und unvoreingenommen. Ernst nimmt sie in ihrem Leben eigentlich nur die Maniküre, denn das ist ihr Geschäft, ihre Leidenschaft. Und doch scheint sie meine ungepflegten Fingernägel gar nicht zu sehen, geschweige denn, dass sie sich darüber mokieren würde. Sie akzeptiert jeden so, wie er ist, einschließlich Jake.
Endlich hört Jake auf, seine Schüssel kreiseln zu lassen, und scheint zu einer Entscheidung gekommen zu sein. Ich habe keine Ahnung, was ihn umtreibt. Obwohl ich mit ihm aufgewachsen bin, verstehe ich Jake doch nicht besonders gut.
»Dann fahren wir jetzt rüber zum Haus«, sagt er. »Um Mum zu helfen.«
Ich weiß genau, was er mit »Mum helfen« meint: »Ich nehme mir ein Bier und setz mich vor den Fernseher«, verkneife mir aber die Bemerkung.
»Okay«, sage ich. »Wir sehen uns drüben.«
Vom Laden läuft man nur zehn Minuten zu unserem Haus. Manchmal kommt es mir vor, als wäre das eine ein Anbau des anderen. Eben will ich schon anfangen, einen Stapel von Tischmatten zurechtzurücken, als Leila sagt: »Was ziehst du eigentlich an, Fixie?«, ganz aufgeregt, als wollten wir zum Schulball.
»Keine Ahnung«, sage ich verdutzt. »Ein Kleid, vermute ich mal. Nichts Besonderes.«
Es ist Mums Geburtstagsparty. Da kommen Freunde und Nachbarn und Onkel Ned. Ich meine, ich möchte natürlich hübsch aussehen, aber es ist ja nicht gerade der Wiener Opernball.
»Ach so.« Leila ist baff. »Dann willst du also nicht …«
»Was nicht?«
»Ich dachte nur, weil …«
Vielsagend lässt sie ihren Satz verklingen, als wüsste ich genau, wovon sie redet.
»Weil was?« Ich mustere sie, und plötzlich fährt Leila auf ihren Klapperdiklapper-Absätzen zu Jake herum.
»Jakey!«, sagt sie mit ihrer Version einer tadelnden Stimme. (Im Grunde ist es ein schmachtendes, gekünsteltes Lächeln.) »Hast du es ihr denn nicht gesagt?«
»Ach so. Stimmt.« Jake rollt mit den Augen und sieht mich an. »Ryan ist wieder da.«
Bitte?
Reglos starre ich ihn an. Ich kann nicht sprechen, denn meine Lunge hat sich verklemmt, aber mein Hirn ist schon dabei, die Worte »wieder da« zu analysieren, wie ein unerbittliches Computerprogramm. »Wieder da.« Was bedeutet »wieder da«? Wieder in England? Wieder zu Hause? Wieder bei mir?
Nein, nicht wieder bei mir, offensichtlich nicht wieder bei mir …
»Er ist wieder im Lande«, erklärt Leila mit sanftem, mitfühlendem Blick. »Es hat nie so richtig funktioniert mit dieser Amerikanerin. Er kommt zur Party. Und er hat nach dir gefragt.«
KAPITEL DREI
Ich weiß nicht, wie oft ein Herz brechen kann, aber meins wurde immer und immer wieder gebrochen, und jedes einzelne Mal von Ryan Chalker.
Nicht dass er etwas davon wüsste. Ich kann meine Gefühle ziemlich gut verbergen. (Glaube ich.) Aber die Wahrheit ist, dass ich schon mit zehn Jahren in Ryan verliebt war. Damals war er fünfzehn. Ich bin ihm zum ersten Mal beim Burger King begegnet, mit Jake und ein paar anderen Jungs. Ich war vom ersten Augenblick an von ihm fasziniert. Kein Wunder bei diesen blonden Haaren, diesem Profil, dieser Ausstrahlung.
Als ich auf die weiterführende Schule kam, war Ryan eng mit Jake befreundet und kam jedes Wochenende zu Besuch, klopfte Sprüche und flirtete mit Mum. Im Gegensatz zu allen anderen Jungs in seinem Alter hatte er ganz reine Haut. Er wusste, wie man seine Haare stylt. Er schaffte es sogar, selbst in unserer Schuluniform sexy auszusehen – so scharf war er.
Und Geld hatte er auch. Man erzählte es sich hinter vorgehaltener Hand. Irgendein Verwandter hatte ihm ein kleines Vermögen vererbt. Dauernd gab er Partys, und zu seinem siebzehnten Geburtstag bekam er ein Auto. Ein Cabrio. Ich bin jetzt siebenundzwanzig und werde ganz bestimmt niemals ein Cabrio besitzen. Ryan und Jake fuhren immer damit in London herum, das Verdeck offen, die Musik ganz laut, wie zwei Rockstars. Und Ryan war es auch, der Jake in diese schnöselige Partyszene einführte. Die beiden kamen sogar in die Clubs rein, von denen man in der Klatschpresse liest, und prahlten damit am nächsten Tag bei uns zu Hause. Als ich alt genug war, ließ Mum mich manchmal mit Jake und Ryan ausgehen. Ich fühlte mich, als hätte ich im Lotto gewonnen. Sie erregten immer und überall so großes Aufsehen, und plötzlich war ich ein Teil davon.
Ryan konnte auch wirklich nett sein. Ich werde nie vergessen, wie wir abends mal im Kino waren. Ich hatte mich gerade von einem Jungen namens Jason getrennt, und ein paar von seinen Freunden saßen hinter uns. Als sie anfingen, über mich herzuziehen, drehte sich Ryan gleich zu ihnen um und hat sie zurechtgestutzt. Als das am nächsten Tag in der Schule die Runde machte, riefen alle: »Ryan liebt Fixie!«
Selbstverständlich habe ich mitgelacht. Ich habe es wie einen Scherz behandelt. Aber in Wahrheit war ich ihm verfallen. Es fühlte sich an, als wären wir miteinander verbunden. Immer wieder dachte ich: Irgendwann werden wir ein Paar sein. Wir sind doch für einander bestimmt, oder?
Im Laufe der Jahre gab es so viele Momente, in denen ich dachte, ich hätte eine Chance. Einmal in dieser Pizzeria, als er mir zur Begrüßung ein längeres Küsschen gab. Ein andermal, als er meinen Oberschenkel gedrückt hat. Dann, als er mich gefragt hat, ob ich einen Freund hätte. Bei Dads Beerdigung, als er sich nach der Trauerfeier zu mir setzte und mich endlos von Dad erzählen ließ. An meinem einundzwanzigsten Geburtstag hat er »Don’t Want to Miss a Thing« für mich gesungen, während mein Herz flatterte wie ein Schmetterling und ich dachte: »Ja, ja, das ist es …« Aber am selben Abend ist er mit einem Mädchen namens Tamara abgezogen. Im Laufe der Jahre musste ich dabei zusehen, wie er mit so ziemlich jedem Mädchen aus West-London ausgegangen ist, wohingegen er mich kaum eines Blickes gewürdigt hat.
Dann zog er vor fünf Jahren nach L.A., um Filmproduzent zu werden. Ein echter Filmproduzent. Es gibt wohl keinen glamouröseren oder unerreichbareren Job. Ich habe immer noch die Visitenkarte, die er mir vor seiner Abreise gegeben hat, mit abstraktem Logo und einer Adresse am Wilshire Boulevard.
Ich hätte ihn leichter vergessen können, wenn er für immer verschwunden wäre – aber so war es nicht. Ständig kam er nach London geflogen und besuchte Jake, sorgte immer für helle Aufregung. Immer waren seine blonden Haare sonnengebleicht, und er hatte endlose Geschichten über Prominente zu erzählen. Beiläufig sprach er dann von einem »Tom«, und ich denke: »Tom? Welchen Tom meint er denn?« Bis mir plötzlich aufgeht, dass er von Tom Cruise spricht, und mein Herz hüpft vor Freude, und ich denke: »O mein Gott. Ich kenne jemanden, der Tom Cruise kennt!«
Derweil bin ich mit anderen Typen ausgegangen, natürlich bin ich das. Aber Ryan hatte sich in meinem Herzen festgesetzt. Und dann, letztes Jahr, ganze sechzehn Jahre nach unserer ersten Begegnung, tauchte er sturzbetrunken und todunglücklich bei Jakes Geburtstagsparty auf. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber es hatte irgendwas mit einem wichtigen Studiotypen zu tun, der ihm das Leben schwer machte.
Ich kann gut zuhören, also ließ ich ihn über den Mann herziehen und nickte und zeigte Mitgefühl. Irgendwann hatte er Dampf abgelassen, und ich merkte, wie er mich ansah. So richtig ansah. Als hätte er eben erst gemerkt, dass aus mir eine Frau geworden war. Er sagte: »Weißt du, ich mochte dich schon immer, Fixie. Du bist so echt. So verdammt erfrischend.« Dann fügte er wie staunend hinzu: »Warum sind wir eigentlich nie zusammengekommen?«
Mein Herz raste, aber ausnahmsweise schaffte ich es, mir nichts anmerken zu lassen. Ich sah ihn lange an, ließ seine Frage einen Moment in der Luft hängen, dann sagte ich: »Tja, warum eigentlich …?«
Er lächelte nur vielsagend. »Tja, warum eigentlich …?«
O mein Gott, es war fantastisch! Kaum drei Minuten später sind wir gegangen. Er nahm mich mit in das Apartment, in dem er vorübergehend wohnte, und wir verbrachten die Nacht damit, jede einzelne meiner Teenager-Fantasien in die Tat umzusetzen. Mein Verstand schrie: »Es wird wahr! Ich bin mit Ryan zusammen! Es wird tatsächlich wahr!« Zehn Tage war ich wie in Trance.
Und dann ging er zurück nach L.A.
Klar ging er zurück nach L.A. Was hatte ich erwartet? Dass er mir einen Heiratantrag machte?
(Darauf werde ich nicht antworten. Nicht mal im Stillen. Weil ich sonst vielleicht meine erbärmlichste Fantasie von allen preisgeben würde: dass wir nämlich eins von diesen Liebespaaren sein könnten, die ihr Leben lang »für einander bestimmt« sind und es irgendwann endlich merken und von da an nie mehr ohne einander sein wollen.)
Als er mich an diesem grauen Aprilmorgen verließ, küsste er mich mit einem Ausdruck ehrlichen Bedauerns und meinte: »Du tust mir so gut, Fixie.« Als wäre ich eine Saftdiät oder eine Reihe von inspirierenden Vorträgen.
So leichthin wie möglich sagte ich: »Ich hoffe, du kommst mich mal wieder besuchen.« Was nicht so ganz stimmte. Eigentlich hoffte ich, er würde plötzlich rufen: »Jetzt wird mir alles klar! Fixie, mein Liebling, ich kann nicht ohne dich leben, und ich möchte, dass du jetzt mit mir in dieses Flugzeug steigst, jetzt gleich.«
Egal. Das ist jedenfalls nicht passiert.
Dann hörte ich von Jake, dass Ryan in L.A. eine neue Freundin namens Ariana hatte und die beiden sich zwar ständig stritten, es aber ziemlich ernst war. Ein paarmal habe ich mir die beiden bei Facebook angesehen. (Okay, ständig.) Ich habe ihm nette, unverbindliche Nachrichten geschrieben, sie aber gleich wieder gelöscht. Und die ganze Zeit über habe ich so getan, als machte es mir nichts aus. Vor Mum, vor Jake, vor allen. Was hätte ich auch sonst tun sollen?
Aber das war alles gelogen. Ich habe mich nie damit abgefunden, dass ich ihn verloren hatte. Insgeheim – gegen jede Vernunft – hoffte ich noch immer.
Und jetzt ist er wieder da. Wie eine Trommel wummern die Worte in meinem Kopf – er ist wieder da, er ist wieder da –, während ich wie eine schmachtende Vierzehnjährige in einer kleinen Boutique stehe und hektisch versuche, Haarspangen auszuprobieren. Als könnte die Wahl des richtigen Haarschmucks Ryan auf magische Weise dazu bewegen, sich in mich zu verlieben.
Ich konnte unmöglich direkt nach Hause gehen. Was, wenn er schon da wäre, auf dem Sofa herumlümmelte, bereit, mich mit seinem unwiderstehlichen Lächeln zu überrumpeln? Ich brauchte Zeit. Ich musste mich vorbereiten. So gegen fünf bat ich Greg, den Laden nachher abzuschließen, und machte mich auf den Weg. Auf der High Street kaufte ich mir einen neuen Lippenstift. Und jetzt stehe ich vor einem Schmuckständer und versuche, einen anderen Menschen aus mir zu machen – mit einer strassbesetzten Haarspange für drei neunundneunzig. Oder sollte ich vielleicht doch lieber die Blume nehmen?
Ein Glitzerhaarband?
Ich weiß, es ist die reine Verdrängung. Ich kriege die ganze Tragweite dessen, was es bedeutet, Ryan wieder zu begegnen, gar nicht in meinen Kopf, also konzentriere ich mich auf ein unwichtiges Detail, das sonst niemandem weiter auffallen wird. Schicksal meines Lebens.
Am Ende nehme ich zwei Haarspangen mit Perlen, ein paar kleine Haarclips und goldene Ohrringe, als Glücksbringer. Ich bezahle alles und trete in die milde Abendluft hinaus. Mum wird inzwischen wohl den Tisch decken. Die Pappbecher stapeln. Messer und Gabeln in Servietten wickeln. Und trotzdem brauche ich noch etwas Zeit. Ich muss meinen Kopf klar kriegen.
Spontan kehre ich ins Café Allegro ein, das Stammcafé unserer Familie. Ich kaufe eine Packung frische Kaffeebohnen für Mums Maschine – wir haben immer zu wenig da, und Café Allegro hat die besten –, dann bestelle ich mir einen Pfefferminztee und setze mich ans Fenster. Ich versuche, mir genau zu überlegen, wie ich Ryan begrüßen soll. Was ich ausstrahlen möchte. Nicht überschwänglich und bedürftig, sondern selbstbewusst und verführerisch.
Seufzend nehme ich die beiden Perlenspangen aus der kleinen Tüte und halte sie mir an die Haare. In meinem Handspiegel sehe ich nicht sonderlich verführerisch aus. Ich probiere es mit den goldenen Ohrringen und verziehe das Gesicht. O Gott. Schrecklich. Vielleicht bringe ich sie lieber zurück.
Da fällt mir ein Mann auf, der mir gegenübersitzt und mich leicht amüsiert über sein Notebook hinweg beobachtet. Augenblicklich laufe ich rot an. Was tue ich hier? Normalerweise würde ich in einem Café niemals Haarspangen anprobieren. Offenbar weiß ich schon nicht mehr, mich zu benehmen.
Als ich die Spangen und Ohrringe wieder in die Tüte stecke, fällt ein Wassertropfen auf den Tisch, und ich blicke auf. Wenn ich es recht bedenke, tropft es schon die ganze Zeit von der Decke, allerdings in einen Eimer neben dem Tisch.
Eine Kellnerin serviert gerade einem Gast in der Nähe ein heißes Sandwich, und ich winke ihr, als sie eben wieder gehen will.
»Hi! Es tropft von der Decke!« Ich deute nach oben, und für einen kurzen Moment folgt ihr Blick meinem Finger, dann zuckt sie mit den Schultern.
»Ja, wir haben schon einen Eimer druntergestellt.«
»Aber es tropft auch auf den Tisch.«
Bei näherer Betrachtung bemerke ich zwei tropfende Stellen und einen feuchten Fleck an der Decke. Der ganze Bereich da oben sieht irgendwie ungesund aus. Ich werfe einen Blick zu dem Mann mir gegenüber, um herauszufinden, ob er auch schon was davon gemerkt hat, aber der ist inzwischen am Telefon und schwer beschäftigt.
»Ja …«, sagt er gerade. Er klingt gebildet, spricht geschliffenes Englisch. »Ich weiß, Bill, aber …«
Schicker Anzug, fällt mir auf. Teure Schuhe.
»Im Stockwerk über uns wird gebaut.« Die Kellnerin klingt eher ungerührt. »Wir haben schon angerufen. Sie könnten sich woandershin setzen, wenn Sie möchten.«
Es hätte mich stutzig machen sollen, dass dieser Fensterplatz frei war, obwohl das Café so gut besucht ist. Ich sehe mich nach einem freien Platz um, aber es gibt keinen.
Na gut, ich bin da nicht so pingelig. Ein paar kleine Tropfen machen mir nichts. Ich bleibe sowieso nicht lange.
»Ist schon okay«, sage ich. »Ich dachte nur, ich sage Bescheid. Wahrscheinlich muss der Eimer bald mal ausgeleert werden.«
Die Kellnerin zuckt mit den Schultern, diesmal mit dieser berühmten Mir doch egal – ich hab gleich Feierabend-Miene und kehrt wieder hinter den Tresen zurück.
»Menschenskind!«, ruft der Mann mir gegenüber. Er spricht mit lauter Stimme und gestikuliert aufgeregt herum.
Das Wort Menschenskind lässt mich lächeln. Das hat Dad immer gesagt. Man hört es nicht mehr oft.
»Hör mal zu«, sagt er gerade. »Ich habe genug von diesen Intellektuellen mit ihren sechs Abschlüssen aus Cambridge.« Er hört einen Moment lang zu, dann sagt er: »Es kann doch nicht so schwer sein, eine solche Stelle zu besetzen. Wirklich nicht. Aber Chloe besorgt mir immer nur … ich weiß. Sollte man meinen. Aber die kommen mir immer mit ihren schlauen Theorien von der Uni. Nur richtig arbeiten wollen sie nicht.«
Er beugt sich vor, nimmt seine Tasse, um einen Schluck zu trinken. Kurz treffen sich unsere Blicke. Unwillkürlich muss ich lächeln, denn ich höre schon wieder meinen Dad.
Äußerlich betrachtet hat dieser Mann keinerlei Ähnlichkeit mit Dad. Mein Vater war ein wettergegerbter ehemaliger Markthändler. Dieser Mann hier ist ein Mittdreißiger mit schickem Schlips. Und doch höre ich dieselbe Energie, denselben Pragmatismus. Dieselbe Ungeduld mit Leuten, die alles zu wissen glauben. Dad hatte auch keine Zeit für Theorien. Mach einfach, sagte er dann.
»Ich will doch nur jemanden, der wach ist und weiß, was er tut«, sagt der Mann gerade und fährt dabei mit einer Hand durch seine Haare. »Jemand, der sich mit der Welt auskennt und nicht nur eine Dissertation darüber geschrieben hat. Er braucht keinen Abschluss! Er braucht Verstand! Gesunden Menschenverstand!«
Der Mann klingt energiegeladen. Er ist schlank und braun gebrannt. Dunkelbraune Haare, im Sonnenschein etwas heller. Als er nach seiner Tasse greift, fällt ihm eine Strähne ins Gesicht. Ausgeprägte Wangenknochen. Seine Augen sind … ich weiß nicht, mittelbraun oder haselnussig, würde ich sagen. Plötzlich fällt Licht darauf, und ich sehe etwas Grün. Wie Tannengrün.
Es ist so ein Tick von mir, Augenfarben zu benennen. Meine ist »Doppelter Espresso«. Ryans ist »Himmel Kaliforniens«. Mums ist »Tiefseeblau«. Und die von diesem Mann ist »Tannengrün«.
»Ich weiß«, sagt er etwas ruhiger, nachdem sein Zorn verraucht ist. »Dann treffe ich mich also nächste Woche noch mal mit Chloe. Bestimmt freut sie sich schon drauf.« Mit einem Mal verzieht er den Mund zu einem ansteckenden Lächeln.
Er kann über sich selbst lachen. Da hat er Dad etwas voraus, der zwar der liebenswerteste, weichherzigste Mann auf der Welt war, aber weder Seitenhiebe verstehen noch über sich selbst lachen konnte. Nie im Leben hätte man Dad im Scherz eine respektlose Geburtstagskarte schenken können. Er wäre einfach nur gekränkt gewesen.
»Ach, das …« Der Mann rutscht auf seinem Stuhl herum. »Hör mal, es tut mir leid.« Wieder fährt er mit der Hand durch seine Haare, doch diesmal wirkt er gar nicht so dynamisch, eher bestürzt. »Ich bin nur … daraus wird leider nichts. Du kennst Briony, sie ist manchmal etwas vorschnell, also … nein. Kein Fitnessraum. Erst mal nicht. Tanyas Entwürfe waren großartig, sie ist sehr talentiert, aber … ja. Ich vergüte ihr den Aufwand natürlich … Nein, nicht mit einem Abendessen«, fügt er hinzu. »Mit einer offiziellen Rechnung. Ich bestehe darauf.« Er nickt ein paarmal. »Okay. Wir sehen uns. Bis bald.«
Eben schwang noch trockener Humor in seiner Stimme mit, doch als er das Telefon weglegt, starrt er aus dem Fenster, als müsste er sich erst mal fangen. Seltsamerweise kommt es mir vor, als würde ich diesen Mann kennen. Als könnte ich ihn verstehen. Vielleicht würde ich ihn sogar ansprechen, wenn wir nicht zwei verklemmte Briten in einem Londoner Café wären.
Doch das sind wir. Und so was tut man einfach nicht.
Also tue ich, was in London üblich ist, gebe vor, kein Wort von seinem Anruf mitbekommen zu haben, und starre bewusst ins Leere, um nur ja nicht seine Blicke auf mich zu ziehen. Der Mann fängt an, auf sein Notebook einzutippen, und ich sehe auf meine Armbanduhr. 17:45 Uhr. Ich sollte bald mal los.
Summend meldet mir mein Handy eine Nachricht, und ich greife danach in der irren Hoffnung, es könnte Jake sein, der mir schreibt: »Ryan ist da.« Oder besser noch Ryan selbst. Doch das ist natürlich nicht der Fall. Es ist Hannah, die mir auf meine Nachricht antwortet. Eilig überfliege ich ihre Worte:
Ryan ist wieder da? Ich dachte, er ist in L.A.
Ich kann gar nicht aufhören zu grinsen. Eilig tippe ich:
Das war er!!! Aber jetzt ist er hier und wieder Single, und er hat nach mir gefragt!!!!
Ich drücke auf Senden, dann bemerke ich meinen Fehler. Das waren zu viele Ausrufezeichen! Hannah wird misstrauisch werden. Bestimmt dauert es keine halbe Minute, bis sie mich anruft.
Mit Hannah bin ich schon befreundet, seit wir mit elf beide zu Klassensprechern gewählt wurden. Wir wussten sofort, dass wir verwandte Seelen sind. Beide sind wir gut organisiert. Beide lieben wir Listen. Beide kriegen wir was geregelt. Wobei ich zugeben muss, dass Hannah sogar noch mehr geregelt kriegt als ich. Sie schiebt nie etwas auf und sucht nie nach Ausreden. Was auch immer zu tun sein mag, sie tut es sofort, egal ob es um ihre Steuererklärung geht oder darum, ihren Kühlschrank zu putzen oder einem Typen zu sagen, dass sie nicht mag, wie er sie küsst, und das schon bei ihrem ersten Date! (Wobei man ihm zugutehalten muss, dass er es wie ein echter Mann nahm. Er meinte nur: »Wie möchtest du denn gern geküsst werden?« Da hat sie es ihm gezeigt. Und jetzt sind die beiden verheiratet.)
Sie ist die nüchternste, geradlinigste Person, die ich kenne. Sie arbeitet bei einer Versicherung und fängt schon im Juli an, sich um Weihnachtsgeschenke zu kümmern … und da ist sie auch schon! Ihr Name erscheint auf meinem Display. Ich wusste es.
»Hi, Hannah«, sage ich wie beiläufig, als wüsste ich nicht, warum sie anruft. »Wie geht’s?«
»Ryan, hm?«, sagt sie, ohne meinen Gruß zu erwidern. »Was ist mit diesem Mädchen in L.A. passiert?«
»Offenbar ist es aus.« Ich gebe mir Mühe, ruhig zu sprechen, obwohl eine Stimme in mir jubiliert: Es ist aus! Es ist aus!