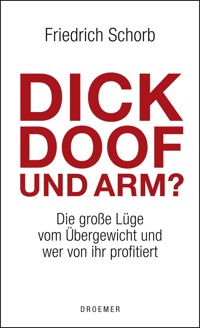
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fette Lügen Die Dicken sind schuld: Sie sind zu oft und zu lange krank, sie leisten zu wenig, sie haben sich nicht im Griff. Sie kosten die Gesellschaft Geld – und sie tun es mit Absicht. Das ist das herrschende Vorurteil. Politik, Krankenkassen und Pharmaindustrie haben die Übergewichtigen zu Sündenböcken erklärt, weil die Kosten explodieren und das Gesundheitssystem zu kollabieren droht. Doch diese gigantische Kampagne ist an Verlogenheit kaum zu überbieten. Die Grenzwerte für Übergewicht und Fettsucht sind willkürlich festgelegt – und stempeln vollkommen gesunde Menschen als Kranke ab. Leicht korpulente Menschen leben sogar gesünder und sind leistungsfähiger als sehr schlanke. Der Soziologe Friedrich Schorb ist den Lügen des Schlankheitswahns auf den Grund gegangen und demaskiert sie als Volksverdummung und Geschäftemacherei. Dick, doof und arm von Friedrich Schorb: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Friedrich Schorb
Dick, doof und arm?
Die große Lüge vom Übergewicht und wer von ihr profitiert
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Die Fett-Panik und ihre fatalen Folgen
I. Wie das Übergewicht zur Epidemie erklärt wurde
Die Epidemie und ihre Sponsoren oder Wie die Pharmaindustrie Dicke macht
Wie die Deutschen die dicksten Europäer wurden – Eine Falschmeldung und ihre Folgen
Das versicherte Idealgewicht oder Wie Gewichtsnormen entstehen
Der adipöse »Governator« – Zur medizinischen Bedeutung des Body-Mass-Index
Werden wir wirklich immer dicker? – Zahlen, Prognosen und was sie wirklich aussagen
Übergewicht: Killer oder Lebenszeitverlängerer?
Relative Risiken oder Von der Schwierigkeit, den Tod vorherzusagen
Eine Seuche namens Wohlstand – Übergewicht in der Dritten Welt
II. Der vergebliche Kampf der Weißkittel gegen die Wampe
Symptom dicker Bauch – Zur Geschichte des Übergewichts
Diäten: Keine Lösung für eine eingebildete Krankheit
Der verzweifelte Kampf gegen den gesunden Appetit – Zur Psychologie des Essens
Auf der Suche nach der Wunderpille – Pharmakonzerne auf der Anklagebank
Operation gelungen, Patient tot – Zur chirurgischen Behandlung von Übergewicht
Macht Fett fett? oder Wer ist eigentlich schuld an der »Übergewichts-Epidemie«?
Zu wenig Bewegung, Schlafmangel oder Stress? Alternative Erklärungen für Übergewicht
Das vererbte Übergewicht oder Warum die »Ausrede« von den besseren Futterverwertern keine ist
Wo die dicksten Menschen leben: Die Südseeinsel Nauru
III. Die fettfeindliche Gesellschaft
Neandertaler in der Konditorei – Übergewicht im Licht der Evolutionstheorie
Selbst schuld! – Übergewicht als abweichendes Verhalten
Dick, doof und arm? – Übergewicht und die Unterschichtendebatte
Von athletischen Arbeitern und dicken Direktoren – Arbeitsverhältnisse und Körperbilder im Wandel
Macht Bildung schlank? – Der Zusammenhang von Ausbildung und Körpergewicht
Menü Sarrazin – Ernährung in Armutshaushalten
Das Armuts-Jojo – Vom Mangel in der Überflussgesellschaft
IV. Keine Angst vor dicken Kindern!
»Zehn Prozent sind zu dick« – Wie Übergewicht bei Kindern gemessen wird
Von kleinen Mädchen und großen Lügen – Die größten Mythen über dicke Kinder
Übergewicht als »besonders perfide Form der Misshandlung« – Die Sorgerechtsdebatte
Die Pausenbrotpolizei – Übergewichtsprävention an Kindergärten und Schulen
Die Mission des britischen Starkochs Jamie Oliver oder Wie ich lernte, den Sellerie zu lieben
Wie es anders gehen könnte: Alternative Überlegungen zu Interventionen an Kindergärten und Schulen
V. Schlanke Bürger im schlanken Staat
Was kostet das Übergewicht? oder Wie die Dicken die Pharmaindustrie mästen, ohne die Krankenkassen zu schröpfen
Die Mär von der Kostenexplosion im Gesundheitswesen oder Wo bleibt eigentlich das viele Geld?
Kleine Ökonomie des Gesundheitswesens oder Warum ein billigeres Gesundheitssystem nicht unbedingt ein schlechteres ist
Gesundheit als Konsumgut – Zur Privatisierung von Lebensrisiken
Schuld und Krankheit – Wenn der OP zum Gerichtssaal wird
Warnhinweise und Fettsteuern – Die falschen Lehren aus der Tabakprävention
Essstörungen und Gewichtsdiskriminierung – Die Kollateralschäden im »War on Fat«
Lebensfreude statt schlechten Gewissens
Dank
Die Fett-Panik und ihre fatalen Folgen
»Was darf’s denn sein?«, fragt der Kellner. – »Ich hätte gerne das argentinische Riesensteak mit Bratkartoffeln, dazu eine Flasche Rotwein bitte.« Der Kellner mustert mich prüfend. »Dann müsste ich laut Gesetz zum Schutze vor Übergewicht kurz einen Blick auf ihren Fitness-Ausweis werfen«, entgegnet er mir streng. »Das Steak darf ich Ihnen nur verkaufen, wenn Ihr Body-Mass-Index im grünen Bereich liegt. Oder Sie legen mir eine Bescheinigung vom kommunalen Fitnessstudio vor.« – »Oje, beides vergessen«, gestehe ich. »Dann also Sommersalat mit Knäckebrot, gerne«, befindet der Kellner mit schmalem Lächeln. »Die hausärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung über ihre Leberwerte haben Sie aber dabei?« – »Leider auch nicht …« – »Gut, dann bringe ich Ihnen ein stilles Wasser – ist ja auch gesünder.«1
Diese Zukunftsvision – aufgeschrieben von Sascha Hammes, nachzulesen in der ZEIT – scheint uns als zwar amüsante, doch zugleich maßlos übertriebene Glosse. Wir lesen sie, schmunzeln und denken uns: So weit wird es schon nicht kommen. Doch ein Blick ins Ausland belehrt uns eines Besseren.
Als der britische Staatsbürger Richard Trezise, Spezialist für Unterwasserverkabelung, ein lukratives Jobangebot von einer neuseeländischen Firma erhielt, beschlossen er und seine Frau Rowan Trezise, sich den Traum vom Leben im fernen Ausland zu erfüllen. Dem Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung legt Richard vorschriftsgemäß die medizinische Untersuchung durch seinen Hausarzt bei. Reine Routine, glaubt er, schließlich ist er kerngesund. Bei der Ankunft am Flughafen in Auckland kam die böse Überraschung. Zu seinem Entsetzen erfuhr er, dass die Ausländerbehörde des Landes jedem ausländischen Staatsbürger, der nach den Kriterien der neuseeländischen Gesundheitsbehörde krankhaft übergewichtig ist, die Aufenthaltsgenehmigung verweigert. Richard Trezise wurde mitgeteilt, dass er mindestens fünf Zentimeter seines Bauchumfangs abspecken müsse, bevor er ein Arbeitsvisum erhalten könne. Gemessen werden in Neuseeland nicht wie andernorts das Gewicht und die Körpergröße, sondern der Umfang des Unterleibs. Der Brite wurde zurück in seine Heimat geschickt. Trezises Hausarzt zeigte sich in der britischen Tageszeitung The Independent überrascht, dass dem Freizeitsportler, der regelmäßig Rugby gespielt hatte, aus gesundheitlichen Gründen die Einreise verweigert wurde. Allein, es nützte nichts, die neuseeländischen Behörden blieben stur. Richard beschloss abzunehmen. Nach einer qualvollen Crash-Diät hatte er es schließlich geschafft, er erhielt das begehrte Visum. Doch nun drohte neues Ungemach. Richard durfte zwar einreisen, aber er musste alleine bleiben. Denn jetzt wurde seiner Frau Rowan die Einreise verweigert – ebenfalls wegen Übergewicht.
Im US-Bundesstaat Mississippi starteten etwa zur selben Zeit drei Abgeordnete einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf, der den Betreibern von Restaurants mit mindestens fünf Sitzplätzen verbieten sollte, in »Amerikas dickstem Bundesstaat« offensichtlich übergewichtigen Kunden Essen zu servieren. Dass es in Mississippi bislang noch keinen Fitnessausweis gibt, in dem der aktuelle Body-Mass-Index festgehalten wird, schreckte die Abgeordneten nicht. Umfangreiches Informationsmaterial sollte Restaurantbesitzer und -angestellte in die Lage versetzen, unter ihren potentiellen Gästen treffsicher die krankhaft Übergewichtigen herauszufiltern. Ob es den Kellnern zuzumuten sei, ihre Gäste öffentlich zu wiegen und zu messen, wurde im Gesetzentwurf nicht festgelegt, wohl aber, dass ein widerrechtliches Servieren von Speisen an offensichtlich übergewichtige Kunden im Wiederholungsfall zum Entzug der Gaststättenlizenz führen könne. Das Gesetz sollte am 1. Juli 2008 in Kraft treten. Doch die House Bill No. 282 stieß auf große Proteste und wurde dem Parlament nicht zur Abstimmung vorgelegt. Der zuständige Minister erklärte gegenüber dem Nachrichtensender »Fox News«: »Sobald das Gesetz bei mir auf dem Schreibtisch liegt, ist es tot.« Die Autoren des Gesetzes behaupteten anschließend, sie hätten gar nicht mit einer Verabschiedung gerechnet. Ihnen wäre es lediglich darum gegangen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema Übergewicht zu lenken.
Ein halbes Jahr später erklärte der Gemeinderat von Los Angeles ein Fast-Food-Verbot für den armen Süden der Stadt. Zunächst für ein Jahr dürften im Stadtteil South LA keine neuen Schnell-Restaurants mehr eröffnet werden. Ginge es nach den Vorstellungen der Stadträte, sollten sich dort, wo einst Wendy’s, BURGER KING und McDonald’s die Kunden lockten, Restaurants mit Sitzgelegenheiten, Supermärkte mit Frischtheken und Obst-, Gemüse und Bioläden ansiedeln. Auf diese Weise hoffte man die Zahl der Übergewichtigen in South LA zu senken und so Kosten im Gesundheitswesen einzusparen. Woher die Bewohner des verarmten Stadtteils das Geld nehmen sollten, um in den vielen neuen Restaurants, Bistros, Feinkost- und Bioläden, die dort anstelle von Burger-Bratern wie Pilze aus dem Boden sprießen würden, einzukehren und zu kaufen, ließen die Stadträte allerdings unbeantwortet.
US-amerikanische Fluggesellschaften wie United Airlines, Southwest Airlines, Continental und Delta lassen adipöse Fluggäste, die sich in den engen Sitzen der Economy Class nicht anschnallen bzw. im Sitzen die Armlehnen nicht herunterklappen können, schon länger für zwei Sitze bezahlen. Der irische Billigflieger Ryan Air hat sich diese Maßnahmen jetzt zum Vorbild genommen. Im Gegensatz zu den US-amerikanischen Fluggesellschaften aber begründet Ryan Air sein Vorgehen nicht mit dem Sitzkomfort normalgewichtiger Passagiere, sondern mit den zusätzlichen Kosten für Treibstoff. Und so geht es bei der Ryan Air-Maßnahme auch nicht darum, ob die Passagiere in die engen Sitze passen oder nicht, sondern allein um ihr Gewicht. Zuvor war der Billigflieger mit der besonderen Vorliebe für versteckte Gebühren noch mit dem Vorschlag angeeckt, Münztoiletten an Bord seiner Maschinen einzubauen. Doch aufs Klo müssen schließlich alle, da ist es einfacher, eine Minderheit abzukassieren. Zumal sich die Fluggesellschaft diesmal vorab der Zustimmung seiner Kunden zu dieser Maßnahme per Fragebogen versichert hatte.
An britischen Schulen sind Cola, Chips und Co. offiziell schon lange verboten, doch weil sich viele Jugendliche außerhalb der Schule mit ebendiesen Leckereien versorgten, wurde ihnen in zahlreichen Gemeinden mittags das Verlassen des Schulgeländes untersagt. Findige Betreiber mobiler Imbissbuden nutzten dies, um ihre Wagen unmittelbar vor den Schulen zu parken und die Schüler so trotz Ausgangssperre bedienen zu können. Als Reaktion darauf haben viele britische Gemeinden »Junk-Food-Bannmeilen« um Schulen gezogen. In einem Umkreis von mindestens 500 Metern darf nun nichts mehr verkauft werden, was die Behörden zuvor als der Gesundheit abträglich definiert haben. Das Totalverbot von Chips, Süßigkeiten, Limonaden, Kebabs, Hamburgern und Frittiertem aller Art hat dazu geführt, dass auf den Schulhöfen die betreffenden Lebensmittel wie Schwarzmarktware feilgeboten werden. Die Regierung möchte diesem grassierenden Schmuggel nun durch eine strengere Pausenhofaufsicht entgegenwirken. Zukünftig sollen die »lunch bags« der Schüler besser kontrolliert und alles, was als gesundheitsschädlich gilt, sofort einkassiert werden.
Einigen Müttern im nordenglischen Rotherham ging die Bevormundung der britischen Regierung zu weit. Sie umgingen das Junk-Food-Verbot für ihre Kinder und brachten ihnen die geliebten Snacks an den Schulzaun. Vom englischen Starkoch Jamie Oliver müssen sie sich dafür als »Arschlöcher« bezeichnen lassen. Der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingstone wollte es indes nicht bei Verbalattacken belassen. Er fordert, die rebellischen Mütter festnehmen zu lassen.
Weil die Schule die Kinder aber nicht rund um die Uhr vor den Gefahren fettigen und süßen Essens schützen kann, werden in Großbritannien übergewichtige Kinder immer häufiger der Obhut ihrer Eltern entzogen und dem Jugendamt unterstellt. Was früher nur in extremen Einzelfällen diskutiert wurde, droht heute gängige Praxis zu werden. Die BBC berichtete im Juni 2007 von mindestens 20 Fällen, die der Redaktion bekannt seien, bei denen über einen Sorgerechtsentzug wegen starken Übergewichts verhandelt wurde. Im August 2008 forderte ein Zusammenschluss von mehr als 400 britischen Gemeindevertretern, die Praxis des Sorgerechtsentzugs massiv auszudehnen, da der »Übergewichts-Epidemie« und der mit ihr einhergehenden Kostenlawine für die Kommunen anders nicht Herr zu werden sei.
Der Co-Erzieher der Kinder – das Fernsehen – trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei, die Kleinen vor den Gefahren falscher Ernährung zu bewahren. Das Krümelmonster der pädagogisch wertvollen Sesamstraße wurde jedenfalls schon länger auf Diät gesetzt. Statt dem alten Schlachtruf »Keeeeekse!« hört man es heute höchstens noch »Einen Keks isst man ab und an« brummeln.
Ebenfalls in Großbritannien rief der konservative Abgeordnete und – im Falle des Wahlsieges seiner Partei zukünftige Gesundheitsminister – Andrew Lansley in einer Parlamentsdebatte seine Landsleute dazu auf, Übergewichtige sozial zu ächten. Eltern dürften sich nicht mit Hinweis auf die Gene oder die Umwelt aus der Verantwortung stehlen. Vielmehr sei es an der Zeit, dass Eltern und Kinder sozialen Druck auf ihre übergewichtigen Freunde ausübten, anstatt selbst der Versuchung nachzugeben und deren schlechte Angewohnheiten zu übernehmen. Denn in Wahrheit, so Lansley weiter, gebe es keine Ausrede dafür, keinen Sport zu treiben und wenig Obst und Gemüse zu essen. Wer fett ist, trage dafür selbst die Verantwortung und habe Ächtung, nicht Mitleid verdient.
Lansleys japanische Kollegen gehen derweil mit gutem Beispiel voran. Sie halten öffentlich Diät. Per Internet kann jeder den stellvertretenden Gesundheitsministern Noritoshi Ishida und Keizo Takemi beim Abspecken zuschauen. Damit auch wirklich alle sehen, dass hier nicht geschummelt wird, werden auf einem eigens eingerichteten Blog des Gesundheitsministeriums regelmäßig Fotos veröffentlich, die eine Mitarbeiterin dabei zeigen, wie sie deren entblößte Bäuchlein misst. Erst wenn sie ihren Bauchumfang auf unter 85 Zentimeter getrimmt haben, geloben die Minister, werde der Blog abgeschaltet.
Bliebe die peinliche Peepshow ein Einzelfall, man könnte darüber schmunzeln. Doch weit gefehlt. Ausgerechnet in Japan, dem Land, wo beleibte Menschen so selten sind, dass Adipositas als Synonym für »Sumo-Ringer« durchgehen könnte, wird seit 2006 von allen Bürgern des Landes im Alter zwischen 40 und 74 Jahren jährlich der Bauchumfang gemessen. Erlaubt sind bei Frauen maximal 90 Zentimeter, bei Männern sogar nur 85 Zentimeter.
Sechsundfünfzig Millionen Bäuche, und damit 44 Prozent der Gesamtbevölkerung, werden in einer zentralen Datei erfasst. In vier Jahren soll die Zahl der »übergewichtigen« Japaner auf diese Weise um zehn Prozent und in sieben Jahren sogar um 25 Prozent gesenkt werden. In den Großbetrieben sind die Bauchmessungen Teil der traditionellen jährlich stattfindenden Gesundheitschecks. Den Firmen, die besonders viele füllige Mitarbeiter beschäftigen, drohen finanzielle Konsequenzen. Die Sanktionen für die Firmen sind so happig – allein der Computer-Hersteller NEC rechnete für 2008 mit Strafzahlungen von fast 15 Millionen Euro –, dass die Betriebe den finanziellen Druck bald an ihre Mitarbeiter weitergeben dürften.
Alle Japaner, die nicht in einem Großbetrieb arbeiten und nicht privat versichert sind, erhalten die Aufforderung, sich jährlich einmal zur Bauch-Musterung in ein Krankenhaus in ihrer Nähe zu begeben. Im Kleinstädtchen Amagasaki sind das immerhin zwei Drittel der Einwohner im Alter von 45 bis 74 Jahren. Auch der Blumenhändler Minoru Nogiri blieb von der Maßnahme nicht verschont. Ein New-York-Times-Reporter begleitet den 45-jährigen Nogiri auf dem Weg zur Untersuchung. »Nogiri entblößt«, beschrieb der Reporter die Szene, »einen flachen Bauch mit kaum sichtbaren Fettpölsterchen. Eine Krankenschwester setzt das Maßband an. 85,3 Zentimeter. 0,3 Zentimeter mehr als erlaubt. ›Das war’s: Ich bin erledigt‹, sagt Nogiri, die Niederlage steht ihm ins Gesicht geschrieben.«2
Um sich und seinen Angestellten solche Demütigungen zukünftig zu ersparen, hat der Bürgermeister des Nachbarorts Mie mit sechs anderen Angestellten der Kommune die »Seven Metabo Samurai« – benannt nach dem »metabolischen Syndrom« aus Übergewicht, Bluthochdruck und hohen Cholesterinwerten – ins Leben gerufen, um gemeinsam abzuspecken. Die Aktion endete abrupt, als ein 47-jähriges Mitglied der »Metabo-Samurai« beim Joggen einen Herzinfarkt erlitt.
Nicht nur wegen solcher Exzesse zweifeln japanische Public-Health-Experten am Sinn der staatlichen Abspeckkampagne. Sie halten die Hürden, die selbst im schlanken Japan über die Hälfte der Männer in der entsprechenden Altersgruppe nicht einhalten, für maßlos übertrieben. Auch die offizielle Begründung, die Gesundheitskosten liefen aus dem Ruder, wirkt vorgeschoben. In Japan, das über ein hervorragendes Gesundheitssystem verfügt, sind die Kosten für Gesundheitsausgaben pro Einwohner gerade mal halb so hoch wie in den USA. Und so geht es in Wahrheit wohl eher darum, die Krankenversicherten zu schröpfen, um die klammen öffentlichen Haushalte zu entlasten. Denn dem Gewichtserlass ging bereits ein anderer Gesetzesentwurf zur Abwälzung der Kosten des Gesundheitswesens auf die Versicherten voraus. Premierminister Yasuo Fukuda wollte die Krankenkassenbeiträge für über 75-Jährige erhöhen. Das allerdings hätte ihm im Land mit der weltweit höchsten Lebenserwartung fast den Kopf gekostet. Und deswegen muss jetzt der Blumenhändler Minoru Nogiri die Zeche zahlen.
In atemberaubendem Tempo wurde in den letzten Jahren weltweit tatsächlich oder vermeintlich gesundheitsschädigendes Verhalten verurteilt und nicht selten auch verboten. Ging es bisher vorwiegend um die legalen Drogen Alkohol und Tabak, gerät in letzter Zeit zunehmend der dicke Bauch ins Visier der Gesundheitspolizei. Doch im Gegensatz zum Kampf gegen Erstgenannte betrifft Übergewicht die gesamte Lebensführung. Wenn die Dickmacher attackiert werden, dann geht es anders als bei Nikotin und Alkohol nicht um einzelne Stoffe, sondern um Buletten, Süßigkeiten, Softdrinks, um Fernsehabende, Autofahrten, um die Entscheidung zwischen Fahrstuhl und Treppe, zwischen Sofa und Laufband sowie um tausend andere kleine Angewohnheiten und Vorlieben.
Und obwohl eigentlich alle angesprochen sind, haben einige nichts zu befürchten. Denn auch wenn sie sich noch so gerne auf der Couch lümmeln, höchstens bei einem Großbrand auf den Fahrstuhl verzichten, zum Briefkasten mit dem Auto fahren und sich ausschließlich von Pommes, Pizzas, Burgern und Bockwürsten ernähren, niemand sieht ihnen ihre Sünden an. Sie haben das Glück, zur dünnen Minderheit zu gehören.
Fast zwei Drittel der Männer und mehr als jede zweite Frau gelten in Deutschland dagegen als zu dick, ein gutes Fünftel sogar als krankhaft fettleibig. Und ganz gleich, was sie am liebsten essen und wie sie ihre Freizeit gestalten, sie stehen unter dringendem Tatverdacht.
Das Verhalten und die Vorlieben dieser Menschen sind nicht länger ihre private Angelegenheit. Sie müssen sich für alles, was sie tun, rechtfertigen. Denn sie verursachen Kosten, die, jedenfalls behauptet das die Bundesregierung, die Allgemeinheit, also auch alle, die sich vernünftig verhalten, für Sie mittragen.
»Für jede Bürgerin und jeden Bürger ist es in Deutschland grundsätzlich möglich, gesund zu leben, sich insbesondere eigenverantwortlich gesund zu ernähren und ausreichend zu bewegen. Dennoch nehmen in Deutschland und in den meisten Industrienationen Krankheiten zu, die durch eine unausgewogene Ernährung und zu wenig Bewegung begünstigt werden. Das bedeutet, dass nicht alle Menschen in der Lage oder willens sind, diese bestehenden Möglichkeiten zu nutzen. Daher ist es erforderlich, die Kenntnisse über die Zusammenhänge von ausgewogener Ernährung, ausreichender Bewegung und Gesundheit weiter zu verbessern, zu gesunder Lebensweise zu motivieren und Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Wahrnehmung der Verantwortung jeder Einzelnen und jedes Einzelnen für die eigene Gesundheit und die der Familie fördern. (…). Die Unterstützung von Verhaltensänderungen durch Information und Motivation sowie die Weiterentwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen sind zentrale Aufgaben des Nationalen Aktionsplans. Denn Gesundheit ist nicht nur ein individueller Wert, sondern eine Voraussetzung für Wohlbefinden, Lebensqualität und Leistung, ein Wirtschafts- und Standortfaktor, die Voraussetzung für die Stabilität des Generationenvertrags, und sie leistet einen Beitrag zur Teilhabe an der Gesellschaft und zur sozialen Gerechtigkeit.«3
Das jedenfalls schreibt die Bundesregierung in ihrer Erklärung zum neuesten Aktionsplan gegen das Übergewicht. Im Klartext heißt das: Wer sich trotz bestehender Alternativen nicht vernünftig ernährt, zu viel, zu fett oder zu süß isst, sich nicht ausreichend bewegt und deshalb zu viel auf die Waage bringt, gefährdet nicht nur sich selbst und seine Familie, sondern den Wirtschaftsstandort Deutschland, den Generationenvertrag und die soziale Gerechtigkeit gleich mit. Dasselbe gilt für Menschen, die sich gesund ernähren, Sport treiben und trotzdem dick werden.
Doch stimmt es wirklich, dass die Übergewichtigen das Gesundheitssystem ruinieren? Stecken Fehlernährung und Bewegungsmangel hinter mehr als einem Drittel der Kosten im Gesundheitswesen, wie die Bundesregierung behauptet? Und wie wird so etwas eigentlich gemessen? Sterben dicke Kinder vor ihren Eltern? Werden aus dicken Kindern zwangsläufig dicke Erwachsene? Wer definiert, welches Gewicht als gesund und welches als krank gilt? Wer profitiert davon, wenn die Bevölkerungsmehrheit als übergewichtig klassifiziert wird? Warum sind wir so felsenfest davon überzeugt, dass das Leben im Wohlstand die Menschen kränker werden lässt, obwohl alle Indizien dagegensprechen? Was hat Übergewicht mit Armut zu tun und »gesundes Essen« mit dem Wunsch, sich abzugrenzen? Warum ist es heute schick, dünn und athletisch zu sein, während früher der dicke Bauch für Wohlstand und Prestige stand? Diese und weitere Fragen möchte dieses Buch beantworten.
I.Wie das Übergewicht zur Epidemie erklärt wurde
Die Epidemie und ihre Sponsoren oderWie die Pharmaindustrie Dicke macht
Wir alle sind, jedenfalls wenn wir der Berichterstattung in den Medien und den Worten der zuständigen Experten Glauben schenken, Zeugen einer Epidemie. Einer Epidemie, von der mehr als jeder zweite Deutsche und über eine Milliarde Menschen weltweit betroffen sind. Einer Epidemie, die in ihrem Schlepptau ein Bündel an tödlichen Folgekrankheiten führt. Einer Epidemie, die selbst Babys nicht verschont und die die Lebenserwartung der kommenden Generation erstmals seit Jahrhunderten senken wird. Einer Epidemie, deren Folgekosten so groß sind, dass sie nicht nur das Gesundheitswesen in ernste Finanzierungschwierigkeiten bringt, sondern auch zukünftiges Wirtschaftswachstum gefährdet.
Obwohl es schon seit mindestens vierzig Jahren Anzeichen für das Auftreten der neuen Massenkrankheit gibt, hat sich erst in den letzten zehn Jahren das Bewusstsein für ihre rasante Verbreitung und ihre fatalen Folgen geschärft. Gab es bis Anfang der 1990er Jahre nur sporadische Berichte über die Folgen der verheerenden Seuche, explodierte deren Zahl nach der Jahrtausendwende. So berichteten DIE ZEIT und DER SPIEGEL von 1980 bis 1999 lediglich neunzehnmal über die Krankheit. Allein zwischen 2004 und 2008 waren es, die Online-Ausgaben der Zeitungen nicht mitgerechnet, 24 Artikel, in denen der neuen Epidemie durch das Wörtchen Adipositas – den medizinischen Fachausdruck für krankhaftes Übergewicht – die Referenz erwiesen wurde.
Ein ähnliches Bild ergibt sich in Großbritannien. In der britischen Tageszeitung The Guardian erschienen im Jahr 1999 erst 40 Berichte, in denen das Wort »obesity« vorkam, im Jahr 2002 waren es bereits 127 Artikel, bis 2004 mit 392 Meldungen ein vorläufiger Rekord erreicht wurde. In den USA blieb die Zahl der jährlichen Meldungen über die Massenerkrankung in Tageszeitungen und Nachrichtenportalen bis Anfang der 1990er Jahre deutlich unter 500. 1994 waren es erstmals über 1000 Meldungen, die den Namen der Epidemie in der Schlagzeile führten, 1997 dann bereits 2500 Meldungen, und nur sechs Jahre später hatte sich die Zahl auf 7500 verdreifacht.
Auf internationaler Ebene vervierfachte sich die Zahl der englischsprachigen Artikel, die die Krankheit erwähnten, von weniger als 4000 pro Quartal im Jahr 2000 auf fast 16 000 pro Quartal im Jahr 2007. In Frankreich wurde »obésité« in der landesweiten Tageszeitung Le Monde zwischen 1987 und 1997 weniger als zwanzigmal pro Jahr erwähnt. Im Jahr 2002 dagegen bereits mehr als fünfzig-, 2004 dann sogar schon mehr als hundertmal.
Wenn die These von der seuchenartigen Verbreitung der Adipositas also in irgendeinem Zusammenhang gerechtfertigt ist, dann in Bezug auf die Berichterstattung in den Medien. Doch nicht nur die Zahl der Artikel zu Übergewicht und Adipositas hat sich vervielfältigt, auch der Tonfall, in dem über das Phänomen berichtet wird, ist aggressiver geworden. War lange Zeit nur von einem – wenn auch gravierenden – Gesundheitsproblem die Rede, so ist die Bezeichnung als Seuche mittlerweile unhinterfragter Bestandteil der Berichterstattung über den dicken Bauch. Metaphern wie der »Krieg gegen die Pfunde« oder die viel bemühte »tickende Zeitbombe« unterstreichen die Dringlichkeit des Problems und lassen keinen Zweifel an der Notwendigkeit und Zulässigkeit von Gegenmaßnahmen mehr zu.
Die schrillsten Töne sind dabei in den USA und Großbritannien zu vernehmen. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush sprach 2002 vom »War on Fat«, der dem »War on Terrorism« folgen müsse, und zog medienwirksam die Joggingschuhe an. Sein oberster Gesundheitsbeauftragter, Richard Carmona, der in den USA ganz militärisch »Surgeon General« heißt, bezeichnete das Übergewicht seiner Landsleute gar als »Terror im Innern«, der schlimmer sei als die Anschläge vom 11. September 2001. Der britische Gesundheitsminister Alan Johnson dagegen befand, dass das Übergewicht mindestens ebenso bedrohlich für die Zukunft der Insel sei wie der Klimawandel. Britische Forscher setzten kürzlich sogar noch einen drauf. Sie behaupteten, massenhaftes Übergewicht sei ein maßgeblicher Grund für den Klimawandel.4 Auch in den USA schüren Wissenschaftler die Hysterie um die Fettpolster: So meint beispielsweise der US-amerikanische Ernährungsexperte Barry Popkin, dass global gesehen das Übergewicht bereits heute die Gefahren des Welthungers in den Schatten stelle.5
Die Wahrnehmung von Übergewicht als einer Epidemie, einer Seuche also, die sich die Welt in rasantem Tempo unterwirft und die Zukunft des Planeten in Frage stellt, geht wesentlich auf ein Ereignis im Jahr 1997 zurück: das Treffen einer Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.
»Adipositas: Verhütung und Bewältigung einer weltweiten Epidemie« hieß die Tagung, die zum Ziel hatte, die Verbreitung, Ursachen sowie die gesundheitlichen und ökonomischen Folgen des Übergewichts zu untersuchen und Strategien zu seiner Bekämpfung zu entwickeln.
Die Konferenz der WHO im Jahr 1997 bestimmte zugleich die Wahrnehmung der neuentdeckten Epidemie. Für die WHO und für die überwiegende Mehrzahl der Regierungen, Gesundheitsorganisationen, Public-Health-Experten und Fachjournalisten ist Übergewicht eine Krankheit, die durch das Leben im Wohlstand ausgelöst wird. Gemeint ist damit, dass weltweit die Notwendigkeit, sich im Alltag zu bewegen, zurückgeht und gleichzeitig Lebensmittel, und hier besonders die kalorienreichen, in immer mehr Ländern zu einem günstigen Preis für beinahe jeden verfügbar sind. Dieser auf den ersten Blick paradiesische Zustand führe aber zu einer gefährlichen Massenkrankheit: der Adipositas nämlich und als ihrer Vorstufe dem Übergewicht. Adipositas wiederum sei der Auslöser zahlloser Zivilisationskrankheiten und gefährde so den Wohlstand und die Leistungsfähigkeit moderner Gesellschaften weltweit.
Um das Ausmaß der eben entdeckten Epidemie veranschaulichen zu können, mussten die WHO und ihre Mitstreiter aus der Pharmaindustrie zunächst eine einheitliche und weltweit verbindliche Definition schaffen. Dazu bemühte man den Body-Mass-Index (BMI), der auch als relatives Körpergewicht bezeichnet wird. Die dazugehörige Formel lautet BMI = kg/m². Wer seinen Body-Mass-Index selbst berechnen möchte, wiege dafür zunächst sein Körpergewicht in Kilogramm, messe anschließend seine Körpergröße in Metern, nehme dann mit Hilfe eines Taschenrechners die Körpergröße zum Quadrat und teile das zuvor ermittelte Körpergewicht durch die potenzierte Körpergröße: Fertig ist der BMI. Noch einfacher ist es allerdings, sich einer der unzähligen BMI-Rechner im Internet zu bedienen.
Seit der WHO-Konferenz vom Juni 1997 gilt weltweit einheitlich ein BMI kleiner als 18,5 als Untergewicht, ein BMI zwischen 18,5 und 25 als Normalgewicht, ein BMI größer als 25 als Übergewicht, und ein BMI größer als 30 als krankhaftes Übergewicht bzw. Adipositas.
Übergewicht ist medizinisch als »kritisch erhöhter Fettanteil an der Gesamtkörpermasse« definiert. George Bray, einer der Väter der modernen Adipositasforschung, hatte 1976 einen Fettanteil an der Körpergesamtmasse von 30 Prozent bei Frauen und von 25 Prozent bei Männern als Adipositas bestimmt. Da der Fettanteil an der Körpergesamtmasse aber nur mit aufwendigen Verfahren ermittelt werden kann, hat sich international der Body-Mass-Index zur Bestimmung von Übergewicht und Adipositas durchgesetzt. Begründet wird dieses Vorgehen damit, dass der Körperfettanteil und der BMI in einem engen Verhältnis stünden.
Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise eine Frau mit einem BMI größer 30 auch einen Körperfettanteil von mehr als 30 Prozent hat, ziemlich hoch. Doch vor allem bei Menschen mit einem BMI im Bereich 25 bis 30 ist der automatische Rückschluss vom Body-Mass-Index auf den Körperfettanteil fragwürdig. Das zeigen zahlreiche Beispiele von Sportlern und Schauspielern, die – obgleich sportlich und alles andere als fett – nach dem BMI entweder übergewichtig oder sogar adipös sind. Ihr hohes relatives Körpergewicht resultiert aber weniger aus Fettzellen denn aus Muskelkraft. Und genau hier setzt die Kritik am Body-Mass-Index an. Moniert wird, dass der BMI nicht in der Lage ist, den individuellen Körperbau zu berücksichtigen, und damit zwangsläufig jeden Menschen, der kräftiger gebaut und/oder muskulös ist, fälschlicherweise als fett klassifiziert.
Von solchen Einwänden unbeeindruckt, übernahmen innerhalb weniger Jahre weltweit praktisch alle staatlichen Gesundheitsministerien, -institute, -behörden und unabhängige bzw. halbstaatliche Gesundheitsorganisationen die neuen Grenzwerte. Mit zum Teil erheblichen Konsequenzen. So wurden 1998 mit Übernahme der WHO-Grenzwerte durch das US-amerikanische Gesundheitsinstitut (NIH) mehr als 35 Millionen US-Amerikaner übergewichtig, und das, ohne ein Gramm zugelegt zu haben.6 Die USA hatten zuvor auf eigener Datenbasis weniger strenge Grenzwerte festgelegt. Frauen galten dort zuvor erst ab einem BMI von 27,8 als übergewichtig und ab einem BMI von 32,3 als adipös. Die Werte für Männer lagen bei 27,3 respektive 31,1.
In vielen anderen Ländern gab es vor der folgenschweren WHO-Konferenz überhaupt keine verbindlichen Grenzwerte, sondern lediglich Empfehlungen. In Deutschland beispielsweise wurde bis weit in die 1990er Jahre hinein noch mit dem Broca-Index gearbeitet. Der Broca-Index – Körpergröße in Zentimetern minus 100 – ist aber nicht mehr als eine grobe Faustformel: Wer weniger wog, galt als normalgewichtig, wer darüber lag, als zu dick.
Der Body-Mass-Index war dagegen bis Mitte der 1990er Jahre in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern lediglich wenigen Experten ein Begriff. Durch die Vereinheitlichung der Indizes und der Grenzwerte war es plötzlich möglich, die Betroffenheit der Bevölkerung von Übergewicht und Adipositas zu ermitteln. Von mindestens 300 Millionen Adipösen und mehr als einer Milliarde Übergewichtigen weltweit ist seitdem die Rede. Die Zahl der Übergewichtigen wäre allerdings erheblich geringer ausgefallen, hätte man sich zum Beispiel an den damals noch geltenden US-amerikanischen Grenzwerten orientiert. Erst durch die niedrigen Schwellenwerte schärfte die WHO die Wahrnehmung von Übergewicht als einem globalen Phänomen, das selbst vor den ärmsten Nationen der Dritten Welt nicht haltmacht.
Als geistiger Vater der »Übergewichts-Epidemie« gilt die International Obesity Taskforce (IOTF) unter Führung von Philip James. Die IOTF besteht seit 1995 als ein informeller Zusammenschluss von Medizinern, die sich ganz der Bekämpfung und Behandlung von Übergewicht und Adipositas verschrieben haben. Dieses kleine, zum damaligen Zeitpunkt selbst der Fachwelt unbekannte Komitee hat nach eigenen Angaben die Konferenz der WHO vom Juni 1997 inhaltlich maßgeblich vorbereitet. An die Öffentlichkeit trat die IOTF erstmals 1998 auf einer Konferenz von Adipositas-Experten in Barcelona. Mittlerweile ist die IOTF Teil der sehr viel älteren und etablierteren International Association for the Study of Obesity (IASO) geworden.
IOTF und IASO gelten in der öffentlichen Wahrnehmung als unabhängige Nichtregierungsorganisationen, die sich ohne ökonomische Hintergedanken allein der Bekämpfung einer der größten Gesundheitsgefahren unserer Zeit verschrieben haben. Doch dieser Eindruck trügt. Rund zwei Drittel des Etats der JASO werden von Pharmakonzernen finanziert. Unter ihnen so prominente Namen wie Abbott, Hoffmann-La Roche, Sanofi-aventis, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson und Novo Nordisk.7
Die einseitige Finanzierung der IASO bleibt nicht ohne Widerspruch. So wurde der Organisation im renommierten British Medical Journal vorgeworfen, durch eine übertriebene Darstellung der Übergewichtsproblematik der Pharmaindustrie in die Hände zu spielen, zum Beispiel, indem sie durch das Eintreten für besonders rigide Grenzwerte deren potenziellen Kundenkreis erweitern würde.8 Der Sprecher der IASO, Neville Rigby, wies den Vorwurf, seine Organisation bediene vor allem die Interessen der Pharmaindustrie, entschieden zurück. Stattdessen betonte er die inhaltliche Unabhängigkeit von den Hauptsponsoren. Ohnehin liege der Arbeitsschwerpunkt der IASO auf Maßnahmen zur Prävention der Adipositas, die Behandlung der Krankheit spiele nur eine untergeordnete Rolle.9
So eindeutig, wie Rigby es darstellt, ist die inhaltliche Unabhängigkeit in der Praxis aber längst nicht. Ein gutes Beispiel hierfür ist der von der IASO organisierte International Congress on Obesity (ICO) 2006 in Sydney. Die IASO warb im Vorfeld des Kongresses ganz direkt mit den Marketingmöglichkeiten, die die Veranstaltung Unternehmen aus der Pharma- und Diätindustrie einräumt. Wörtlich heißt es im Programmheft für die Konferenz von Sydney: »Wenn Adipositas-Experten Teil Ihres Zielmarktes sind, dann gibt es keinen besseren Weg, Ihre Geschäftsinteressen wahrzunehmen, als die ICO2006 zu unterstützen. Ihre Unterstützung stellt eine exzellente Möglichkeit dar, ihren Namen und ihre Produkte bekannt zu machen. (…) Ihre Firma wird von der Präsentation gegenüber einem interessierten, wichtigen und vor allem einflussreichen Publikum bestimmt profitieren.« Für die Summe von 30 000 Australischen Dollar (ca. 15 000 Euro) konnten Firmen auf der ICO thematisch für sie interessante Symposien unterstützen und nicht nur auf die Themen, sondern auch auf die Auswahl der Referenten Einfluss nehmen.10
Besonders eng ist die Zusammenarbeit zwischen dem Pharmakonzern Roche und dem Vorsitzenden der IASO und Gründer der IOTF Philip James. James vergibt nicht nur jedes Jahr den Roche International Award for Obesity Journalism – ein besonders augenscheinliches Beispiel für die enge Verquickung von Medizinjournalismus und Geschäftsinteressen. Er hat zudem selbst eine von Roche finanzierte Pionierstudie zur Wirksamkeit von Xenical, dem Diätmittel von Roche, durchgeführt. Auch für das weltweit zweitumsatzstärkste Schlankheitsmittel aus dem Hause Knoll (heute Abbott) hat James eine vom Hersteller bezahlte Studie erarbeitet: beide mit uneingeschränkt positivem Ergebnis.11
Doch nicht nur mit Schlankheitspillen lässt sich viel Geld verdienen. Und so ist die Debatte um die Grenzwerte für Übergewicht und Adipositas beileibe kein Einzelfall. Auch bei anderen Risikofaktoren für chronische Krankheiten wie etwa Bluthochdruck, Blutzucker oder dem Cholesterinspiegel hat die massive Lobbyarbeit der Pharmaindustrie dafür gesorgt, dass die Grenzwerte so lange gesenkt wurden, bis die Mehrzahl der Bevölkerung in mindestens eine der zahlreichen Risikokategorien fiel. So wurde zum Beispiel die Grenze für Bluthochdruck in Deutschland durch die Intervention eines privaten Interessenverbundes von Ärzten und Mitarbeitern von Pharmafirmen Anfang der 1990er Jahre von 160/100 auf 140/90 gesenkt; mit der Folge, dass sich die Zahl der Betroffenen über Nacht von sieben auf über zwanzig Millionen verdreifachte.12
Das Krankheitsbild Diabetes wurde 2002 vom US-amerikanischen Gesundheitsministerium und der American Diabetes Association durch die Diagnose Prädiabetes (pre-diabetes) ergänzt. Galt man früher bis zu einem Blutzuckerwert von 125 mg/dl (Milligramm pro Deziliter) noch als gesund, werden jetzt auch Menschen mit leicht überdurchschnittlichen Blutzuckerwerten ab 100 mg/dl schon als Risikopersonen betrachtet, die nach den Vorstellungen der Pharmaindustrie regelmäßig ihre Werte testen lassen und sie mit ärztlicher und idealerweise auch medikamentöser Hilfe unter einen medizinisch fragwürdigen Grenzwert drücken sollen.
Den 1990 in Deutschland willkürlich festgelegten Grenzwert für Cholesterin überschreitet gar mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Doch das so verteufelte Cholesterin ist kein Killer, so wie es uns die Pharmalobby glauben machen möchte, sondern ein lebenswichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers, den gerade unser Gehirn in großer Menge benötigt.
Die Praxis, Grenzwerte immer weiter abzusenken und gleichzeitig die Aufmerksamkeit für vermeintliche Risikofaktoren durch aufwendige PR-Kampagnen am Köcheln zu halten, lohnt sich für die Pharmariesen. Denn cholesterin- und blutdrucksenkende Mittel sind die großen Verkaufsschlager unter den Medikamenten. Lipitor, der Cholesterinblocker aus dem Hause Pfizer, war 2007 mit einem Umsatz von fast 13 Milliarden US-Dollar das mit Abstand erfolgreichste Medikament der Welt. Das blutdrucksenkende Norvasc von Pfizer, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter dem Namen Sortis vermarktet wird, brachte es immerhin noch auf knapp fünf Milliarden US-Dollar Umsatz.13
Unbestritten gibt es Fälle, bei denen die Einnahme blutdruck- und cholesterinsenkender Mittel medizinisch notwendig ist. Doch die Gefahr besteht, dass diese Mittel durch die Etablierung unrealistischer Grenzwerte von Menschen eingenommen werden, die eigentlich kerngesund sind. Das ist nicht nur schlecht für den eigenen Geldbeutel bzw. das Budget der Krankenkassen, sondern auch für das Wohlbefinden der vermeintlich Kranken, die sich unnötig Sorgen machen, Arzneimittel schlucken, die ihnen eher schaden als nutzen, und vor allem auf Dinge verzichten, auf die sie gar nicht verzichten müssten.
Wie die Deutschen die dicksten Europäer wurden – Eine Falschmeldung und ihre Folgen
Einen ganz besonderen Marketing-Coup landeten IASO und IOTF2007 in Deutschland. Die Partnerorganisationen hatten schon 2005 Zahlen veröffentlicht, denen zufolge sage und schreibe sieben europäische Länder noch mehr Übergewichtige vorzuweisen hätten als die USA. Und ganz oben auf dieser Liste stand Deutschland.
In den USA wurde gejubelt. Das Ende des Hochmuts und der Selbstzufriedenheit der Europäer mit ihrem Leibesumfang sei endlich gekommen, freute sich beispielsweise der US-amerikanische Nachrichtensender CBS im März 2005. In Deutschland dagegen hatte damals anscheinend niemand etwas von der Studie mitbekommen.
Das änderte sich erst zwei Jahre später, als dieselbe Studie am 19. April 2007 urplötzlich aus der Versenkung geholt wurde. Die Süddeutsche Zeitung berichtete unter der Überschrift »Deutsche sind die dicksten Europäer« über das Zahlenwerk. Zwei Drittel der Deutschen seien zu dick, das sei europaweit Rekord. Schuld an der Misere trügen Bierkonsum und Bewegungsfaulheit, so der Bericht weiter. In den folgenden Tagen wurde in allen großen Tages- und Wochenzeitungen, Hörfunk- und Fernsehsendungen die Nachricht von der nationalen Schande verbreitet. Politiker aller Parteien, Experten und Meinungsmacher zeigten sich betroffen, besorgt und zum Handeln entschlossen.
Doch schon nach einigen Tagen wurden die ersten kritischen Stimmen laut. Das Robert Koch-Institut hielt den Vergleich für fragwürdig, da die IASO alte und neue Datensätze miteinander verglichen hatte. So datierten die Vergleichszahlen aus Dänemark aus dem Jahr 1992, die aus Malta waren sogar von 1984, die deutschen Daten dagegen waren erst 2002 erhoben worden. Zudem waren die Erhebungsmethoden nicht einheitlich, so wurden zum Beispiel Befragungs- mit Messdaten vermischt. Manche der Studien, so auch die deutsche, hatten nur Menschen im Alter von 25 bis 69 Jahren berücksichtigt. In anderen Studien wurde die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, bei der Übergewicht am seltensten auftritt, mitberücksichtigt.
Neville Rigby von der IASO wehrte sich gegen den Vorwurf, Falschmeldungen zu verbreiten, mit dem Argument, man habe im Kleingedruckten sehr wohl darauf hingewiesen, dass die Daten nur bedingt miteinander vergleichbar seien. Es sei seiner Organisation gar nicht darum gegangen, eine Rangliste der dicksten Nationen in Europa zu erstellen.
Ihr Ziel hatte die IASO aber so oder so erreicht: die deutsche Öffentlichkeit und die Bundesregierung zu alarmieren und zum Handeln zu treiben. Eine schlampig zusammengeschusterte Datensammlung ohne jeden Neuigkeitswert brachte das Kabinett am 4. Mai 2007 – gerade einmal zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Zahlen in Deutschland – dazu, einen nationalen Aktionsplan gegen Übergewicht ins Leben zu rufen. Wohl nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik dürfte eine Zeitungsente eine derart panische Politikerreaktion ausgelöst haben.
Das versicherte Idealgewicht oderWie Gewichtsnormen entstehen
Den Versuchen, Übergewicht und Adipositas zu definieren, haftete immer schon etwas Willkürliches an. Denn medizinisch haben sich die Grenzwerte noch nie wirklich rechtfertigen lassen. Lange Zeit entschieden die Ärzte nach Augenmaß, was zu dick und was gerade noch tolerabel sei. Selbstredend war das ärztliche Urteil abhängig von der persönlichen Einstellung der Mediziner gegenüber dicken Menschen. Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Patienten dürfte außerdem der eigene Bauchumfang gespielt haben.
Versuche einzelner Mediziner, fixe Grenzwerte zu bestimmen, gab es seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder. Doch ihnen allen blieb die Anerkennung der Fachwelt versagt. Allgemeinverbindlichkeit erreichten sie nie. Einzig die sogenannte Broca-Formel – Körpergröße minus 100 ist Normalgewicht, alles, was darüber liegt, ist Übergewicht – wurde zumindest in Europa schon vor dem Zweiten Weltkrieg populär, auch wenn ihre medizinische Aussagekraft strittig blieb.
Die erste Gewichtsnorm aufzustellen, die sich scheinbar eindeutiger wissenschaftlicher Kriterien bediente, blieb dem Versicherungsangestellten Louis Dublin vorbehalten. Dublin, zeit seines Lebens als Statistiker bei der Metropolitan Life Insurance Company beschäftigt, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, im Interesse seines Arbeitgebers den idealen Versicherungsnehmer mit bester Gesundheit und längster Lebenserwartung zu ermitteln. Besonderes Augenmerk bei seinen Berechnungen legte Dublin dabei auf den Faktor Gewicht. In mehr als 600 Artikeln und Vorträgen verbreitete Dublin seine These, dass das Übergewicht eine der wichtigsten Ursachen für chronische Krankheiten und vorzeitige Todesfälle sei. Louis Dublin hatte großen Erfolg damit, und zwar ironischerweise, obwohl die Lebenserwartung in den USA seit 1900 für Männer von 47 auf 60 Jahre gestiegen war. Doch der Anstieg der Lebenserwartung war in erster Linie Folge des selteneren Auftretens von Infektionskrankheiten wie Tuberkulose oder Lungenentzündung. Mit dem Rückgang der Infektionskrankheiten aber gerieten die chronischen Krankheiten, vorrangig Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen, ins Visier der Public-Health-Experten und Gesundheitspolitiker.
Dublins stärkstes Argument für die These vom Übergewicht als Killerkrankheit waren die Daten seiner Versicherung; Zahlen, die er selbst erhoben hatte. Die Metropolitan ermittelte aus den Daten ihrer zahlreichen Mitglieder ein sogenanntes Idealgewicht, das als Gewicht mit der höchsten Lebenserwartung definiert war. Allerdings unterliefen den Versicherungsmathematikern der Metropolitan dabei gleich mehrere grobe Fehler, die dafür verantwortlich waren, dass das Gewicht mit der höchsten Lebenserwartung jahrzehntelang viel zu niedrig eingeschätzt wurde.
Zwar wurde die Mehrheit der Versicherten gewogen und gemessen, jedoch ohne einheitliche Maßstäbe. Teilweise wurden die Personen mit Kleidern gewogen und die Körpergröße mit angezogenen Schuhen gemessen. Ein Teil der Versicherten wurde zudem am Telefon befragt. Mittlerweile weiß man aus zahlreichen Erhebungen, dass das Gewicht bei Befragungen generell unterschätzt und gleichzeitig die Körpergröße überschätzt wird.
Lebensversicherungen werden heute wie damals meist in relativ jungen Jahren abgeschlossen, und nur bei Abschluss der Versicherungspolice werden die Anwärter nach Gewicht und Größe befragt. Die Tatsache, dass das Gewicht mit zunehmendem Alter ansteigt, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die Lebenserwartung hat, bleibt so unberücksichtigt.
Im Fall der von Dublin befragten Mitglieder der Metropolitan kam erschwerend hinzu, dass hier Angehörige der Mittel- und Oberschicht sowie US-Amerikaner mit nord- und mitteleuropäischem Hintergrund deutlich überrepräsentiert waren. Da in der damals ganz überwiegend weißen und protestantischen Mittel- und Oberschicht Übergewicht – insbesondere bei Frauen – sozial geächtet war, lag der Anteil der Molligen besonders niedrig, ohne dass man deshalb zwangsläufig auf einen Zusammenhang zur Lebenserwartung hätte schließen müssen.
Aus diesen Gründen lag das von Dublin ermittelte Idealgewicht der Metropolitan vor allem bei Frauen erheblich unter dem damaligen Durchschnittsgewicht. Dennoch wurden die aus den Daten der Metropolitan abgeleiteten Tabellen zur Bestimmung des Idealgewichts weltweit zum Vorbild für Gewichtsnormen.





























