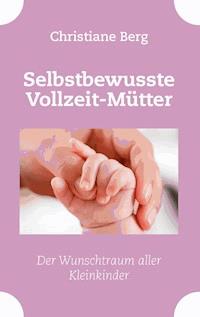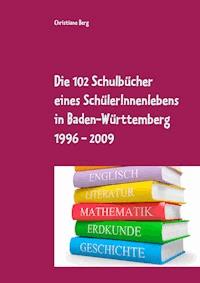
Die 102 Schulbücher eines SchülerInnenlebens in Baden-Württemberg 1996 - 2009 E-Book
Christiane Berg
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schulbücher enthalten nicht nur das Fachwissen der Themengebiete, die laut Lehrplan im entsprechenden Schuljahr zu unterrichten sind, sondern sie vermitteln sozusagen "zwischen den Zeilen" nebenbei und unbemerkt auch geschlechtsrollenstereotype Inhalte. Dies wird in Deutschland bereits seit 1967 von Fachleuten - meist Fachfrauen - kritisiert. Die versteckten Inhalte wirken sich unterschiedlich u. a. auf das Selbstbewusstsein und die Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern aus. Sie sind eine der Ursachen, warum sich junge Frauen - trotz im Schnitt besserer Schulabschlüsse - auch heute noch häufig für "typisch weibliche" Berufe entscheiden. Und warum Frauen auf der Karriereleiter meist weit unter ihren männlichen Kollegen zurückbleiben und im Schnitt knapp ein Viertel weniger Lohn als diese erhalten. Durch ihre Analyse von 102 Schulbüchern gelingt es der Autorin Christiane Berg, diese verborgenen Inhalte sichtbar zu machen. Denn nur was wahrgenommen werden kann, kann auch verändert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In der vorliegenden Arbeit wurden - nach einer kurzen theoretischen Einführung in das Thema - 102 Schulbücher eines SchülerInnenlebens untersucht. Die Analyse gliedert sich in zwei Teile Klasse 1 - 6 und Klasse 7 - 13 (und ist darin begründet, dass Ergebnisse bereits nach der "Halbzeit" vorliegen sollten). Untersucht wurde, wie viele Frauen und Männer sind jeweils abgebildet und wie viele kommen im Text vor? Wie viele und welche Berufe werden von Frauen dargestellt und wie viele und welche von Männern? Wie viele SchulbuchautorInnen und -illustratorInnen und wie viele SchulbuchherausgeberInnen gibt es? Im ersten Teil (Klasse 1 - 6) wurde zusätzlich geprüft wie viele AutorInnen von Texten, Hauptpersonen, Bildunterschriften, berühmte Persönlichkeiten, sportliche Aktivitäten, Überschriften, die sich auf ein Geschlecht beziehen (nur in den Fremdsprachenwerken) und welche sprachliche Formen in Anweisungen im Schulbuch vorkommen.
Die Autorin Christiane Berg, geboren 1960, eine Tochter, Diplom-Psychologin, lebt und arbeitet in der Nähe von Karlsruhe in eigener Praxis und in der aufsuchenden Familienhilfe und -therapie für Jugendämter. "Die 102 Schulbücher eines SchülerInnenlebens in Baden-Württemberg 1996 - 2009" ist ihre erste Buchveröffentlichung. Die Autorin ist unter folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ein Rätsel
Teil 1 Grundlagen
1.1 Eigene Motivation für Buchanalysen
1.2 Was sind Rollen und wie entstehen Geschlechtsrollen
1.3 Identität, Selbstvertrauen und Leistungsmotivation
1.4 Wirkung von Sprache
1.5 Sozialisationsinstitution Schule - heimlicher Lehrplan
1.5.1 Heimlicher Lehrplan, direkte und indirekte Diskriminierungen von Mädchen im Schulalltag und die Konsequenzen
1.5.2 Schulbücher und ihre Zulassung
Teil 2 Schulbuchanalysen
2.1 Weshalb werden Schulbücher analysiert
2.2 Merkmale, die in Schulbuchanalysen untersucht werden
2.3 Kritik an untersuchten Schulbüchern
2.4 Kriterien für ein gutes Schulbuch
2.5 Einige Schulbuchanalysen seit 1967
Teil 3 Untersuchung der 102 Schulbücher
3.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
3.1.1 Ergebnisse der vier untersuchten Hauptmerkmale
3.1.2 Ergebnisse der untersuchten HerausgeberInnen-/AutorInnenschaft
3.1.3 Ergebnisse pro Schulfach oder Fächerverbund
3.1.4 Ergebnisse, die auffallen
3.2 Der Vergleich der Ergebnisse mit früheren Studien
3.3 Die Analysemethoden
3.3.1 Die Analysemethoden im Detail
3.3.2 Musterbeispiel einer Datenerhebung
3.4 Darstellung der Ergebnisse
3.4.1 Ergebnisse der Analysen Teil I
3.4.2 Ergebnisse der Analysen Teil II
3.5 Einzelergebnisse
3.5.1 Einzelergebnisse der Buchanalysen Teil I
3.5.2 Einzelergebnisse der Buchanalysen Teil II
3.6 Tabellen
3.7 Diagramme
3.8 Lehrbuchverzeichnisse
3.8.1 Lehrbuchverzeichnis der Schulbuchanalysen Teil I
3.8.2 Lehrbuchverzeichnis der Schulbuchanalysen Teil II
3.9 Literaturverzeichnis
Vorwort
Die Arbeit an dem vorliegenden Buch - eine Analyse von 102 Schulbüchern bezüglich der Darstellung der Geschlechter - hat sich über einen Zeitraum von fast 20 Jahren hingezogen, von der Untersuchung der ersten Schulbücher meiner Tochter aus Klasse eins im Jahr 1996 bis zur Erstellung der Diagramme in den Jahren 2014 und 2015. Eine berechtigte Frage ist deshalb, welchen Wert die gewonnenen Ergebnisse heute noch haben, denn mit Sicherheit sind einige der aufgeführten Schulbücher aktuell nicht mehr in Gebrauch.
Bereits nach der Analyse der ersten sechs Schuljahre - also ungefähr nach der Hälfte der Zeit - habe ich Ergebnisse erstellt und diese den betreffenden Verlagen, der Schule meiner Tochter, dem Kultusministerium von Baden-Württemberg und der damaligen Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz zur Verfügung gestellt. Die Arbeit wurde zur Kenntnis genommen, teilweise bekam ich Rückmeldungen, praktisch geändert (z. B. ein Schulbuch wird bezüglich der Geschlechterdarstellung überarbeitet, die Schule verwendet das Buch nicht mehr oder das Kultusministerium entzieht die Zulassung) hat sich kurzfristig natürlich nichts.
Seit 1967 werden Schulbücher mit Fragestellungen, die sich auf eine geschlechtergerechte Darstellung von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern beziehen, überprüft.
Ich sehe den Wert der Untersuchung darin, dass mit ihrer Hilfe erkennbar wird, was sich bis zum Jahr 2009 (der Klasse 13 meiner Tochter) im Vergleich mit Untersuchungen, die in früheren Jahren erfolgten, schon verändert bzw. gerade noch nicht verändert hat. Ich gehe auch davon aus, dass noch viele weitere Untersuchungen notwendig sind, bis irgendwann einmal geschlechtergerechte Schulbücher die Norm sind.
Der sogenannte "Datenanhang" - das ist die konkrete Datenerhebung jedes Schulbuchs wie unter 3.3.2 in einem Musterbeispiel aufgezeigt - ist hier nicht veröffentlicht. Er ist auf Nachfrage bei mir direkt erhältlich.
Waldbronn, Juli 2015
Christiane Berg
Ein Rätsel
Vater und Sohn fahren gemeinsam zu einem Fußballspiel der Lieblingsmannschaft. Da es sich um ein Aufstiegsspiel handelt, sind beide schon aufgeregt und voller Vorfreude. Sie diskutieren lebhaft und haben ihr Ziel fast schon erreicht. Auf einmal stottert der Motor, das Auto wird immer langsamer und bleibt dann in der Mitte eines Bahnübergangs stehen. Der Vater versucht, das Auto wieder in Gang zu bringen. Beide hören, dass sich ein Zug nähert. Die Versuche des Vaters den Motor wieder zu starten werden immer verzweifelter. Das Auto bewegt sich keinen Zentimeter und zum Aussteigen ist es nun zu spät. Das Auto wird vom Zug erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift. Als Rettungssanitäter an der Unfallstelle ankommen, stellen sie fest, dass beide Unfallopfer schwer verletzt sind. Auf der Fahrt ins nächstgelegene Krankenhaus verstirbt der Vater und der Sohn befindet sich bei der Einlieferung in einem äußerst kritischen Zustand. Er muss dringend notoperiert werden. Der diensthabende Chirurg betritt den OP, erbleicht jedoch als er das Unfallopfer sieht und sagt: "Ich kann diese OP nicht durchführen - das ist mein Sohn".
In Anlehnung an Marianne Grabrucker 1993 S. 9. Dieses Rätsel kann sehr gut Zusammenhänge verdeutlichen, die nachfolgend beschrieben werden. Die Auflösung erfolgt im Text.
Teil 1 Grundlagen
1.1 Eigene Motivation für Buchanalysen
Ich möchte mich gerne der Lehrerin Dr. Ulrike Fichera anschließen - die mit ihrer Dissertation zur Schulbuchdiskussion in der BRD alle bis zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen und verfügbaren Schulbuchanalysen ausfindig gemacht, zusammengetragen und kategorisiert hat - wenn sie ausführt, dass es in der neuen Frauenforschung sozusagen zum guten Ton gehört, zu erklären, warum eine Frau sich gerade mit einem bestimmten Thema beschäftigt.
""Da es zu den berechtigten Postulaten der neuen Frauenforschung gehört, zu wissen, aus welchen Forschungs- und Praxiszusammenhängen heraus eine Frau zu einem Thema etwas sagt", worin ihre "Selbstbetroffenheit" besteht, zunächst einige Ausführungen zu meiner persönlichen Motivation." (Müller, U. 1984; zitiert nach Ulrike Fichera, 1996, S. 15)
Ich liebe Bücher seit meiner Kindheit. Mir wurde viel vorgelesen. Seit ich selbst lesen kann, ist Lesen eines meiner Lieblingshobbys. Dabei geht es mir wie meiner Mutter: Wenn ein Buch richtig spannend ist, dann kann ich nichts anderes mehr tun, als so lange zu lesen bis ich es zu Ende gelesen habe - alle anderen Tätigkeiten liegen dann auf Eis bis ich weiß wie alles ausgegangen ist. Bis heute kann ich mich nicht zu einem E-Book-Reader durchringen, weil ich das Gefühl eines Buches in meiner Hand liebe, zu sehen wie viele Seiten Lesevergnügen noch vor mir liegen und Seite für Seite umzublättern, mir Eselsohren zu knicken, damit ich Seiten wiederfinde auf denen für mich wichtige Dinge geschrieben stehen. Und ich lese auch gerne vor: früher oft meiner Tochter, heute noch meinem Mann, meinen Nichten und Neffen oder anderen Kindern aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Weil ich Bücher wichtig finde, weil ich finde, dass frau und mann aus Büchern viel Neues erfahren kann und weil ich die Situation des Vorlesens und des anschließenden Diskutierens der gerade gehörten Inhalte als eine besonders angenehme Art von Kommunikation und auch "Beziehungspflege" betrachte.
Eine andere "Wurzel" meiner Motivation, mich mit der Analyse von Büchern zu beschäftigen, liegt in meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Da mir Bücher sehr wichtig sind, war es für mich folgerichtig, bei meinen persönlichen Bemühungen, auf gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen aufmerksam zu machen, mich mit Büchern zu befassen.
Meine nähere Beschäftigung mit Büchern hat nicht erst mit der Analyse der Schulbücher begonnen. Bilderbücher sind die ersten Bücher mit denen Babys und Kleinkinder in Berührung kommen. Angeregt durch die Literatur über geschlechtsrollenspezifische Erziehung habe ich mich bereits mit Bilderbüchern ausführlich beschäftigt und an der Volkshochschule meines Wohnortes Vorträge zu - aus meiner Sicht - "guten" (= nicht geschlechtsrollenkonformen) Bilderbüchern gehalten, um andere Eltern und Großeltern für dieses Thema zu sensibilisieren.
Bei der Entscheidung, zuerst Bilderbücher und später Schulbücher zu analysieren, habe ich mich von verschiedenen Autorinnen inspirieren lassen. Frau Matthiae, die von Beruf Diplom-Biologin ist, hat sich z. B. mit den unterschiedlichen Darstellungen der Geschlechter im Bilderbuch auseinandergesetzt und mit dem Einfluss, den die Bilderbücher auf die Entwicklung, gerade auch auf die geschlechtsspezifische Entwicklung von Kindern nehmen.
Cornelia Hagemann hat 1981 ihre Diplomarbeit mit dem Titel "Bilderbücher als Sozialisationsfaktoren im Bereich der Geschlechtsrollendifferenzierung" veröffentlicht.
Der Begriff "Sozialisation" bedeutet, dass Kinder in die Gesellschaft, in die sie hineingeboren werden, hineinwachsen sollen. Dies geschieht erstens durch die Erziehung im Elternhaus, im Kindergarten und in der Schule. Aber Sozialisation ist mehr als bewusste Erziehung und umfasst auch Einflüsse der erweiterten Familie und des Freundeskreises der Eltern wie auch Einflüsse von Gleichaltrigen und der sozialen Umwelt, mit der das Kind in Kontakt ist. Es geht darum, dass die Kinder lernen, die jeweiligen Normen und Werte dieser Gesellschaft zu übernehmen. Sie sollen lernen, was erlaubt und was verboten ist, was für richtig und was für falsch befunden wird, was für gut und was für schlecht erachtet wird.
Astrid Matthiae zitiert die Ausführungen von Cornelia Hagemann wie folgt:
"Die Zeit des Bilderbuchalters fällt, darauf weist Cornelia Hagemann hin, mit der Zeit, in der Mädchen und Jungen ihre Geschlechtsidentität entwickeln, zusammen. Deswegen ist es nicht gleichgültig, mit welchen Bilderbüchern sie umgehen. Bilderbücher sind natürlich nicht der einzige Einflußfaktor, dem Mädchen und Jungen ausgesetzt sind […] Doch gerade mit Bilderbüchern beschäftigen sich Kinder intensiv. Wer hat nicht so manches Bilderbuch mindestens schon 20mal vorgelesen, korrigiert von der/dem Dreijährigen, wenn ein Satz in seiner Wortfolge nicht genau eingehalten wurde. Und während wir mehr oder weniger teilnahmsvoll vorlesen, hören die Mädchen und Jungen zu und sehen sich die Bilder an, immer wieder…" (Astrid Matthiae 1990, S. 8)
Dr. Ursula Scheu, von Beruf Diplom-Psychologin, hat den Klassiker "Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden dazu gemacht" geschrieben und erläutert dort u. a. die geschlechtsspezifische Erziehung und die in den Büchern vorhandenen Geschlechtsrollenmodelle. Wie diese Rollenmodelle konkret aussehen und welche Auswirkungen sie auf Kinder haben, beschreibt sie folgendermaßen:
"Untersuchungen zeigen, daß die geschlechtsspezifischen Rollenmodelle vom Bilderbuch bis zur Fernsehsendung noch konservativer sind als die Realität." (Ursula Scheu, 1997 S. 97)
Auch Leonore Weitzmann hat den geschlechtsrollenspezifischen Einfluss von Bilderbüchern auf Vorschulkinder 1972 in den USA untersucht. Damals gab es noch keine vergleichbare Untersuchung in Deutschland. Ursula Scheu weist in ihren Ausführungen zum Thema Bilderbücher auf diese Untersuchung hin:
"Durch das Angebot erwachsener Rollenmodelle lernen Mädchen und Jungen, was man von ihnen für die Zukunft erwartet. Weitzmann fand, daß das Image der erwachsenen Frau in den Bilderbüchern ebenso begrenzt stereotypisiert ist, wie das des kleinen Mädchens. Wieder einmal ist die Frau passiv, der Mann aktiv. Die Frauen sind im Haus, die Männer außer Haus. Die Frauen verrichten im Haus nahezu ausschließlich Dienstleistungsfunktionen, umsorgen Mann und Kinder. Männer führen, Frauen folgen; Männer retten, Frauen werden gerettet. Die einzigen nicht stereotypen Rollen sind eindeutig mystische Rollen, also keine realen Möglichkeiten. Im Kontrast dazu stehen die Rollen der Männer, die variationsreicher und interessanter sind. Sie sind z. B. Lagerverwalter, Hausbauer, Könige, Geschichtenerzähler, Mönche, Kämpfer, Fischer, Polizisten, Soldaten, Abenteurer, Väter, Köche, Pfarrer, Richter, Ärzte und Bauern.
Frauen werden nicht einmal entsprechend ihrer Realität dargestellt. So gab es in den untersuchten Bilderbüchern nicht eine einzige Frau, die einen Beruf hatte. Und das in den USA, einem Land, in dem 40% der Frauen, also nahezu 30 Millionen Frauen erwerbstätig sind." (Ursula Scheu, 1997 S. 101)
Und sie erklärt, wie Bilderbücher ihre Wirkung entfalten. Sie äußert genau wie Astrid Matthiae, dass die Tatsache, dass Bilderbücher wieder und wieder angeschaut und vorgelesen werden, bei der Entstehung der Geschlechtsidentität eine besondere Rolle spielt:
"Welche Rolle spielen dabei die Bilderbücher? Durch sie lernen Mädchen und Jungen etwas über die Welt außerhalb ihrer unmittelbaren Umgebung. Sie lernen, was andere Mädchen und Jungen tun, sagen und fühlen. Sie lernen, was für Mädchen richtig und falsch ist und was von ihnen in diesem Alter erwartet wird. Bilderbücher sind besonders einflußreich, da sie von dem Kind immer und immer wieder angesehen und gelesen werden - und dies in einer Zeit, in der die Entwicklung der Geschlechtsidentität besonders entscheidend ist. Die Rollenmodelle in Bilderbüchern erreichen das Kind, noch bevor andere Sozialisationseinflüsse wie Schule, Lehrer, Gleichaltrige zum Tragen kommen." (Ursula Scheu, 1997 S. 97)
Dass ich mich dann zur Analyse von Schulbüchern entschlossen habe, hängt damit zusammen, dass Schulbücher "aufgezwungene" Bücher sind. Denn wer in Deutschland zur Schule geht, die und der muss diese Bücher verwenden - ob es ihr oder ihm gefällt oder nicht. Schulbücher enthalten nicht nur das Fachwissen der Themengebiete, die laut Lehrplan im entsprechenden Schuljahr zu unterrichten sind, sondern sie vermitteln sozusagen "nebenbei" und unbemerkt auch geschlechtsrollenstereotype Inhalte (siehe im Folgenden unter "Heimlicher Lehrplan"). Dies gilt übrigens auch für andere Bücher, wie Bilderbücher oder Jugendbücher. Diese geschlechtsrollenstereotypen Inhalte werden bereits seit 1967 von Fachfrauen und wenigen -männern kritisiert, da sich diese zusammen mit den Interaktionen von Lehrkräften und SchülerInnen unterschiedlich auf die Entwicklung von Selbstbewusstsein und die Entstehung der Leistungsmotivation bei Mädchen und Jungen auswirken, wie nachfolgend ausführlicher erläutert wird. Durch eine Schulbuchanalyse werden diese versteckten Inhalte sichtbar gemacht, die ohne Analyse nicht ins Auge fallen. Erst durch das Aufzählen und Auszählen der verschiedenen Geschlechter in Bild, Text und der verwendeten Sprache kann das Ausmaß des Einflusses erkannt werden, der sonst verborgen bleiben würde.
Auch wenn ich Schulbücher analysiert habe und die Ergebnisse darstelle, ist mir bewusst, dass es keine direkte und lineare Verbindung zwischen den Inhalten eines bestimmten Buches und einem konkreten Verhalten einer Schülerin oder eines Schülers gibt. Und einerseits ist die Benutzung von Schulbüchern auch nur ein Teilaspekt des Schulalltags. Es gibt weitere Teilaspekte wie z. B. der Umgang von SchülerInnen untereinander und die Kommunikation zwischen Lehrkräften und SchülerInnen. Andererseits bleiben die Schulbücher eben nicht ohne Wirkung, weil es nicht nur ein Buch gibt, sondern z. B. - wie bei meiner Analyse - 102 innerhalb eines SchülerInnenlebens und wenn sie sich in den Inhalten und Darstellungen - bezüglich der geschlechtsrollenstereotypen Aspekte - ähneln, dann wirken sie einfach über die vielfachen, ständigen Wiederholungen. Wenn dann die Interaktionen z. B. zwischen Lehrkräften und SchülerInnen in die gleiche Richtung zielen und weitere "Wiederholungen" darstellen, dann bleibt dies nicht ohne Auswirkung sowohl auf Schülerinnen als auch auf Schüler. Da Schulbücher - wie auch Bilderbücher - ein Sozialisationsfaktor sind, sind Schulbuchanalysen aus meiner Sicht wichtig und sinnvoll. Denn wenn sich die SchulbuchautorInnen, SchulbuchillustratorInnen, die SchulbuchherausgeberInnen und die Verantwortlichen für die Schulbuchzulassung des Ungleichgewichts bewusst sind, kann das Augenmerk bei neuen Schulbüchern darauf gerichtet werden, zukünftig geschlechtergerechte Schulbücher herzustellen.
Da mir bekannt war, dass es in Deutschland schon seit 1967 - mit der Schulbuchanalyse von Inge Sollwedel - Kritik an Schulbüchern gab, wollte ich selbst prüfen, ob diese und alle folgenden Arbeiten zu diesem Thema inzwischen - Mitte der 1990er Jahre bis 2009 - Früchte getragen hatten. Außerdem wollte ich einmal alle Schulbücher eines SchülerInnenlebens vollständig erfassen, denn mir ist nicht bekannt, dass dies in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Ich wollte herausfinden, was sich verändert hat und aufzeigen, in welchen Bereichen noch weiterhin Veränderungsbedarf besteht. Während meiner Arbeit erfuhr ich, dass es offensichtlich eine Vielzahl von anderen Frauen gab und gibt, die aus ähnlichen Motiven die Analyse von Schulbüchern - genau wie ich selbst - als so wichtig erachtet haben, dass sie diese ebenfalls häufig ohne Auftrag und vor allem auch ohne Bezahlung gemacht haben.
Da ich motiviert war nicht erst am Ende (also erst nach 13 Schuljahren) der Untersuchung Ergebnisse zu erhalten, habe ich mich entschlossen die Schulbücher der ersten 6 Schuljahre zu untersuchen und dann auszuwerten, so dass ich bereits nach 6 Schuljahren Ergebnisse vorweisen konnte. Diese Ergebnisse habe ich in Kurzform der Schule meiner Tochter, den betreffenden Schulbuchverlagen, dem Kultusministerium Baden-Württemberg und der damaligen Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz mitgeteilt. Ich wollte die betreffenden Institutionen mit meiner Untersuchung für dieses Thema sensibilisieren. In Teil 1 möchte ich die Schulbuchanalyse in einen größeren Rahmen einbetten und aufzeigen, welche anderen Sozialisationseinflüsse häufig ebenfalls in die gleiche - geschlechtsrollenspezifische - Richtung zielen und sich so gegenseitig verstärken. In Teil 2 gehe ich auf Schulbuchanalysen ganz allgemein und auf einige Arbeiten von KollegInnen ein. In Teil 3 stelle ich meine Untersuchung und ihre Ergebnisse vor.
1.2 Was sind Rollen und wie entstehen Geschlechtsrollen
Im Laufe unseres Lebens lernen wir, bestimmte Rollen zu übernehmen. Je nach Situation agieren wir in unterschiedlichen Rollen. In meinem Beruf bin ich in der Berufsrolle der Psychologin oder der Therapeutin. In der Familie bin ich zur selben Zeit in der Rolle der Partnerin, der Mutter oder der Tochter. Welche Erwartungen und Ansprüche die Menschen aus meiner Umwelt an meine jeweilige Rolle stellen, hängt auch damit zusammen, wie die Gesellschaft bestimmte Rollen definiert. Weichen wir in unserem Verhalten von diesen gesellschaftlichen Rollenvorstellungen ab, dann bekommen wir häufig Rückmeldungen, dass wir nicht den Rollenerwartungen entsprechen. Beispiel: Wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen und sie z. B. nicht dem Wetter entsprechend kleiden oder in verschmutzter Kleidung zur Schule schicken, dann schaltet die Schule das Jugendamt ein, weil sie von einer Verwahrlosung ausgeht. Das Jugendamt sucht den Kontakt zu den Eltern und versucht, sie dazu zu bewegen, die Verantwortung, die der Elternrolle zugeschrieben wird, ernster zu nehmen. Sind die Eltern dazu nicht bereit, kann das Jugendamt mit Sanktionen drohen, die letztendlich auch zu einer Herausnahme der Kinder aus der Familie führen können.
Auch die Geschlechtsrollen - sich so zu verhalten, wie es von der Gesellschaft für das jeweilige Geschlecht als passend erachtet wird - sind erlernt und werden von den Kindern schon im Kleinkindalter übernommen. Sie entstehen - wie bereits oben angeführt - indem die Kinder immer wieder darauf hingewiesen werden, dass sie ein Mädchen oder ein Junge sind und ihnen immer wieder gesagt und gezeigt wird, was für Mädchen oder für Jungen, für Frauen oder Männer als passend erachtet wird. Auch wenn Kinder ein und dasselbe Verhalten zeigen, wird es bei Mädchen anders wahrgenommen und bewertet als bei Jungen. Auf diese Zusammenhänge weist Franziska Stalmann, Diplom-Psychologin und Fachjournalistin in ihrem Buch "Die Schule macht die Mädchen dumm" hin, indem sie eine Professorin für pädagogische Psychologie in Hamburg zitiert:
"Was sind Geschlechtsrollen und wie entstehen sie? Angelika Wagner hat das knapp und präzise zusammengefaßt: >>Jede Gesellschaft schreibt eine breite Palette von Verhaltensweisen und Eigenschaften fast ausschließlich dem einen oder dem anderen Geschlecht zu. Margaret Mead hat gezeigt, daß die Aufteilung in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich sein kann. Die Zuschreibung erfolgt also nicht aufgrund biologischer Gegebenheiten, sondern wird willkürlich vorgenommen. Diese Trennung in >weibliche< und >männliche< Verhaltensweisen engt alle ein und verhindert die volle menschliche Selbstentfaltung. Die Geschlechtsrolle ist eine grundlegende Rolle und beeinflußt die Erwartungen in fast allen Bereichen. Dasselbe Verhalten wird bei Mann und Frau unterschiedlich wahrgenommen. Die Geschlechtsrollen werden von Geburt an gelernt; der Lernprozeß wird von Eltern, Schule, Gleichaltrigen, Medien und den Wissenschaften gefördert.<<" (Wagner, 1978, zitiert nach Franziska Stalmann, 1992 S. 58)
Dass geschlechtsrollentypisches Verhalten nicht angeboren sondern erworben ist, darauf weisen auch Untersuchungen von Margaret Mead hin. Denn sollten diese Verhaltensweisen angeboren sein, dann wäre ja zu erwarten, dass sie von allen Menschen auch gezeigt werden unabhängig davon, in welchem Erdteil sie geboren werden und aufwachsen.
Margaret Mead war Ethnologin und Anthropologin und forschte in Neuguinea. Dort untersuchte sie drei verschiedene Volksstämme:
Arapesh (sowohl Männer als auch Frauen zeigen eher feminine Züge im Verhalten, sind einfühlsam und kooperativ);
Mundugumor (beide Geschlechter sind eher aggressiv und feindselig im Verhalten);
Tchambuli (die Männer zeigen eher einfühlsames und "mütterliches" Verhalten, die Frauen zeigen dominantes und rationales Verhalten).
Sie beschrieb, dass bei diesen unterschiedlichen Stämmen die Geschlechtsrollen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und gar nicht den Vorstellungen von typisch weiblichen und typisch männlichen Verhaltensweisen entsprechen, wie wir sie bei uns kennen.
Ein Beispiel aus dem Jahr 2014 welches zeigt, wie Eltern – meist unbewusst – darauf hinwirken, dass sich kleine Mädchen zu "richtigen Frauen" und kleine Jungs zu "richtigen Männern" entwickeln:
"Kleine Jungs: Erst Puppen, dann Autos Selbst pädagogisch fortschrittliche Eltern gehen oft auf Nummer sicher und schenken ihrem männlichen Nachwuchs lieber Spielzeugautos als Puppen. Und das bereits im Säuglingsalter, weil Jungs angeblich schon technikaffin zur Welt kommen. Doch das ist wohl, wie jetzt eine australische Studie ergab, ein Irrtum.
Das Forscherteam der University of Sydney zeigte jeweils 24 männlichen und weiblichen Babys eine Reihe von Fotos, auf denen Menschen und Puppen sowie Backöfen und Autos abgebildet waren. Per Eyetracking-Technologie wurde dann untersucht, wie lange der Blick der vier und fünf Monate alten Säuglinge auf den Bildern verweilte. "Unsere Prämisse war, dass sich ein Kind umso stärker von einem Gegenstand angezogen fühlt, je länger es ihn betrachtet", berichtet Studienleiterin Paola Escudero.
Das Ergebnis: Die kleinen Jungs und Mädchen bevorzugen alle in gleichem Maße jene Bilder, auf denen sie Gesichter sehen konnten. Ob diese zu einer Puppe oder einem Menschen gehörten, war ihnen egal. Aber die Öfen und Autos kamen weder bei männlichen noch bei weiblichen Babys sonderlich gut an.
Die männliche Vorliebe für Autos ist also nicht angeboren, sie entwickelt sich erst später. "Im Alter von drei Jahren ist sie dann in der Regel schon recht deutlich ausgeprägt", erklärt Escudero. Ob dies allerdings mehr an den hormonellen Veränderungen, der kognitiven Entwicklung oder dem sozialen Druck liegt, kann sie nicht sagen: "Wir müssen noch erforschen, was einen Jungen zwischen dem ersten halben Jahr und dem Ende seines dritten Lebensjahres zunehmend mit Autos spielen lässt." Doch unabhängig davon spricht nichts dagegen, dass Eltern ergebnisoffen agieren - und Jungen im Säuglingsalter beides zum Spielen geben: also Autos und Puppen." (Paola Escudero u. a. 2013 zitiert nach Jörg Zittlau 2014 S. 16)
Wer sich genauer dafür interessiert, welchen Einfluss die Umwelt (Eltern, Verwandte, FreundInnen, Situationen außerhalb der Familie usw.) auf die Entstehung der Geschlechtsrollen innerhalb der ersten 3 Jahre hat, die/der kann das sehr ausführlich im Buch von Marianne Grabrucker (1991 ">>Typisch Mädchen…<< - Prägung in den drei ersten Lebensjahren. Ein Tagebuch") nachlesen. Die Autorin beschreibt in Tagebucheinträgen sehr detailliert, welchen geschlechtsformenden Einflüssen ihre Tochter täglich ausgesetzt war und wie häufig sie beobachten konnte, dass Erwachsene auf das gleiche Verhalten unterschiedlich reagierten in Abhängigkeit vom Geschlecht: Hier zwei Auszüge:
"3. Mai 1983 (1 Jahr, 9 Monate)
Oma ist gekommen und spielt mit Anneli. Stofftiere werden in Tücher gewickelt und gewiegt. Oma zeigt es ihr genau, und sie ahmt es eifrig nach. Oma hätte das mit einem Buben nie gemacht.
Sie hat ihr als Geschenk ein kleines Einkaufskörbchen mitgebracht. Als wir nachmittags einkaufen gehen, will ich es Anneli automatisch in die Hand drücken und dazu sagen: >>damit du auch eine Einkaufstasche hast wie die Mama.<< Mir fällt gerade noch ein, daß ich Anneli auf diese Weise mit meiner Tätigkeit identifiziere und definiere. Natürlich nicht allein mit diesem einzigen Mal >>Einkaufstasche-Tragen<<. Aber wie oft habe ich ihr die Botschaft >>Wie die Mama<< bei all meinen täglichen, typisch hausfraulichen Tätigkeiten schon weitergegeben.
So sein wie die Mama, vermittelt mit der Liebesintimität zwischen Mutter und Tochter, bleibt unser Leben lang haften." (Marianne Grabrucker, 1991 S. 52)
Oder ein anderes Beispiel aus demselben Buch:
"17. Juni 1983 (1 Jahr, 10 Monate)
Wir sind bei einer Bekannten und ihrem vierjährigen Sohn eingeladen. Der Bub fingert an der Balkontür herum, es gibt Krach und Konfusion, weil er sie nicht so schließen kann, wie er will. Da sagt seine Mutter vor beiden Kindern: >>Buben sind ja wirklich schrecklich, sie stellen immer so viel unsinnige Dinge an. Aber da kann man nichts machen. Mädchen dagegen tun so etwas nicht, sie sind von Haus aus vernünftiger und ruhiger!<< Natürlich probieren Mädchen ebenso an Türen herum und machen Unsinn - nur wird das nicht gleich dem Geschlecht zugeordnet, wie das bei Buben ist, sondern einfach untersagt.
Zwei Stunden später versucht sich nämlich Anneli an der Tür, wohl inspiriert vom Vorbild. Da ging die Gastgeberin schnell auf sie zu, nahm sie in den Arm und sagte: >>Das ist ja viel zu gefährlich für dich, komm schnell weg von der Tür<<, und dann verließ sie mit Anneli in ihren beschützenden Armen das Zimmer." (Marianne Grabrucker, 1991 S. 62)
1.3 Identität, Selbstvertrauen und Leistungsmotivation
Wenn wir uns etwas genauer anschauen wollen wie sich die eigene Identität, das Selbstvertrauen und die Leistungsmotivation von Kindern entwickeln, dann können wir feststellen, dass kleine Kinder immer wieder wahrgenommen und in ihrer Identität und in ihrem Verhalten bestätigt werden müssen, wenn sich bei ihnen ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln soll. In diesem Zusammenhang spielt es auch eine Rolle, für welches Verhalten ein Kind belohnt und für welches Verhalten ein Kind nicht beachtet oder gar mit negativen Äußerungen bedacht wird. Aufgrund unterschiedlicher Attribution der Umwelt auf ein und dasselbe Verhalten lernen Mädchen und Jungen, dass ein bestimmtes Verhalten für Mädchen "gut" ist und ein anderes Verhalten für Jungen. Luise Pusch, Professorin für Linguistik schreibt dazu:
"Es ist für alle Menschen existentiell wichtig, von anderen Menschen wahrgenommen, beachtet und in ihrer Identität bestätigt zu werden. Das wissen wir alle aus Erfahrung: Wir sind irritiert bis verletzt, wenn wir von Leuten, die uns persönlich kennen, mit falschem Namen angesprochen werden (Fehlidentifikation); wir vertragen es nicht, wenn man im Krankenhaus von uns als "dem Magengeschwür auf Zimmer 217" spricht; wir erleben oft den berechtigten Zorn und/oder die Verzweiflung von Kindern, die von Erwachsenen nicht wahrgenommen werden und nun mit allen Mitteln versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, oft sogar nach der Devise: >>Besser unangenehm als gar nicht auffallen.<< […] Die Sozialpsychologie unterscheidet mit und seit Mead 1934 zwischen dem spontanen Teil des Selbst ("I") und dem sozialisierten Teil des Selbst ("Me"). Den sozialisierten Teil des Selbst nennt man auch Identität. Identität ist das Ergebnis eines Zusammenwirkens von Identifizierungen durch andere und Selbstidentifikation (Aneignung der Identifizierungen)." (Luise Pusch, 1984, S. 24)
Dies bedeutet, dass das, was von anderen wahrgenommen und rückgemeldet wird und welche Ursachen dem wahrgenommenen Verhalten von den anderen zugeschrieben werden, im Laufe der Zeit in das eigene Ich übernommen wird. Wenn die Kinder die Erfahrung machen, dass unterschiedliche Eigenschaften von ihnen in Abhängigkeit vom Geschlecht erwartet werden und diese unterschiedliche Wertschätzung erzielen, kann das auf Dauer nicht ohne Auswirkung auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls bleiben. Dies ist ein permanenter Prozess, der nicht endet und der gerade auch in der Pubertät - der Zeit des Umbruchs - erneut eine besondere Bedeutung erfährt. In ihrem Beitrag "Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in der informationstechnologischen Bildung" zeigt Renate Schulz-Zander - zwischenzeitlich Professorin em. Dr. für Bildungsforschung und Informations- und Kommunikationstechnologische Bildung - auf, welchen Stellenwert das Selbstwertgefühl für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen hat, welchen Zusammenhang es zwischen der Selbsteinschätzung und den Geschlechterrollen gibt, welche unterschiedlichen Eigenschaften von Mädchen und Jungen erwartet werden und aus welchen Gründen sich die Mädchen dann nicht mehr für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer interessieren.
"Es ist davon auszugehen, daß die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls eines Kindes und später Erwachsenen von fundamentaler Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Die Selbsteinschätzung und Selbstbewertung von Mädchen und Jungen ist abhängig von der Wertschätzung der Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft. Da die >>männliche<< Rolle mit den angeblich männlichen Eigenschaften Fähigkeit zu autonomem Denken, instrumentelles Verhalten, technische Kompetenz und Aktivität in unserer Leistungsgesellschaft allgemein höher bewertet wird als die >>weibliche<< Rolle mit den ihr zugeschriebenen Fähigkeiten der sozialen Anteilnahme, Emotionalität, Sanftheit, Passivität und der Bereitschaft zur Unterordnung, müssen Mädchen schon früh ihre eigene Benachteiligung erfahren und einschätzen lernen. Während die Jungen und Männer z. B. eher ein positives Selbstwertgefühl aus dem Vergleich mit anderen, weniger kompetenten Konkurrenten ziehen, beurteilen sich Mädchen und Frauen z. B. stärker hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur sozialen Anteilnahme. Die Identitätsentwicklung von Mädchen stellt sich als permanente aktive Auseinandersetzung mit den Widersprüchen zwischen geforderter >>Weiblichkeit<< und Selbstachtung dar. Es ist plausibel, daß sich gerade in der Phase der Pubertät Interessenunterschiede verstärken. Sich in männlich besetzten Bereichen als kompetent zu erweisen, hieße gerade, den für Mädchen und Frauen vorgezeichneten Weg zur Erhöhung des Selbstwertgefühls zu verlassen. Es ist daher nur allzu verständlich, daß Mädchen mit Beginn der Pubertät an mathematisch-naturwissenschaftlichen-(informations-)technischen Fächern verstärkt weniger >>Interesse<< zeigen." (Uta Enders- Dragässer, Claudia Fuchs, 1991, S.140f das ist ein Beitrag von Renate Schulz-Zander)
Mädchen sollen sich also "weiblich" verhalten und bekommen positive Rückmeldung wenn sie das tun. Gleichzeitig lernen sie, dass die "weiblichen" Eigenschaften von der Gesellschaft weniger wertgeschätzt werden als die "männlichen" Eigenschaften und dass Mädchen weniger zugetraut wird. Da die Kinder die Ursachenzuschreibungen der Umwelt übernehmen, bedeutet dies, dass die Mädchen sich selbst mit der Zeit auch immer weniger wertschätzen und zutrauen. Diese Ursachenzuschreibungen des gezeigten Verhaltens wird gerade auch durch (Bilder- oder Schul-)Bücher (oder andere Medien) sehr gefördert, weil (Bilder- oder Schul-)Bücher immer wieder angeschaut oder gelesen werden.
Auch die Entwicklung der Leistungsmotivation wird in entscheidendem Ausmaß von den Erwartungen der Umwelt beeinflusst. In Untersuchungen zur Einschätzung von LehrerInnen gab es hierzu nachfolgende Ergebnisse, auf die Frau Renate Schulz-Zander in ihrem Beitrag hinweist:
"Jungen werden als interessierter, intelligenter, offener und kreativer eingeschätzt, Mädchen als fleißiger, ordentlicher, unselbständiger, weniger interessiert. LehrerInnen trauen Jungen eher zu, schwierige Probleme selbst zu lösen, und ermuntern sie dazu, während sie Mädchen eher helfen, was das Überlegenheitsgefühl der Jungen verstärkt." […]
"Aus den empirischen Untersuchungen geht hervor, daß die Jungen durch die LehrerInnen weit mehr Aufmerksamkeit erfahren, häufiger aufgerufen, häufiger gelobt und getadelt werden. Während Jungen eher für Disziplinstörungen getadelt und für Leistungen gelobt werden, erfahren Mädchen wenig Aufmerksamkeit, zumal sie durch ihr angepaßtes, konformes Schülerrollenverhalten die LehrerInnenarbeit erleichtern. Entgegen ihrer subjektiven Einschätzung widmen LehrerInnen den Jungen durchschnittlich zwei Drittel ihrer Zeit, selbst wenn diese in der Minderheit sind; unterschreiten sie diesen Zeitanteil geringfügig, so haben sie bereits den Eindruck, die Mädchen zu bevorzugen. Dieses LehrerInnenverhalten prägt das Selbstbild in folgender Weise: Jungen lernen, daß Erfolg auf eigene Anstrengungen zurückzuführen ist und Mißerfolg auf mangelndes Bemühen; Mädchen lernen dagegen, daß aufgrund der Nichtbeachtung Erfolg auf Glück oder Zufall, Mißerfolg hingegen auf Nicht-Können zurückzuführen ist." (Uta Enders-Dragässer, Claudia Fuchs, 1991, S. 144f das ist ein Beitrag von Renate Schulz-Zander)
Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung kommt auch Bärbel Kerber in ihrem Beitrag "Typisch Mädchen? Typisch Jungs?". Sie zitiert in der Zeitschrift PSYCHOLOGIE HEUTE Renate Valtin - Grundschulpädagogin und emeritierte Professorin an der Berliner Humboldt-Universität wie folgt:
"Es hat sich nicht viel daran geändert, dass Jungs für ihre Fähigkeiten gelobt werden, Mädchen hingegen für angepasstes und braves Verhalten. Umgekehrt sorgt der heimliche Lehrplan dafür, dass Jungen Tadel vornehmlich in Bezug auf ihre Unordentlichkeit und Disziplinlosigkeit kassieren. Mädchen dagegen ernten Tadel eher für schlechte Leistungen. Erbringen sie allerdings gute Noten, wird dies allgemein als Resultat von Fleiß und Anstrengung gewertet - etwas, das bei Jungs als Ergebnis ihres Könnens betrachtet wird. Ein Muster, das übrigens bei Lehrern und Eltern gleichermaßen erkennbar ist. Die Auswirkungen für das Selbstbild sind fatal: Frauen führen ihre Erfolge auf glückliche Umstände und Zufall zurück, Männer dagegen auf eigene Begabung und besondere Fähigkeiten". (Bärbel Kerber S. 28 Typisch Mädchen? Typisch Jungs? PSYCHOLOGIE HEUTE Juni 2011)
Dies bedeutet, dass die Leistungsmotivation eines Kindes durch solche Prozesse entsteht und dass u. a. dieses unterschiedliche Verhalten der Erwachsenen gegenüber Jungen und Mädchen dazu führt, dass die Jungen eher erfolgsmotiviert werden und die Mädchen eher misserfolgsmotiviert. Wie im vorangegangen Zitat erwähnt, schreiben erfolgsorientierte Menschen ihren Erfolg den eigenen Bemühungen zu und ihren Misserfolg den äußeren Umständen wie z. B. Pech. Misserfolgsorientierte Menschen schreiben ihren Erfolg den äußeren Umständen zu wie z. B. Glück und ihren Misserfolg ihrer eigenen Unfähigkeit. Die Leistungsmotivation gehört zu den erlernten Motiven. Die Kinder übernehmen diese Ursachenzuschreibungen durch Erwachsene und durch Bücher und andere Medien, in denen sie immer wieder die gleichen Zuschreibungen zu sehen und hören bekommen. Ob ich erfolgsmotiviert oder misserfolgsmotiviert bin, hat einen entscheidenden Einfluss darauf wie ich mit Situationen, die mit Lernen und mit Prüfungen zusammenhängen, umgehe. Erfolgsorientierte Menschen haben gelernt, dass sie einen Einfluss auf das Ergebnis einer Leistungsprüfung haben und haben deshalb auch gelernt, dass die eigenen Bemühungen das Ergebnis beeinflussen werden. Sie gehen strukturierter und motivierter an Aufgaben heran, weil sie wissen, dass sie besser abschneiden werden, wenn sie sich mehr Mühe geben. Misserfolgsorientierte Menschen haben gelernt, dass sie keinen Einfluss auf das Ergebnis einer Leistungsprüfung haben. Sie trauen sich selbst nichts zu und denken, dass sie nur durch Glück ein gutes Ergebnis erzielen können. Dies führt dazu, dass sie weniger gut und weniger intensiv lernen, weil sie davon ausgehen, dass das Lernen das Ergebnis nicht beeinflussen kann. Bei gleicher Intelligenz schneiden misserfolgsorientierte Menschen deshalb in Leistungssituationen schlechter ab als erfolgsorientierte Menschen.
Selbstbewusstsein entsteht auch durch Identifikation mit Heldinnen und Helden und deren Eigenschaften. Dabei zeigt sich, dass sich Mädchen in aller Regel mit weiblichen Vorbildern identifizieren und Jungen mit männlichen Vorbildern. Leider gibt es in unserer Gesellschaft weitaus mehr Vorbilder für Jungen als für Mädchen. Helden gibt es überall - Heldinnen müssen gesucht und gefunden werden. Es gibt auch heute noch wenige von den Geschlechtsrollenmodellen abweichende Vorbilder. Es werden schon eher mal Mädchen oder Frauen gezeigt, die aufregende Abenteuer erleben oder schwierige Situationen gut meistern, aktiv und stark sind. Jungen oder Männer, die sich einfühlsam und vorsichtig zeigen oder auch mal weinen oder sich mit Haushaltstätigkeiten oder mit Kindererziehung beschäftigen, müssen eher mit der Lupe gesucht werden. Insofern stimmt auch heute noch das nachfolgende Zitat: