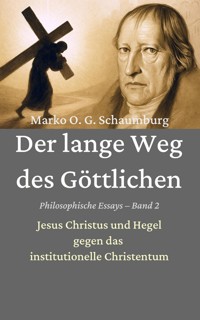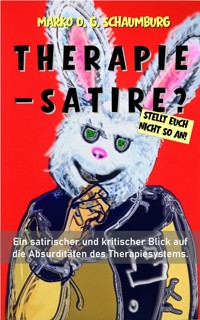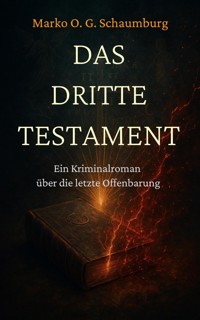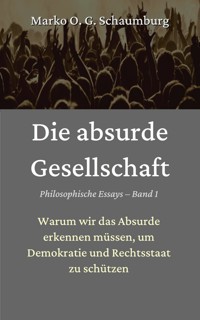
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer Welt, in der Absurdität nicht mehr Ausnahme, sondern Normalität geworden ist. Von der digitalen Öffentlichkeit über politische Bewegungen bis hin zu moralischen Debatten – überall begegnen uns Widersprüche, die irritieren, manipulieren und verunsichern. Der Autor nimmt den Leser mit auf eine essayistische Reise durch die Abgründe und Möglichkeiten der Gegenwart: Fake News, Cancel Culture, moralische Überhöhungen, Anspruchsdenken in der Dienstleistungsgesellschaft, der Nahostkonflikt, Russlands Angriffskrieg – die Beispiele sind vielfältig. Mit philosophischem Tiefgang (Camus, Hegel, Arendt, Rawls u. a.) und psychologischer Schärfe werden diese Phänomene nicht nur beschrieben, sondern in ihrer inneren Logik entschlüsselt. Das Buch zeigt: Das Absurde ist Teil unseres Menschseins – aber wir sind ihm nicht ausgeliefert. Der Schlüssel liegt in der Würde, die jedem Menschen innewohnt. Sie eröffnet den Raum, Absurdität nicht nur zu erkennen, sondern zu überwinden. Ein Werk, das aufrüttelt, orientiert und den Leser einlädt, sich der eigenen Verantwortung in einer offenen Gesellschaft bewusst zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marko O. G. Schaumburg
Die absurde Gesellschaft
First published by Marko O. G. Schaumburg, Turmweg 3, 34596 Bad Zwesten, [email protected] 2025
Copyright © 2025 by Marko O. G. Schaumburg
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.
First edition
Hersteller: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
This book was professionally typeset on Reedsy Find out more at
Hinweise des Autors und dem Werk
Der Autor ist im höheren Dienst einer bundesunmittelbaren Körperschaft mit Selbstverwaltung tätig. Die vorliegende Publikation ist unabhängig von seinem dienstlichen Aufgabenbereich entstanden. Sie beruht auf persönlichen, wissenschaftlichen Studien sowie langjähriger interdisziplinärer Arbeit in den Bereichen Informatik, Philosophie, Theologie und Organisationsanalyse. Alle Inhalte spiegeln ausschließlich die persönliche Auffassung des Autors wider.
Es wurden keine dienstlichen oder nicht öffentlich zugänglichen Informationen verwendet. Die Inhalte stehen in keiner Verbindung zu institutionellen oder amtlichen Positionen der Behörde, bei der der Autor beschäftigt ist.
Einleitung
Wir leben in der westlichen Welt in einer weitgehend freien Gesellschaft, in der Würde und Meinungsfreiheit zu den unverzichtbaren Grundwerten unseres Zusammenlebens gehören. Beide sind untrennbar miteinander verbunden: Was wäre Meinungsfreiheit wert, wenn nicht zugleich die Würde des Anderen anerkannt und geschützt würde? Und was könnte Würde bedeuten, wenn nicht auch die Freiheit, Gedanken und Überzeugungen ohne Angst äußern zu können?
Doch gerade dort, wo diese Werte als unantastbar gelten, tritt ein neues Phänomen auf, das ihre Substanz zu unterminieren droht: das Absurde. Gemeint ist nicht das alltäglich Komische oder Unverständliche, sondern ein tiefer liegender Widerspruch, in dem sich das Anspruchsvollste unserer Kultur in sein Gegenteil verkehrt. Inmitten der Beteuerung von Freiheit erleben wir ihre Einschränkung durch moralische Überhöhung und symbolische Kämpfe. Unter dem Banner der Würde begegnet uns zugleich ihre Verletzung, sei es durch sprachliche Verzerrung, gesellschaftliche Stigmatisierung oder politische Instrumentalisierung. Das Absurde ist damit mehr als eine Randerscheinung; es ist zu einer gesellschaftlichen Grundkraft geworden, die das Selbstverständliche in Frage stellt und das Selbstverständliche ins Fragwürdige verkehrt.
Doch eine freie Gesellschaft ist immer auch eine Toleranzgesellschaft. Sie lebt davon, Unterschiede auszuhalten, Konflikte auszutragen und Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung zu verstehen. Darin liegt ihre Stärke – und zugleich ihre größte Gefahr. Denn wo jede Haltung, jede Meinung und jede Praxis als gleichwertig gelten soll, wächst die Gefahr, auch das Absurde zu tolerieren. Was ursprünglich als Schutz des Andersdenkenden gedacht war, kann so zum Einfallstor für Haltungen und Verhaltensweisen werden, die nicht mehr zur Freiheit beitragen, sondern sie untergraben. Das Absurde wird dann nicht mehr erkannt, benannt und begrenzt, sondern es sickert in den Zeitgeist ein, tarnt sich als Vielfalt und beginnt, die Grundlagen der Gesellschaft von innen heraus auszuhöhlen.
Der Mensch ist fehlbar. Er irrt, er täuscht sich, er kann sich in seinen Überzeugungen verrennen – und er hat zugleich die Fähigkeit, sich zu korrigieren und umstimmen zu lassen. Gerade die Offenheit, Fehler einzugestehen und Meinungen zu revidieren, ist ein Wesenskern der Freiheit. Doch in unserer öffentlichen Kultur sind Fehltritte, ungeschickte Formulierungen oder missverständliche Aussagen oft nicht mehr Teil eines offenen Austausches, sondern Anlass für scharfe und pauschale Verurteilungen. Kritik verliert dort ihre aufklärende Funktion und schlägt in eine eigene Form der Absurdität um: wenn die Würde der betroffenen Person keine Rolle mehr spielt, wenn weder ihr Hintergrund noch der Kontext ihres Handelns beachtet wird, sondern allein der Augenblick zum Tribunal erhoben wird.
Dieses Buch verfolgt das Ziel, die feinen, aber entscheidenden Unterschiede sichtbar zu machen, die das Absurde in unserer Gesellschaft prägen. Es geht darum, das scheinbar Selbstverständliche neu zu hinterfragen und die Mechanismen zu benennen, durch die das Absurde Teil unseres öffentlichen Diskurses werden konnte. Dazu werden aktuelle Schlagworte wie Cancel Culture oder Fake News aufgegriffen und in ihrem eigentlichen Gehalt geklärt, um sie aus der Grauzone bloßer Schlagworte herauszuführen. Philosophische Bezüge, insbesondere zu Denkern wie Albert Camus, Karl Popper oder Hannah Arendt, bilden dabei die Grundlage, auf der die Analyse erfolgt. Ergänzt wird diese Betrachtung durch aktuelle Quellen, die das Buch zugleich zu einem Spiegel gegenwärtiger Diskussionen machen.
Absurdität – eine philosophische Frage?
Wer von Absurdität spricht, kommt an Albert Camus nicht vorbei. In seinem berühmten Essay Der Mythos des Sisyphos (1942) beschreibt er das Absurde als Grundsituation des Menschen: den Widerstreit zwischen dem Drang nach Sinn und der Erfahrung einer Welt, die keinen letzten Sinn bereithält. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Sinnsuche und Sinnleere macht für Camus die eigentliche Absurdität des menschlichen Daseins aus. Auch wenn Camus sein Denken im Kontext der Mitte des 20. Jahrhunderts formulierte, ist seine Analyse heute aktueller denn je. Denn viele gesellschaftliche Erscheinungen, die uns widersprüchlich, übersteigert oder schlicht unvernünftig vorkommen, lassen sich vor dem Hintergrund seiner Philosophie in einem tieferen Licht betrachten. Zahlreiche Autoren haben später an Camus angeschlossen oder ihn neu interpretiert – etwa in kulturkritischen Analysen unserer Gegenwart, die das Absurde nicht nur als individuelles, sondern als gesellschaftliches Phänomen deuten.
Albert Camus (1913–1960) war Schriftsteller, Philosoph und Journalist französisch-algerischer Herkunft. Er wuchs in einfachen Verhältnissen in Algier auf, studierte Philosophie und machte sich früh als scharfer Beobachter seiner Zeit einen Namen. Seine Werke wie Der Mythos des Sisyphos, Die Pest oder Der Fremde prägten die geistige Landschaft des 20. Jahrhunderts. Camus verstand sich weniger als Systemphilosoph denn als literarischer Denker, der philosophische Fragen in erzählerische Formen goss. 1957 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Seine Überlegungen zum Absurden sind daher nicht nur theoretische Reflexionen, sondern tief in das menschliche Leben und Erleben eingebettet – verständlich, greifbar und bis heute von bestechender Aktualität.
Vom Absurden des Menschseins
Camus beschreibt das Absurde nicht als ein kurioses Einzelereignis, sondern als Grundsituation des Menschen. Jeder Mensch trägt in sich den Drang, die Welt zu verstehen und seinem Leben einen letzten Sinn zu geben. Gleichzeitig begegnet er einer Wirklichkeit, die auf diese Fragen keine endgültige Antwort bereithält. Genau in dieser Kollision – zwischen unserem Bedürfnis nach Sinn und einer schweigenden Welt – entsteht das Absurde.
Für Camus ist das Absurde also kein Fehler, den man beheben könnte, sondern eine unausweichliche Erfahrung. Es gehört zum Menschsein, dass wir Fragen stellen, die größer sind als die Antworten, die wir erhalten können. Diese Erfahrung kann erschütternd sein, sie kann Hoffnung nehmen – und doch birgt sie auch eine besondere Freiheit. Denn wer akzeptiert, dass es keinen vorgegebenen, höheren Sinn gibt, ist frei, das eigene Leben selbst zu gestalten.
Camus fasst dieses Spannungsverhältnis im Bild des Sisyphos: jenes mythischen Helden, der dazu verurteilt ist, einen Stein ewig einen Berg hinaufzurollen, nur damit er wieder herabstürzt. Sisyphos kann sein Schicksal nicht ändern, aber er kann seine Haltung dazu wählen. In diesem Bild zeigt Camus, dass das Absurde nicht zwangsläufig Verzweiflung bedeutet, sondern auch einen Akt der Selbstbehauptung – ja sogar der Würde – inmitten einer sinnlosen Welt.
Gerade weil Camus das Absurde nicht als Randerscheinung, sondern als Grundsituation des Menschseins versteht, bietet seine Perspektive einen Schlüssel, um auch das Absurde unserer Gesellschaft besser zu begreifen – dort, wo individuelle Sinnsuche und kollektive Wirklichkeit aufeinanderprallen.
Vom Absurden der Gesellschaft
Wenn das Absurde nach Camus aus der Kollision zwischen menschlichem Sinnbedürfnis und einer stummen Welt entsteht, so zeigt sich eine vergleichbare Spannung auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Gesellschaften leben von gemeinsamen Werten, Regeln und Erzählungen, die Orientierung geben sollen. Doch gerade in einer Zeit, in der alte Gewissheiten brüchig werden und neue Deutungen ständig miteinander konkurrieren, verliert auch die Gesellschaft ihre Eindeutigkeit. Begriffe werden umgedeutet, Normen verschieben sich, und das, was gestern noch selbstverständlich war, kann heute als fragwürdig gelten.
Das Absurde der Gesellschaft zeigt sich darin, dass Grundwerte wie Freiheit, Toleranz oder Wahrheit zwar hochgehalten, zugleich aber in ihrer Anwendung ins Gegenteil verkehrt werden. Eine Toleranz, die keine Grenzen kennt, läuft Gefahr, Intoleranz selbst zu dulden. Eine Freiheit, die nur als schrankenlose Selbstbehauptung verstanden wird, kann andere ihrer Freiheit berauben. Und eine Wahrheit, die in unzähligen „Wahrheiten“ zerfällt, droht ihren orientierenden Charakter ganz zu verlieren.
So entsteht eine paradoxe Lage: Die Prinzipien, die eine offene Gesellschaft tragen sollen, werden zugleich zu den Hebeln, mit denen ihre Substanz ausgehöhlt wird. Darin liegt die Absurdität unserer Gegenwart – eine Absurdität, die nicht mehr nur das Schicksal des Einzelnen betrifft, sondern die Ordnung des Zusammenlebens insgesamt.
„Die Frage nach dem Selbstmord“ – Individuum und Gesellschaft
Camus bezeichnete den Selbstmord als die „einzig wirklich ernste philosophische Frage“. Er meinte damit nicht eine moralische Bewertung, sondern die Grundentscheidung des Menschen: ob das Leben angesichts des Absurden lebenswert ist oder nicht. Wer das Absurde erkennt, steht vor der Wahl: Flucht, Resignation – oder die bewusste Entscheidung, weiterzuleben und ihm die Stirn zu bieten.
Diese Frage, die Camus auf das Individuum bezog, erhält heute eine beklemmende Aktualität im gesellschaftlichen Diskurs. Immer häufiger wird in den Diskursen scheinbar ein „Selbstmord“ unserer Gesellschaftsordnung be- bzw. verhandelt – von inneren Kräften, die ihre eigenen Grundlagen aushöhlen, von Werten, die unter dem Banner der Freiheit zerstört werden, und von Mechanismen, die den Gemeinsinn zerfressen. Wenn Camus das Individuum vor die Entscheidung stellte, das Leben trotz des Absurden zu bejahen, so steht heute die offene Gesellschaft selbst vor einer ähnlichen Prüfung: ob sie in der Lage ist, ihre Prinzipien zu verteidigen und zu erneuern, oder ob sie – wie Sisyphos – unter der Last ihrer eigenen Widersprüche zusammenbricht.
Camus’ Antwort auf die Frage nach dem Selbstmord lautete: Revolte. Nicht Resignation, nicht Flucht in Illusionen, sondern das bewusste Aufbegehren gegen die Sinnlosigkeit. Revolte heißt für ihn, das Absurde nicht zu leugnen, sondern es auszuhalten – und dennoch das Leben zu bejahen. Sie ist ein Akt der Selbstbehauptung, in dem der Mensch seine Würde wahrt, indem er sich dem Unausweichlichen nicht ergibt.
Übertragen auf die Gesellschaft bedeutet dies: Eine freie Ordnung kann das Absurde, das sie durchzieht, nicht aus der Welt schaffen. Sie kann Widersprüche nicht einfach auflösen, sondern muss lernen, mit ihnen zu leben. Revolte im gesellschaftlichen Sinn heißt, sich nicht mit dem Niedergang der Werte abzufinden, sondern aktiv ihre Verteidigung zu ergreifen – ohne in Dogmatismus zu verfallen. Es ist ein Widerstand, der nicht zerstört, sondern bewahrt, indem er die Grundlagen der Freiheit gegen ihre absurde Verkehrung behauptet.
Die Revolte wird so zu einer Kraft der Erneuerung. Sie ruft dazu auf, das Offene, das Verletzliche und das Unvollkommene der Gesellschaft nicht als Schwäche zu verachten, sondern als Bedingung ihrer Lebendigkeit zu erkennen. Doch diese Haltung ist anspruchsvoll: Sie verlangt die Fähigkeit zur Selbstkritik, ohne Selbstzerstörung zu betreiben. Genau in diesem Spannungsfeld entscheidet sich, ob die Gesellschaft an ihren eigenen Absurditäten zerbricht – oder ob sie die Kraft findet, ihnen standzuhalten.
Camus’ Gedanke der Revolte wird oft missverstanden. Linke wie rechte Bewegungen berufen sich gern auf den Anspruch, „rebellisch“ zu sein, und setzen ihre Revolte mit radikalem Widerstand oder gar Umsturz gleich. Doch eine solche Instrumentalisierung pervertiert den eigentlichen Sinn, den Camus mit diesem Begriff verband. Für ihn wäre gerade das Abrutschen ins Extreme – sei es nach links oder nach rechts – selbst ein Akt des gesellschaftlichen Selbstmords. Revolte im Sinne Camus bedeutet nicht, die Ordnung zu zerstören, sondern sich gegen ihre absurde Selbstauflösung zu stellen. Sie ist der Widerstand gegen jene Dynamiken, die aus Freiheit Beliebigkeit machen, aus Toleranz Zerstörung oder aus Wahrheit bloße Meinung. Revolte heißt also, der Versuchung des Extremen zu widerstehen – und in der Mitte des Absurden jene Haltung zu bewahren, die das Gemeinsame schützt.
Das Absurde totalitärer Systeme
Hannah Arendt (1906–1975) war eine der bedeutendsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. In Deutschland geboren und als Jüdin verfolgt, floh sie 1933 zunächst nach Paris und später in die USA. Dort wurde sie Professorin für politische Theorie und schrieb Werke, die bis heute Maßstäbe setzen. Arendt war keine „Systemphilosophin“, sondern eine Denkerin, die aus der Erfahrung von Flucht, Exil und politischer Katastrophe heraus nach den Bedingungen von Freiheit und Herrschaft fragte.
In ihrem Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951) untersuchte Arendt, was totalitäre Systeme wie den Nationalsozialismus oder den Stalinismus im Kern ausmacht. Für sie waren diese Herrschaftsformen mehr als bloße Diktaturen: Sie zielten nicht nur auf politische Kontrolle, sondern auf die vollständige Unterwerfung des Menschen – bis in Denken, Handeln und Sein hinein. Totalitäre Systeme schaffen eine eigene „Wirklichkeit“, in der Wahrheit durch Ideologie ersetzt wird und der Einzelne nur noch als Funktion dieser Ideologie existiert.
Das Absurde dieser Systeme liegt darin, dass sie mit dem Anspruch antreten, eine perfekte Ordnung zu schaffen, aber in Wirklichkeit das Menschliche selbst zerstören. Indem sie jeden Lebensbereich politisieren, jede Spontaneität ersticken und jede Kritik als Verrat brandmarken, verkehren sie die Idee von Gemeinschaft in ihr Gegenteil. Aus dem Versprechen von Sinn entsteht die totale Sinnlosigkeit, weil die Freiheit des Einzelnen ausgelöscht wird. Arendt machte deutlich: Das eigentliche Ziel totalitärer Herrschaft ist nicht die Erfüllung eines Ideals, sondern die totale Kontrolle – und gerade darin liegt ihre zerstörerische Absurdität.
Aus Arendts Analyse ergibt sich eine zentrale Konsequenz: Offene Gesellschaften müssen wachsam bleiben, um die Grenzlinie zu erkennen, an der das legitime Ringen um Deutungen in totalitäre Muster umzuschlagen beginnt. Wo im Meinungsdiskurs Wahrheit durch Ideologie ersetzt, Andersdenkende pauschal entmenschlicht oder Kritik als „Verrat“ gebrandmarkt wird, ist die Absurdität des Totalitären bereits präsent – auch wenn das System selbst noch freiheitlich erscheint. An dieser Stelle wird die Verantwortung der offenen Gesellschaft sichtbar: Sie darf nicht jede Meinung grenzenlos dulden, sondern muss jene Mechanismen klar benennen und abwehren, die auf ihre Abschaffung zielen.
Karl Popper (1902–1994), ein österreichisch-britischer Philosoph, gilt als einer der einflussreichsten Denker der Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie des 20. Jahrhunderts. In seinem Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1945) prägte er den Begriff des „Paradoxons der Toleranz“: Eine Gesellschaft, die unbegrenzt tolerant ist, riskiert, von den Intoleranten zerstört zu werden. Deshalb muss eine offene Gesellschaft das Recht haben – ja, sogar die Pflicht –, Intoleranz nicht zu tolerieren, wenn diese auf die Vernichtung der Freiheit abzielt. Poppers Gedanke verdeutlicht: Toleranz ist kein schrankenloses Prinzip, sondern verlangt die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen. Nur so kann eine offene Gesellschaft verhindern, dass sie in die Absurdität des Totalitären abgleitet.
Arendt hat gezeigt, wie totalitäre Systeme das Menschliche durch Ideologie zerstören, Popper hat verdeutlicht, dass offene Gesellschaften genau dort ihre Grenze ziehen müssen, wo Toleranz zur Waffe gegen die Freiheit wird – beide zusammen mahnen uns, das Absurde nicht zu verharmlosen, sondern es als Vorzeichen des Totalitären zu erkennen.
Kernfrage der heutigen Zeit: Toleranz in welchen Grenzen?
Beobachtet man die aktuellen Diskussionen in Deutschland und darüber hinaus – etwa in den USA –, so zeigt sich eine zentrale Kernfrage unserer Zeit: In welchen Grenzen soll Toleranz gelten? Diese Frage lässt sich nicht mehr mit einfachen Antworten fassen. Sie betrifft die unterschiedlichsten Lebensbereiche, von Migration über freien globalen Handel bis hin zu kulturellen und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen.
Gerade hier zeigt sich die Absurdität des öffentlichen Diskurses: Die Mitte, die lange als Ort des Ausgleichs und der Maßstäbe galt, scheint keine überzeugenden Antworten mehr zu geben. Ihre Argumente stützen sich auf Rechtsstaatlichkeit, auf allgemeine Menschenrechte oder auf internationale Verträge – doch sie bleiben oft abstrakt und scheinen den praktischen Lebenswirklichkeiten nicht gerecht zu werden. In der Folge verschiebt sich der Diskurs zunehmend an die Ränder: nach links oder rechts, nicht selten bis in extreme Positionen.
Damit entsteht ein gefährliches Vakuum. Wo die Mitte keine vermittelnde und handlungsfähige Stimme mehr ist, geraten ihre Prinzipien unter Druck, und die offene Gesellschaft verliert den Raum, in dem Kompromisse und Grenzen der Toleranz ausgehandelt werden können.