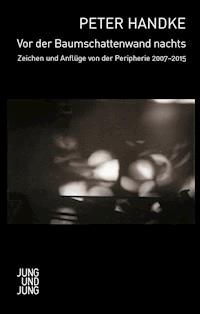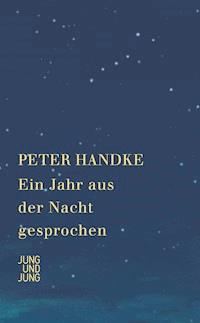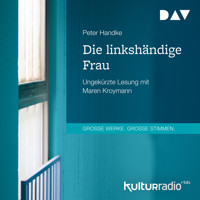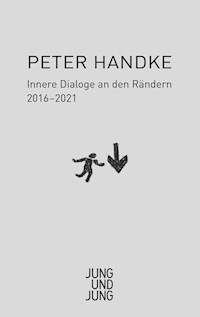9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
"Die vier Personen, der Alte, die Frau, der Soldat und der Spieler, bewegen sich in einer Art Phantasie-Topographie durch Kontinente und Zeiten. Sie sind aus dem Alltag ausgebrochen, sie wollen »im Unterwegssein zu Hause sein«. In den Unterhaltungen der vier, in ihren Aussprachen, Ansprachen, Ausbrüchen, Erwiderungen, Selbstgesprächen und Traumvisionen explizieren sie ihre eigene Geschichte; so »machen« sie das Märchen, seine Stille und »Unstille«."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Ähnliche
Peter Handke
Die Abwesenheit
Suhrkamp Verlag
Die Abwesenheit Ein Märchen
»Einem Allerweltspferd ‒ dem liegt's im Blut. Es ist wie zögernd, wie verloren, wie selbstvergessen. Ein solches Tier läßt Staub und Erde hinter sich und verliert sich vor den Blicken.«
Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland
1
Es ist ein später Sonntagnachmittag, mit schon langen Schatten der Statuen auf den Plätzen des Zentrums, und leeren Vorstadtstraßen, wo der gewölbte Asphalt einen Bronzeschimmer hat. Aus einer Gaststätte dringt nichts nach außen als das Sirren des Ventilators in der Fassade, zwischendurch ein Klappern. Ein Blick geht hinauf ins Astwerk einer Platane, so als stünde da jemand an ihrem Fuß, in Betrachtung der unzähligen, immerfort pendelnden Samenkugeln, der einzelnen großlappigen, langstengeligen Blätter, die sich ruckhaft zusammenbewegen wie ein vielarmiger Lotse, und der schaukelnden, tiefgelben Sonnennester im Laub; wo der breite gescheckte Stamm sich gabelt, ist eine Kuhle wie für ein Tier. Ein anderer Blick geht hinab in einen schnellfließenden Fluß, welchen, vom Ufer aus gesehen, die Sonne durchscheint bis auf den Grund: dort steht ein langer Fisch, hellgrau wie die Kiesel, die unter ihm in der Strömung rollen. Es ist die Zeit, da die Sonnenstrahlen auch die Wand eines Souterrain-Zimmers erreichen; sie füllen die ganze bilderlose Fläche aus und lassen den Kalk dort körnig wirken. Der Raum ist weder verlassen noch unbewohnt; es bevölkern ihn, immer in Augenhöhe, die Schattenrisse kreuzender Vögel und, in Abständen, der Passanten auf der Straße, von denen die Mehrzahl Radfahrer sind. Ebenso in Augenhöhe zeigt sich im Freien, am Horizont, von der letzten Sonne bestrahlt, ein einzelner, fernöstlicher Berg. Das Bild kommt nah und macht oben auf der Rundung den schroffen Felsgipfel deutlich, welcher mit seinen Zinnen, Kaminen, Vorsprüngen und gläsernen Flanken an eine uneinnehmbare, auch unzugängliche Burg erinnert. ‒ Die Sonne ist untergegangen; hier und da ein Licht in den Häusern; auf der leeren Wand des Souterrain-Zimmers der Abglanz des gelben Himmels, durchquert von inzwischen umrißlosen Schemen. So vollkommen leer ist die Wand nicht: es rückt nun ins Bild ein kleiner Abreißkalender, mit einer dickroten Zahl.
In einem Park steht ein schloßartiges Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert, mit hohen, von dreieckigen Giebelfeldern bekrönten Fenstern in den unteren Stockwerken, und einem Hundert das Haus in allen Himmelsrichtungen umlaufenden Luken knapp unter der Dachtraufe. Im Vergleich zu diesem weitausladenden Bauwerk wirkt der Park klein; Bewuchs, Wege und Ruheplätze dürftig; einzig der Ansatz einer Birkenallee und die alleinstehende, sich wie aus einer Rasenbank erhebende, säulenästige Platane geben die Ahnung einer anderen Epoche. An beiden Flanken der scheinbaren Herrschaft Schnellstraßen, jetzt gegen Sonntagabend nur von Personenwagen befahren, ohne Laster. Im Gegensatz zu den paar verstreuten, durch die Nähe des Komplexes hüttenartig niedrigen Behausungen im Umkreis, sind fast alle Fenster des Schlosses beleuchtet, so als spiele sich da durch die Etagen, mit offenen Flügeltüren von Saal zu Saal, und sogar in den lüsterverzierten, marmornen Treppenhäusern ein großes Fest ab. Das Gebäude ist aber ein Altersheim, oder, laut Inschrift über dem Eingangsportal, eine »Versorgungsanstalt«, wo die hellen Fenstervierecke, dicht an dicht, die Einzelzimmer bedeuten. In einigen davon, hinter den oft vorhanglosen Scheiben, die Silhouetten der Bewohner, immer bewegungslos, untätig und in der Regel auch blicklos. Es gibt daneben Fenster, die offenstehen, und diese lassen, trotz der brennenden Deckenlampen, der einen Topfpflanze auf der Stellage, des einen Vogelkäfigs am Rahmen, die Räume verlassen erscheinen. Auch die Fernseherlichter springen über die leeren Wände und wechseln die Farben wie für sich allein. Das Klicken eines Bügeleisens und das kräftige Klirren, sooft es abgestellt wird, kommen aus einem Dienstzimmer. Der Kopf oben in der Luke, in die Hände gestützt, mit Detektiv- oder Forscheraugen, die alles im Blick haben, ist der eines jungen Mannes, keines Heiminsassen. Kein Lachen im ganzen festlich strahlenden Kreuzschiff, es sei denn, in regelmäßigen Abständen, jäh und wie auf Einsatz losbrechend, des Publikums in dem Fernsehbild. Der einzige natürliche Gesang ist der eines Küchenmädchens, beim Öffnen eines riesigen Blechtopfs unten im weißgekachelten Keller, eher ein Summen, eintönig, kurz, sich wiederholend, mit dem es sich nur seiner Stimme vergewissern will. Der Schotterweg draußen, hin zum Eingangsportal, endet vor einer flachen Stufe, einem Hindernis, groß genug, daß es beidseits von einem Geländer flankiert werden muß, dessen Messingschwünge, zusammen mit den Krückstöcken des einen sich da noch ergehenden alten Menschen, unter dem gelben Himmel in dem Gelände die Glanzstellen bilden.
In einem der wenigen Zimmer des Heims, wo kein Licht brennt, ist dann doch eine Lampe an, montiert an ein Stehpult im Hintergrund. So winzig sie ist, so hell ist, in dem Halbdunkel ringsum, der Kreis, den sie auf das Pult wirft. Dort liegt, aufgeschlagen, ein Notizblock, vom Ausmaß eines üblichen Buchs, mit weit überstehenden festen Deckeln, die umwickelt sind mit einer Zeltleinwand, brüchig, vielfach verklebt, das Papier stockfleckig, so als habe das Ganze eine eigene Geschichte ‒ sei immer wieder in Sonne und Regen gekommen, oder sogar Teil eines Reisegepäcks gewesen, auf hoher See. Die Seiten sind, in senkrechten Reihen, zum Teil bedeckt mit Zeichen, die an Bilderschriften erinnern, ohne dabei bestimmbar zu sein. Neben ein paar von ihnen stehen, in einer klaren, amtlichen, zugleich kindlichen Handschrift, deutsche Ausdrücke, die etwas von Entzifferungsversuchen haben (zum Teil mit Fragezeichen versehen), unter anderem: »Sich vor Augen halten«; »sich bemächtigen«; »sich auf den Weg machen«; »aufbrechen«; »sich hinbegeben«; »sich dazuhocken«?; »das Rinnsal«?; »der Fels an der Grenze«?; »die Wasserscheide«? Im Falz ein sechskantiger Bleistift, schwarz. Das Zimmer, mit den breiten, langen, kaum gestückten Schiffbodenbrettern, deren Fluchtlinien, markiert von den spiraligen Astlöchern und den polierten Nagelköpfen, auf einen gemeinsamen Fernpunkt weisen, hat in seiner Fastleere etwas Geräumiges und durch die Stuckdecke, ein Ellipsen-Ornament, etwas Nobles. Indem der Winkel mit dem Stehpult erhöht ist durch ein Holzpodest, gibt er das Bild eines Altans in einer mittelalterlichen Gelehrtenstube. Das einzige Mobiliar sonst ist das Klappbett in einer Wandnische, das da abgestellt scheint wie der Ausrüstungsteil einer Expedition; als Decke, auf dem nackten Gestell, ein Schlafsack. Das Fenster ‒ es gibt nur eines ‒ ist oben leicht gerundet und gleicht so einer Arkade. Auf dem Boden darunter zwei Hanteln, an den Griffen mit abgeblättertem Lack, zu Füßen eines Rucksacks, ohne Inhalt, schlaff, faltig, zusammengesunken.
Der Bewohner, der am Fenster steht, ist kein Heiminsasse, sondern der Herr dieses Raums. Zwar hat er einen Stock in der Hand, aber der ist keine Krücke, eher ein Wanderstab, aus dem harten, fast unzerbrechlichen, dabei unbiegsamen Rosenholz, an welchem unten noch ein paar kräftige, spitzschnäblige Dornen geblieben sind, so daß er zugleich als Schlagwaffe dienen könnte; und sein Eigentümer, ein Greis, hält ihn in der Faust wie sein Szepter. Die Augen des da Aufgerichteten, mag alles sonst an dem Gesicht, das Haar, die Haut, die Lippen, greisenhaft sein, reizen zum Vergleich mit denen des jungen Mannes oben in der Mansardenluke: während dieser die Dinge in seinem Blickfeld eher mit Mißtrauen oder Neugier bedenkt, nimmt jener die Einzelheiten vor seinem Fenster in vollkommenem Gleichmut wahr. Unbewegt geht der Alte mit mit den sich regenden Zweigen, einem Flugzeug am Himmel und den Betreßten, die unten einen Sarg durch eine Seitenpforte ins Haus tragen. In seinem Blick lichtet sich das Gelände. Eine U-Krümmung im untersten Ast der Platane bekommt die Gestalt eines Steigbügels. Das schräge Schindeldach des Geräteschuppens sendet, wie eine Schieferschicht, ein urtümliches Grau aus, und der übliche sich an der Bretterwand da aufrankende Holunderstrauch hat parallele Zweige, welche die Sprossen von Leitern nachbilden. Es ist, als zögere das Anschauen des alten Mannes die Dämmerung hinaus und umgebe seine Gegenstände mit einem Tageslicht. Der die Anlage durchfließende gerade kleine Kanal zeigt an den Rändern Schattenbuchten, welche gleichsam die Mäander eines weithin strömenden Flusses einfassen, und in der Folge wird dahinter der Horizont deutlich, mit der langen Linie eines Waldrands, dessen Stämme hervortreten als Schiffsmasten. Diesen vorgelagert ein breiter Streifen Niemandsland, gequert von der Autobahn, auf der die unhörbaren Fahrzeuge zu Schnellbooten auf einer unablässig durchfurchten Meeresstraße werden. Der fernste Horizontpunkt ist der kahle Hügel hinter dem Mastenwald, wo die kalkweiße Kirche einen Leuchtturm darstellt, so daß die Kuppe die Form eines Atolls annimmt, mit den Baumzacken davor als dem Außenriff. Wie es kein Sprung hin ist in die Weite, so ist es auch keiner zurück in die Nahsicht: die Linien der langgestreckten Fischereischuppen an einer Nebenstelle des Horizonts, im Hafen einer anderen Insel, gehen ohne weiteres über in die der Greisenhand, welche, nach oben gekehrt, hier auf der Fensterbank seines Asyls ruht. Im leeren blauen Zenit über ihm erscheint der dunkle Umriß eines Fallschirmspringers, sich gemächlich um und um drehend, hierhin und dorthin trudelnd, und zuletzt wie selbstverständlich in dem offenen Handteller des Alten landend in Gestalt eines leichtflügligen Lindensporens, an welchem der »Springer« als wacholderbeerkleines Kügelchen hängt.
Der alte Mann kommt in Bewegung. Er fängt an, zwischen seinem Fenster und dem Stehpult hin- und herzugehen. Am Pult malt er jeweils mit dem Bleistift eins seiner Zeichen unter das andre, wie mit angehaltenem Atem; zurück am Fenster, seinem Ausguck, ereignet sich dann ein langsames Ausatmen, wodurch es ist, als träten draußen, an dem Gras, den Querrillen des Pförtnergebäudes, einem zusammengeschobenen Rollstuhl, die letzten Farben hervor. Die Linien der Schriftbilder in dem Buch spiegeln indessen nichts von dem augenblicklich Gesehenen wider, könnten höchstens, unter anderem, einen gefiederten Pfeil, eine mehrfach gegabelte Zweigspitze oder die Schwünge eines die Luft durchtauchenden Vogels bedeuten. Das Hin- und Hergehen geschieht ohne Stock ‒ dieser lehnt an der Wand ‒, und ist kein Schlurfen, vielmehr ein lässiges, die Beine werfendes Schlendern, welches von Mal zu Mal, eigenartig bei der kurzen Strecke, eher zu einem Ausschreiten wird. Zuletzt wird den Zeichen noch eine Kolonne von einzelnen Wörtern angefügt: »teilhaben«; »zeitigen«?; »sich sammeln«; »sich trennen«?
Das Tagewerk scheint getan. Der alte Mann setzt sich, angekleidet, in einem weiten Anzug und oben zugeknöpftem Hemd, auf das Feldbett, aufrecht, die Hände auf den Knien. In das Zimmer, dessen Fenster offensteht, dringt von den Schnellstraßen das Tosen des Sonntagabendverkehrs, zwischendurch der Knall einer Fehlzündung. Dann ein Quietschen, dem unmittelbar ein schweres Krachen folgt. Nach einer kleinen Stille ein vielfältiges Schreien, der Schmerzen, aus Angst, um Hilfe, des Entsetzens; schließlich ein allgemeines Brüllen und Gellen, begleitet aus dem Hintergrund von einem ahnungslosen Gehupe. Von seinem Fenster aus könnte der Greis die Geschehnisse gut überblicken. Doch er bleibt sitzen, anscheinend unberührt. Zufällig setzt dann, inmitten des Schluchzens und der Jammerlaute von der Unfallstelle, das jemand ganz anderem geltende Bimmeln der Anstaltssterbeglocke ein. Obwohl der Lärm draußen andauert, untermischt inzwischen vom Sirenengeheul, und obwohl der alte Mann in seiner Zelle lauschend den Kopf erhoben hat, hört er mit der Zeit immer inständiger von den Ereignissen weg. Was so allmählich hörbar wird und den Tumult übertönt: das Rufen von Flugvögeln und das Dahinströmen des kleinen Bewässerungsgerinnes, welches einmündet in das Rauschen der Parkbäume, einen brandenden Ozean, mit dem Vogelgezirpe als dem Möwenschrillen. Der Greis auf dem Klappbett fängt an, sich mit dem Oberkörper vor und zurück zu wiegen, und klopft dann den gleichen Rhythmus mit den Fingern auf seine Schenkel. Er legt den Kopf in den Nacken und öffnet den Mund, ohne daß daraus aber ein Laut dringt. Mit den sich blähenden Nüstern und den vorstehenden Augen gleicht er einem uralten Sänger, längst schon verstummt, dessen Gesang nur noch aus seinem Hören und Sehen kommt.
Der Bleistift liegt diagonal auf dem Buch, in dem kleinen Lichtkreis. Oben zeigt er, in Blockbuchstaben, den Aufdruck CUMBERLAND. Das von dem Stift gequerte Schriftbild hat etwas von auf vielen parallelen Gleisen wartenden Zügen, mit den Wörtern als den Waggons und den Zeichen als deren Lokomotiven. Es erfolgt nun aus der Ferne tatsächlich das zugehörige Trillern, wie das Signal zur Abfahrt, fortgesetzt in einem alle Räume durchdringenden Pfiff.
Das Pfeifen wiederholt sich, nah. Das Fenster, an welchem der Zug, beleuchtet, auf einer Brücke vorbeirollt, ist ein andres als jenes im Altersheim. Zwar steht es ebenfalls offen, doch es ist viereckig, breiter als hoch, und ohne ein Aufstützbrett. Die Wände des Zimmers sind bedeckt mit Photographien in jeder Größe, einige in Rahmen, nicht nur metallenen Leisten, sondern ziseliertem Mahagoni. Die Bilder zeigen allesamt dieselbe Person, als unförmigen Säugling, als stämmig aufgepflanztes Kleinkind, als jugendliche Königin eines Kostümfests, und schließlich, jeweils in einer neuen Spielart und einem besonderen Licht, als Schönheit. Fast immer ist sie auf den Photos allein und hat da ‒ der Säugling wie die junge Frau ‒ den immer gleichen Ausdruck des Forderns und des sich Mittelpunkt Wissens. Von den Bildern geht vom Anfang bis zum Ende ein unbesiegbares Selbstgefühl aus. Zwei Ausnahmen davon aber gibt es: Auf den paar Photos, wo sie den Kopf in die Halsbeuge eines Mannes gelegt hat, zeigt sie eine einfältige oder gekünstelte Miene; und auf dem einen Bild, wo sie als kleines Mädchen mit Zopf und weißen Strümpfen auf einer Flechtkiste vor dem Stockwerkbett eines bühnenartigen Kinderzimmers hockt, verkörpert die zusammengesunkene Gestalt mit den übereinandergestellten Füßen, den im Schoß verflochtenen Fingern und den für einmal nicht recht weiter wissenden Augen (deren einziges Gegenüber der fast gleich große, einen Kleiderbügel im Schnabel tragende hölzerne Pinguin mit Namen »Kleiderdiener« ist) etwas wie Ausgesetztheit und Verlassenheit.
Eine der Photowände rahmt einen Spiegel, in welchem von hinten, mit einem Knick im Scheitel, die Frau, wie sie jetzt ist, erscheint. Ihre Haare wirken naß. Sie sitzt in einem weißen Bademantel an einem Sekretär, tief über ein Schreibheft vom Ausmaß und der Dicke eines Kontobuchs gebeugt. Von vorn gesehen, in Natur, wirkt ihr Gesicht, im Gegensatz zu den Bildern, verschlossen und geradezu verhärtet. Gesenkten Blicks und verkniffenen Mundes fährt sie mit einem breiten Tuschestift über das Papier, ohne Augen zu haben für das letzte Gelb des Himmels vor dem Fenster, den Früchtekorb in der Küchennische, oder den Blumenstrauß am Kopfende des raumfüllenden Betts in dem wie illuminierten Nebenzimmer. Trotz der Blockbuchstaben bleibt ihre Schrift fast unleserlich; die wenigen sich einer Form nähernden Zeichen haben den Schwung chinesischer Kalligraphien. Dafür spricht sie mit ihrer Tätigkeit unentwegt halblaut mit und läßt sich, schwarzfleckig die Fingerkuppen und einen ungewöhnlich dicken Höcker am Mittelfinger, etwa folgend hören: »Er hat gesagt, ich forderte unentwegt Liebe, und sei selber dazu der unfähigste Mensch auf der Erde. Er hat gesagt, ich sei nie jemandes Frau gewesen, und würde nie jemandes Frau sein können. Er hat gesagt, ich sei die Getriebenheit in Person, und würde, mit wem immer, nichts als Unruhe stiften. Bei dem sanftmütigsten Wesen würde ich, über kurz oder lang, es schaffen, den Zerstörungsdrang, ob als Mordlust oder Sterbenssehnsucht, hervorzukehren und ihm diese Seiten dann als seine wahren einzureden. Er meint, das kindliche Geschöpf, als welches ich jedermann zu bezaubern wüßte, entpuppe sich, hätte ich mein Opfer nur in meine Kinderhöhle gelockt, als eine Ausgeburt, aus deren Fängen es kein Entkommen gäbe; ich sei eine Hexe Kirke, welche nicht nur einen jeden Gefährten des Odysseus, sondern auch diesen selbst in ein Schwein verwandle. Zusammen mit mir habe ihn geradezu ein Heimweh nach der Freiluft der Einsamkeit gepackt, vereint mit dem Entschluß, ja dem Gelübde, nie wieder in die Nähe einer Frau zu geraten. Durch mich sei es mit ihm inzwischen soweit gekommen, daß er, selbst wenn ihm die herrlichste Erscheinung schöne Augen mache, im stillen denke: Hau ab! Er fragt, warum es ihm in all der Zeit nicht gelungen sei, mich liebenzulernen, und warum er sich selber am Ende nun schrecklich unliebenswert erscheine, und warum er sich wie mich dafür hassen müsse? Er hat meinen Vater und meine Mutter verflucht. Er hat den Ort meiner Geburt verflucht. Er hat mit mir meine ganze Generation verflucht, die ziellos, frühverdorben, profan und ohne Sehnsucht sei. Er hat mir vorgeworfen, keinen Sinn für irgend etwas Drittes, eine Arbeit, eine Natur, eine Geschichte, zu haben; zwangsbezogen zu sein auf das Lieben, die Zweisamkeit, ohne zu begreifen, daß dieses Glück des Zweisamen nur auf dem Umweg über ein Drittes eintreffen könne. Er meint, in mir sei weder die Begeisterung, etwas zu schaffen, noch eine Wißbegier, mich selbst zu verstehen anhand der Geschichte meiner Vorfahren, noch ein Fernweh nach dem Unbekannten; ein Jahrzehnt lang hauste ich nun schon in meiner Wohnung und wisse noch immer nicht den Namen des Bergs am Horizont, ja nicht einmal des Flusses unter meinem Fenster, und woher und wohin die Züge oben auf seiner Brücke führen; die einzige mir geläufige Ortsbezeichnung hier in der Stadt sei die meiner Wohnstraße; die Himmelsrichtungen seien mir gleichgültig; mit dem Wort Süden verbände ich allein Sonne und Meer; spräche man mir von Norden oder Westen, verzöge ich gelangweilt das Gesicht. Meine Abwehr gegen jede Art Wissen sei panisch; als sträube sich dagegen mein Innerstes wie gegen das Hineingestoßenwerden in ein feindliches Element. Schlimmer noch erscheine ihm mein Unwille, allem, was nicht ich selber sei, ob Dingen oder Menschen, seine Zeit zu lassen; ich nähme von dem anderen, wie schön es auch sei, bloß Notiz, ohne es anzuschauen, wodurch mein Begriff von Schönheit oder Häßlichkeit strafwürdig äußerlich sei; daß es für mich nichts gäbe, das des Anschauens oder Hinhörens wert sei, fände er empörend. Daraus folge nämlich das Schlimmste: Mit mir sei keine Beständigkeit, und damit kein Alltag möglich. Dabei habe er doch erfahren, wie ein Teil von mir gut und groß sei: Nur zeige der sich immer nur an einer Grenze, und ich gäbe ihm weder Zeit noch Raum. So, hat er gemeint, solle ich endlich Abstand nehmen von meinem Paar-Traum ‒ und er hat mir dazu noch aus dem Parzival und dem König Lear zitiert: Wer die Form wahrt, schweigt von Liebe. ‒ Liebe, und sei still.«
Zugleich mit diesem Nachsprechen hat die Frau auch ihre, bis zuletzt unentzifferbare, Eintragung abgeschlossen, deutlich nur die oft doppelten und dreifachen Ausrufezeichen und Unterstreichungen; ihre Erwiderung. Sie erhebt sich, nicht ruckhaft, sondern schwungvoll. Dabei fallen ihr freilich Stift und Papier zu Boden. Sie hockt sich hin, betrachtet beides, läßt es so liegen. Der Raum, mit seinen übervielen Lichtern und seinen durcheinanderliegenden Fernseh-Programmen, zeigt die leicht beklommene Welt des Sonntagabends an. Die Frau steht nah vor dem großen Spiegel, mit weitoffenen Augen. Aus einer Nebenwohnung die Stimmen eines Zwistes. Durch den abwesenden Blick und die Geducktheit hat die Gestalt im Spiegel etwas von einem in das Hochhaus-Apartment verschlagenen Tier. Unversehens aber dreht sie den Kopf über die Schulter und lacht ins Leere, so unbeschwert, als lächle sie auf offener Straße jemanden an. Ebenso anmutig ist sie im anderen Zimmer verschwunden, und bekleidet und schmückt sich, mit behender Eleganz zwischen den Räumen hin und her wechselnd, welche durch ihr Paradieren den Anschein von Gemächern bekommen. Im Nu steht sie ausgehfertig an der Tür, wo ihr allerdings die Tasche aus der Hand fällt, so daß sie sich zu den umherliegenden Sachen bückt. Aufgerichtet läßt sie sich dann für einen langen Augenblick gleichsam ansehen, kein versprengtes Tier mehr, sondern ein Star, und spricht so erhobenen Hauptes zu seinen Zuschauern: »Geht mir mit eurem Alltag! Niemand kann euch Freude machen so wie ich. Ihr braucht mich, auch du!«