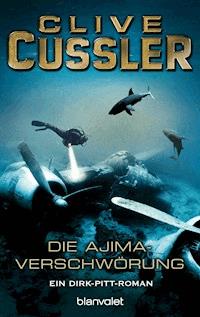
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Mit einer infamen Aktion will ein kaltblütiges japanisches Verschwörerkartell zur Weltmacht Nummer Eins aufsteigen. Von Ajima aus, einer kleinen Insel im Pazifik, wird die atomare Bedrohung gesteuert, die das Leben tausender von Menschen bedroht! Für Dirk Pitt, der im Auftrag der Meeresbehörde NUMA die Katastrophe abwenden soll, beginnt ein verzweifelter Wettlauf mit der Zeit – bis zum explosiven Finale scheinen ihm seine Gegner immer einen Schritt voraus zu sein ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Die Ajima-Verschwörung
Roman
Übersetzt von Dörte und Frieder Middelhauve
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Dragon« bei Simon & Schuster, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 1990 by Clive CusslerEnterprises, Inc..
All rights reserved throughout the world.
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1991 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15209-3
www.blanvalet.de
Den Frauen und Männern, die in denGeheimdiensten unserer Nation tätigsind und deren Hingabe und Loyalitätselten Anerkennung finden.Und deren Anstrengungen Amerikanernmehr Tragödien erspart haben, als mansich vorstellen kann, und die niemalsenthüllt werden können.
Dennings’ Demons
6. August 1945
Shemya Island, Alaska
Der Teufel hielt mit seiner Linken eine Bombe umklammert, mit der Rechten eine Mistgabel und grinste spitzbübisch. Er hätte vielleicht drohend gewirkt, wenn da nicht die hochgezogenen Brauen und die Schlitzaugen gewesen wären. Sie verliehen ihm eher das Aussehen eines verschlafenen Koboldes als die satanische Miene, die man vom Herrscher der Hölle erwartete. Doch er trug den gewohnten roten Umhang, die vorschriftsmäßigen knospenden Hörner und einen langen gezackten Schwanz. Die klauenförmigen Zehennägel krampften sich seltsamerweise um einen Goldbarren, auf dem ›24 Karat‹ geschrieben stand.
Die schwarzen Buchstaben oberhalb und unterhalb der Figur auf dem Rumpf des B-29 Bombers bildeten die Worte Dennings’ Demons.
Das Flugzeug, nach Kommandeur und Mannschaft benannt, hockte wie ein trauriges Gespenst in den Regenschauern, die vom Wind der Bering See südwärts über die Inseln der Aleuten getrieben wurden. Eine Batterie transportabler Scheinwerfer beleuchtete den Platz unter dem offenen Bauch des Flugzeugs und warf die zitternden Schatten der Bodenmannschaft auf den glitzernden Aluminiumrumpf. Kurze Blitze, die in regelmäßigen Abständen das Dunkel über dem Flugfeld durchbrachen, verstärkten die Unwirklichkeit der Szene.
Major Charles Dennings hatte sich gegen die Zwillingsreifen des Steuerbordfahrwerks gelehnt, die Hände tief in den Taschen seiner ledernen Fliegerjacke vergraben, und beobachtete das Treiben rund um sein Flugzeug. Das gesamte Gebiet wurde von bewaffneter Militärpolizei und K-9 Patrouillen überwacht. Eine kleine Kameramannschaft filmte das Ereignis. Leicht beklommen beobachtete er, wie die dicke Bombe vorsichtig in den umgebauten Bombenschacht der B-29 gehievt wurde. Sie war zu groß für die Bodenfreiheit des Bombers, deshalb musste sie von einer Grube aus an Bord genommen werden.
In den zwei Jahren, die er als einer der erfolgreichsten Bomberpiloten mit über vierzig Einsätzen in Europa verbracht hatte, hatte er niemals ein derartig hässliches Ding gesehen. Die Bombe kam ihm vor wie ein gigantischer, zu prall aufgeblasener Fußball, der an einem Ende mit völlig unsinnigen Flossen versehen war. Der runde Mantel der Bombe war hellgrau gestrichen, und die Klammern, die ihn in der Mitte zusammenhielten, erinnerten an einen riesigen Reißverschluss.
Dennings hatte vor dem Ding, das er fast dreitausend Meilen weit transportieren sollte, Angst. Am Nachmittag des vorangegangenen Tages hatten die Wissenschaftler vom Los Alamos-Projekt, die die Bombe auf dem Rollfeld zusammengebaut hatten, Dennings und seine Crew über die Waffe informiert. Den jungen Männern war ein Film der Trinity-Test-Detonation vorgeführt worden, und fassungslos hatten sie dagesessen und die fürchterliche Detonation dieser Waffe mit angesehen, die in der Lage war, eine ganze Stadt auszuradieren.
Er stand noch eine weitere halbe Stunde da, bis schließlich die Bombenklappen zuschwangen. Die Atombombe war scharf und gesichert, das Flugzeug aufgetankt und startklar.
Dennings liebte sein Flugzeug. In der Luft wurde er mit der großen, komplexen Maschine eins. Er war das Gehirn, sie der Körper. Am Boden war das etwas anderes. Wie sie so dastand, im Schein der Lampen, vom eisigen Regen gepeitscht, sah er in ihr, in diesem wunderschönen, geisterhaften silbernen Bomber, sein Grab.
Dennings schob den morbiden Gedanken beiseite und rannte durch den Regen auf eine Wellblechbaracke zu, in der die letzte Einsatzbesprechung mit seiner Mannschaft stattfinden sollte. Er trat ein und nahm neben Captain Irv Stanton, dem Bordschützen, einem gut gelaunten, rundgesichtigen Mann mit mächtigem Schnauzbart, Platz.
Stanton gegenüber lümmelte sich mit ausgestreckten Beinen Captain Mort Stromp, Dennings Copilot, ein ruhiger Südstaatler, der sich mit der Behändigkeit eines dreizehigen Faultiers bewegte. Unmittelbar dahinter saßen Lieutenant Joseph Arnold, der Navigator, und Navy Commander Hank Byrnes, der Waffenmeister, der während des Fluges für die Bombe verantwortlich sein würde.
Die Einsatzbesprechung fing damit an, dass ein Offizier des Geheimdienstes eine Tafel enthüllte, an die Luftaufnahmen der Zielgebiete gepinnt waren. Das erste und eigentliche Ziel war das Industriegebiet von Osaka; zweites Ziel, im Falle dichter Bewölkung, bildete die historisch bedeutende Stadt Kyoto. Man empfahl den direkten Anflug, und Stanton machte sich in aller Seelenruhe Notizen.
Ein Offizier des meteorologischen Dienstes zeigte Wetterkarten und prognostizierte leichten Gegenwind und aufgelockerte Bewölkung über den Zielgebieten. Er warnte Dennings auch vor Turbulenzen, die über Nordjapan zu erwarten seien. Um ganz sicherzugehen, waren eine Stunde zuvor zwei B-29-Bomber gestartet, um auf der Flugroute das Wetter und über den Zielen die Wolkendecke zu beobachten.
Dennings übernahm, als die dunkel getönten Schweißerbrillen ausgegeben wurden. »Ich will euch keine Märchen erzählen«, sagte er und sah das erleichterte Grinsen auf den Gesichtern seiner Männer. »Wir haben in einem Monat das Training eines Jahres absolviert, aber ich weiß, dass wir diesen Einsatz durchziehen können. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung seid ihr die verdammt beste Bombermannschaft der Air Force. Wenn wir unsere Sache gut machen, könnten wir dadurch den Krieg beenden.«
Dann nickte er dem Kaplan der Flugbasis zu, der ein Gebet für einen sicheren und erfolgreichen Flug sprach.
Während die Männer nacheinander hinaus- und auf die wartende B-29 zugingen, trat General Harold Morrison auf Dennings zu. Morrison war der Adjutant von General Leslie Groves, dem Leiter des Manhattan-Projekts .
Einen Moment lang betrachtete Morrison Dennings prüfend. In die Augenwinkel des Piloten hatte sich Müdigkeit eingegraben, doch die Augen selbst glühten erwartungsvoll. Der General streckte die Hand aus. »Viel Glück, Major.«
»Danke, Sir. Wir werden den Job erledigen.«
»Daran zweifle ich keine Sekunde«, erwiderte Morrison, merklich um einen zuversichtlichen Ton bemüht. Er wartete auf eine Erwiderung, doch der Pilot schwieg.
Nach einem Moment des Zögerns fragte Dennings: »Wieso gerade wir, General?«
Morrisons Lächeln war kaum zu bemerken. »Wollen Sie kneifen?«
»Nein, meine Mannschaft und ich werden die Sache durchziehen. Aber wieso wir?«, wiederholte er. »Entschuldigen Sie meine Frage, Sir, aber ich kann nicht glauben, dass wir die einzige Flugzeugbesatzung der Air Force sind, der man zutrauen kann, eine Atombombe quer über den Pazifik zu befördern, mitten in Japan abzuladen, um danach mit kaum mehr als ein paar Tropfen Benzin in den Tanks auf Okinawa zu landen.«
»Am besten ist, Sie wissen nur das, was man Ihnen gesagt hat.«
»Damit wir keine Geheimnisse verraten können, wenn wir gefasst und gefoltert werden?«, erkundigte sich Dennings unbewegt.
Der General sah ihn unwirsch an. »Ihre Mannschaft und Sie wissen Bescheid. Jeder hat eine Todeskapsel mit Zyanid erhalten.«
»Mund auf und runter damit, falls einer von uns den Absturz über feindlichem Territorium überleben sollte«, rezitierte Dennings kalt. »Warum nicht einfach die Bombe über dem Meer abwerfen? Dann hätten wir zumindest eine Chance, von der Navy aufgefischt zu werden.«
Morrison schüttelte ernst den Kopf. »Allein die Möglichkeit, dass die Waffe in feindliche Hände fallen könnte, ist ganz und gar undenkbar.«
»Verstehe«, murmelte Dennings. »Dann bestünde die einzige Alternative, falls wir über Japan von der Flak oder von Jägern getroffen werden, darin, den Vogel runterzubringen und die Bombe detonieren zu lassen, damit sie nicht verschwendet ist.«
Morrison sah ihn an. »Das hier ist kein Kamikazeangriff. Jede nur denkbare Maßnahme wurde getroffen, um Ihr Leben und das Ihrer Mannschaft zu schützen. Vertrauen Sie mir, mein Sohn. Der Abwurf von Mother’s Breath auf Osaka wird ein Kinderspiel sein.«
Dennings hätte ihm beinahe geglaubt; einen Augenblick lang hatte er sich von Morrison fast überzeugen lassen, doch dann entdeckte er die Sorge in den Augen und in der Stimme des Älteren.
»Mother’s Breath.« Dennings wiederholte die Worte langsam und tonlos wie einer, der unaussprechliches Grauen beschreibt. »Welches kranke Hirn hat sich nur einen dermaßen abartigen Codenamen für die Bombe einfallen lassen?«
Resigniert zuckte Morrison die Achseln. »Ich glaube, es war der Präsident.«
Siebenundzwanzig Minuten später starrte Dennings angestrengt an den hin- und herrasenden Scheibenwischern vorbei. Der Regen war stärker geworden, und er konnte durch den nassen Dunst hindurch nur knapp zweihundert Meter weit sehen. Beide Füße auf die Bremsen gestemmt, erhöhte er die Drehzahl auf 2200 Umdrehungen pro Minute. Flugingenieur Sergeant Robert Mosely meldete, dass Außenbordmotor Nummer vier fünfzig Umdrehungen zu wenig machte. Dennings beschloss, diese Meldung zu ignorieren. Zweifellos war die feuchte Luft für den leichten Abfall der Umdrehungszahl verantwortlich. Er zog die Gashebel zurück, die Motoren liefen im Leerlauf.
Mort Stromp, der rechts neben Dennings auf dem Platz des Copiloten saß, nahm die Starterlaubnis des Towers entgegen. Er senkte die Landeklappen. Die zwei Mann, die in den Rumpftürmen der Bordkanonen saßen, bestätigten, dass sich die Landeklappen gesenkt hatten.
Dennings schaltete die Bordsprechanlage ein. »Auf geht’s, Jungs.«
Er schob die Gashebel wieder vor, kompensierte das ungeheure Drehmoment, indem er die linken Motoren etwas mehr beschleunigte als die rechten, und löste dann die Bremsen.
Dennings’ Demons wog vollbeladen an die achtundsechzig Tonnen. Die Tanks waren mit 28000 Litern Flugbenzin bis zum Rand gefüllt, der vordere Bombenschacht enthielt eine sechs Tonnen schwere Bombe, und die Maschine hatte eine zwölfköpfige Mannschaft an Bord. Jetzt rollte sie langsam an. Sie hatte nahezu acht Tonnen Übergewicht.
Die vier 54,9 Liter Wright Cyclone Motoren bebten an ihren Aufhängungen, und insgesamt 8800 Pferdestärken trieben die fünf Meter langen Propeller an, die die windgepeitschte Feuchtigkeit durchschnitten. Die Auspuffe der Motoren spuckten blaue Flammen, und mit gischtverhüllten Flügeln donnerte der mächtige Bomber in die Dunkelheit hinein.
Die Maschine beschleunigte quälend langsam. Die lange Startbahn, herausgesprengt aus dem schwarzen Lavagestein, dehnte sich vor ihr aus und endete abrupt fünfundzwanzig Meter über dem eiskalten Meer. Ein am Horizont aufflammender Blitz tauchte die neben der Startbahn abgestellten Feuerwehren und Ambulanzen in ein unheimliches blaues Licht. Bei achtzig Knoten spürte Dennings, wie das Ruder reagierte, und gab für die Motoren auf der rechten Seite Vollgas. Grimmig umfasste er den Steuerknüppel, fest entschlossen, die Maschine hochzubringen.
Stanton, der Schütze, der vor den Piloten in der Nase des Bombers saß, beobachtete besorgt, wie die Startbahn schnell kürzer wurde. Selbst der lethargische Stromp reckte sich auf seinem Sitz und versuchte vergeblich im Dunkel vor ihnen auszumachen, wo die Startbahn endete und das Meer begann.
Drei Viertel der Startbahn lagen schon hinter ihnen, und noch immer klebte die Maschine am Boden. Die Zeit verschwamm. Sie alle hatten das Gefühl, ins Leere zu fliegen. Dann plötzlich durchdrangen die Scheinwerfer der Jeeps, die neben der Startbahn parkten, den Regenschleier.
»Allmächtiger!«, stieß Stromp hervor. »Zieh sie hoch!«
Dennings wartete noch weitere drei Sekunden und zog dann behutsam den Knüppel an die Brust. Die Räder der B-29 lösten sich vom Boden. Die Maschine hatte kaum dreißig Fuß an Höhe gewonnen, als die Startbahn unter ihr verschwand.
Morrison stand im kalten Regen vor der Radarhütte, sein vier Mann starker Stab wartete pflichtgemäß hinter ihm. Den Start von Dennings’ Demons verfolgte er eher im Geiste als mit den Augen. Er konnte kaum mehr als das langsame Vorankriechen des Bombers ausmachen, als Dennings Gas gab und die Bremsen löste, bevor die Maschine von der Dunkelheit verschluckt wurde.
Die Hände an den Ohren, lauschte er dem Dröhnen der Motoren, das sich in der Ferne verlor. Das ungleichmäßige Geräusch war kaum zu hören. Niemand außer einem Mechanikermeister oder einem Flugingenieur konnte es auffallen, und Morrison hatte in beiden Funktionen zu Beginn seiner Karriere im Army Air Corps Dienst getan.
Ein Motor lief etwas unruhig. Einer oder mehrere der achtzehn Zylinder hatten Zündaussetzer.
Besorgt lauschte Morrison auf ein Anzeichen, dass der Bomber nicht abheben würde. Wenn Dennings’ Demons beim Start zu Bruch ging, würde innerhalb von Sekunden jedes Lebewesen auf der Insel verbrannt sein.
Dann brüllte der Radarbeobachter durch die offene Tür: »Sie sind in der Luft.«
Morrison stieß einen Seufzer aus. Erst jetzt wandte er dem erbärmlichen Wetter den Rücken zu und ging hinein.
Nun blieb nichts weiter zu tun, als General Groves in Washington davon in Kenntnis zu setzen, dass Mother’s Breath auf dem Weg nach Japan war. Jetzt hieß es Abwarten und Hoffen.
Doch tief im Innern machte sich der General Sorgen. Er kannte Dennings. Der Mann war zu starrköpfig, um mit einem defekten Motor umzukehren. Dennings würde die Maschine nach Osaka bringen, und wenn er sie auf dem Buckel dorthin tragen müsste.
»Möge Gott ihnen beistehen«, murmelte Morrison leise. Er wusste mit beängstigender Sicherheit, dass diese ungeheure Operation ein Gebet dringend nötig hatte.
»Fahrwerk einziehen«, befahl Dennings.
»Bin ich froh, das zu hören«, grunzte Stromp und griff nach dem Hebel. Die Fahrwerksmotoren surrten, und die drei Rädergruppen hoben sich in ihre Gehäuse unter dem Bug und den Tragflächen. »Fahrwerk eingezogen und eingerastet.«
Die Geschwindigkeit nahm zu, und Dennings gab weniger Gas, um Treibstoff zu sparen. Er wartete, bis der Geschwindigkeitsmesser 200 Knoten anzeigte, bevor er in einen leichten Steigflug ging. Unterhalb der Steuerbordtragfläche, außer Sichtweite, wand sich die Inselkette der Aleuten leicht nach Nordosten.
»Was macht Motor Nummer vier?«, fragte er Mosely.
»Zieht, aber die Temperatur ist eine Spur zu hoch.«
»Sobald wir auf fünftausend Fuß sind, lasse ich ihn ein paar Umdrehungen langsamer laufen.«
»Könnte nicht schaden, Major«, erwiderte Mosely.
Arnold gab Dennings den Kurs, den sie die nächsten zehneinhalb Stunden beibehalten würden. In 4900 Fuß Höhe überließ Dennings Stromp das Ruder. Er entspannte sich und blickte in den schwarzen Himmel. Kein Stern zu sehen. Als Stromp die Gewitterwolken durchflog, konnte man im Flugzeug die Turbulenzen spüren.
Als sie schließlich den schlimmsten Teil des Unwetters hinter sich hatten, schnallte Dennings sich los und kletterte aus seinem Sitz. Er drehte sich um und sah durch ein Backbordfenster unter sich den engen Gang, der zur Mitte und zum Heck des Flugzeugs führte. Er konnte gerade noch einen Teil der Bombe ausmachen, die in ihrem Geschirr hing.
Man hatte den Gang um den Bombenschacht herum verengt, um Platz für das Ungetüm zu schaffen. Dennings schlängelte sich an ihm vorbei und ging am anderen Ende in die Hocke. Dann zog er die kleine, luftdichte Tür auf und schlüpfte hinein.
Er zog eine Taschenlampe aus der Oberschenkeltasche und ging langsam über den abgetrennten Gang mit den Gitterrosten, der an den beiden Bombenschächten entlangführte, die man zu einem einzigen umgebaut hatte. Die ungeheuerlichen Ausmaße der Bombe sorgten für drangvolle Enge. In der Länge unterschritt sie den Abstand zwischen den Schotts nur um drei Zentimeter.
Zögernd griff Dennings nach unten und berührte sie. Unter seinen Fingerspitzen fühlte sich der Stahlmantel eiskalt an. Es gelang ihm nicht, sich die hunderttausend Menschen vorzustellen, die innerhalb von Sekunden zu Asche verbrannten, noch die schrecklichen Brandwunden und Verletzungen, die die Strahlung herbeiführte. Er sah in ihr nur ein Mittel, den Krieg zu beenden und damit Hunderttausenden seiner Landsleute das Leben zu retten.
Auf dem Rückweg zum Cockpit blieb er kurz stehen und unterhielt sich mit Byrnes, der eben die Zeichnungen der Schaltkreise des Bombenauslösers überflog. Dann und wann warf der Bombenschütze einen kurzen Blick auf den Schaltkasten, der über seinem Schoß montiert war.
»Könnte das Ding losgehen, bevor wir dort sind?«, fragte Dennings.
»Durch einen Blitzschlag könnte das passieren«, antwortete Byrnes.
Dennings warf ihm einen entsetzten Blick zu. »Bisschen spät für die Warnung, oder? Seit Mitternacht fliegen wir mitten durch ein Unwetter.«
Byrnes blickte hoch und grinste. »Am Boden hätten wir ebenso gut in die Luft gehen können. Was, zum Teufel, soll’s? Wir haben’s doch geschafft, oder?«
Dennings begriff Byrnes sachliche Art nicht. »War General Morrison das Risiko klar?«
»Mehr als jedem anderen. Er war von Anfang an an dem Projekt beteiligt.«
Dennings schauderte es, und er wandte sich ab. Wahnsinn, dachte er, diese Operation war der blanke Wahnsinn. Es wäre ein Wunder, wenn einer von ihnen überlebte, um die Geschichte anderen erzählen zu können.
Nach fünf Stunden Flug und 8000 Litern verbrauchtem Treibstoff ging Dennings mit der B-29 auf zehntausend Fuß in Horizontalflug über. Die Stimmung innerhalb der Crew stieg, als die frühe Dämmerung den Himmel im Osten rötlich färbte. Der Sturm lag weit hinter ihnen, und jetzt konnten sie die rollende Dünung des Meeres und ein paar verstreute weiße Wolken erkennen.
Dennings’ Demons flog gemächlich mit 220 Knoten auf südwestlichem Kurs. Glücklicherweise hatten sie einen leichten Rückenwind erwischt. Als der Tag anbrach, befanden sie sich mutterseelenallein über der weiten Leere des Nordpazifiks. Ein einsames Flugzeug, das aus dem Nirgendwo kam und ins Nirgendwo flog, dachte Bombenschütze Stanton, während er durch die Glasfenster am Bug schaute.
Dreihundert Meilen vor der japanischen Hauptinsel Honshu ging Dennings in einen langsamen, stetigen Steigflug über, der sie auf 32000 Fuß bringen würde, die Höhe, aus der Stanton die Bombe auf Osaka abwerfen sollte. Arnold, der Navigator, stellte fest, dass sie fünfundzwanzig Minuten vor dem Zeitplan lagen. Wenn sie die gegenwärtige Geschwindigkeit beibehielten, so schätzte er, würden sie in etwas weniger als fünf Stunden auf Okinawa landen.
Dennings warf einen Blick auf die Tankanzeige und fühlte sich in Hochstimmung. Selbst mit einem hundert Knoten starken Gegenwind würden sie es mit einer Reserve von 1600 Litern schaffen.
Nicht alle waren so guter Laune. Mosely, der am Platz des Flugingenieurs saß, beobachtete besorgt die Temperaturanzeige von Motor vier. Was er sah, gefiel ihm gar nicht. Von Zeit zu Zeit klopfte er mit dem Finger auf die Anzeige.
Die Nadel zitterte und wanderte in den roten Bereich.
Er kroch nach hinten durch den Gang und sah sich durch ein Backbordfenster die Unterseite des Motors an. Auf der Verkleidung entdeckte er Ölstreifen, und aus dem Auspuff drang Rauch. Mosely kehrte ins Cockpit zurück und hockte sich in den schmalen Gang zwischen Dennings und Stromp.
»Schlechte Neuigkeiten, Major. Wir werden Nummer vier abschalten müssen.«
»Können Sie den Motor nicht noch ein paar Stunden hätscheln?«, fragte Dennings.
»Nein, Sir. Da kann sich jederzeit ein Kolben festfressen, und dann fängt er Feuer.«
Stromp warf Dennings einen ernsten Blick zu. »Ich bin dafür, wir schalten Nummer vier eine Weile ab und lassen den Motor abkühlen.«
Dennings wusste, dass Stromp recht hatte. Sie mussten ihre gegenwärtige Höhe von 12000 Fuß beibehalten und pfleglich mit den drei übrigen Motoren umgehen, um sie vor Überhitzung zu bewahren. Für den Steigflug und den Angriff konnten sie Nummer vier wieder starten.
Er wandte sich an Arnold, der über das Navigationsbord gebeugt den Kurs verfolgte, und fragte: »Wie lange noch bis Japan?«
Arnold registrierte das leichte Abfallen und stellte eine schnelle Berechnung an. »Eine Stunde und siebenundzwanzig Minuten bis zur Hauptinsel.«
Dennings nickte. »Okay, wir stellen Nummer vier ab, bis wir den Motor wieder brauchen.«
Noch während er das sagte, nahm Stromp Gas weg, schaltete die Zündung ab und trimmte den Propeller auf Segelstellung. Danach schaltete er den Autopiloten ein.
»Wir haben Landberührung«, stellte Arnold fest. »Eine kleine Insel, ungefähr zwanzig Meilen voraus.«
Stromp sah durchs Fernglas. »Sieht aus wie ein Hotdog, das im Meer schwimmt.«
»Reine Felsenküste«, bemerkte Arnold. »Keinerlei Anzeichen für einen Strand.«
»Wie heißt die Insel?«, fragte Dennings.
»Ist nicht mal auf der Karte eingezeichnet.«
»Irgendein Lebenszeichen? Die Japse könnten sie als Vorposten benutzen.«
»Sieht unbewohnt und verlassen aus.«
Im Augenblick fühlte sich Dennings sicher. Feindliche Schiffe waren nicht gesichtet worden, und von der Küste waren sie zu weit entfernt, um von Jägern abgefangen zu werden. Er machte es sich in seinem Sitz wieder gemütlich und starrte geistesabwesend aufs Meer.
Die Männer entspannten sich, reichten Kaffee und Salamisandwiches herum und bemerkten weder die donnernden Motoren noch den winzigen Fleck, der zehn Meilen entfernt 7000 Fuß über der Spitze ihrer Backbordtragfläche aufgetaucht war.
Die Besatzung von Dennings’ Demons hatte keine Ahnung, dass sie nur noch wenige Minuten zu leben hatte.
Lieutenant Sato Okinaga entdeckte unter sich das kurze Aufglitzern in der reflektierenden Sonne. Er beschrieb eine Kurve und ging in einen leichten Sinkflug über, um die Sache zu überprüfen. Ein Flugzeug, keine Frage. Wahrscheinlich eine weitere Patrouillenmaschine. Er griff nach dem Schalter seines Funkgeräts, doch dann zögerte er. In ein paar Sekunden würde er die andere Maschine genau identifizieren können.
Okinaga war jung und unerfahren, doch er hatte Glück gehabt. Aus einer Gruppe von zweiundzwanzig Piloten, die wegen Japans verzweifelter Lage schnell durch die Ausbildung geschleust worden waren, hatte man ihn und drei weitere ausgewählt, Küstenpatrouillen zu fliegen. Die Übrigen waren zu Kamikaze-Einheiten abkommandiert worden.
Okinaga war tief enttäuscht. Frohen Herzens hätte er für den Kaiser sein Leben gegeben, doch er akzeptierte den langweiligen Patrouillendienst als vorübergehenden Einsatz und hoffte, man würde ihn zu ruhmreicheren Aufgaben rufen, wenn die Amerikaner an den heimatlichen Küsten landeten.
Das einsam dahinfliegende Flugzeug wurde größer, und Okinaga traute seinen Augen nicht. Er rieb sie und blinzelte. Bald sah er ganz deutlich den dreißig Meter langen Rumpf aus poliertem Aluminium, die riesigen Tragflächen mit achtunddreißig Metern Spannweite und das drei Stockwerke hoch aufragende Querruder einer amerikanischen B-29.
Restlos verblüfft starrte er das Flugzeug an. Der Bomber kam aus nordöstlicher Richtung über das weite, unbefahrene Meer und flog 20000 Fuß unter der normalen Einsatzhöhe. Tausend Fragen, auf die es jetzt keine Antwort gab, schossen ihm durch den Kopf. Woher kam die Maschine? Weshalb flog sie mit einem abgeschalteten Motor auf Japan zu? Welchen Auftrag hatte die Besatzung?
Wie ein Hai, der auf einen blutenden Wal zuschoss, ging Okinaga bis auf weniger als eine Meile heran. Die Mannschaft schien zu schlafen oder hatte vor, Selbstmord zu begehen.
Okinaga hatte keine Zeit, weitere Vermutungen anzustellen. Der Bomber ragte mit seinen riesigen Tragflächen vor ihm auf. Er schob den Gashebel seiner Mitsubishi A6M Zero bis zum Anschlag vor und ging in einer flachen Kurve nach unten. Die Zero folgte dem Ruder wie eine Schwalbe; die 1300 Pferdestärken ihres Sakae-Motors brachten sie schnell hinter und ein paar Fuß unter die schlanke, glänzende B-29.
Zu spät entdeckte der Heckschütze das Jagdflugzeug, und zu spät eröffnete er das Feuer. Okinaga drückte auf den Auslöser an seinem Steuerknüppel. Die Zero erbebte, als ihre zwei Maschinengewehre und die beiden zwanzig-Millimeter-Kanonen Metall und menschliches Fleisch durchschlugen.
Eine leichte Ruderbewegung, und die Leuchtspuren fraßen sich durch die Tragfläche und den Motor Nummer drei der B-29. Die Abdeckung wurde zerfetzt und löste sich; Öl strömte aus den Einschlägen, Flammen schlugen heraus. Der Bomber schien einen Augenblick in der Luft zu verharren, dann kippte er auf die Seite und raste aufs Meer zu.
Erst bei dem unterdrückten Aufschrei des Heckschützen und dem kurzen Feuerstoß, den er abgab, merkten die Dämonen, dass sie angegriffen wurden. Die Männer hatten keine Ahnung, aus welcher Richtung der feindliche Jäger gekommen war. Sie hatten sich kaum von dem Schock erholt, als die Kugeln der Zero sich bereits durch die Steuerbordtragfläche fraßen.
Stromp stieß einen erstickten Schrei aus. »Uns hat’s erwischt!«, rief er.
Dennings brüllte in die Bordsprechanlage, während er darum kämpfte, den Bomber wieder in die Horizontale zu bringen. »Stanton, wirf die Bombe ab! Wirf die verdammte Bombe ab!«
Der Bombenschütze, der von der Zentrifugalkraft gegen sein Bombenzielgerät gedrückt wurde, schrie zurück: »Die fällt nicht, solange Sie’s nicht schaffen, uns in den Horizontalflug zu bringen!«
Motor Nummer drei brannte lichterloh. Der plötzliche Verlust von zwei Motoren, die beide auf derselben Seite lagen, hatte den Vogel derart aus dem Gleichgewicht gebracht, dass er jetzt auf einer Tragfläche zu stehen schien. Dennings und Stromp kämpften gemeinsam am Steuerknüppel, um das sterbende Flugzeug in die Horizontale zu bringen. Dennings nahm Gas weg und schaffte es, den Bomber wieder auszubalancieren, der jedoch gleichzeitig bedrohlich weit abrutschte.
Stanton zog sich hoch und öffnete die Bombenklappen. »Halten Sie sie ruhig«, schrie er verzweifelt. Er hielt sich nicht damit auf, das Bombenzielgerät zu beobachten. Er drückte auf den Auslöser.
Nichts passierte. Das gewaltige Drehmoment hatte die Atombombe in ihrem engen Gehäuse verkantet.
Kreidebleich im Gesicht schlug Stanton mit der Faust auf den Auslöser, doch die Bombe verharrte starrköpfig an ihrem Platz. »Sie klemmt!«, schrie er. »Sie fällt nicht!«
Dennings kämpfte weiter um ihrer aller Leben, obwohl er genau wusste, dass sie alle sich mit Zyanid das Leben nehmen mussten, falls sie überlebten, und versuchte den tödlich getroffenen Vogel aufs Meer hinunterzubringen.
Beinahe hätte er es geschafft. Es gelang ihm, bis auf zweihundert Fuß über dem ruhigen Meer hinunterzugehen, wo er die Demons oder ihren Bauch hätte aufsetzen können. Doch das Magnesium in den Hilfsaggregaten und im Kurbelgehäuse von Motor Nummer drei flammte auf wie eine Brandbombe, fraß sich durch die Aufhängungen und die Streben der Tragfläche. Der Motor löste sich aus seiner Verankerung und nahm die Steuerkabel des Flügels mit.
Lieutenant Okinaga zog eine enge Kurve und umkreiste mit seiner Zero die getroffene B-29. Er beobachtete den schwarzen Rauch und die orangenen Flammen, die wie ein Buschfeuer zum Himmel emporzüngelten. Er sah, wie das amerikanische Flugzeug in einer Säule schäumenden Wassers im Meer aufschlug.
Er flog weitere Kreise, hielt nach Überlebenden Ausschau, konnte jedoch nur ein paar treibende Trümmer entdecken. Voller Hochstimmung über seinen ersten Abschuss, der auch sein letzter sein sollte, umflog Okinaga die Rauchsäule noch einmal, bevor er wieder Kurs auf Japan und seinen Horst nahm.
Während Dennings’ zerschossenes Flugzeug mitsamt seiner toten Besatzung zweitausend Fuß unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresboden aufsetzte, machte sich eine B-29 in einer späteren Zeitzone, sechshundert Meilen südöstlich, für ihren Bombenangriff bereit. Die Enola Gay, mit Colonel Paul Tibbets am Steuer, war über der japanischen Stadt Hiroshima angekommen.
Die beiden Flugzeugkommandanten wussten nichts voneinander. Beide Männer waren der Meinung gewesen, ihr Flugzeug und ihre Mannschaft habe die erste Atombombe an Bord, die in diesem Krieg abgeworfen werden würde.
Dennings’ Demons hatte ihr Rendezvous mit dem Schicksal verpasst. Die Stille auf dem Meeresboden war so tief wie das Schweigen, das sich über dem Geschehen ausbreitete. Der heroische Versuch Dennings’ und seiner Mannschaft wurde in den Kellern der Bürokratie vergraben und fiel der Vergessenheit anheim.
ERSTER TEIL Big John
1
3. Oktober 1993
Westpazifik
Der schlimmste Teil des Taifuns war vorüber. Das wütende Toben des Meeres war abgeklungen, doch die Wellen stiegen noch immer am Bug hoch, überfluteten grün und bleigrau die Decks und hinterließen ein schaumiges Chaos. Die dichten schwarzen Wolken brachen auf, und der Wind flaute zu dreißig Knoten schnellen Böen ab. Im Südwesten brachen die ersten Sonnenstrahlen durch und zauberten blaue Kreise auf die anrollenden Wogen.
Captain Arne Korvold stand trotz des Windes und der Gischt auf der offenen Brücke des Passagier-Fracht-Liners der Norwegischen Rindal Linie und richtete sein Fernglas auf ein riesiges Schiff, das bewegungslos in der von Schaumkronen übersäten See lag. Es war groß, und so wie es aussah, handelte es sich um einen japanischen Autotransporter. Seine Aufbauten erstreckten sich vom elegant geschwungenen Bug bis zum scharf abgeschnittenen Heck, das wie eine rechteckige, flache Schachtel wirkte. Abgesehen von der Brücke und den Mannschaftsquartieren auf dem Oberdeck waren am Rumpf des Schiffes weder Bullaugen noch Fenster zu entdecken.
Das Schiff schien eine Zehn-Grad-Schlagseite zu haben, legte aber bis zu zwanzig Grad über, wenn die Wogen gegen seine ungeschützte Backbordseite anliefen. Das einzige Lebenszeichen war eine Rauchfahne, die aus seinem Schornstein stieg. Mit grimmiger Miene stellte Korvold fest, dass die Rettungsboote zu Wasser gelassen worden waren, auf der unruhigen See jedoch weit und breit nicht das Geringste von ihnen zu entdecken war. Er richtete das Glas wieder auf das Schiff und entzifferte den englisch geschriebenen Namen unter den japanischen Schriftzügen am Bug.
Es handelte sich um die Divine Star.
Korvold trat wieder in die Behaglichkeit des Brückenhauses zurück und steckte den Kopf durch die Tür des Funkraums. »Noch immer keine Antwort?«
Der Funker schüttelte den Kopf. »Nichts. Kein Pieps, seit wir das Schiff gesichtet haben. Die müssen das Funkgerät abgeschaltet haben. Kaum zu glauben, dass sie das Schiff verlassen haben, ohne einen einzigen Notruf abzugeben.«
Schweigend sah Korvold durch die Scheiben der Brücke zu dem japanischen Frachter hinüber, der weniger als einen Kilometer von seiner Steuerbordseite entfernt dahintrieb. Er war gebürtiger Norweger, ein kleiner, vornehmer Mann, der immer ruhig und gelassen wirkte. Seine eisblauen Augen blinzelten nur selten, und um seine Lippen unter dem gestutzten Bart schien stets ein leichtes Lächeln zu spielen. Seit sechsundzwanzig Jahren fuhr er zur See, den größten Teil davon auf Kreuzfahrtschiffen. Er hatte ein warmes, freundliches Wesen und wurde von seiner Mannschaft respektiert und von den Passagieren bewundert.
Jetzt zupfte er an seinem kurzen, ergrauenden Bart und fluchte leise vor sich hin. Der Tropensturm hatte unerwartet nach Norden, auf seinen Kurs, umgeschwungen und dafür gesorgt, dass er mit seiner Fahrt vom Hafen Pusan in Korea nach San Francisco beinahe zwei Tage hinter dem Zeitplan lag. Seit achtundvierzig Stunden hatte Korvold die Brücke nicht verlassen, und jetzt war er erschöpft. Gerade als er sich etwas hinlegen wollte, hatten sie die allen Anschein nach verlassene Divine Star gesichtet.
Jetzt sah er sich mit einem Rätsel und der zeitraubenden Suche nach den Rettungsbooten des japanischen Frachters konfrontiert. Gleichzeitig trug er die Verantwortung für 130 Passagiere, von denen die meisten seekrank in den Kojen lagen, und die sicherlich keinerlei Verlangen nach einer barmherzigen Rettungsaktion verspürten.
»Habe ich Ihre Erlaubnis, mit ein paar Mann rüberzufahren, Captain?«
Korvold blickte in das wie aus Stein gemeißelte nordische Gesicht Oscar Steens, seines Ersten Offiziers. Die Augen, die ihn ansahen, waren von einem tieferen Blau als die Korvolds. Der Erste Offizier war schlank und hielt sich kerzengerade; er war tief gebräunt, und das Haar war von der Sonne gebleicht.
Korvold antwortete nicht gleich, sondern ging zu einem Brückenfenster hinüber und sah hinunter auf das zwischen den beiden Schiffen liegende Meer. Die Wellen maßen vom Kamm bis zum Tal immer noch drei bis vier Meter. »Ich habe nicht die Absicht, Menschenleben zu riskieren, Mr. Steen. Besser wir warten, bis der Seegang etwas abgeflaut ist.«
»Ich habe schon bei schlimmerem Wetter Boote geführt.«
»Wir haben keine Eile. Das da drüben ist ein totes Schiff, so tot wie eine Leiche, die in der Leichenhalle aufgebahrt ist. Und wie es aussieht, ist die Ladung verrutscht, und das Schiff nimmt Wasser auf. Besser, wir lassen die Divine in Ruhe und suchen nach den Booten.«
»Dort drüben könnten Verletzte sein«, meinte Steen.
Korvold schüttelte den Kopf. »Kein Kapitän würde sein Schiff verlassen, wenn noch verletzte Besatzungsmitglieder an Bord sind.«
»Kein Kapitän, der seine fünf Sinne beisammen hat, vielleicht. Aber welcher Mann würde ein unversehrtes Schiff verlassen und die Boote mitten in einem Sturm mit Windstärken von fünfundsechzig Knoten aussetzen, ohne Mayday zu funken?«
»Ja, das ist seltsam, stimmt«, pflichtete ihm Korvold bei.
»Und dann ist da auch noch die Fracht zu berücksichtigen«, fuhr Steen fort. »Seinem Tiefgang nach zu urteilen, ist das Schiff voll beladen. Es sieht aus, als könne es mehr als siebentausend Autos transportieren.«
Korvold warf Steen einen prüfenden Blick zu. »Denken Sie an eine Bergung, Mr. Steen?«
»Ja, Sir. Sicher. Wenn das Schiff mit voller Ladung verlassen wurde und wir es in einen Hafen bringen können, dann könnten die Bergegeldansprüche dem halben Wert, möglicherweise noch mehr, entsprechen. Gesellschaft und Mannschaft könnten sich gut und gerne fünf- bis sechshundert Millionen Kronen verdienen.«
Korvold sann einen Moment darüber nach. In seinem Innern rangen Gier und eine starke Vorahnung drohenden Unheils miteinander. Die Gier obsiegte. »Versammeln Sie eine Prisenmannschaft und nehmen Sie den Zweiten Ingenieur mit dazu. Wenn der Schornstein raucht, müssten die Maschinen noch funktionieren.« Er schwieg. »Mir wäre es dennoch lieber, wenn Sie warten würden, bis das Meer sich beruhigt hat.«
»Keine Zeit«, verkündete Steen ungerührt. »Wenn das Schiff noch weitere zehn Grad Schlagseite bekommt, könnten wir zu spät kommen. Ich beeile mich lieber.«
Captain Korvold seufzte. Er handelte gegen seine Überzeugung, doch andererseits – wenn die Lage, in der sich die Divine Star befand, erst einmal bekannt war, würde jeder Schlepper im Umkreis von tausend Meilen mit voller Kraft voraus auf ihre Position zuhalten.
Schließlich zuckte er die Achseln. »Sobald Sie sich davon überzeugt haben, dass niemand von der Mannschaft der Divine Star mehr an Bord ist und Sie das Schiff in Fahrt bringen können, melden Sie sich, und wir beginnen mit der Suche nach den Booten.«
Steen war schon weg, kaum dass Korvold zu Ende gesprochen hatte. Innerhalb von zehn Minuten hatte er seine Männer zusammengetrommelt und wurde mit ihnen in das wirbelnde Wasser gehievt. Die Prisenmannschaft bestand aus ihm selbst, vier Matrosen, dem Zweiten Ingenieur Olaf Andersson und David Sakagawa, dem Funker und einzigen Besatzungsmitglied an Bord der Narvik, das Japanisch sprach. Die Matrosen sollten das Schiff erkunden, während Andersson den Maschinenraum überprüfte. Steen sollte den Autofrachter offiziell in Besitz nehmen, wenn man ihn verlassen vorfand.
Die an Bug und Heck spitz zulaufende Barkasse mit Steen am Ruder wühlte sich durch die schwere See, kämpfte sich über die Wellenkämme, die sie immer wieder zu verschlingen drohten, bevor sie auf der anderen Seite hinunterstürzte. Der große Volvoschiffsmotor grummelte ohne Aussetzer, während sie mit achtern einfallendem Wind und auflaufender See auf den Autofrachter zuhielten.
Als sie noch etwa hundert Meter von der Divine Star entfernt waren, entdeckten sie, dass sie nicht allein waren. Ein Haifischschwarm umkreiste das zur Seite geneigte Schiff, als verrate den Fischen eine Art siebter Sinn, dass die Divine sinken würde und möglicherweise ein paar leckere Happen dabei für sie abfielen.
Der Matrose am Ruder ließ das Boot unter das gedrungene Heck an Lee gleiten. Die Männer hatten das Gefühl, als würde die Divine Star sie jeden Augenblick unter sich begraben, wenn die Wellen sich an ihrem Rumpf brachen. Als das große Schiff sich senkte, schleuderte Steen eine dünne Nylonstrickleiter, an deren Ende ein Aluminiumhaken befestigt war, nach oben. Beim dritten Versuch verfing sich der Enterhaken am oberen Ende des Schanzkleids.
Steen kletterte als Erster die Strickleiter hoch über die Reling, gefolgt von Andersson und den anderen Männern. Sie sammelten sich neben den riesigen Ankerwinden und erstiegen eine Art Feuerleiter, vorbei am fensterlosen vorderen Schott. Nachdem sie fünf Decks hochgeklettert waren, gelangten sie auf die weiträumigste Brücke, die Steen in den fünfzehn Jahren, die er zur See ging, gesehen hatte. Verglichen mit dem kleinen, rationell eingerichteten Brückenhaus der Narvik wirkte dies hier wie ein Ballsaal, und das eindrucksvolle elektronische Instrumentarium füllte nur einen kleinen Teil in der Mitte des Raumes aus.
Hier befand sich kein Mensch, doch die Brücke war mit Karten, Sextanten und anderen Navigationsgeräten übersät, die aus den offenen Schränken gefallen waren. Zwei Mappen lagen offen auf einem Tisch, so als hätten ihre Eigentümer nur mal eben kurz die Brücke verlassen. Alles sah nach einer panischen Flucht aus.
Steen inspizierte die Hauptkonsole. »Vollautomatisch«, bemerkte er zu Andersson gewandt.
Der Zweite Ingenieur nickte. »Und nicht nur das. Die Kontrollinstrumente werden akustisch gesteuert. Da braucht man weder Hebel umzulegen noch dem Steuermann Kursbefehle zu geben.«
Steen drehte sich zu Sakagawa um. »Können Sie das Ding hier in Gang kriegen und ihm Befehle geben?«
Der in Norwegen geborene Asiate beugte sich über die Computerkonsole und studierte sie ein paar Sekunden lang. Dann drückte er nacheinander schnell auf ein paar Knöpfe. Die Lichter auf der Konsole blinkten auf, und das Gerät gab ein summendes Geräusch von sich. Mit dünnem Lächeln sah Sakagawa Steen an. »Mein Japanisch ist zwar eingerostet, aber ich glaube, ich kann damit kommunizieren.«
»Erfragen Sie den Status des Schiffes.«
Sakagawa murmelte etwas auf Japanisch in den kleinen Empfänger und wartete gespannt. Einen Augenblick später antwortete eine Männerstimme, langsam und sehr betont. Als sie verstummte, starrte Sakagawa Steen verblüfft an.
»Die Stimme sagt, die Ventile sind offen und der Wasserspiegel im Maschinenraum erreicht mittlerweile zwei Meter.«
»Befehlen Sie, die Ventile zu schließen!«, fuhr Steen ihn an.
Nach einem kurzen Wortwechsel schüttelte Sakagawa den Kopf. »Der Computer behauptet, die Ventile seien blockiert. Sie könnten elektronisch nicht geschlossen werden.«
»Damit wäre wohl klar, was ich zu tun habe«, meinte Andersson. »Ich gehe besser mal runter und sehe zu, ob ich sie schließen kann. Und befehlen Sie diesem verdammten Roboter, er soll die Pumpen anwerfen.« Während er sprach, gab er zweien der Matrosen einen Wink, ihm zu folgen, und sie eilten über einen Niedergang, so schnell sie konnten, in den Maschinenraum.
Einer der zurückgebliebenen Matrosen kam auf Steen zu, leichenblass und mit weit aufgerissenen Augen. »Sir … ich habe eine Leiche gefunden. Ich glaube, es ist der Funker.«
Steen eilte in die Funkkabine. Eine beinahe konturlose Leiche hing auf einem Stuhl sitzend über dem Funkgerät. Es mochte sich einmal um einen Menschen gehandelt haben, als er an Bord der Divine Star gekommen war – jetzt war er keiner mehr. Er hatte keine Haare, und wären da nicht die entblößten Zähne gewesen, hätte Steen unmöglich sagen können, ob er das Gesicht oder den Hinterkopf vor sich hatte. Dieses entsetzliche Monstrum sah aus, als sei die Haut in Blasen aufgelöst, das darunterliegende Fleisch verbrannt und teilweise zusammengeschmolzen.
Andererseits war nicht das leiseste Anzeichen von außergewöhnlicher Hitze oder Feuer zu entdecken. Die Kleider des Mannes waren sauber und gebügelt, als habe er sie gerade erst angezogen.
Der Mann schien von innen heraus verbrannt zu sein.
2
Der fürchterliche Gestank und der schockierende Anblick erschütterten Steen. Er brauchte eine volle Minute, um sich zu fangen. Dann schob er den Stuhl beiseite und lehnte sich über das Funkgerät.
Glücklicherweise war der digitale Frequenzanzeiger mit arabischen Ziffern beschriftet. Nach ein paar Minuten fand er die richtigen Hebel und funkte Captain Korvold auf der Narvik an.
Korvold meldete sich augenblicklich. »Bitte kommen, Mr. Steen«, erwiderte er. »Was haben Sie entdeckt?«
»Hier ist irgendetwas ganz Unheimliches passiert, Captain. Bis jetzt haben wir ein verlassenes Schiff mit einer Leiche, dem Funker, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist, vorgefunden.«
»Ist an Bord Feuer ausgebrochen?«
»Dafür gibt’s keinerlei Anzeichen. Das Computer-Kontrollsystem zeigt beim Feuerwarnsystem nur grüne Lämpchen.«
»Irgendein Hinweis, weshalb die Mannschaft in die Boote gegangen ist?«, fragte Korvold.
»Nichts, was ins Auge fiele. Scheinen in Panik von Bord gegangen zu sein, nachdem sie versucht haben, das Schiff absaufen zu lassen.«
Korvold presste die Lippen aufeinander, und seine Knöchel traten weiß hervor, als er den Funktelefonhörer fester fasste. »Wiederholen Sie das.«
»Die Ventile waren geöffnet und blockiert. Andersson ist gerade dabei, sie zu schließen.«
»Weshalb in aller Welt sollte die Mannschaft ein unversehrtes Schiff mit Tausenden neuer Autos an Bord selbst versenken?«, fragte Korvold.
»Die Lage muss vorsichtig erkundet werden. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Leiche des Funkers ist gespenstisch. Er sieht aus, als habe man ihn auf einem Grill geröstet.«
»Wollen Sie, dass der Schiffsarzt rüberkommt?«
»Hier gibt’s für den guten Doktor nichts zu tun, außer eine Obduktion durchzuführen.«
»Verstanden«, erwiderte Korvold. »Ich bleibe noch weitere dreißig Minuten auf Posten, bevor ich weiterfahre, um die vermissten Boote zu suchen.«
»Stehen Sie in Kontakt mit der Gesellschaft, Sir?«
»Bis jetzt noch nicht; ich wollte erst sichergehen, dass sich von der ursprünglichen Besatzung niemand an Bord befindet, der unseren Anspruch auf Prisengeld anfechten könnte. Forschen Sie weiter. Sobald Sie absolut sicher sind, dass das Schiff verlassen ist, werde ich an den Direktor unserer Gesellschaft eine Nachricht übermitteln und ihn von unserer Inbesitznahme der Divine Star in Kenntnis setzen.«
»Ingenieur Andersson ist wie gesagt schon dabei, die Ventile zu schließen und das Schiff trocken zu pumpen. Die Motoren funktionieren, und wir müssten bald Fahrt aufnehmen können.«
»Je eher, desto besser«, erklärte Korvold. »Sie treiben auf ein ozeanografisches Forschungsschiff der Briten zu, das eine stationäre Position innehat.«
»Wie weit noch?«
»Schätzungsweise zwölf Kilometer.«
»Das ist weit genug.«
Korvold fiel nichts mehr ein, also sagte er nur kurz: »Viel Glück, Oscar. Sichere Fahrt zum Hafen.« Und dann brach er das Gespräch ab.
Steen wandte sich vom Funkgerät ab und vermied es, die verstümmelte Leiche auf dem Stuhl anzusehen. Er merkte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Er erwartete fast, den geisterhaften Kapitän des Fliegenden Holländers auf der Brücke hin- und hergehen zu sehen. Es gab nichts so Morbides wie ein verlassenes Schiff, dachte er grimmig.
Er befahl Sakagawa, sich zu beeilen und das Logbuch des Schiffes zu übersetzen. Den beiden Matrosen, die oben geblieben waren, gab er den Befehl, die Autodecks zu überprüfen, während er selber systematisch die Mannschaftsquartiere durchsuchte. Er hatte das Gefühl, durch ein Geisterhaus zu laufen.
Bis auf ein paar herumliegende Klamotten sah alles so aus, als könnte die Mannschaft jede Minute zurückkommen. Anders als bei der Unordnung auf der Brücke schien hier alles belebt und aufgeräumt. In den Räumen des Kapitäns stand ein Tablett mit zwei Teetassen, die während des Sturms seltsamerweise nicht auf den Boden gefallen waren, auf dem Bett lag eine Uniform, und auf dem Teppichboden stand ein Paar auf Hochglanz gewienerte Schuhe. Das gerahmte Bild einer Frau und drei Jungen im Teenageralter war umgefallen und lag auf einem aufgeräumten und sauberen Schreibtisch.
Steen war nicht wohl dabei, in den persönlichen Dingen und Erinnerungen anderer Menschen herumzustöbern.
Sein Fuß stieß gegen etwas, das unter dem Schreibtisch lag. Er beugte sich hinunter und hob den Gegenstand auf. Es war eine Pistole vom Kaliber neun Millimeter. Eine österreichische Steyr GB-Automatic. Er schob die Waffe in seinen Gürtel.
Das Klingen eines an der Wand angebrachten Chronometers ließ ihn zusammenzucken, er fluchte und spürte, wie ihm die Haare zu Berge standen. Steen beendete seine Durchsuchung und ging eilig zur Brücke zurück.
Sakagawa saß im Kartenraum, die Füße auf ein kleines Schränkchen gelegt, und studierte das Logbuch des Schiffes.
»Sie haben’s gefunden«, stellte Steen fest.
»In einer der offenen Aktentaschen.« Er wandte sich wieder den aufgeschlagenen Seiten zu und fing an vorzulesen: »Divine Star, Länge siebenhundert Fuß, übergeben am sechzehnten März neunzehnhundertachtundachtzig. Im Dienst und im Eigentum der Sushimo Steamship Company, Limited. Heimathafen Kobe. Auf dieser Fahrt befördert sie siebentausendzweihundertachtundachtzig Autos der Marke Murmoto nach Los Angeles.«
»Irgendwelche Hinweise, wieso die Mannschaft das Schiff verlassen hat?«, fragte Steen.
Sakagawa schüttelte verwirrt den Kopf. »Hier ist weder von einem Unglück noch von einer Epidemie oder Meuterei die Rede. Der Taifun ist auch nicht erwähnt. Der letzte Eintrag ist ein bisschen seltsam.«
»Lesen Sie ihn vor.«
Sakagawa nahm sich einen Moment Zeit, um sicherzugehen, dass seine Übersetzung der japanischen Schriftzeichen weitgehend richtig war. »Was ich daraus entnehme ist: ›Wetter verschlechtert sich. Seegang wird stärker. Mannschaft leidet an unbekannter Krankheit. Alle krank, auch der Kapitän. Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Unser Passagier, Mr. Yamada, ein sehr bedeutender Direktor der Gesellschaft, verlangt in einem hysterischen Anfall, dass wir das Schiff verlassen und es versenken. Kapitän glaubt, Mr. Yamada hat einen Nervenzusammenbruch erlitten, und hat befohlen, ihn in seinem Quartier einzuschließen.‹«
Steen blickte mit ausdrucksloser Miene auf Sakagawa hinunter. »Ist das alles?«
»Der letzte Eintrag«, erklärte Sakagawa. »Danach folgt nichts mehr.«
»Welches Datum?«
»Erster Oktober.«
»Das war vor zwei Tagen.«
Sakagawa nickte abwesend. »Kurz danach müssen sie von Bord gegangen sein. Seltsam, dass sie das Logbuch nicht mitgenommen haben.«
Langsam, ohne Eile, ging Steen in die Funkkabine. Er versuchte, aus dem letzten Eintrag schlau zu werden. Plötzlich blieb er stehen und streckte die Hand im Eingang aus, um sich abzustützen. Der Raum schien vor seinen Augen zu verschwimmen; ihm war schwindlig, und er glaubte, sich übergeben zu müssen. Aber der Anfall ging ebenso schnell vorüber, wie er gekommen war.
Leicht schwankend ging er zum Funkgerät hinüber und funkte die Narvik an. »Hier ist der Erste Offizier Steen, bitte Captain Korvold. Over.«
»Ja, Oscar«, antwortete Korvold. »Machen Sie Ihre Meldung.«
»Verschwenden Sie keine Zeit mit Suchoperationen. Dem Logbuch der Divine Star zufolge verließ die Mannschaft das Schiff, bevor es von der vollen Stärke des Sturms getroffen wurde. Die Männer sind bereits vor fast zwei Tagen von Bord gegangen. Mittlerweile dürften die Winde sie zweihundert Kilometer weit abgetrieben haben.«
»Vorausgesetzt, sie haben überlebt.«
»Eher unwahrscheinlich.«
»In Ordnung, Oscar. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass eine Suche der Narvik zwecklos sein würde. Wir haben alles getan, was man von uns erwarten kann. Ich habe die amerikanischen Seenotrettungseinheiten auf Midway und Hawaii und sämtliche Schiffe im weiteren Umkreis alarmiert. Sobald Sie Fahrt aufnehmen, werden wir wieder Kurs auf San Francisco nehmen.«
»Verstanden«, erwiderte Steen. »Ich gehe jetzt in den Maschinenraum, um die Sache mit Andersson abzuklären.«
Steen hatte gerade aufgehört zu funken, als das Schiffstelefon klingelte. »Hier Brücke.«
»Mr. Steen«, meldete sich eine schwache Stimme.
»Ja, was ist?«
»Matrose Arne Midgaard, Sir. Können Sie sofort runter zu Ladedeck C kommen? Ich glaube, ich habe etwas gefunden –«
Midgaard hielt abrupt inne, und Steen hörte, wie sich jemand erbrach.
»Midgaard, sind Sie krank?«
»Bitte beeilen Sie sich, Sir.«
Dann verstummte die Leitung.
Steen schrie nach Sakagawa. »Welchen Knopf muss ich drücken, um Verbindung mit dem Maschinenraum zu bekommen?«
Keine Antwort. Steen betrat wieder den Kartenraum. Sakagawa saß totenbleich da und atmete schwer. Er sah auf und keuchte bei jedem Wort. »Der vierte Knopf … klingelt den Maschinenraum an.«
»Was fehlt Ihnen?«, fragte Steen besorgt.
»Weiß nicht. Ich … fühle … mich … entsetzlich … zweimal gekotzt.«
»Halten Sie durch«, knurrte Steen. »Ich hole die anderen. Wir machen, dass wir von diesem Todeskahn runterkommen.« Er schnappte sich das Telefon und rief im Maschinenraum an. Keine Antwort. Angst stieg in ihm auf. Die Angst vor etwas Unbekanntem, das gegen sie losschlug. Er spürte, wie der Gestank des Todes das ganze Schiff durchdrang.
Steen warf einen schnellen Blick auf das Diagramm der Decks, das an einem Schott befestigt war, und sprang dann, sechs Stufen auf einmal nehmend, den Niedergang hinunter. Er wollte auf die weitläufigen Stauräume, die die Autos bargen, zulaufen, doch die Übelkeit verkrampfte seinen Magen, und er schwankte durch die Gänge wie ein Betrunkener durch eine Hinterhofgasse.
Zuletzt stolperte er durch den Eingang des Ladedecks C. Vor und hinter ihm erstreckte sich hundert Meter weit ein Meer von Autos in allen Farben. Erstaunlicherweise standen sie trotz der Erschütterung durch den Sturm und der Schlagseite alle noch an ihrem Platz.
Steen brüllte laut nach Midgaard, und seine Stimme wurde von den stählernen Schotts zurückgeworfen. Doch Schweigen war die einzige Antwort. Dann entdeckte er es; es fiel auf wie ein Mann, der mitten in einer Menschenmenge ein Schild hochhält.
Bei einem der Wagen war die Motorhaube geöffnet.
Er stolperte zwischen den langen Reihen hindurch, knallte gegen Türen und Kotflügel und stieß mit den Knien gegen vorstehende Stoßstangen. Während er sich dem Wagen mit der offenen Motorhaube näherte, rief er wieder: »Ist hier jemand?«
Diesmal hörte er ein schwaches Stöhnen. Mit zehn Schritten hatte er den Wagen erreicht und blieb beim Anblick Midgaards, der neben einem Reifen lag, wie angewurzelt stehen.
Das Gesicht des jungen Seemanns war mit eiternden Schwären bedeckt. Aus seinem Mund rann eine Mischung aus Speichel und Blut. Seine Augen starrten ins Leere. Die Arme waren, als Folge innerer Blutungen, purpurrot. Er schien vor Steens Augen zu zerfallen.
Steen sackte voller Entsetzen gegen den Wagen. Hilflos und verzweifelt barg er seinen Kopf in den Händen und merkte, wie ihm büschelweise das Haar ausfiel, als er ihn sinken ließ.
»Warum, um Gottes willen, sterben wir?«, flüsterte er und sah seinen eigenen grässlichen Tod in Midgaard vor sich. »Was bringt uns um?«
3
Das Tiefseetauchboot Old Gert hing an einem großen Kran, der am Heck des britischen Meeresforschungsschiffs Invincible angebracht war. Das Meer hatte sich so weit beruhigt, dass die Old Gert zu Wasser gebracht werden konnte, um auf dem Meeresboden in 5200 Metern Tiefe wissenschaftliche Erkundungen durchzuführen. Die Mannschaft des Tauchboots befasste sich gerade mit den strengen Sicherheitsüberprüfungen.
An dem Tauchboot war nichts veraltet. Es handelte sich um die allerneueste Konstruktion. Die Old Gert war im vergangenen Jahr von einem britischen Raumfahrtunternehmen gebaut worden und nun bereit für ihren ersten Tauchversuch, der sie zur Mendocino-Bruchzone führen sollte, einer riesigen Spalte im Boden des Pazifiks, die sich von der Küste Nordkaliforniens die halbe Strecke bis Japan hinzog.
Ihr Äußeres unterschied sich grundsätzlich von der aerodynamischen Form anderer U-Boote. Statt des zigarrenförmigen Rumpfes mit der rundlichen Wölbung darunter, bestand das Tauchboot aus vier transparenten Kugeln, die aus einer Titan-Polymer-Mischung hergestellt waren, verbunden durch tunnelartige Röhren, die ihr das Aussehen eines Spielzeugroboters gaben. Eine Kugel enthielt eine komplexe Kameraausrüstung, eine andere barg die Luft- und Ballasttanks und die Batterien. Die dritte Kugel enthielt den Sauerstoffvorrat und die Elektromotoren. Die vierte Kugel, die größte, war über den übrigen dreien angeordnet und bot Platz für Mannschaft und Steuerung.
Die Old Gert war gebaut worden, um dem ungeheuren Druck in den tiefsten Tiefen der Weltmeere standzuhalten. Ihre Hilfssysteme waren darauf ausgelegt, einer Mannschaft achtundvierzig Stunden Überlebenszeit zu garantieren, und ihr Antrieb gestattete es ihr, mit einer Geschwindigkeit von bis zu acht Knoten die dunklen Abgründe zu durchfahren.
Craig Plunkett, Leitender Ingenieur und Kapitän der Old Gert, zeichnete die letzten Prüfberichte ab. Er mochte fünfundvierzig oder fünfzig sein und hatte ergrauendes Haar, das er nach vorne kämmte, um die Glatze zu verbergen. Sein Gesicht war rötlich, die Augen mittelbraun mit schweren Tränensäcken darunter, ähnlich denen eines Bluthundes. Er war am Entwurf der Old Gert beteiligt gewesen und betrachtete sie jetzt als seine Privatyacht.
Um sich gegen die zu erwartende Kälte am Meeresboden zu wappnen, zog er einen dicken Wollpullover über und schlüpfte in ein Paar weiche, pelzgefütterte Mokassins. Dann stieg er durch den Eingangstunnel und schloss die Luke hinter sich. Er ließ sich in die Steuerkugel fallen und schaltete die elektronisch gesteuerten Systeme an.
Dr. Raul Salazar, Meeresbiologe an der Universität von Mexiko, hatte bereits Platz genommen und justierte das Bodensonar.
»Wenn Sie fertig sind, kann’s losgehen«, erklärte er. Er war ein kleines Energiebündel, mit einem dichten schwarzen Schopf, schnellen Bewegungen und schwarzen Augen, die ständig hin- und herhuschten und nie länger als zwei Sekunden auf einem Menschen oder einem Gegenstand verweilten. Plunkett mochte ihn. Salazar war ein Mann, der seine Daten ohne viel Aufhebens zusammentrug und das Sammeln von Tiefsee-Bodenproben eher als normales Geschäft und nicht so sehr als akademische Übung betrachtete.
Plunkett warf einen schnellen Blick zum leeren Sitz auf der rechten Seite der Kugel hinüber. »Ich dachte, Stacy sei an Bord.«
»Das ist sie auch«, erwiderte Salazar, ohne den Blick von seinen Instrumenten abzuwenden. »Sie ist in der Kamerakugel und überprüft noch ein letztes Mal ihre Videosysteme.«
Plunkett beugte sich über den Tunnel, der zur Kamerakugel führte, und sah zwei Füße, die in dicken Socken steckten. »Wir sind bereit zum Tauchen«, sagte er.
Eine hohl klingende Frauenstimme antwortete. »Bin in einer Sekunde fertig.«
Plunkett schob seine Füße unter die Bedienungskonsole und machte es sich gerade in seinem Liegesitz bequem, als Stacy Fox sich in die Kontrollkugel zurückschlängelte. Ihr Gesicht war durch die Arbeit, die sie mit dem Kopf nach unten erledigt hatte, rot angelaufen.
Stacy war zwar keine atemberaubende Schönheit, aber attraktiv. Das lange, glatte blonde Haar rahmte ihr Gesicht ein, und oft schleuderte sie es mit einer kurzen Kopfbewegung nach hinten. Sie war schlank und hatte für eine Frau breite Schultern. Was ihren Busen anging, so war die Mannschaft auf Spekulationen angewiesen. Natürlich hatte niemand je ihre Brüste zu Gesicht bekommen, und immer trug sie locker sitzende Pullover. Doch gelegentlich, wenn sie gähnte und sich rekelte, ahnte man die festen Formen.
Sie wirkte jünger als vierunddreißig. Ihre Augenbrauen waren dicht, die Augen, mit blassgrün schimmernder Iris, lagen weit auseinander. Ihre Lippen über dem entschlossen wirkenden Kinn verzogen sich nahezu jederzeit bereitwillig zu einem strahlenden Lächeln, das ihre ebenmäßigen Zähne entblößte.
Stacy hatte zu den braun gebrannten Strandmädchen Kaliforniens gehört, bevor sie am Choninard Institute in Los Angeles ihr Examen als Fotografin abgelegt hatte. Nach dem Abschluss hatte sie sich in der Welt herumgetrieben und Meeresfauna aufgenommen, die noch nie zuvor fotografiert worden war. Sie war zweimal verheiratet gewesen und wieder geschieden, hatte eine Tochter, die bei ihrer Schwester lebte. Offiziell war sie an Bord der Old Gert, um Unterwasseraufnahmen zu machen, aber das war in Wirklichkeit die Tarnung für eine weit anspruchsvollere Aufgabe.
Sobald sie ihren Platz auf der rechten Seite der Kugel eingenommen hatte, signalisierte Plunkett ›Okay‹. Der Kranführer bugsierte das Tauchboot behutsam über eine schräge Rampe, die durch das ausgeschnittene Heck des Schiffes verlief, nach unten und senkte es ins Meer.
Der Sturm war abgeflaut, doch noch immer erreichten die Wellen eine Höhe von ein bis zwei Metern. Der Kranführer passte den Zeitpunkt des Absetzens so ab, dass Old Gert gerade noch den Kamm einer Welle berührte, und ließ das Boot ins darauffolgende Wellental gleiten. Dort lag es ruhig und hob und senkte sich mit dem Seegang. Das Kabel des Krans wurde elektronisch gelöst, und ein paar Taucher überprüften noch ein letztes Mal die Außenhaut des Bootes.
Fünf Minuten später erklärte Jimmy Knox, ein fröhlicher Schotte, der die Operation über Wasser leitete, dass das Boot klar zum Tauchen sei. Die Ballasttanks wurden geflutet, und Old Gert sank schnell unter die glitzernde Meeresoberfläche und machte sich auf den Weg zum Boden des Ozeans.
Obwohl es sich bei Old Gert um den allerneuesten Entwurf eines Tauchboots handelte, tauchte sie nach dem altbewährten System, bei dem die Ballasttanks mit Meerwasser geflutet werden. Um wieder zur Meeresoberfläche aufzusteigen, mussten verschiedene große Eisengewichte abgeworfen werden, um den Auftrieb zu verstärken, denn die Pumptechnologie der Gegenwart war nicht in der Lage, den Gegendruck großer Tiefen zu bewältigen.
Stacy erlebte das langsame Absinken in der endlosen Weite des Meeres wie im Trancezustand. Die Spektralfarben des von der Oberfläche gebrochenen Lichts verblassten nach und nach und wurden zu undurchsichtigem Schwarz.
Wenn man von den Bedienungskonsolen absah, die jeder von ihnen vor sich hatte, hatte die Besatzung nach vorn einen ungehinderten Rundumblick. Das durchsichtige Polymer mit den dünnen Titanverstärkungen bot eine Auflösung, die ungefähr der eines großflächigen Fernsehschirms entsprach.
Salazar nahm weder die Schwärze noch die gelegentlichen Leuchtfische richtig wahr, die draußen vorbeischwammen. Er machte sich vielmehr Gedanken darüber, was sie auf dem Boden finden würden. Plunkett beobachtete aufmerksam den Tiefenmesser und die Instrumente der Versorgungseinheit und achtete sorgfältig auf Störungen, während der Druck anstieg und die Temperatur mit jedem Augenblick weiter absank.
Die Invincible hatte kein Ersatztauchboot für den Notfall an Bord. Falls sich ein unerwarteter Unglücksfall ereignete, sie sich in Felsen verfingen oder die Technik versagte, sodass Old Gert nicht mehr zur Meeresoberfläche zurückzukehren vermochte, konnten sie die Kontrollkugel abtrennen und damit, wie in einer großen Blase, wieder nach oben steigen. Doch dabei handelte es sich um ein komplexes System, das noch nie zuvor unter Hochdruckbedingungen getestet worden war. Wenn diese Möglichkeit versagte, gab es keinerlei Hoffnung auf Rettung, sondern nur die Gewissheit, durch Sauerstoffmangel umzukommen und in der ewigen Nacht der Tiefe ein unbekanntes Grab zu finden.
Ein kleiner aalähnlicher Fisch schlängelte sich vorbei, und sein Leuchtkörper sonderte Lichtblitze ab wie eine Autoschlange, die durch mehrere Kurven fuhr. Seine Zähne waren im Verhältnis zum Kopf unverhältnismäßig lang, und er hatte Reißzähne wie ein chinesischer Drachen. Vom Licht im Innern des Bootes angezogen, schwamm er furchtlos auf die Kontrollkugel zu und warf aus geisterhaften Augen einen Blick ins Innere.
Stacy richtete ihre Batterie von Fotoapparaten und Videokameras auf das Tier und erwischte ihn mit sieben Objektiven, bevor er verschwunden war. »Stellt euch mal vor, das Ding wäre sechs Meter lang«, murmelte sie voller Abscheu.
»Glücklicherweise leben die Blackdragons in der Tiefe«, erklärte Plunkett. »Der Druck der Tiefsee verhindert, dass sie größer als ein paar Zentimeter werden.«
Stacy schaltete die Außenscheinwerfer an, und die Schwärze verwandelte sich ganz plötzlich in einen grünen Schleier. Nichts. Kein Lebewesen zu entdecken. Der Blackdragon war verschwunden. Sie schaltete die Scheinwerfer wieder aus, um die Batterien zu schonen.
In der Kugel stieg die Luftfeuchtigkeit an, und die zunehmende Kälte fing an, die dicken Wände zu durchdringen. Stacy sah, wie sich Gänsehaut auf ihren Armen bildete. Sie blickte auf und umfasste fröstelnd ihre Schultern. Plunkett bemerkte das und schaltete eine kleine Heizung ein, die kaum etwas gegen die Kälte ausrichten konnte.
Die zwei Stunden, die es dauerte, bis sie den Boden erreichten, wären noch langsamer vergangen, wenn nicht jeder seine Aufgaben zu erledigen gehabt hätte. Plunkett machte es sich bequem, beobachtete den Sonarmonitor und das Echolot und hielt ein wachsames Auge auf die Elektro- und Sauerstoffanzeigen. Salazar war damit beschäftigt, ein Muster für die Untersuchungen zu entwerfen, die durchzuführen waren, wenn sie den Boden erreicht hatten. Stacy bemühte sich, mit ihren Kameras die Bewohner der Tiefe zu erwischen, wenn sie gerade nicht auf der Hut waren.
Plunkett bevorzugte als Hintergrundmusik die Klänge von Johann Strauß, doch Stacy bestand darauf, ihre »New Age-Musik« in den Kassettenrekorder einzulegen. Sie behauptete, diese Musik sei entspannender und weniger aufregend. Salazar bezeichnete sie als »Gedudel«, doch er kam ihrer Bitte nach.
Jimmy Knox’ Stimme klang geisterhaft, als sie durch das Unterwasser-Akustiktelefon der Invincible drang.
»Bodenberührung in zehn Minuten«, teilte er mit. »Ihr sinkt ein bisschen schnell.«
»In Ordnung«, erwiderte Plunkett. »Ich habe den Boden auf dem Sonar.«
Salazar und Stacy hielten in ihrer Arbeit inne und blickten auf den Sonarmonitor. Die Digitalvergrößerung zeigte den Meeresboden dreidimensional. Plunketts Blick schoss zwischen Bildschirm und Wasser hin und her. Er vertraute dem Sonar und dem Computer zwar, doch nicht mehr als seinen eigenen Augen.
»Achtung«, warnte Knox sie. »Ihr geht an der Wand einer Schlucht nach unten.«
»Hab’ ich gemerkt«, erwiderte Plunkett. »Die Klippen münden in einem weiten Tal.« Er griff nach einem Hebel und warf eines der Ballastgewichte ab, um den Abstieg zu verlangsamen. Dreißig Meter über dem Boden warf er ein weiteres ab, sodass das Tauchboot beinahe perfekt neutralen Auftrieb bekam. Dann schaltete er die drei Scheinwerfer ein, die an die Außenenden der drei unteren Kugeln montiert waren.
Langsam wurde der Boden als zerklüftete, unebene Schräge im Jadeschimmer des Wassers sichtbar. So weit man sehen konnte, erblickte man groteske Formen eines seltsamen schwarzen Gesteins.
»Wir sind neben einem Lavafluss runtergekommen«, stellte Plunkett fest. »Der Rand des Vorsprungs liegt ungefähr einen Kilometer vor uns. Danach folgt noch ein dreihundert Meter tiefer Abhang bis zum Talboden.«
»Notiert«, erwiderte Knox.
»Was sind das bloß für wurmartige Gesteinsformen?«, fragte Stacy.
»Kissenlava«, antwortete Salazar. »So was entsteht, wenn die heiße Lava auf das kalte Meer trifft. Die Außenhaut kühlt sich ab und formt eine Röhre, durch die weiterhin Lava dringt.«
Plunkett schaltete das Höhen-Positionssystem ein, das das Tauchboot automatisch in einer Höhe von vier Metern über der Schräge hielt. Während sie über das zerklüftete Plateau glitten, entdeckten sie auf gelegentlichen Sandflächen Spuren von Tiefseekriechtieren. Möglicherweise stammten sie von Seesternen, Garnelen oder auf dem Meeresgrund lebenden Seegurken, die in der Dunkelheit jenseits der Scheinwerfer herumkrabbelten.
»Achtung«, sagte Plunkert, »gleich geht’s abwärts.«
Ein paar Sekunden nach der Warnung versank der Boden wieder im Dunkel; das Tauchboot kippte nach vorn und fiel in die Tiefe, immer in vier Metern Entfernung von den steilen Wänden der Schlucht.
»Ihr befindet euch in einer Tiefe von fünf-drei-sechs-null Metern«, drang Knox’ Stimme wieder durch das Unterwassertelefon.
»Jawohl. Ich lese dasselbe ab«, erwiderte Plunkett.
»Wenn ihr den Talboden erreicht«, sagte Knox, »seid ihr genau in der Mitte der Frakturzone.«
»So sieht’s aus«, murmelte Plunkett und konzentrierte sich auf Steuerpult, Computerbildschirm und einen Videomonitor, der jetzt das Gebiet unter den Landekufen von Old Gert zeigte. »Woanders können wir gar nicht hin.«
Zwölf Minuten vergingen, und dann schimmerte ebener Boden vor ihnen, und das Boot richtete sich wieder auf. Unterwasserpartikel, die durch eine leichte Strömung aufgewirbelt wurden, trieben wie Schneeflocken an der Kugel vorbei. Sandstreifen erstreckten sich im Lichtkegel vor ihnen. Doch es handelte sich nicht um reinen Sand. Tausende schwarzer Partikel, rund wie alte Kanonenkugeln, bedeckten in einer dicken Schicht den Meeresboden.
»Manganknollen«, erklärte Salazar, als halte er eine Vorlesung. »Niemand weiß genau, wie sie sich geformt haben, obwohl man vermutet, dass Haizähne oder Ohrknochen von Walen den Kern gebildet haben könnten.«
»Sind die was wert?«, fragte Stacy und schaltete ihre Kamerasysteme ein.
»Außer dem Mangan enthalten sie kleine Mengen Kobalt, Kupfer, Nickel und Zink. Ich vermute, dass diese Konzentration hier sich über Hunderte von Meilen quer durch die Frakturzone erstreckt und pro Quadratkilometer ungefähr acht Millionen Dollar wert sein dürfte.«
»Vorausgesetzt, man kann die Rohstoffe gewinnen und zur fünfeinhalb Kilometer entfernten Meeresoberfläche transportieren«, fügte Plunkett hinzu.
Salazar gab Plunkett den Kurs, den sie bei ihrem Forschungsvorhaben verfolgen wollten, und Old Gert glitt leise über den knollenbedeckten Sand. Dann schimmerte backbord etwas auf. Plunkett ging leicht in die Kurve und hielt auf das Objekt zu.
»Was habt ihr entdeckt?«, fragte Salazar und blickte von seinen Instrumenten auf.
Stacy sah nach unten. »Einen Ball!«, rief sie. »Einen riesigen Metallball mit seltsam aussehenden Klampen. Ich schätze ihn auf einen Durchmesser von drei Metern.«
Plunkett winkte ab. »Muss von einem Schiff gefallen sein.« Aus der mangelnden Korrosion ließ sich schließen, dass das noch nicht übermäßig lange her sein konnte.
Plötzlich sichteten sie einen breiten Sandstreifen, der vollkommen frei von Manganknollen war. Er sah aus, als sei ein gigantischer Staubsauger mitten durch das Manganfeld gefahren.





























