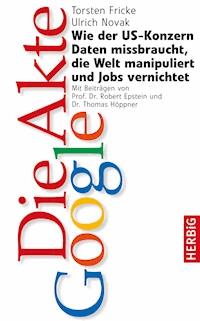
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wir sind nicht mehr die Kunden, wir sind das Produkt von Google. Don't be evil, sagt Google freundlich und ändert dabei Stück für Stück die Welt, in der wir leben. In einer einzigen Sekunde beantwortet Google über 4500 Suchanfragen – vermeintlich kostenlos. Doch in Wirklichkeit zahlen wir alle einen hohen Preis, in dem wir Google unsere Daten geben. Unsere Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und Google hat ein Quasi-Monopol auf eine gigantische Geld-Quelle, die Tag für Tag ertragreicher wird. Mit dieser Kraft wird der Konzern seine dominante Stellung immer weiter ausbauen: Firmen kaufen, ganzen Branchen seine Regeln oktroyieren, Jobs überflüssig machen, ja sogar Wahlen und unser Denken beeinflussen – Googles Macht ist grenzenlos. Aber wir können uns schützen: die Autoren zeigen wie – einfach und nachvollziehbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die Beiträge von Robert Epstein, Wie Google Wahlen beeinflussen kann, und Thomas Höppner, Copy, Paste und Kasse, verwenden wir mit freundlicher Genehmigung der Autoren.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: 2015 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7766-8216-8
1.Google: Daten sind das neue Öl
»Wir sind überzeugt, dass Portale wie Google … weitaus mächtiger sind, als die meisten Menschen ahnen. Und dies verleiht auch ihren Machern, Eigentümern und Nutzern neue Macht.«
ERIC SCHMIDT, GOOGLE
Heute schon geAppelt, geShellt oder geWalmartet? Wohl kaum. Aber wahrscheinlich schon gegoogelt. Apple, Shell und Walmart gehören zwar zu den teuersten Unternehmen der Welt, aber ihnen fehlt etwas, was nur Google hat: ein weltweites Monopol auf eine Geldquelle, die von Jahr zu Jahr stärker sprudelt und damit automatisch die Macht des Unternehmens immer weiter festigt.
Google, das ist längst wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Überall auf der Welt googeln zu jeder Tages- und Nachtzeit gleichzeitig Millionen von Menschen, sie telefonieren mit einem Handy, in dessen Inneren das Google-Betriebssystem Android läuft, oder schauen sich Videos auf YouTube an, das ebenfalls zu Google gehört.
An Google kommt heute niemand mehr vorbei. Nicht die Wirtschaft, nicht die Medien, nicht die Wissenschaft, nicht die Politik und auch nicht der normale Bürger.
Google, das ist längst nicht mehr nur eine Suchmaschine. Google, das ist heute ein Konglomerat aus Hunderten Firmen, die sich gegenseitig unterstützen und vor Mitbewerbern schützen. Ein Mega-Reich, aufgebaut von uns allen, die wir freiwillig Google unsere Daten überlassen und überlassen haben.
Google verfügt zum Teil über unsere intimsten Daten und über die Fähigkeit, daraus ein gigantisches Geschäft zu machen.
Google kann aber noch mehr: Mitbewerber aus dem Wettbewerb drängen, ganzen Branchen seine eigenen Regeln oktroyieren oder die politische Willensbildung bis hin zu Wahlen beeinflussen.
Don’t be evil – sei nicht böse, so lautete einst das Motto von Google. Doch diese Romantik aus den Gründerzeiten ist längst Geschichte. Heute ist Google mit einer Umsatzrendite von über 20 Prozent eines der profitabelsten Großunternehmen der Welt.
Im aktuellen Ranking der wertvollsten Marken[1] ist Google mittlerweile hinter Apple auf den zweiten Platz aufgestiegen, wohl nur ein weiterer Zwischenschritt auf dem Weg zu Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen Coca Cola, Microsoft und IBM. Vier Tech-Firmen unter den ersten fünf. Die Old Economy musste Platz machen. Selbst der Öl-Gigant Exxon Mobil landet nur noch auf dem 41. Platz, denn Daten sind das neue Öl – eine Einschätzung, die der Internetpionier und Cyberguru Jaron Lanier bestätigt: »Der Grund, warum persönliche Daten immer wertvoller werden, ist der, dass sie den Rohstoff für die automatisierten und hypereffizienten Systeme liefern und es immer mehr von diesen Systemen gibt.«[2]
Die Auswertung des Rohstoffs »Persönliche Daten« führt über den Einsatz dieser automatisierten Systeme zu einem wirtschaftlichen Strukturwandel, den viele Branchen fürchten. Die deutschen Taxi-Innungen, die sich gegen die Dienste der Google-Tochter Uber wehren, oder der Buchhandel, der unter der Vorherrschaft von Amazon und Google leidet und existenzielle Gefährdung verspürt. Auch die Verlage und Printmedien sehen durch die Digitalisierung von Informationen und das Wachsen des eBook-Marktes dunkle Wolken am Horizont aufziehen.
Google hat unser Leben verändert und tut dies weiter – nicht immer automatisch zum Schlechteren. Der Nutzen überwiegt für den Konsumenten den Schaden, argumentiert beispielsweise Deutschlands führender Wettbewerbsökonom Justus Haucap und bricht eine Lanze für die Internetriesen: Sie machten das Leben leichter und billiger[3], und: »Google ist super.«[4]
Wirklich?
»Wichtig für das Verständnis der digitalen Welt ist, die finanziellen Mechanismen zu durchschauen, um die daraus resultierenden Motivationen der Menschen und Institutionen erkennen zu können. … Die Bewertungsmechanismen für Internetfirmen belohnen Innovation vor allem in einem Gebiet: den Nutzern immer mehr Informationen zu entlocken, sie auf den Plattformen zu halten und alle ihre Freunde einzuladen. Entsprechend agieren auch die Betreiber und ihre Eigentümer: Ob Google oder Facebook, gepriesen wird eine Illusion von Freiheit durch Datenfreigiebigkeit. Zum Wohle des Unternehmenswertes werden menschliche Grundnormen wie die Achtung der Privatsphäre oder die Diskretion zerrüttet«[5], schreiben die Autoren Constanze Kurz und Frank Rieger in ihrem Buch »Die Datenfresser«.
Aber ist es wirklich die »digitale Nacktheit«, die möglicherweise missbräuchliche Verwendung unserer Daten zu ökonomischen Zwecken, die uns ängstigt?
Natürlich ist es das, aber auch die Monopolstellung eines Internetgiganten wie Google.
Sind es beim Öl die geografische Dislozierung und die Endlichkeit des fossilen Brennstoffs, die ein Wuchern und obszönes Preisgestalten möglich machen und ganze Wirtschaftszweige und die Politik zu Abhängigkeiten zwingen, so ist es beim Umgang mit unseren Daten als vernetzter Mensch der technische und verwaltende Dienstleister, der unser Leben rücksichtslos bestimmen kann. Die Verführung, die in angepassten, individuellen Informations- und sonstigen Angeboten liegt, wird bis zu einem gewissen Grad von der schrecklichen Vision des »gläsernen Menschen« neutralisiert.
Was in Kalifornien als harmloses Forschungsprojekt begann und was in den Anfängen, von Idealismus getragen, mit einer sympathischen Firmenkultur die Welt eroberte, das hat sich verändert. Immer öfter steht Google nach Skandalen in der Kritik oder muss sich kritischen Fragen stellen. Wie sind die Gerichtsverfahren und Firmenzukäufe von Google in jüngster Zeit zu bewerten? Was hat der verschwiegene Gigant mit Big Data vor? Ist da wirklich nur Smart Data auf der firmeninternen strategischen Agenda? Inwieweit bestimmt Google bereits unser Leben, die Politik und die Wirtschaft? Die Mahnung von Jaron Lanier an uns alle ist deshalb eindeutig: »Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne, du bist ihr Produkt.«[6]
Zur Verleihung des Preises »Das beste Wirtschaftsbuch des Jahres 2014« an Michael Lewis für seinen Krimi über Bankenkrise und Big Data, »Flash Boys – Revolte an der Wall Street«, schreibt der Herausgeber des Handelsblattes, Gabor Steingart:
»Die beiden mit Leidenschaft geführten Debatten der Gegenwart, die eine handelt von der Macht der Daten und der Datensammler, die andere beschäftigt sich mit dem Kulturwandel im Bankensektor, berühren sich hier. … Die Information einer Order wird selbst zur Ware. Nicht ganz zufällig fühlen wir uns an den zu früh verstorbenen Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der FAZ, erinnert, der auf genau diesen Sachverhalt in der Google-Debatte hingewiesen hatte: Wer sucht, wird zum Zulieferer. Wer kauft, zum Produkt. Dieses Grundmuster, dass Daten der neue Goldstandard sind, begegnet uns in ›Flash Boys‹ wieder. Silicon Valley und Wall Street rechnen offenbar in derselben, uns Europäern noch seltsam fremd anmutenden Währung, jenen Datensätzen, die wir selbst hervorbringen.«[7]
Anmerkungen
[1] Global Top 100 – Brand Corporations 2014: http://www.eurobrand.cc/studien-rankings/eurobrand-2014/
[2] Jaron Lanier, Wem gehört die Zukunft?, Hamburg 2014, S. 470
[3] Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 05.10.2014, Nr. 40, S. 19
[4] Vgl. Ebd.
[5] Constanze Kurz und Frank Rieger, Die Datenfresser – Wie Internetfirmen und Staat sich unsere persönlichen Daten einverleiben und wie wir die Kontrolle darüber zurückerlangen, Frankfurt a. M. Juli 2012, S. 9
[6] Jaron Lanier, Wem gehört die Zukunft?, Hamburg 2014
[7] http://www.handelsblatt.com/panorama/kultur-literatur/wirtschaftsbuchpreis/laudatio-auf-michael-lewis-flash-boys-gier-trifft-geschwindigkeit/10816192.html
3. Google wächst und wächst und wächst
Die neuen Büros lagen in der University Avenue 165 in Palo Alto, die dann nicht nur der umfangreicheren Technik, sondern auch acht neuen Mitarbeitern Platz gaben.
Hier gelang es Brin und Page, einige Hochkaräter aus der IT-Szene anzuheuern. Unter den ersten Angestellten waren Urs Hölzle, ein Professor von der computerwissenschaftlichen Fakultät der Universität Santa Barbara (UCSB), das Mathematikgenie Marissa Mayer, aber auch Computerwissenschaftler wie Jeffrey Dean und Krishna Bharat, die gerne und sogar begeistert von der Digital Equipment Corporation[40] zu Google Inc. wechselten[41].
Doch das Wachstum hatte auch seinen Preis. Mit ihrer Hardware waren die zwei Gründer nicht mehr in der Lage, die mittlerweile 500 000 Suchanfragen mit steigender Tendenz täglich zu bearbeiten.
Das Geld der Erstinvestoren war verbraucht, das Geschäft schwierig.
Da beide Herren im eigenen Haus, ihrer Firma, bleiben wollten, und weil das Geschäftsmodell wenig Profit versprach und zu wenig kommerziell ausgelegt war, kam ein Börsengang, wie es 1999 im Silicon Valley mit seiner Goldgräberstimmung häufiger vorkam[42], nicht infrage. Dazu kam, dass Brin und Page die Geheimnisse und Methoden hinter der Suchmaschine und den weiteren Produkten nicht preisgeben wollten. Stattdessen bauten sie vorerst auf ein Lizenzierungsgeschäft.
Erster offizieller Kunde war Red Hat[43], der die Such-Technologie für interne und externe Netze brauchte. Aber Red Hat war eine Ausnahme, und Google Inc. benötigte immer dringender eine Finanzspritze.[44]
Trotz vieler Vorbehalte gegenüber Venture-Capital-Firmen entschlossen sich die beiden Firmengründer in der Not dazu, gleich die zwei renommiertesten und größten potenziellen Investoren anzusprechen: Kleiner Perkins Caufield & Byers und Sequoia Capital.
Brin und Page glaubten – falls es ihnen gelingen sollte, die zwei an Bord zu holen –, dass die Konkurrenzsituation der Investoren deren Gier ausschalten könnte.
Zu oft war es in den letzten Monaten im Silicon Valley vorgekommen, dass VC-Firmen sich in die Start-ups einkauften, um entweder dann bei einem Börsengang Kasse zu machen oder Eingriffe in die strategischen Ansätze der jeweiligen Gründer vorzunehmen, indem auf die Web-Entwicklungen einfach eine Werbemaschine draufgeschnallt wurde, die gnadenlos Gewinne zu generieren hatte.





























