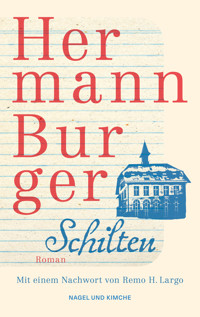Die allmähliche Verfertigung der Idee beim Schreiben. Tractatus logico-suicidalis E-Book
Hermann Burger
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Hermann Burger war, allem voran in seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung, ein wortreicher Erläuterer des eigenen schriftstellerischen Werks. Minutiös und erhellend berichtet er über seine Arbeitsmethoden, seine An- und Einsichten zur Schweiz und über die Recherchen zu seinen literarischen Texten, er reflektiert die Existenzform des Schreibens und schließlich, in seinem berühmten Traktat, das in Form von Aphorismen aufgebaut ist, über das Verhältnis von Kunst, Tod und Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
Hermann Burger
WERKE IN ACHT BÄNDEN
Herausgegeben von
Simon Zumsteg
Achter Band
Poetik & Traktat
Hermann Burger
ESSAYS UND
PREIS-REDEN
DIE ALLMÄHLICHE
VERFERTIGUNG DER IDEE
BEIM SCHREIBEN
Frankfurter Poetik-VorlesungRoman
TRACTATUS
LOGICO-SUICIDALIS
Über die Selbsttötung
Mit einem Nachwort von
Ulrich Horstmann
Nagel & Kimche
Die Werkausgabe wurde ermöglicht dank der großzügigen Unterstützung durch
den Kanton Aargau
sowie der Unterstützung durch
die UBS Kulturstiftung
die STEO-Stiftung Zürich
die Stadt Zürich Kultur
den Verein zur Förderung des Schweizerischen Literaturarchivs
© 2014 Nagel & Kimche
im Carl Hanser Verlag München
Umschlag: Stefanie Schelleis, München
Porträtfoto Hermann Burger: 1988, © Yvonne Böhler
Herstellung: Andrea Mogwitz und Rainald Schwarz
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann
ISBN Band 8: 978-3-312-00620-5
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
INHALTSVERZEICHNIS
ESSAYS
«Warum und für wen schreiben Sie?»Brief des Autors an den LeserEine Philippika wider den «Literaturbetrieb»Im Gespräch sein
ErstlingeDas vorläufige Ende der Wörter: Beim Abschluss eines Manuskriptes und vor Eröffnung der Buchmesse in FrankfurtWas mir die Rüebliländer Metropole bedeutet: Ein lokalpolitisches Feuilleton
PREIS-REDEN
Verfremdung zur Kenntlichkeit: Hölderlin-Preis-Rede
Schreiben als Existenzform: Aargauer Literaturpreis-Rede
DIE ALLMÄHLICHE VERFERTIGUNG
DER IDEE BEIM SCHREIBEN
Frankfurter Poetik-Vorlesung
VorstudienSchiltenDiabelli
Die Künstliche Mutter
TRACTATUS LOGICO-SUICIDALIS
Tractatus logico-suicidalis: Über die Selbsttötung
ANHANG
Editorische NotizenHerausgeberbericht
Zeittafel zu Burgers Leben und Werk
FragebogenNachwort von Ulrich Horstmann
Alphabetisches Register der Werke in acht Bänden
ESSAYS
«WARUM UND FÜR WEN SCHREIBEN SIE?»
Welcher Schriftsteller quält sich nicht immer wieder mit dieser Frage ab, auch wenn sie ihm nicht von außen gestellt wird! Die «Gretchenfrage» muss ihn beschäftigen wie alle Fragen, auf die sich keine präzisen und schon gar keine endgültigen Antworten geben lassen. Es gibt die bekannte Ausflucht in die überspitzte Originalität. (Ich schreibe für alle, die lesen können!) Oder aber das ehrliche Geständnis: Man schreibt zunächst nur für sich selbst. Aus Eitelkeit, aus Geltungsdrang, vielleicht aus der Einsamkeit heraus, die von der ständigen Kluft zwischen Innenwelt und Außenwelt herrührt. Schreiben als Selbstentwurf.
Ich schreibe; zunächst, um mich kennenzulernen, um meine Umwelt in der Fiktion erträglich zu gestalten; ich schreibe, um meinen Gedanken, Gefühlen und Träumen jene Gestalt zu geben, die sie in der sogenannten Wirklichkeit nicht annehmen können. Ich schreibe, um zu existieren. Oft betrachte ich das alltägliche Leben nur als Rohstoff, ja sogar als Traumstoff, der einen geringeren Wirklichkeitsgrad besitzt als alles Geschriebene. Dabei muss ein Missverständnis ausgeschaltet werden: Der Glaube an die Veränderung der Welt durch Literatur ist sehr gering. Verändern lässt sie sich nur durch große Realisten. Der Schriftsteller kennt im Allgemeinen die Welt viel zu wenig, um sie zum Beispiel politisch verändern zu können.
Indessen suche ich, sobald ich veröffentliche, die Begegnung mit dem Leser. Denn nur die Aktivität der Leser kann die Literatur lebensfähig machen. Eine Literatur für Literaten ist eine tote Literatur. Die Begegnung ist möglich im Rahmen der Fiktion. Wir treffen uns als Leser und als Autor in der Frage: Was würde geschehen, wenn? Die Ebene der Möglichkeiten ist für mich viel spannender und menschlich viel ergiebiger als das harte Pflaster der Realität. Ein Mensch, der mir einen seiner Träume erzählt, zeigt mir mehr von seinem Wesen, als wenn er seinen Beruf schildern würde. Er redet, wenn auch in verschlüsselten Bildern, vom Unbewussten, von der Quelle seiner unausgeschöpften Möglichkeiten, von dem, was er sein könnte. Ich lerne ihn kennen, nicht in seiner Rolle, sondern in seinen Ausbruchsversuchen. Schreiben ist ein Ausbruchsversuch, ein ständiges Ringen um neue Möglichkeiten. Lesen ist das Entdecken und Mitgestalten dieser Möglichkeiten. Schon immer hat der Möglichkeitssinn in der Literatur eine große Rolle gespielt, vom Mann ohne Eigenschaften bis zum Gantenbein.
Was bewirken diese Fiktionen? Sie entlarven nichts, dafür sind sie viel zu harmlos. Sie bringen im Glücksfall die Begegnung, das Zwiegespräch ohne Worte. Jeder Mensch kennt das Bedürfnis, gelesen, das heißt: im Tiefsten erkannt zu werden. Der Autor ist einer, der dieses Bedürfnis zu seinem Beruf macht. Er nimmt die mühselige und nervenaufreibende Arbeit des Tippens auf sich, um vielleicht von einem Leser, den er kaum zu Gesicht bekommt, erkannt zu werden. Und der Leser? Er findet da und dort Gedanken formuliert, die ihn beschäftigen, findet Gefühle bestätigt, die ihm wichtig sind. Er entdeckt durch die Lektüre eigene, neue Schichten, er liest, um sein Wesen herauszuschälen.
Ich schreibe also nicht für den Leser, um seine Probleme zu lösen (daran wage ich gar nicht zu denken bei so viel eigenen), vielmehr für denjenigen Leser, der Probleme entdecken möchte, der gewillt ist, das Risiko einer Begegnung einzugehen, indem er meine Fiktion teilt und mit seinem Leben vermischt. Der Wunschtraum jedes Autors ist der mitschöpferische, aktive Leser, der im Idealfall sogar einen Bericht über die Lektüre eines Buches schreiben könnte. Ein Leser, der zugleich kritisch und wachsam bleibt, sich nichts vorschwatzen lässt.
Der Einfluss des Lesers, schon des imaginären Lesers, den man ja immer vor sich hat, ist auf mein Schreiben sehr groß. Ich schreibe nie etwas, ohne dabei zu denken: Wie wird das der oder der Leser aufnehmen? Denn die Bücher, so scheint mir, sollten in erster Linie für Leser, nicht für Kritiker geschrieben werden. Es gibt keine bessere Instanz als die des unbeeinflussten Lesers. Ihm gilt meine ganze Aufmerksamkeit. Sein Urteil wäre wichtiger als das Echo im Literaturgespräch. Denn dieses Gespräch bleibt immer abstrakt, formelhaft, seinerseits eine papierene Fiktion.
Jeder Schriftsteller hofft (er kann dies nur hoffen), dass seine subjektive Art, die Welt zu sehen, durch das Medium der Sprache objektive Gültigkeit für andere Menschen erreicht. In diesen seltenen Glücksfällen kann man sagen: Er hat nicht nur für den Leser geschrieben, sondern auch etwas für den Leser geleistet.
BRIEF DES AUTORS AN DEN LESER
Meine Erzählung ‹Die Leser auf der Stör›
ist leider keine Utopie
Der Autor sucht immer wieder das Gespräch mit dem kritischen Leser, weil er nie aus seiner Haut schlüpfen und sein Werk von außen prüfen kann. Ich bin dem Leser ausgeliefert, das Geschriebene lebt nur durch ihn. Mir fehlt die objektive Distanz. Meine Phantasie ergänzt, was dasteht, zu dem, was dastehen sollte. Der Autor ist der Einzige, der sein Buch nicht kaufen und lesen kann, weil er es schon im Kopf hat. Er erfährt seinen Text im Gespräch, und deshalb ist dieses Gespräch, das öffentliche wie das private, sein wertvollstes Instrument. Die Verantwortung des Lesers wäre sehr groß, doch wer nimmt sich Zeit für Verantwortung! Eine Studentin entgegnete auf die Frage, weshalb sie das Buch eines bekannten Schweizer Autors lese: Weil man nicht alle Gehirnzellen mobilisieren muss und dennoch in kurzer Zeit ein Stück moderner Literatur bewältigt hat, so dass man mitreden kann. Mitreden, im Gespräch sein, etwas für die Kultur tun, auf Echo stoßen, ins Kreuzfeuer der Kritik geraten: alles Formeln als Ersatz für die wirkliche Auseinandersetzung. Man liest sich ein Buch vom Leibe, man frisst sich durch den Bücherberg; warum bestellen wir nicht gleich die Leser auf die Stör?
Das Vorbild des Lesers sollte der Kritiker sein. Er setzt seine Erfahrungen mit einem Buch in Worte um, er knüpft das Gespräch mit dem Autor an. Sind wir als Rezensenten bescheiden genug, um diese Verantwortung auf uns zu nehmen? Ich glaube, der bescheidene Kritiker ist noch viel seltener als der bescheidene Schriftsteller. An Stelle der Vermittlerrolle spielt er allzu gerne diejenige eines Deutschlehrers mit erhobenem Zeigefinger: So kann man doch heute nicht mehr schreiben. Gestern vielleicht und morgen wieder, aber heute nicht! Da der Kritiker meistens sehr genau weiß, wie man nicht schreiben kann, selber aber weit davon entfernt ist, so zu schreiben, wie man schreiben müsste, liegt der Verdacht nahe, er lasse die Autoren in seinen Plädoyers vor dem hohen Gerichtshof der Weltliteratur dafür büßen, dass ihm der künstlerische Durchbruch nicht gelungen ist. Er hat eine Theorie, wie Literatur auszusehen habe, und bespricht dankbar die lebendigen Beispiele, die sie bestätigen.
Diese Haltung färbt auf das Publikum ab. Wir haben jedes mögliche Verhältnis zu den Schriftstellern, nur kein menschliches. Im Extremfall betteln wir vor den Türen der Kultur oder schlagen den Bettlern die Türe vor der Nase zu. An Autorenabenden sitzen wir dem Dichter gegenüber wie schlecht vorbereitete Schüler im Examen und zucken zusammen, wenn einer von uns in der obligatorischen Diskussion etwas ganz Dummes fragt, zum Beispiel: Warum schreiben Sie? Man hat uns doch längst beigebracht, dass diese Frage unanständig ist, weil sie heute meistens im Sinne von «Warum schreiben auch Sie noch?» gestellt wird. Ist diese Stunde, wenn schon Examenstimmung, nicht eher eine Prüfung für den Autor? Nur die Auseinandersetzung, die frei ist von Untertänigkeit und Überheblichkeit, hilft ihm einen Schritt weiter.
Man darf das Cliché des bösen Kritikers nicht übertreiben, umso weniger, als es sehr schwierig ist, innerhalb der Literaturkritik eine Persönlichkeit zu werden. Der integre Kritiker, dessen Größe darin besteht, klein zu bleiben, schreibt weder Verrisse noch Lobhudeleien, sondern führt ein sorgfältiges Gespräch, aus dem der Autor lernen kann, weil er sich nicht ducken und nicht strecken muss. Und er zeigt dem Leser, dass Lesen ein ebenso ernsthafter kultureller Akt ist wie Schreiben, wenn der Leser ein Gewicht in die Schale wirft und nicht nur der Nehmende, sondern auch der Gebende ist. Ich weiß, diese Arbeit ist mühsamer als Beifall klatschen. Doch sie muss geleistet werden, wenn wir verantwortlich sein wollen für die Tauglichkeit unserer Literatur und keine Kultur der Leser auf der Stör dulden.
«Aber er hat ja gar nichts an!», rief das Kind im Märchen Des Kaisers neue Kleider. Und hätte er wirklich Gold getragen, wäre es für die Kammerherren unsichtbar gewesen. Solche Leser brauchen wir.
EINE PHILIPPIKA WIDER DEN «LITERATURBETRIEB»
«Der sogenannte freie Schriftsteller»
Es gibt viele Einflüsse, die einen Schriftsteller an seiner freien Entfaltung hindern können. Von den politischen, die zu den schlimmsten zu zählen wären, will ich einmal absehen und bloß andeuten, dass der selbstauferlegte Zwang zur obligatorischen Opposition in Unfreiheit münden kann. Der engagierte Schriftsteller gibt sich selten Rechenschaft darüber, wie rasch er, sofern man seine Meinung abonnieren kann, zum Sklaven der Publizität wird. Die Angst, nicht mehr im Gespräch zu sein und aus der Mode zu geraten, wächst sich rasch zu einem Trauma aus, dem wir ein schönes Stück Gegenwartsliteratur verdanken. Die Kritiker tragen das Ihrige zur hektischen Produktionswut bei, indem sie etwa erklären: Er hat seinen Stil noch nicht gefunden, man darf auf das nächste Buch gespannt sein. Das Schreiben eines Buches hat offenbar längst nichts mehr mit einem zwingenden Befreiungsakt zu tun, sondern eher mit Leistungssport. Wer bringt zuerst das neue Mundartgedicht, wer schreibt endlich den schweizerischen Militärroman, wo hält sich der Mann versteckt, der wieder Novellen drechseln kann? Autoren werden transferiert, fallengelassen, hochgespielt. Im Fußballgeschäft, glaube ich, geht es menschlicher zu.
Ein Autor, der zuerst arbeiten will, bevor er als «Entdeckung» auftritt, muss sich buchstäblich verkriechen. Umgekehrt kann einer, der um kein Haar besser schreibt als Herr Müller und Frau Meier, ohne weiteres als Autor auftreten, sofern es ihm gelingt, die richtigen Leute für sein Image einzuspannen. Angenommen, der Luchterhand Verlag bringt morgen die Protokolle eines Gerichtsschreibers oder die Fresszettelchen einer Hausfrau als großen Schlager heraus (Werbung: 100 000 Mark), wird sich todsicher ein namhafter Kritiker finden, der dieses Ereignis stürmisch feiert. Und bis alle, die von Berufs wegen auf dem Laufenden sein müssen, gemerkt haben, dass nichts dahintersteckt, ist die erste Auflage bereits ausverkauft. Der Leser, der wird ja nicht gefragt, er ist auf gut Deutsch einfach der Affe im Umzug. Ihm hat man längst vorgerechnet, wie groß die Kluft zwischen dem durchschnittlichen Leserbedürfnis und der modernen Literatur sein müsse.
Ich will mit diesem übertriebenen Beispiel andeuten, dass sich jeder Autor, bewusst oder unbewusst, in einem literarischen Klima oder in einer Landschaft befindet, von der er mitbestimmt und – je nachdem – eingeschränkt oder gefördert wird. Die Wellen können tragen oder begraben. Keiner schreibt jemals so, wie er eigentlich gern möchte, immer sind da Widerstände und Einflüsse im Spiel, die ihn hemmen, ankurbeln, festnageln oder töten. Drei wesentliche Kriterien möchte ich nennen: die Tradition; die herrschende Theorie, wie man glaubt, dass geschrieben werden müsse, und das eigene Ideal, wie man schreiben möchte. Das Kräftespiel dieser Einflüsse lässt sich an einem einfachen Beispiel zeigen.
Ein Lyriker X. liebt Trakl. Er wächst in einer Landschaft auf, die mit Trakls Gedichtlandschaft verwandt ist: Wälder, einsame Weiler, Bauerndörfer und Weiher. Er schreibt Gedichte, in denen diese Elemente vorkommen, vielleicht sogar noch mit Assonanzen und Alliterationen. Das Ideal dieser Gedichte wäre eine Mischung aus Trakl und dem Lyriker X., aus literarischer und realer Landschaft, aus Expressionismus und Neoromantik. Das schwebt ihm vor, das will er erreichen. Nun meldet sich ein Kritiker und sagt: «Halt, so kann man heute nicht mehr schreiben. Alliterationen gehören der Vergangenheit an, und das Weiher-Motiv hat Georg Trakl ausgeschöpft.» Er sieht nicht ein, dass der junge Mann auf dem Umweg über Trakl zu sich selbst gelangen muss. Der Lyriker wird kopfscheu und schreibt aus purem Trotz, um zu zeigen, dass er auch anders kann, Silbenstenogramme. Wieder meldet sich der Kritiker: «Der vielversprechende junge Lyriker X. wird sich selber untreu.» Seine Gedichte werden vom Verlag zurückgewiesen mit dem Vermerk: «Sie sind in einer Gegend aufgewachsen, in der man eine seltene Mundart spricht. Schreiben Sie Mundartgedichte nach Schema F, und wir bringen sie ganz groß raus.» Nun wird der Lyriker unsicher. Was wollte er eigentlich? Trakl verehren, sein Gedicht suchen oder ein berühmter Schriftsteller werden? Am besten alles zusammen, denkt er. Wenn ich bekannt bin, kann ich immer noch so schreiben, wie ich ursprünglich wollte. Wenn er einen guten Tag hat, legt er die Feder weg für immer, hat er einen schwarzen Tag, wird er einer der drei Schweizer Autoren, die es gibt.
In diesem Spannungsfeld steht jeder Schreibende. Er hat primär die Wahl zwischen Form und Formalismus. Wenn er finanziell unabhängig ist vom Geschäft, kann er sich’s leisten, jahrelang an seiner Form zu arbeiten. Niemals aber – so paradox es tönt – als freier Schriftsteller. Das beste Buch setzt sich nicht durch, wenn ihm nicht eine Theorie vorangeht, die es bestätigt. Gute, anspruchsvolle Literatur bleibt Liebhabersache. Was nicht heißt, dass ein gutes Buch nicht auch einmal ein Bestseller werden kann. Doch vorherrschend ist der Reklame-Bestseller, das gemachte Buch. Man liest es, begeistert darüber, dass wirklich drinsteht, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, und verwechselt diese Eigenschaft mit literarischer Qualität. Es gibt eine anonyme Leserschaft, deren Urteil ganz anders lautet als dasjenige des individuellen Durchschnittslesers. Alle finden das Buch mittelmäßig, aber 50 000 kaufen es. Handkehrum findet der Einzelne ein Buch großartig, aber nur 500 kaufen es. Woran liegt es?
Ob er sich nun um diese Marktgesetze kümmert oder nicht, jeder Autor wird geprägt von dem, was andere um ihn herum schreiben. Was er aufschnappt in Kritiken und in den Büchern seiner Kollegen, das ergibt einen Grundakkord, einen harmonischen oder dissonanten, auf dem er aufbauen muss, und auch sein Werk wird immer betrachtet im Spiegel anderer Werke. Setzt er seinen Rotklang in eine graue Landschaft, wird der Erfolg ganz anders sein, als wenn sein Rot eines unter Tausenden ist. Vom Konkurrenzkampf her wird seine Freiheit am stärksten beschnitten. Und deshalb finde ich es einen Witz, wenn «engagierte» Autoren immer wieder die Manipulation anprangern, während sie stillschweigend die Diktatur im eigenen Verlag akzeptieren, um im Geschäft zu bleiben. Es gibt eine Manipulation von Seiten der Formalisten, die ebenso schwierig durchschaubar ist wie die politische Beeinflussung. Man schreibt nicht, was der Staat will, aber so, wie er will, der mächtige Kulturstaat, der sich zusammensetzt aus Verlegern, Lektoren, Kritikern und Bestseller-Autoren.
Ich betrachte es als wichtige Aufgabe eines jungen Autors, dass er beharrlich seinen Weg geht, auch wenn es ein Umweg ist, und dass er sich weder vorbeten lässt, was, noch wie er zu schreiben hat. Heute, da in der Lyrik und in der Prosa jedes Gefühl, jede Reflexion und jede Psychologisierung verpönt sind, sollte man sich nicht scheuen, das Wort ‹Herz› zu brauchen. Möglichst so schreiben, wie «man nicht mehr schreiben kann», doch nicht aus Trotz, sondern aus Überzeugung. Ich bewundere jeden Autor, der auf Kosten seiner Publizität schwierig, schwerblütig und subtil bleibt, der im Zeitalter der Dummerchen-Prosa die verrücktesten Sätze bastelt und mitten in die esoterische Kühlschrank-Lyrik eine dickflüssige Elegie fallen lässt, der meinetwegen sogar reimt und immer noch an den Schlüsselroman glaubt. In einer Rezension meiner Gedichte las ich den erstaunlichen Satz: «Auch in seine weniger von Reflexionen durchsetzten Landschafts- und Naturgedichte ist der Zweifel an der Sprache nicht eingedrungen.» Das «Auch» bezieht sich auf die Reflexionslyrik, von der es kurz vorher hieß: «Andere Verse gelten der Problematik des Dichters selbst, der Ohnmacht der Sprache und des Wortes (eine Thematik, die ja seit langem zum Repertoire moderner Lyrik gehört).» Was also leider überflüssigerweise auch zu meinem Repertoire gehört, ist auch in die Landschaftsgedichte nicht eingedrungen. Etwa so sieht die Logik gewisser Rezensenten aus. Ich habe mich darauf um Aufnahme im Lord-Chandos-Club beworben. Max Frisch schreibt zu dieser Methode im Tagebuch: «Nichts leichter als das: man schneidet eine Kartoffel zurecht, bis sie wie eine Birne aussieht, dann beißt man hinein und empört sich vor aller Öffentlichkeit, daß es nicht nach Birne schmeckt, ganz und gar nicht!»
Man könnte nun sagen: Schert euch nicht um die Kritiker. Doch das wäre falsch. Es gibt sehr gute Kritiker, und die Aufgabe des Kritikers ist nicht zu unterschätzen. Der Kritiker sollte der aufmerksamste Leser eines Autors sein, der obendrein das Talent besitzt, seine Erfahrungen mit einem Buch in Worte umzusetzen. Er sollte dem Leser, der gar nicht mehr Zeit hat, sich über alles zu informieren, das Buch zeigen. Indessen wird diese Macht zu oft missbraucht. Man bevormundet den Leser. Und wenn er sich auch dagegen wehrt, gegen einen katastrophalen Verriss zum Beispiel, so liest er das Buch nicht aus eigenem Antrieb, sondern aus Trotz «erst recht».
Wir müssen wieder lesen lernen, dann sähe unsere Literatur anders aus.
IM GESPRÄCH SEIN
Wie oft hört man doch, ein Autor müsse, um Erfolg zu haben, «ins Gespräch kommen». Viele haben Angst, «aus dem Gespräch zu geraten». Wie stellt man sich dieses Gespräch eigentlich vor? Wer führt es? Ist es das Kritiker-Gespräch, das Buchmesse-Gespräch, das Hausfrauen-Gespräch, das Studenten-Gespräch, das Kaminfeuer-Gespräch? Was wird herumgeboten: der Name eines Autors, die Auflageziffer seines letzten Buches, die Summe seines Werkjahres, das jüngste Gerücht über seinen neuen Roman? Es gibt Buchhändler, welche junge Autoren mit den Worten begrüßen: «Man redet von Ihnen», oder: «Sie sind diesen Herbst leider noch nicht richtig ins Gespräch gekommen.»
Im Gespräch zu sein stelle ich mir etwa so vor, dass man in einer Badewanne voller Schaum und ohne Wasser sitzt. Leise knisternd dringt es an die Ohren. Überall, wo der Autor mit hochgeschlagenem Mantelkragen durchgeht, hat man gerade von ihm gesprochen. Betritt er eine Buchhandlung, gehen die Verkäuferinnen auf Zehenspitzen herum, um ja die Bücher nicht zu stören, die sich den Namen zuflüstern. An keiner Party kann er teilnehmen, ohne dass das anonyme Gespräch ihn einholt. Nie sprechen die Leute zu ihm, alle sprechen über ihn. So paradox es tönt, das «Gespräch» klammert den Autor aus. Die vielen Leser führen es, die das «Man» ausmachen in der Literatur. Buch und Autor sind eine Gesprächsware, die «man» austauscht, wenn es gilt, mit Kenntnissen zu brillieren. Von Toten und Lebendigen wird dabei gleichermaßen feierlich oder rücksichtslos gesprochen. Ein Gespräch ohne Partnerschaft, nicht Blabla, ganz und gar nicht, aber unwirklich für den Autor: das Gespenst seiner Popularität.
Dagegenzuhalten wäre der Dialog – im «Gespräch» reden immer alle auf einmal – zwischen Leser und Autor, nicht über das Buch, sondern aufgrund des Buches. Das Werk als Instrument, um etwas zu erfahren von andern Menschen, um etwas von sich preiszugeben, was man gesprächsweise niemals preisgeben könnte. Es gehört indessen zur Einsamkeit des Autors inmitten seiner großen oder kleinen Popularität, dass dieser Dialog selten zustande kommt, und vom stummen Zwiegespräch zwischen Buch und Leser erfährt er ohnehin nichts. Günter Eich hat seine Erfahrung im lakonischen Vierzeiler ‹Zuversicht› formuliert: «In Saloniki / weiß ich einen, der mich liest, / und in Bad Nauheim. / Das sind schon zwei.» (Ich wüsste auch noch einen dritten.)
Wie kommt man ins Gespräch, ohne «ins Gespräch zu kommen»? Am ehesten, scheint mir, gelingt der Dialog, wenn Leser und Autor ihre Rollen vergessen oder gar vertauschen. Novalis schreibt: «Der wahre Leser muß der erweiterte Autor sein. Er ist die höhere Instanz, die die Sache von der niedern Instanz schon vorgearbeitet erhält.» Würde das nicht heißen, dass man als Autor, sozusagen inkognito, versuchen müsste, dem Leser diese Instanz bewusst zu machen? Vielleicht sollte man sich einmal dazu bequemen, Fragen zu stellen, statt immer nur Fragen zu beantworten, und zwar solche, auf die man die Antwort nicht bereits in der Tasche hat. Die große Kunst des Fragens haben viele Schriftsteller, welche in ihrem Beruf gewohnt sind, alles in Frage zu stellen, im privaten Gespräch verlernt. Sie blicken nicht in Gesichter, sondern in Spiegel. Alles dreht sich um die Achse ihrer Person und ihres Werks; und wenn ein Leser von seinem eigenen Leben anfängt und länger spricht als zwei Minuten, sind sie beleidigt, dass es so viel Leben überhaupt noch gibt, außerhalb ihrer Phantasie. Ja, der Autor hat etwas von einem Pfarrer, wenn er so dasitzt mit meisterhaft gemimter Aufmerksamkeit und zuhört, ohne zuzuhören, ohne dem Gespräch die geringste Chance zu geben, dass es sein Weltbild aus den Fugen bringen könnte.
Falls der Dialog tatsächlich wünschenswert erscheint, muss auch der Autor ein erweiterter Leser sein. Ein Leser vor allem, der Augen hat für das, was sich nicht in Literatur ummünzen lässt, der Gesichter und Gebärden zu lesen versteht, ohne an eine Nebenfigur seines Romans zu denken. Dieses Gespräch, meine ich, wäre für beide Teile hygienischer als das große Schaumbad des Kulturgeflüsters.
ERSTLINGE
Ich habe in den Jahren 1962 und 1963 – vor den Gedichten – eine Reihe von Prosatexten geschrieben, die man heute als «Fingerübungen» bezeichnen würde. Zwar gibt es keinen Czerny der Literatur, aber man stellt sich, wenn man diesen Ausdruck gebraucht, doch vor, dass sich die Sprache an sich trainieren lasse. Man hat das Bild eines jungen Schreibers vor sich, der über seinem Leben das Zielband «Schriftsteller» aufgespannt hat und sich nun täglich an die Schreibmaschine setzt, um Wörter und Sätze zu üben, in der Hoffnung, dass er bis in ein paar Jahren etwas zu sagen haben werde. Dazu zwei persönliche Bemerkungen.
Es erstaunt mich bei der Durchsicht dieser frühen Texte selber, dass ich zum Teil so gearbeitet habe. Da gibt es folgende Passage aus einer Zirkusgeschichte:
«Der Blick siegte, und noch ehe ich Gelegenheit gehabt hätte, den Geruch von Schminke, Magnesium, Sägemehl, Pferden, Futterfischen und das süßliche Parfüm verwelkender Artistinnen zu einem Bild zusammenströmen zu lassen, war ich schon drinnen im Zelt, schon bei der Strickleiter, stieg schon, mit der rechten Hand vorgreifend, den Rumpf nachziehend, erreichte die ersten Scheinwerfer, zog mich höher, ließ die Trapeze mit den sorgfältig ausgeklügelten Aufhängungen hinter mir, warf beim weiteren Aufstieg einen Blick in das sandgelbe, verjüngte Oval der Manege, schätzte die Höhe ab, scheuchte Nachtfalter auf …»
Dieser Abschnitt erinnert den Leser an etwas, und ich kann ihm genau sagen, an was: an die Blechtrommel,das Kapitel «Fernwirkender Gesang vom Stockturm aus gesungen». Der Aufstieg Oskars auf den Stockturm wird wie folgt geschildert: «… die Tür gab nach, und Oskar war, ehe er sie ganz aufgestoßen hatte, schon drinnen im Turm, schon auf der Wendeltreppe, stieg schon, immer das rechte Bein vorsetzend, das linke nachziehend, erreichte die ersten vergitterten Verliese, schraubte sich höher, ließ die Folterkammer mit ihren sorgfältig gepflegten und unterweisend beschrifteten Instrumenten hinter sich, warf beim weiteren Aufstieg – er setzte jetzt das linke Bein vor, zog das rechte nach – einen Blick durch ein schmal vergittertes Fenster …»
Ich habe auf diese Weise ganze Kapitel abgeschrieben, indem ich das syntaktische Muster von Grass übernahm und mit eigenen Wörtern füllte. Was ist der Sinn einer solchen Übung?
Man muss unterscheiden zwischen Stil und Sprachbewusstsein, Sprachkenntnis. Ein Stil lässt sich mit einem solchen Verfahren nie heranbilden, und das ist gut so. Der Stil kann sich erst aus einer Perspektive, aus einer bestimmten Anschauungs- und Interpretationsweise des Lebens entwickeln, wobei ich schon als Interpretation bezeichnen würde, was sich meinem Erleben erschließt und was nicht. Wenn ich sage: Dieser Mensch hat Stil, so meine ich, dass alles, was sein Leben ausmacht, zusammenpasst, und dass er sich mit sich selbst geeinigt hat über die adäquate Ausdrucksform. Es wäre also Unsinn, einen syntaktischen Stil von Grass oder einem andern Satzkünstler übernehmen zu wollen. Aber ich kann mein Konstruktionsvermögen schulen, erweitern, ich kann sehen, was passiert, wenn ich in einen Nebensatz dritten Grades einen selbständigen Hauptsatz einschiebe, durch Gedankenstriche aus der Abhängigkeit herausgelöst. In dieser Hinsicht kann ein Schriftsteller nie zu viel tun, nie weit genug gehen. Es gibt das schöne Gedicht von Gottfried Benn, oft zitiert:
«‹Die wenigen, die was davon erkannt› – (Goethe) – / wovon eigentlich? / Ich nehme an: vom Satzbau.» (‹Satzbau›)
Ich habe mal einen namhaften Literatursachverständigen gefragt, ob ich ihm ein Gedicht von 8 Zeilen zeigen dürfe. Er sagte: Es hat keinen Sinn, dass ich ein Gedicht von 8 Zeilen beurteile, bevor ich 80 Seiten Prosa von Ihnen gelesen habe. Ich darauf entrüstet: Aber die Lyrik, das ist doch etwas anderes! Er: Ja, gerade weil die Lyrik etwas anderes ist, muss man Deutsch können, und ob Sie Deutsch können, sehe ich nicht an ein paar Substantiven, Adjektiven und Partizipien. Ich will wissen, ob Sie die Mittel beherrschen, die Sie nicht einsetzen, ob Sie sie also mit gutem Grund nicht einsetzen. Ich habe mich als junger Lyriker entschieden gegen diese Ansicht gewehrt und mich auf meinen Weltschmerz berufen. Heute gebe ich ihm recht. Die Sprache ist ihrem Wesen nach «mangelhaft», und wenn man Fehler zu beabsichtigten Fehlern machen und sie in ein System bringen will, muss man – unter anderem – Perioden bauen, gewollte Schachtelsätze konstruieren können. Ich richte diese Mahnung zuallererst an mich selbst, denn wenn ich mir nicht auf die Finger schaue, wird jeder zweite Satz ein Dass-Satz. Die Erstlinge, über die ich hier spreche, lassen wenigstens den Versuch erkennen, aus der Satz-Armut auszubrechen.
In einer zweiten Bemerkung muss ich nun gleich alles zurücknehmen, was ich generalisierend gesagt habe: Die Übungen, die man sich auferlegt, lassen sich so wenig übermitteln wie schriftstellerische Rezepte anderer Art. Man muss sie selber erfinden. «Gutes Deutsch für jedermann» ist ein schöner Gedanke für die Volkshochschule, aber für den Schreibenden total unbrauchbar. Schon als Anfänger nämlich ist er ja unterwegs zu seiner eigenen Sprache, und wenn es nur darum ginge, sich möglichst variantenreich verständlich zu machen, brauchte es die Erfindung nicht, die Fiktion. In diesem Sinne, meine ich, kann man das Sprachbewusstsein erweitern, aber nicht die Sprache an sich schulen, weil niemand über die Sprache an sich verfügt. Die Kunstsprache basiert auf einem Auswahlprinzip, das ich nicht steuere, indem ich «Das treffende Wort» aufschlage, sondern indem ich so und nicht anders lebe. Deshalb muss ich, um einen Text beurteilen zu können, wissen, wer der Betreffende ist, woher er kommt, woraufhin er sich entwirft. Das Ausdrucksvermögen kann sehr gering sein, aber die Substanz, die nach außen drängt, enorm. Dies zu erkennen, wäre die primäre Aufgabe der Literatur-Kritik. Einem solchen Autor kann nämlich geholfen werden, während im umgekehrten Fall – Formuliertalent, Durchschnittspersönlichkeit – nicht das Schreiben, sondern das Erleben gefördert werden müsste, das Denken.
Ich will damit sagen, dass wir, bei aller Hilflosigkeit der ersten Gehversuche, keinen Grund haben, unsere Erstlinge zu belächeln oder gar zu vernichten. Denn der Schriftsteller kommt, sofern er sich nicht bequem im Selbst-Epigonentum einrichtet – und viele, denen die Weltveränderung auf den Nägeln brennt, wandeln sich überhaupt nie und präsentieren uns mit 60 Jahren denselben Quark wie mit 30 –, der Schriftsteller kommt aus der Erstlings-Situation überhaupt nie heraus. Wer glaubt, er habe mit seinem Werk eine sichere Basis erreicht, täuscht sich und die andern. Es darf in diesem Metier keine sichere Basis geben.
DAS VORLÄUFIGE ENDE DER WÖRTER
Beim Abschluss eines Manuskriptes und
vor Eröffnung der Buchmesse in Frankfurt
Der Abschluss eines Romans, an dem man jahrelang gearbeitet hat, und dies gilt bestimmt ebenso für Gedichtzyklen, Erzählungen, dramatische Texte, ist nicht leichter als das Beginnen. Kann der Autor mit den ersten Sätzen Gefahr laufen, den richtigen Weg zu verfehlen, sich selber die Papierschnitzel falsch zu streuen – wobei man sich immer vorbehalten muss, statt Indien Amerika zu entdecken –, zwingt ihn der Schlussstrich dazu, den richtigen, vielmehr den einzig möglichen Weg zu verlassen. Eine alltägliche Situation: Fremde Menschen sitzen sich an einer Party gegenüber, kommen stockend ins Gespräch, haben einander je länger je mehr zu sagen, und wenn es ans Abschiednehmen geht, bleibt das Gefühl zurück, jetzt erst sollte der Abend beginnen. Trennungsschmerz führt vielleicht noch dazu, dass man Streit sucht, nur um das Zusammensein zu verlängern. Der Schlussspurt-Alkoholismus, zum Teil findet er hier seine Erklärung.
Das Abprotzen eines Romans ist eine traurige Arbeit, von der Stimmung her vergleichbar dem Lichterlöschen im Zirkus, auf dem Lunapark. In meinem Studio, das ich frei nach Corbusier die Kapelle nenne, sind es drei übereck miteinander verbundene Architektentische – ein Z für Zero, Zenit und Ziel –, die vom Ballast, von den Humusschichten mehrerer Jahre befreit werden müssen. Weg mit den Nachschlagewerken, dem gelben, dem roten, dem blauen Duden, in den Papierkorb mit den Exzerpten, Tabellen, Karteikärtchen, Fresszetteln, Verfeuern der Zeitungsausschnitte und Prospekte, Einsargen restlicher Ideen; der Kopf wird ausgemistet und die Wörter müssen entlassen werden, gattungsweise, die Adjektive immer vor den Substantiven: denn 300 Seiten sind unterwegs nach Frankfurt, unwiderruflich.
Aber fühlt man sich denn nicht auch heillos erleichtert nach dem Terminato-terminato-terminato, so lautet die immer wiederkehrende Leserfrage. Ist da nicht etwas in die Welt gesetzt worden, wenn auch vorerst nur ins Verlagshaus, einem Kuckucksei vergleichbar, das es vorher nicht gab? Sicher. Man feiert gehemmt und still für sich in einer Landbeiz, Wilchinger ist das angemessene Gewächs, doch, wie Bichsel einmal sagt, nicht von der Seele, auf die Haut geschrieben hat man sich den Text, und diese Haut zu Markt zu tragen, ist und bleibt ein zwiespältiges Gefühl. Zwar durfte man für eine Weile die Rolle des freien Unternehmers spielen, Dutzende von Heimarbeitern beschäftigen, der eigenen Kraft abgespaltene Untersekretäre, doch das Produkt hat im Grunde niemand gewollt. Schriftsteller ist kein Beruf, sondern ein Zustand, sterbliche Verliebtheit ebenso wie abgrundtiefer Furor.
Ein weiteres Dilemma liegt darin, dass das Buch erscheinen muss, um sichtbar zu werden, auch für mich, den Urheber, dass ich aber nach Abschluss der Arbeit, weil völlig ohne Distanz zu meinem Roman, keineswegs sicher bin, ob er zu erscheinen auch die Berechtigung habe. Die Einsicht, du hast etwas Brauchbares gemacht oder daneben gehauen, kommt – bezüglich des Schaffensprozesses – immer postum. Der Schlafwandler balanciert über den First, man schreckt ihn auf, und er stürzt. Bei uns ist es etwas anders: wir taumeln über den Grat, von dem wir annehmen, er sei der unsrige, fallen dauernd runter und kommen doch irgendwie ans Ziel. Oder ein anderes Bild – wir müssen uns ja Metaphern ausliefern, stets von Neuem –: man haut eine Schneise in das Dschungelstück, von dem man hofft, da irgendwo liegt der Hund begraben, und merkt dann später im Rück- und Überblick, welche Narrenwege man gegangen ist.
Ein Manuskript abschließen heißt, eine eben erst entworfene Welt aus der Hand geben, eine Erfindung im besten Fall, die aber kein Patent schützt, und die Sättigung, «alles» gesagt zu haben, ist zugleich eine große Leere. Sprache ist ja nicht einfach ein Zahnbesteck, dessen man sich bedienen kann, wenn der Kiefer schmerzt – abgesehen davon, dass wir Schriftsteller permanent unter Kieferschmerzen leiden –, Sprache ist eine vorübergehende Potenz, die heranwachsen muss unter dem Druck der gestellten Aufgabe. Dieses Protuberieren abzuwürgen, ist eine Entziehungskur für sich.
Wir kennen den schwerblütigen, den grüblerischen, den zaudernden Schreiber, der nicht enden kann. Wir alle haben ein Stück von ihm in uns. Es gibt die berühmten Fragmente der Weltliteratur, der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil ist in unserem Jahrhundert wohl das beeindruckendste Beispiel einer Komposition ad infinitum. Musil ließ bis zu seinem Tod nicht davon ab, sich das Ende vorzugaukeln; im Tagebuch notierte er einmal: «Ich bin der einzige Dichter, der keinen Nachlaß haben wird». Welche Ironie, wenn man bedenkt, dass er Tausende von Manuskriptseiten zum Mann ohne Eigenschaften hinterließ, deren Entzifferung bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Uwe Johnsons Jahreszeiten, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, blieben 10 Jahre lang ein Torso bis zum Erscheinen des vierten Bandes im vergangenen Herbst.
Die Finis-Hemmung liegt in der Natur der Sache. Das Bessern und Bosseln, das Schnipseln und Kleben ist ein Stück weit auch die Arbeitstherapie des aus seinem Roman endgültig Entlassenen. Ein Stoff durchläuft verschiedene Stadien der Aktualität. Wenn es lichterloh brennt, soll man sich nicht mit der Uniformierung der Feuerwehr beschäftigen; ist die Aktualität verbraucht, hilft auch Kosmetik nichts mehr. Dazwischen liegt die Phase, wo das Eisen, wie man so schön sagt, heiß ist. Doch Schreiben ist kein Schmiedehandwerk am Amboss. Man lebt eine Zeit lang mit seinen Figuren, dann hat man durch sie und haben sie dem Autor und hat der Autor ihnen nichts mehr zu sagen. Diesen kritischen Termin gilt es einzuhalten.
Ich glaube, dann wird man auch immer wieder zu seinen früheren Werken stehen können. Zwar würde man das Thema auf gar keinen Fall noch einmal gleich anpacken. Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Aber das, was in der früheren Lebensepoche möglich war, hat man gewagt – nein, nicht mit den damaligen «bescheidenen» Mitteln. Es brauchte keinen anderen Stil. Das Sprachvermögen war dem gestellten Problem in etwa angemessen. Stil ist die Art und Weise, wie der Schreiber sich fortbewegt, auf steilem Gelände anders als in einer Tiefebene oder im Sumpf. Sieht man ihn schwimmen, dann muss man ihm glauben, dass dort Wasser ist.
Trotz alledem: Trennungsschmerz und Zweifel, blindes Herumtappen, Insuffizienzen und das lange Warten auf den Leser. Man möchte ihn aus dem fahrenden Zug reißen und ihm sagen: schau, da ist sie, meine letztwillige Verfügung, und du bist ein Erbe. Trittst du die Hinterlassenschaft auch an? Ich habe abgeschlossen, bist du willens, anzufangen, so dass ich mit deinen Augen sehen kann? Wohin jetzt mit der überschüssigen Erwartung? Denn dies ist das Allerschwierigste: aus dem eigenen Text zu schlüpfen und sich selber ein Leser zu werden. Käme nun ein frühzeitig eingeweihter Kritiker und würde erklären: ungültig, man nähme es ihm ab, auf der Stelle.
Das Vakuum, das viele Autoren überbrücken, indem sie sich Hals über Kopf in eine neue Arbeit stürzen – oft nicht mehr als Repetition der gelernten Lektion –, dauert zumindest so lange, bis der Verlag, der erste Adressat reagiert. Dem kann ein langwieriger Prozess vorausgehen, den zu schildern ein Thema für sich wäre. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt theoretisch alles offen. Kapitel vier kann sein, muss aber nicht sein. Der Schluss kann so oder anders aussehen. In dem Moment, wo die Zusage definitiv ist, wo von einer Minute auf die andere plötzlich alle vom neuen Titel sprechen, als wäre er schon ausgeliefert, da bereits Schrifttypen und Umschlagvarianten, Papierqualitäten und Ladenpreise gehandelt werden, erlebt der Autor noch einmal den Trennungsriss.
Mit Grass zu sprechen: «Zudem hatte die Hebamme mich schon abgenabelt; es war nichts mehr zu machen.» Ja ich würde, wenn da überhaupt von einem Geburtsprozess und einem Kind die Rede sein soll, den Autor durchaus in der Rolle des Säuglings sehen. Ein Rundgang durch die Buchmesse bestätigt es: lauter blaurot aufgequollene Schreibsäuglinge in den Kojen, am Sekt und am Schnaps hängend, und über ihnen als Stimmenwolke und Tabakdunst: das Buch. Dort in den Gängen des großen Alphabets, in Nischen auf Hockern, in Glaskabinen und auf Sitzrollen, in Querstollen und Alternativständen wird – endlich – Entbindung gefeiert. Der vorläufige Abschied der Wörter ertrinkt im allgemeinen Messegespräch. Oder ist der Trubel vielmehr ein Galaempfang für die noch nicht vorhandenen Wörter? Man wird, so oder so, bei Null anfangen müssen.
WAS MIR DIE RÜEBLILÄNDER METROPOLE BEDEUTET
Ein lokalpolitisches Feuilleton
Kürzlich wurden ein paar Aargauer Autoren von der Redaktion des Badener Tagblatts aufgefordert, sich zum Stichwort «Baden» zu äußern, in freier, improvisatorischer Art, was mich denn auch dazu reizte, dem Badener Stadtrat die Schaffung eines poetischen Stadtschreiberpostens zu anempfehlen, aber natürlich kann es nicht in Frage kommen, die Bäderstadt, in deren Schwefeluntergrund ich fragmentarische Reste der europäischen Bordellkultur mehr rieche als vermute, einfach so anzuschwärmen, ohne Aaraus zu gedenken, denn schließlich verdanke ich der Stadt der schönen Giebel mehr als Baden, so viel, dass endlich wieder einmal eine Liebeserklärung fällig ist, dies 16 Jahre nach meinen ‹Blauschwarzen Liebesbriefen›, neu aufgelegt im soeben erschienenen Band Als Autor auf der Stör.
Als ich die Bezirksschule in Menziken absolviert hatte, woll-te ich eigentlich, meinem ursprünglichen Talent folgend, in ein graphisches Atelier eintreten und den Beruf eines Graphikers lernen, was ein psychologischer Berufseignungstest in Zürich verhinderte, es gehe, so meinten die Kapazitäten, nicht ohne Mittelschule, also gab ich dem Ruf nach Aarau nach und wohnte als möblierter Studiosus in jener Stadt, in der ich am 10. Juli 1942 um 6.45 Uhr das Licht der Welt erblickt hatte, notfallmäßig, als völlig verquerte Zangengeburt, so aber in den Genuss meines ersten Maienzugs kam, der zunächst nach dem Schönwetterprogramm, gegen Abend eines verheerenden Hagelschlages wegen gemäß der Schlechtwettervariante ablief, die Natur meldete sich also elementar zu Wort, nicht minder elementar als vor fünf Wochen, als ein Blitz in mein Dachstudio auf Brunegg einschlug und mich nur verfehlte, weil ich mein Kolleg an der ETH hielt. Weil ich hier zur Welt kam, ist und bleibt Aarau für mich im höheren Sinne eine «Weltstadt», mondialer als Paris, London und Rom.
Zu Hause im Menziker Park an schönen Sommerabenden, wenn sich stumpenländisch provinzielle Langeweile breitmachte und wir beim Genuss einer Havanna fragten, was unternehmen wir jetzt, schlug ich immer wieder einen Ausflug nach Aarau vor. Mein Vater lachte dann und fragte: «Was um Himmels willen zieht dich nach Aarau?» Meine Familie war allenfalls nach «Luzern ie», wie es mundartlich heißt, nach «Züri use», aber nicht nach «Aarou abe» zu locken. Aarau war eben, was die Eltern wohl wussten, aber nicht teilten, meine «Studierstadt», lange vor Zürich und Berlin, deshalb rangiert sie auch heute noch vor diesen vermeintlich so viel attraktiveren Konkurrentinnen. Aarau, das war auch der «erste Kuss» im Rathausgarten, dargeboten von einer Coiffeuse-Lehrtochter, die, bevor sie ans Werk ging, den Kaugummi aus dem Mund nehmen musste. Was Wunder, dass der Kuss weniger nach Odol als nach Bazooka schmeckte, dass ich fortan Bazooka stangenweise schiggte, dass ich auch heute noch darauf bestehe, mir die Haare von weiblicher Hand schneiden zu lassen, dass Frisiersalons für mich etwas zutiefst Erotisches haben, darin sogar die ominösen Massage-Etablissements übertreffend. Was Wunder, dass kein späterer auch noch so blonder Kuss diesen Urkuss übertroffen hat, seine Süßigkeit, sein Ambra wird vielleicht dann noch einmal anklingen, wenn wir in einem Klinikbett – aber bitte nicht in der Schwarzwaldklinik – die schon dürren Lippen zum letzten Mal spitzen, das Leben liebt solche Symmetrien.
Aarau, das war der Schachen, war ein Handballfeld, auf dem sich in den fünfziger Jahren anlässlich von Kadettentagen die einheimische Bezirksschülermannschaft und Lenzburg ein, ich kann nicht umhin, es so zu nennen, wahrhaft göttliches Spiel lieferten, weitmaschig, trickreich, überfallartig, hochklassig, BTV-reif, eine Partie, die ich deshalb so neidisch verfolgte, weil ich ein miserabler Turner, ein Bewegungsidiot und ein skandalöser Kadett war, mein späterer Freund Kurt Oehler spielte mit, desgleichen mein späterer Bandleader Peter Hiller und ein dunkelhäutiger Bursche, in den sich sogar Thomas Mann verliebt hätte; es kann nicht anders sein, als dass aus dieser Schülermannschaft einige Internationale hervorgegangen sind, und mir prägte sich mit heraldischem Nachdruck ein: Aarau, das ist eine Handball-, keine Fußballstadt. Da sieht man nur, wie sich die Zeiten geändert haben!
Aarau war und ist der Sitz der Rentenanstalt, in deren Diensten mein Vater als erfolgreicher Versicherungsinspektor ein Leben lang stand, und zu Hause in Menziken galt die Regel, dass die sonst immer offene Bürotür geschlossen werden musste, wenn «Aarau» am Apparat war, und genau wie im Roman Deutschstunde von Siegfried Lenz der Vater von Siggi Jepsen in Rugbüll in den Hörer schreit, um alle Distanzen zu überwinden, so sprach auch mein Vater in voller Lautstärke, sein Partner war ein Herr Dubs, später Herr Dr. Moser, wir Kinder lauschten an der zigarrenbraun geflammten Tür und erhaschten rätselhafte Fachtermini wie «Risikorente», «Mortabilitätstabelle», «Überschüsse», «Doppelauszahlung im Todesfall», und das alles hatte zentral mit Aarau zu tun. Wenn mein Vater «nach Aarau musste», das nicht in seinem Rayon lag, war damit immer die Existenzgrundlage unserer Familie berührt, nicht selten kam er mit hochrotem Kopf von einer solchen «Konferenz» zurück, seltsam genug, dass die kurven-, hindernis- und entbehrungsreiche Wynentaler Strecke es nicht vermochte hatte, die Röte der Wut oder Scham zu vertreiben, und wenn dann noch eine Beinahe-Kollision mit der privatbähnlerisch-eigenbrötlerischen, damals noch blau-grauen WTB zu vermelden war, war «der Zapfen ab».
Aarau, das ist meine unvergessliche Kantonsschulzeit in jenem staubigen, altdeutschen Kasten, dessen Architektur mich immer an Anker-Bausteine erinnert. Hier schwitzte ich an der schriftstellerischen Aufnahmeprüfung wie weiland Hermann Hesse am Schwäbischen Landexamen, hier schrieb ich mein erstes Stück Prosa, ‹Beobachtungen bei Kleintieren›, eine «Kurzgeschichte» mit dreifacher Brechung, der Vater überwacht den Sohn, der Sohn zeichnet die Katze, die Katze beobachtet die Kanarienvögel, die der Vater dem Sohn zum Geburtstag geschenkt hat, beide sehen sich in der Annahme getäuscht, die Katze fresse die Vögel, sie lässt sie leben. Note 6, blank und ohne Kommentar, ein schriftstellerischer Anfang. Mein späterer Deutschlehrer, Professor Bagdasarianz, förderte meine Neigung, wo immer er konnte, und als wir nach einer endlos kräftezehrenden Schulreisewanderung alle hinter dem Heutraktor herrannten, auf dem er sich das letzte Stück fahren ließ, als alle gleichzeitig aufsitzen wollten, vertrieb er meine Mitschüler mit dem Stock, machte mir Platz und sagte: «Only for poets.» Ich kann von daher das boulevard-publizistische Gezeter, im Aargau würden alle Talente verkannt, überhaupt nicht verstehen. Wir Schriftsteller auf jeden Fall fanden im Kulturkanton die besten Startvoraussetzungen.
Aarau, das ist, leider muss es gesagt werden, die Infanteriekaserne und die Balänenturnhalle. Auch im adretten Himbeereiston hat das Drillgebäude nichts von seinem Schrecken eingebüßt, es ist Gott, obwohl es ihn so, wie die Pfaffia behauptet, sicher nicht gibt, höchlichst zu danken, dass er mir die Infanterie-Tortur in Aarau ersparte, im Herzen dieser geliebten Welt- und Studierstadt dem Kommando «Laufschritt, marsch» oder «Gewehr bei Fuß» gehorchen zu müssen, hätte mich der Rüebliländer Metropole ein für allemal entfremdet, und jedes Mal, wenn ich einen Zug Kampfsäcke den Fußgängerstreifen in der Laurenzenvorstadt überqueren sehe, frage ich mich ernstens, womit ich es verdient habe, dass dieser Kelch an mir vorüberging. Als Aarauer Infanterist wäre ich glatt vor die Hunde gegangen, als Panzerfahrer in Thun konnte man ins Technische ausweichen und lernte wenigstens, wie ein Motor funktioniert.
Die Schmach, die ich in der Balänenturnhalle unter der Pfeife «Ösci» Webers vor allem an den Geräten erleiden musste, ist mit dem Prosastück ‹Über Turnhallen› (unveröffentlicht) und mit den Turnhallen-Kapiteln in Schilten getilgt worden, dessen ungeachtet möchte ich auf keinen Fall meinen Hinterbliebenen eine Turnhallenabdankung zumuten, ein Brauch, der im Schulhaus Schiltwald noch immer in Kraft ist. Nun war der «Ösci» durchaus ein Bodybuilder der milden Observanz, ich kann im Großen und Ganzen sagen, dass er mit den «gschtabigen» Badener BBC-Söhnen und mit mir eine Art Erbarmen hatte, schon gar im Telli-Bereich, wo es ein Leichtes war, sich in einem Gebüsch zu verschlaufen. Vor Orientierungsläufen der Aare entlang machte ich meine gastrischen Beschwerden geltend und las ungeschoren im mitgenommenen Reclam-Heftchen. Dann gönnte er uns trotz Handballprimat viel Fußball, ein Spiel, bei dem ich einen leidlichen Rechtsaußen abgab. So war die Balänen-Kaserne zwischen Hoffen und Bangen doch irgendwie verkraftbar.
Aarau, das ist, natürlich, wie könnte man sich daran vorbeimogeln, der immer wieder tränenrührende Maienzug mit den zylinderschwenkenden Honoratioren, den Kornblumenkränzchen, den weißen Röckchen in den unteren, den galanten Garderoben in den oberen Jahrgängen, mit den immer an Ort tretenden Couleurbrüdern, mit «Alt Heidelberg, du schöne …», mit der Buchser, der Rohrer, der Küttiger Harmonie, mit Glockengeläute und Fahnenpracht, was die Wetterkonferenz, die Wurstprobe und die Bankett-Querelen betrifft, ist alles schon hundertmal beschrieben worden in den poesiereichsten Spalten, die eine Zeitung aufzuweisen hat, im Lokalteil. Alles Übrige kann man vergessen, das Ausland, das Inland, die Wirtschaft, die Kultur, meinetwegen auch den Sport, auf den ich zwar ungern verzichten würde, was zählt, sind die Regional- und Lokalseiten, hier stehen die Geschichten, die das Leben schreibt, und sie sind unendlich spannender als jede Buchrezension. Lokalredaktor wäre mein Traumberuf, man müsste aber die Aktionärsversammlung einer mittelgroßen Bank so beschreiben können, dass sich kein Abonnent getrauen würde, die Seite als Wickelpapier für Rhabarberstengel zu missbrauchen, und gar das Zentenar-Jubiläum eines Tunnel-Begehungsvereins, etwas Köstlicheres gibt es nicht. Das Lokale ist das wahre Poetische.
Aarau ist naturgemäß das Kunsthaus und die Kantonsbibliothek. Was das Bücherverleihinstitut betrifft, gebe ich gerne zu, dass ich vor jeder Bestellung Lampenfieber kriege wie vor einer großen Rede oder einer Autorenlesung. Kürzlich brauchte ich dringend Lisa Wengers Wie der Wald still ward. Dieses Zittern und Schwitzen in der oberlichtgedämpften Kataloghalle vor dem Ausschank! Gelingt es, den Schatz abzurufen über die Nummer Sch X 1691, oder war da schon ein Nebenbuhler am Werk? Wird man nach Zürich ausweichen müssen in die unsägliche Zentralbibliothek? Dann der Blick in den Lesesaal, voller Bewunderer für die emsigen Kärrner, die das Sitzleder haben, einer Hölderlin-Variante nachzuspüren. Ich hätte es nicht und hatte es nie, ich habe in Lesesälen immer mit den windigsten Ausreden kapituliert. Weil mir Bücher, zuhauf, eine Gänsehaut über den Rücken jagen. In der Bibliothek lesen, das kommt einem Kuttelmahl in einem Schlachthof gleich. Doch welche Erlösung: Wie der Wald still ward ist da, postgelbes Packpapier wie früher in der Menziker Schul- und Volksbibliothek, nichts wie raus!
Das Kunsthaus hat nicht erst seit dem verstorbenen Heiny Widmer einen vorzüglichen Ruf über die Kantons-, ja Landesgrenzen hinaus, hier standen wir mit «Tschudy» im Halbkreis vor Bildern, hier lernten wir, Farbakkorde und Konturen abzutasten, hier ward uns der Impressionismus ein Begriff, hier schüttelten wir auch mal den Kopf anlässlich einer Weihnachtsausstellung, wenn eine Steckdose in der Wand nicht zu erkennen gab, ob sie zu den Exponaten gehöre, hier wurde der «Aargauer Literaturpreis» verliehen, hier liegt Vernissage-Getuschel in der Luft, hier geht es handfest zu, haben auch Hammer und Zange das Wort, weil Gemälde die Vertikale bevorzugen im Gegensatz zu Büchern, hier lagern «Bestände» von unschätzbarem Wert, kommen entlegenste Jurawinkel ab und zu ans Licht, der große Vorzug eines Bildes ist der, dass es im Augenblick ganz erfassbar ist, jedermann weiß, wenn eine Gruppe davor steht, wovon der Museumsführer spricht, das ist in der Literatur und in der Musik leider nicht so, hier hilft dem Pädagogen kein Diapositiv aus der Klemme. Nun spreche ich eine alte, wenn auch unrealistische Forderung aus: Im Aarauer Kunsthaus müsste es ein fahrbares Jugendstilbett geben, es müsste dem Besucher möglich sein, gewissermaßen als Patient und im Einmannbetrieb an Klees Lebenswerk vorbeigefahren zu werden, denn Kunsteindrücke können so stark sein, das man im wörtlichsten Sinn darniederliegt. Und man könnte, hätte man einmal genug, den Kopf auf die andere Seite drehen und in den Schlummer des Kunstgerechten fallen.
Aarau, das ist die ehemalige Buchhandlung Meissner, wo ich als frischer Architekturstudent die Ehre hatte, der Prinzipalin ein wenig zuzudienern, ich wohnte im damals noch unverschobenen Hübscher-Haus und schrieb meine erste Erzählung über das Thema Zauberei, nachdem sich mir in einer grellen Bude im Schachen «Das Zersägen einer Jungfrau ohne Schutz und ohne Abdeckung» unauslöschlich eingeprägt hatte. Im selben Atemzug muss die an französische Kleinstadtläden gemahnende Buchhandlung Wirz genannt werden, Prousts Combray fällt einem ein, dort verlieren die Bücher das Bedrohliche von Bibliothekswänden und bieten sich einem so kostbar dar wie erlesene Tabaksorten. Ja, intime Buchhandlungen haben einen gemeinsamen Nenner mit Kolonialwaren-, früher Spezereihandlungen, Joyce entströmt ein völlig anderes Aroma als zum Beispiel Döblin. Die Droste duftet nach Melissengeist.
Hier habe ich mir die erste Gesamtausgabe meines Lebens geleistet, Hesses Werk in sieben Bänden, ich verdanke die Entdeckung dieses Dichters meinem Freund Kurt Oehler, der bei Professor Bagdasarianz einen Vortrag über den Roman Demian hielt, hier, schien mir, sprach zum ersten Mal einer in meiner Sache, es ist eine Jugendliebe, denn stilistisch habe ich von Hermann, dem Andren, null und nichts gelernt, aber seine Art, die großen Lebenskrisen zu meistern, bleibt vorbildlich. Natürlich hatte ich in Burg schon von Hesse gehört durch Otto Basler, aber die wahre Passion für mein ureigenstes «Lebensmittel», die Literatur, bleibt an Aarau gebunden, und da sage einer, etwa Paul Nizon, es sei keine Weltstadt! Der Weg führte über Eichendorff, dessen Stammsitz Lubowitz ich in Polen besuchte, heute eine Ruine, über Hesse zu Goethe, Kleist und Kafka, dem Französischunterricht verdanke ich die Bekanntschaft mit Camus und Sartre, beide prägend. Noces war eine Offenbarung, ich verschlang das Buch an einem Trottoirtischchen einer verschwundenen Beiz – fast ein Bistro – in der Nähe des Regierungsgebäudes, dann L’Etranger, in einem Zug, es war das Gegengift gegen die Erziehung der «Moralischen Aufrüstung».
Was wäre Aarau ohne den Obertorturm und die Meyerschen Stollen! In der ehemaligen Türmer- und Feuerwächterstube über das rätselhafte Kanalsystem nachzudenken, müsste ein reizvoller Stoff sein, in den Griff zu kriegen nur durch präzise Recherchen in der frühindustriellen Unterwelt, mit Grubenhelm und Taschenlampe, aber so geht der Schriftsteller im Grunde immer vor, er richtet sich ganz oben ein und bohrt ganz unten, um sich dann von unten herauf wieder an die höchste Instanz zu wenden. Der Aperitif zur Buchvernissage wäre dann im wehrhaften Gemäuer, die Lesung im Labyrinth unter dem katholischen Pfarrhaus durchzuführen. Ich befürchte, dass Aarau für mich erst dann «gelöst» sein wird, wenn es mir gelungen ist, den Meyerschen Stollen meinen Sinn aufzuzwingen.