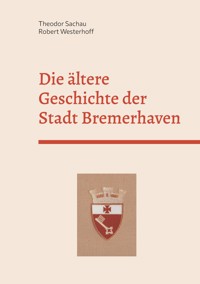
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch "Die ältere Geschichte der Stadt Bremerhaven" erschien zum 100-jährigen Jubiläum Bremerhavens im Jahre 1927. Pastor Theodor Sachau betrachtet hier die Geschichte der Unterweserregion, im Besonderen den Bereich der Stadt und des Umlandes. Unter anderem beschreibt Sachau die Konflikte um die strategisch wichtige Lage der Geestemündung, die daraus resultierenden Besitzverhältnisse, sowie die Chronik der Stadt von der Vorgeschichte über die Gründung und die Auswanderung bis zur Einführung der neuen Stadtverfassung von 1879. Hier fokussiert er sich speziell auf das Leben und Wirken der Einwohner im Alltag. Ebenfalls befinden sich in dem Buch Stammtafeln der ersten Familien Bremerhavens und diverse Pläne und Karten. In diesem Nachdruck, der von Robert Westerhoff aus der ursprünglichen Frakturschrift der Originalausgabe in Lateinische Schrift transkribiert wurde, sind nicht nur die Satzform und die Schreibweise, sondern auch das Bildmaterial und die detailreichen Pläne und Karten der Originalausgabe übernommen worden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis142:
Vorwort
Erster Teil:
Aus der Vorgeschichte Bremerhavens
Zweiter Teil:
Die Entwicklung Bremerhavens von seiner Gründung bis zu seiner Stadtwerdung den 18. Oktober 1851 oder Alt-Bremerhaven
Die Gründung, der Difinitivtraktat, Hafenbau, Straßenpiäne und Anweisung der Bauplätze
Die staatliche Verwaltung Bremerhavens und deren Einrichtungen
Amtmann und Hafenmeister
Die Polizei
Oberlotse und die „Hansestadt-Bremische-Seelotsen-Gesellschaft zu Bremerhaven"
Schleusenmeister und Schleusenknechte
Hannoversche-bremische Quarantäneanstalten
Das Bergungswesen
Die zur Sicherung des Hafens gegen Feuersgefahr und zur Erhaltung der nächtlichen Ordnung 1837 und 1842 getroffenen Einrichtungen.
Die Auswanderung über Bremen – Bremerhaven von 1832 bis Ende 1851.
Bild:
Hafen
Die Werften und Docks von 1843 bis 1851
Die ersten deutsch-amerikanischen Dampferverbindungen zwischen Bremerhaven und Newyork und der Bau des Neuen Hafens
Die Gründung der ersten deutschen Kriegsmarine mit der Hauptstation Bremerhaven
Die Entwicklung von Bremens Handel und Schiffahrt von 1831 bis Ende 1851
Die Entwicklung der Ortsgemeinde. Die Bewohner. Der Ausbau der Straßen. Die Art der Häuser. Die Teilung der Bauplätze. Die Bevölkerungszunahme.
Der durch Fähre, Chaussee, Weserschiffahrt, Post und Telegraphie hergestellte Verkehr mit dem Hafenort
Windmühle in Bremerhaven
Wasserversorgung
Kanalisation
Beleuchtung des Ortes
Arzt, Apotheke und Krankenpflege
Die Rechtspflege
Die erste (provisorische) Gemeindeverwaltung
Theater, Vereine, Musik und Gesang, Geselligkeitsleben, Feste und Vergnügungen der Erwachsenen
Aus dem Leben und Treiben der Bremerhavener Jungen und Mädchen in den dreißiger und vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Die Wirtschaften in Alt-Bremerhaven
Die erste Entwicklung des Bremerhavener Schullebens
Schul- und Armenpflege
Die kirchliche Zugehörigkeit zu Lehe und das kirchliche Leben in Bremerhaven
Die Grundsteinlegung der Kirche
Betrachtung über den kulturellen Stand und das äußere Gepräge Bremerhavens unmittelbar vor seiner Stadtwerdung
Die Stadtfrage und ihre Vorgeschichte, sowie die Einführung der Stadtverfassung
Dritter Teil:
Die Stadt Bremerhaven von 1852 bis zur Durchführung der Neuen Städtischen Verfassung Ende 1879
Das Ende der deutschen Kriegsflotte
Das Ende der deutsch –amerikanischen Dampferverbindungen
Die Gründung des Norddeutschen Lloyd
Bremerhavens bedeutsame Entwicklung als vollgültiger Seehafen
Der Auswanderungsverkehr über Bremen – Bremerhaven von 1852 bis Ende 1879
Die Zunahme des bremischen Handels und der bremischen Schiffe bis Ende 1879
Die staatliche Verwaltung, deren Beamte und Einrichtungen von 1852 bis Ende 1879 (Amtmann, Polizeiverwaltung, Hafenmeister und Hafenbaudirektor)
Die weitere Entwicklung des Lotsen- und Schleusen wesens
Hannoverisch-bremischen Quarantäneanstalten
Strandungsordnung vom 17. Mai 1874
Die Entwicklung der Stadtgemeinde
Wochenmärkte und Jahrmarkt von 1852 an
Ein neues Wasserwerk für Bremerhaven
Das Vereinsleben
Entwicklung des Stadttheaters und die Gründung des Volksgartens, Gasthöfe
Bremerhaven im Kriegsjahr 1870/71 und als Garnison
Die Thomas-Explosion
Die weitere Entwicklung des Schulwesens bis Ende 1879
Das kirchliche Leben und die Entwicklung der einzelnen Kirchengemeinden bis Ende der siebziger Jahre
Bild
Kirche
Erhebene Feste
Durchführung der neuen städtischen Verfassung Ende 1879
Bild:
Kaserne
Das Bild von Stadt und Häfen zur Zeit der neuen Verfassung 1879
Schlußbetrachtung
Vierter Teil:
Anhang: Der Definitivtraktat von 1827
Kapitel III-IX der provisorischen Gemeindeverfassung vom 8. November 1837
Liste der in den 30er Jahren und Anfang der 40er Jahre des vorherigen Jahrhunderts hier ansässigen Gewerbetreibenden
Liste der Gemeindeverordneten vom Jahre 1851
Lieder zum Gesange bei der Feier der Grundsteinlegung der neuen Kirche zu Bremerhaven am 29. Mai 1846
Familien-Stammtafeln der ersten (bzw. ältesten) Bremerhavener Einwohner
Druckfehlerverzeichnis
Karten und Pläne – betr. Befestigungen, Hafenanlagen und Bebauung Bremerhavens
142 Zusatz des Herausgebers
Vorwort
Am 9. August vorigen Jahres feierte die uns nahe liegende, hoch aus den Fluten der Nordsee ragende schöne Felseninsel Helgoland ihr hundertjähriges Bestehen als Seebad. Der verdienstvolle Gründer des Bades war der schlichte Schiffszimmermann Jacob Andresen Siemens. Auf diese Jahrhundertfeier folgt am 1. Mai dieses Jahres die hundertjährige Wiederkehr der Gründung Bremerhavens. Aus allen Gegenden Deutschlands, sowie auch aus dem damals noch englischen Helgoland erhielt es seine Ansiedler, unter denen der Helgoländer Schiffszimmermann R. C. Rickmers, von dem Unternehmungsgeist seines Lehrmeisters Siemens erfaßt, hier sein Glück versuchte und es in reichem Maße fand. – Andere Städte haben ihre Jahrtausendfeier, wie in diesem Jahre Nordhausen am Harz. Was bedeutet demgegenüber die für das Leben einer Stadt kurze Spanne Zeit von hundert Jahren! Und doch, wenn wir zurückblicken auf die bedeutende Entwicklung, welche die Tochterstadt Bremens in ihren Hafenanlagen, in Handel und Schiffahrt, sowie in kultureller Beziehung in einem Jahrhundert erlebt hat, haben wir wohl Grund genug, den Tag ihrer Gründung besonders festlich zu begehen.
Da ich zweiundvierzig Jahre im Pfarramt an der hiesigen vereinigten evangelischen Gemeinde gestanden habe, mit den Interessen unserer Stadt ganz verwachsen bin und von jeher an ihrer Entwicklung lebendigen Anteil nahm, war es mir schon lange ein Bedürfnis und zugleich eine Quelle der Freude, mich mit der älteren Geschichte Bremerhavens, die das größte Interesse darbietet, über die aber manche unserer Einwohner nur dürftig unterrichtet sind, zu beschäftigen. Das gesammelte Material ist nun anläßlich der Jahrhundertfeier zur Darstellung gekommen. Mein Buch: „Die ältere Geschichte der Stadt Bremerhaven" behandelt die Zeit von ihrer Gründung bis zur Durchführung der neuen Stadtverfassung Ende 1879. Vorangestellt ist eine kurze Vorgeschichte Bremerhavens und des ganzen Unterwesergebietes. – Nicht nur aus amtlichen Akten und in meine Geschichte einschlägigen Schriften, sondern auch aus dem Munde der ältesten Bürger, sowie aus schriftlich niedergelegten Erinnerungen habe ich den Stoff für meine Arbeit geschöpft. Zu dem umfassenden Werke des historisch geschulten Studienrates Dr. Bessel, Bremerhaven, der die hundert Jahre Bremerhavens anläßlich seiner Jahrhundertfeier im Auftrage der Stadt behandelt hat, dürfte nach verschiedenen Seiten hin mein Buch eine Ergänzung bieten. Es beschäftigt sich eingehender, als von der den Zusammenhang der allgemeinen deutschen Geschichte stärker berücksichtigenden Arbeit Dr. Bessels erwartet werden darf, mit den Einwohnern der Stadt, ihrem Leben und Wirken, mit dem Vereinsleben und seinen führenden Männern, mit verschiedenen staatlichen Einrichtungen, wie Lotsen-, Schleusen-, Quarantäne- und Brandlöschwesen und den in diesen Berufen stehenden Einwohnern, mit dem Leben und Treiben der Jugend Alt-Bremerhavens. Auch bringt es eine Reihe von Familien-Stammtafeln der in den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts Eingewanderten.
Möge mein Buch eine freundliche Aufnahme zumal bei den Nachkommen unserer ältesten Einwohner finden. Wem statistische Angaben, ausführliche Mitteilungen über Gemeindeverfassung und dergleichen in meiner Geschichte kein sonderliches Interesse abgewinnen, der wird hoffentlich doch manches darin finden, was ihn fesselt oder ihm liebe Erinnerungen weckt.
Herrn Studienrat Dr. Bessel möchte ich an dieser Stelle besonders dafür danken, daß er verschiedene Lücken in meiner Darstellung hat ausfüllen helfen. –
Bremerhaven, am 1. April 1927
Pastor emer. Theodor Sachau.
Hauptsächlich genutzte Quellen:
„Die Bürger-Convents-Verhandlungen" bzw. Verhandlungen zwischen dem Senat und der Bürgerschaft. – Die Akten des Bremer Staatsarchivs , des Bremischen Amtes in Bremerhaven, die städtischen und kirchlichen Akten. – Die hiesige und die bremische Presse, was erstere betrifft u. a. insbesondere: „Bremerhavens Entwicklung als Seehafen und der Norddeutsche Lloyd 1830-1920" von Wilh. Ehlers, Bremen in der Jubiläumsausgabe der Nordwestdeutschen Zeitung 1920.-„Die Memoiren eines Bremerhavener Jungen", Manuskript von Wilhelm Dreyer. – Mitteilungen aus dem Munde der ältesten Bürger unserer Stadt, Wilhelm Luerssen, Mittelstraße, Justes Pötter, Mühlenstraße und Heinrich von Riegen, Bürgermeister Smidt-Straße.
An Büchern und größeren Werken benutzt:
Professor Buchenau: Die freie Hansestadt Bremen.
Wilhelm von Bippen: Geschichte der Stadt Bremen
Johann Smidt, ein Gedenkbuch mit einem Vorwort der historischen Gesellschaft des Künstlervereins. Bremen 1888, C. Ed. Müllers Verlagsbuchhandlung und Bremerhaven Julius Mocker.
W. von Bippen: Johann Smidt ein hanseatischer Staatsmann.
Dr. H. A. Müller: Gedenkbuch der freien Hansestadt Bremen, sowie der Hafenstädte Bremerhaven und Vegesack von 1851 bis 1876. Bremen 1876.
Theodor von Kobbe und Wilhelm Cornelius: Wanderung an der Nord- und Ostsee, Leipzig. Georg Wigands Verlag. Seite 54-64: „Bremerhaven", von Th. von Kobbe.
D. R. Ehmck: Festungen und Häfen an der unteren Weser.
R. Rudloff, F. Claussen, D. Günther: Die Bremerhavener Hafenund Dockanlagen. Hannover, Verlag von Gebr. Jänecke, 1903.
Wilh. Langenbeck: Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd. 1921, Historia-Verlag Paul Schraepler in Leipzig.
Norddeutscher Lloyd Bremen. Jahrbuch 1905.
P. J. Wilcken: Bilder aus dem deutschen Flottenleben 1849. Hannover 1861. Verlag von Carl Rumpler.
Dr. Max Bär: Die deutsche Flotte von 1848 bis 1852. Leipzig 1898. Verlag von S. Hirzel
Über optische Telegraphie und die erste von Kapitän Wendt eingeführte elektrische Telegraphenlinie zwischen Bremen und Bremerhaven:
Aus „Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein". VIII. Band. Bremen, C. Ed. Müller, 1884. Dr. Edmund Rothe: Kapitän J. W. Wendt.
D. Steilen: Optische Telegraphie.
Über Kanalisierung:
Herrn. Gebhard: Die Kanalisation der Stadt Bremerhaven. Bremerhaven 1882.
Über das Vereinsleben:
Die Protokolle des Bürger-Schützen-Vereins, die Jubiläumsschriften vom Turnverein und den Gesangs- und Kriegervereinen.
Über die Garnison Bremerhaven:
Humpert, Oberleutnant z. S.: Geschichte der III. Matrosen-Artillerie-Abtei lung zu Lehe a. d. W. Lehe, Druck von Ernst Bruns, 1911.
Über die Thomas-Explosion:
„Das Thomas-Verbrechen am 11. Dezember 1875", Wiedergabe eines alten Berichtes von der „Provinzialzeitung" als besondere Druckschrift. Wesermünde-Bremerhaven, 1925.
Über das Theaterleben:
Johann Meinken: Der Volksgarten in Bremerhaven, ein Kulturbild.
Über die kirchlichen Verhältnisse:
Bremische Biographie des 19. Jahrhunderts. Bremen 1912. Verlag von Gust. Winter.
Dr. Weiß: Bilder aus der Bremischen Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts.
Hasenkamp: Die erste Predigerwahl zu Bremerhaven, erzählt und beleuchtet von Hasenkamp, Pastor der reformierten Gemeinde zu Lehe. Lehe 1855. Druck von D. Remmler & Comp.
Pastor H. Wolf: Über den angeblichen Kirchenjammer in Bremerhaven 1862.
Pastor Schnackenberg: Kurze geschichtliche Entwicklung der Evangelisch-lutherischen Gemeinde zur Kreuzkirche in Bremerhaven. Krause & Randermann 1911
Erster Teil
Aus der Vorgeschichte Bremerhavens
Aus der Vorgeschichte Bremerhavens1
Jahrhunderte hindurch hatte Bremen sich als eine treue Stadt des Erzbischofs erwiesen und sich völlig unter seine Oberhoheit gebeugt. So war es denn natürlich und konnte Bremen dessen sicher sein, daß der Landesherr seiner Hauptstadt ein größeres Interesse und eine größere Fürsorge entgegenbringen würde, als den übrigen Städten des Stiftes, Stade, Buxtehude (und Verden), und daß er jede Beeinträchtigung des Handels und der Schiffahrt seiner Stadt nach Kräften verhindern oder beseitigen würde. Als aber seit dem 13. Jahrhundert, jener Zeit, in welcher die Städte und insbesondere die norddeutschen Seeplätze, einen raschen Aufschwung nahmen, Bremen sich stark genug fühlte, um zu versuchen, sich immer mehr von der erzbischöflichen Gewalt zu befreien – da mußten freilich die Interessen der Stadt und des Erzbischofs auseinandergehen. In der Gewißheit, daß die Beherrschung der Weser die Grundbedingung seiner Handelsblüte sei, begann Bremen eine selbständige Herrschaft über die Weser, die es fortan „seinen Strom" gerne nannte, auszuüben. Nachdem es sich durch kaiserliche Privilegien die Hoheitsrechte über die Weser hatte zusichern lassen, war sein ganzes Streben darauf gerichtet, den heimischen wie fremden Schiffern und Kauffahrern nach Kräften die Wasserstraße zu sichern. Das geschah durch Auslegung von Tonnen2 und andere Seezeichen auf der Weser, durch die Bekämpfung der friesischen Seeräuber, bei der armierte Orlogschiffe und die beständig an der Mündung des Stromes liegenden Wachtschiffe ihren schweren Dienst verrichteten, sowie durch strenge Ahndung jeder gegen die freie Benutzung der Weser gerichtete Gewalttat. Um die Herrschaft über den Strom zu behaupten, hatte die Stadt sich das Recht erworben, daß von ihren Mauern bis „zur salzen See" keine neue Burg in der Nähe des Stromes ohne ihre Einwilligung errichtet werden durfte. Die Beobachtung dieses Rechtes ließ sie sich wiederholt durch Verträge sichern, zunächst mit den Erzbischöfen. Diese betrachteten sich anfänglich zwar als die eigentlichen Inhaber der Jurisdiktion über den Strom, übten sie aber nicht aus und traten sie dann stillschweigend an die Stadt ab. Solche Verträge, wie sie auch mit dem benachbarten Adel und den Volksgemeinden an der Unterweser abgeschlossen, erneuert und gelegentlich erkämpft wurden, gaben doch der Stadt keine sichere Gewähr einer völligen Beherrschung der Weser. Sie mußte darauf bedacht sein, durch Land erwerb an beiden Ufern sich festere Positionen zu verschaffen. Und das gelang ihr in einer Weise, wie sie es selber kaum zu hoffen gewagt. Noch im 14. Jahrhundert wurden ihr am rechten Weserufer die Schlösser Blumenthal und Stotel verpfändet. Auch das Stadland am linken Ufer kam unter die Botmäßigkeit. Dann wurde, um Stad- und Butjadingerland in der Gewalt zu haben, 1407 die Friedeburg (Bredeborg) in Atens bei Blexen errichtet.
Als Graf Christian von Oldenburg sich mit den Friesen zur Gegenwehr verbündet hatte und dabei besiegt und in Gefangenschaft geraten war, kam 1408 auch das Land Wührden3 als Pfand für die Kriegskosten in Bremens Besitz. Besonders wertvoll wurde für die Stadt das große Amt Bederkesa. Die eine Hälfte desselben war ihr schon 1396 von dem in Geldnöten befindlichen Erzbischof Otto verpfändet worden. Die andere Hälfte, den Herzögen von Sachsen-Lauenburg gehörig, kam 1411 in ihren Pfandbesitz. Die Erwerbung dieses Amtes war für Bremen vor allem deshalb so wichtig, weil zu ihm das Kirchspiel Lehe (als besonderes Gericht) gehörte, das sowohl an die Weser als auch an die Geestemündung grenzte. Ehmck im Eingang seines interessanten Aufsatzes „Über die Festungen und Häfen an der untern Weser", der zugleich eine lichtvolle Darstellung der politischen Begebenheiten gibt, die unsere Gegend im Laufe der Jahrhunderte durchlebte – bemerkt: „Es gibt Landstriche, wo eine glückliche Beschaffenheit der Luft, des Landes und Wassers sich in solcher Vereinigung findet, daß die Natur selbst die Menschen auffordert, sich dort heimisch zu machen. Plätze, denen die Natur von Vornherein schon eine bedeutende Geschichte mitgegeben zu haben scheint und die (mit ihren natürlichen Hilfsquellen) selbst unter verschiedenartigen Bewohnern und verwandelten politischen Verhältnissen wichtige Stätten der geschichtlichen Entwicklung geblieben sind." Der Verfasser wendet dann mit Recht diese allgemeinen Erfahrungssätze auf die Gegend unserer Stadt Bremerhaven an, „auf welche auch nach mißlungenen Versuchen der Blick der Menschen, wie eine größere Zukunft vorahnend, stets gerichtet blieb." Bremen konnte in der Tat keine wertvollere Stütze und keinen vorzüglicheren Schutz für Schiffahrt und Handel gewinnen, als wie es ihm das südlich von Bremeriehe gelegene Gebiet der Geestemündung darbot. Von hier aus konnte es seine Wachschiffe in die Mündung der Weser legen, und die einlaufenden Schiffe fanden in der Geeste bei stürmischem Wetter oder gegen die Räubereien der Friesen oder sonstige feindliche Angriffe sicheren stadtbremischen Schutz. Aber zunächst waren es die Neider und Widersacher der alten Hansestadt, die das unmittelbar oder weiter ab gelegene Terrain am Zusammenfluß der Geeste und der Weser zum Stützpunkt ihrer feindlichen Pläne machten, zuerst die Erzbischöfe, später vor allem die schwedischen Könige. Genanntes Terrain und insbesondere das Areal, auf welchem Bremerhaven gelegen ist, sollte ein geschichtlich denkwürdiger Boden werden.
Es war im Jahre 1408, als Erzbischof Johann II. (vorher Probst von Hadeln) in der Nähe der Geeste den Bau einer festen Schanze begann. Die erst im vorigen Jahre von den Bremern auf dem jenseitigen Weserufer in Atens errichtete Friedeburg, welche sich bereits siegreich bewährt und zu weiterer Machtvergrößerung der Stadt beigetragen hatte, wurde dem Erzbischof je länger desto mehr ein Dorn im Auge, aber auch ein Sporn, um auch seinerseits eine Zwingburg gegen die Widersacher der kirchlichen Oberhoheit zu errichten. Am linken Ufer der Geeste bei Geestendorf ließ er die Burg erbauen, welche – wie Renners Chronik berichtet – von der Menge der Stinte, die herbeischwammen und staunend das neue Werk betrachteten, den Namen Stinteborg4 erhielt. Sie war zunächst gegen die um ihre alten Volksfreiheiten ringenden Wurster errichtet; doch zugleich auch gegen die Stadt Bremen, ihr den Zugang zu ihrer Herrschaft Bederkesa zu erschweren. „Zudem konnte man von der Stinteborg das Fahrwasser der Weser, das sich vor der Geeste nahe an das Ostufer drängte, bestreichen und so den Bremer Weserhandel durch Belastung mit hohen erzbischöflichen Zöllen schädigen" (Plettke). Bremen machte nun alsbald dem Erzbischof Vorstellung mit Berufung auf sein altes Recht, keine fremde Burg an der Weser zu dulden. Das hinderte Johann II. nicht, weiter zu bauen. Doch ehe das Werk vollendet war, durchschwamm eine Schar besorgter aber entschlossener Wurster bei Nachtzeit die Geeste, überfiel die kleine Besatzung, zerstörte möglichst viel an dem Bau, warf die Geschütze ins Wasser und vernichtete das vorhandene „büssen krut" (=Pulver5). Als der Erzbischof von neuem die Arbeit in Angriff nehmen ließ, drohte der Bremer Rat mit Entsendung bewaffneter Eisenschiffe, so daß der Bau eingestellt werden mußte. Der Ärger, der darüber im erzbischöflichen Lager sich regte, war groß. – Der große Gebietszuwachs, den die Stadt Bremen im Laufe der Zeit erfahren hatte, hielt reichlich ein Jahrhundert an. Dann nahm er immer mehr ab, zur Freude ihrer Feinde. Durch Einlösung gingen das Land Wührden (1514) und die Grafschaft Stotel an ihre früheren Herren zurück. Im Jahre 1524 erlag die verhaßte Friedeburg dem vereinigten Angriff der Rüstringer und Friesen, und mit ihr gingen das Stad- und Butjadinger Land für Bremen verloren. Als die Wurster nach heldenmütiger Gegenwehr von dem Erzbischof Christoph unterworfen waren, kam 1526 auch das Kirchspiel Lehe unter die Botmäßigkeit des Erzstiftes. Doch das kaiserliche Kammergericht, bei dem Bremen einen Prozeß angestrengt hatte, sprach das Kirchspiel wieder der Stadt zu.
Im Jahre 1536 erneuerte Lehe den alten Vertrag mit Bremen und zahlte jährlich ein am St. Nikolaustage fälliges Schutzgeld von 25 Gulden. Die Bremer Herrschaft wurde indes unbequem. Der Rat zeigte in der Behandlung der an Selbstverwaltung gewöhnten Leher nicht die nötige Vorsicht und Besonnenheit. Doch der Druck der späteren Herren wurde ihnen noch weit empfindlicher. – Bevor Schweden seine Hand auf unsere Gegend legte, war auch schon von anderen Mächten das Gebiet der Geestemündung als ein wichtiger militärischer Stützpunkt ins Auge gefaßt worden. – Während des Dreißigjährigen Krieges begannen die kaiserlichen Truppen, welche 1628 in unserer Gegend lagen, eine alte verfallene Schanze, die vielleicht ein Rest der Stinteburg war, wieder herzustellen.
Der Rat in Bremen erfuhr von den Soldaten, daß die Befestigung einen etwaigen Einfall des dänischen Königs von der See her abwehren sollte. Der Siegeszug Gustav Adolfs aber zwang die Truppen, unsere Gegend zu verlassen. Neun Jahre später richteten dann wirklich die Dänen ihr Auge auf die Geestemündung. Als Friedrich, der zweite Sohn Christians IV. von Dänemark, 1637 in den Besitz des Erzstiftes gelangt war, begann er sofort Händel mit Bremen und bestritt dessen Reichsunmittelbarkeit. Zwei Jahre darauf schickte er Truppen nach Lehe, und im April erschienen zwei dänische Orlogschiffe, die von den Handelsschiffen ungewöhnliche Abgaben erhoben. Bei Geestendorf wurde eine sogenannte Realschanze6 und auf dem jetzigen Bremerhavener Gebiete, auf dem sogenannten „Maenhorn, am Ende des Winsels" (Wintzelweges) ein größeres Erdwerk errichtet und mit Geschützen armiert. Aus sicherer Quelle erfuhr der Rat von Bremen, daß der Erzbischof sogar mit dem Plane umgehe, bei Geestendorf eine Stadt zu erbauen, deren Bürger er auf Jahre hinaus besondere Vorrechte verleihen wollte. Da erging zur rechten Zeit in scharfen Worten an den Erzbischof ein kaiserlicher Befehl, und laut des zu Stade am 4. Oktober 1639 abgeschlossenen Vertrages mußten die mit Mühe eben errichteten Schanzwerke geschleift werden. – Durch den Westfälischen Frieden kam Schweden in den Besitz der Herzogtümer Bremen und Verden, und von neuem lenkte sich die Aufmerksamkeit auf die militärische Bedeutung unserer Gegend.
Im Jahre 1653, während der Streitigkeiten wegen des Elsflether Zolles, besetzte der schwedische General Graf Königsmark Lehe und warf vor dem Orte eine Schanze auf. Nur durch schwere Opfer, durch Abtretung des Amtes Bederkesa und des Gerichts Lehe, sowie durch Verzicht auf die Hoheit über Blumenthal und Neuenkirchen konnte Bremen in dem Vergleich zu Stade vom 28. November 1654, wenn auch nicht die ausdrückliche Anerkennung der Reichsunmittelbarkeit erkaufen, so doch deren zeitweiligen Besitz behaupten. –
Wie früher im Norden Europas trat jetzt auch an der Weser Dänemark als Rivale Schwedens auf. Eine Flotte erschien am 3. Juli 1657 vor der Geeste und brachte durch wenige Schüsse die Schanze bei Geestendorf zur Übergabe. Doch war diese Eroberung nur von ganz kurzer Dauer. Unter Karl X. von Schweden, der in Dänemark einfiel, das im Frieden zu Roeskilde schwere Bedingungen eingehen mußte, wurde schon am 2. August 1657 die genannte Schanze durch den schwedischen General Wrangel zurückerobert. –
War bis dahin das Gebiet an dem Ausfluß der Geeste vorwiegend nur als ein militärischer Stützpunkt berücksichtigt worden, so erkannte man in Stockholm unter dem jungen, begabten und tatendurstigen Karl XI. zum ersten Male klar, wie günstig der Platz sich auch in kommerzieller Beziehung ausnutzen ließe.
Im Jahre 1672 beschloß der König in dem nördlichen Winkel zwischen Weser und Geeste an der Stelle der alten Leher Schanze eine Festung und Handelsstadt zu gründen. Schon der letzte Erzbischof Heinrich hatte diesen Gedanken erwogen, er ebenso wie jetzt der Schwedenkönig mit der Absicht, durch solche Anlage allmählich Bremens Handel lahmzulegen (Leippen, Geschichte der Stadt Bremen, III, S. 179). Die Mittel zur Erbauung sollten den Subsidien entnommen werden, die Frankreich an Schweden zahlte, damit letzteres imstande sei, den Großen Kurfürsten vom Kriege gegen Frankreich abzuhalten. Truppen wurden gelandet, das nötige Baumaterial herbeigeschafft, und der Gouverneur der Herzogtümer Bremen und Verden, Feldmarschall Horn in Stade, tat selbst am 11. Juni 1672 den ersten Spatenstich. Doch erst im folgenden Jahre schritt die Arbeit vorwärts. Landmesser wurden von Stade aus beauftragt, den Platz für die neue Festung abzumessen und auf einer Karte zu verzeichnen. Der Stader Regierung wurde befohlen, Vorschläge für die Heranziehung von Einwohnern nach der neuen Stadt auszuarbeiten. Erst, als am 21. April aus Stockholm der „Obrist und französische Ingenieur", P. Melle, dem die Anlage des Platzes und das Kommando übertragen war, mit einer neuen Truppenabteilung erschien, wurde mit dem eigentlichen Bau begonnen. – Interessant ist die Nachricht, daß zum Zweck des Festungsbaus die Mündung der Geeste, welche damals weiter oberhalb im heutigen Geestemünde lag, eine andere ziemlich vom alten Geestendorf abführende Richtung erhielt, die sie noch heute hat. Pratje in seinem Geschichtswerk: Altes und Neues aus den Herzogtümern Bremen und Verden, Stade 1778, X, S. 299, § 10, berichtet uns: „Der Platz nahe dabei, wo vor Anlegung dieser Festung die Leher Schanze gestanden, liegt jetzt an der Vieländischen Seite7, indem ein kleiner Arm des Geesteflusses durchgegraben und der alte Alveus (Fluß) durch Einsenkung eines Schiffes verstopft worden ist." Bei Ausgrabung des Geestemünder Hafens kam der alte Schiffsrumpf wieder zum Vorschein, der irrtümlich früher von Altertumsforschern als der Rest eines Askommannenbootes erklärt worden ist. Der 1800 und 1817 aufgenommene Plan von der Geeste bis zur Mündung der Weser (s. den Plan 2 im Anhang) zeigt auf den Geestendorfer Außendeichsländereien kleine, von dem alten Ausfluß der Geeste herrührende, mit Ratjer Loch, Sandbraak und alte Geeste bezeichnete Wasserläufe. Diese deuten die Richtung an, welche ursprünglich die Mündung der Geeste genommen hat. Der kleine Arm des Geesteflusses (Pratje), der bis zur Weser gegraben wurde, nahm beim Ratjer Loch seinen Anfang. Bis zur Erbauung der Karlsburg machte die Geeste kurz vor ihrer Mündung, wie aus dem Plan der Karlsburg im Anhang, Karte 1 zu ersehen ist, noch eine große Schleife nach Süden, bis tief in das heutige Geestemünde hinein. Eine schwache Andeutung von der „alten Geeste", als reguliertem Wasserlauf im damaligen Außendeichsland, befindet sich auch auf der Situationskarte von 1826, welche der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft vom 9. März 1827 über den mit Hannover geschlossenen Vertrag als Anlage beigefügt wurde. „Vor 30 Jahren", berichtet Fr. Plettke in seinem Artikel „Zur Geschichte von Geestemünde" in der Jubiläumsausgabe der Nordwestdeutschen Zeitung 1920, „hieß auch noch ein Graben östlich des Hauptzollamtes in Geestemünde die ,alte Geeste'. Vermutlich ist das Absinken des westlichen Rathausteiles in den ersten Jahren nach der Erbauung darauf zurückzuführen, daß dieser Teil auf dem alten Geestebett steht."
Nach Herstellung des neuen Geesteausflusses und nach angestrengten Aufbauarbeiten erhob sich allmählich die stattliche Festung, die vom König den Namen Karlsburg erhielt, geschützt durch den Geestefluß und durch Gräben, die aus ihm abgeleitet waren, von 16 bis 18 Fuß Tiefe und gegen 80 Fuß Breite. Auf der Landseite sicherten den Ort außer dem Graben ein beböschter Wall, einige Reihen von Palisaden und drei befestigte Tore, das Geestendorfer, ihm gegenüber das Wurster und östlich das Leher Tor. Auf den Wällen standen schließlich (1675) in 36 Rondeelen 72 Kanonen. Ein fester Pulverturm war errichtet, und Baracken waren erbaut für eine Garnison von etwa 2.200 Mann. Ein freier Raum, der im Bedürfnisfall nach der Südseite der Geeste hinüber erweitert werden konnte, war für eine Handelsanlage vorgesehen. Doch blieb die ganze Fläche unbebaut. Welche Hoffnung man in Schweden anfänglich auf die Karlsburg setzte, beweist der für die Ansiedler ausgestellte Freiheitsbrief. Engländern, Holländern, Portugiesen und Vertretern anderer Nationen, falls sie gedächten, daselbst Kontore und Kaufhäuser zu errichten, sollte in allen Wegen zu erkennen gegeben werden, wie sehr man darauf bedacht sei, Handel und Wandel zu stärken. Das am 16. März 1674 in Stockholm ausgestellte Privilegium sicherte dem Platze große Vorrechte zu: Schenkung des Grundstückes, nur mit der Verpflichtung, es zu bebauen, Abgabefreiheit für eine Reihe von Jahren, Gewerbefreiheit und ungestörte Ausübung jeder christlichen Konfession, wobei freilich die Regierung nur den Lutheranern eine Kirche bauen wollte. Es waren großartige Vorschläge in bezug auf die Karlsburg8, welche man in Stade ausgearbeitet und der Regierung in Stockholm unterbreitet hatte: Gründung von Schule und Kirche, Hospital und Friedhof, Rat-, Zeug- und Provianthaus, Errichtung von Pack- und Kaufmannshäusern, Herstellung von Textil- und Lederwaren und Aufbau von 400 Privathäusern. Wenn so weitgehende Pläne wirklich in Erfüllung gegangen wären, hätte Bremen wohl schwere Sorge um seine Zukunft befallen können angesichts eines solchen konkurrierenden Handelsemporiums an der Unterweser. Aber alles blieb ein schöner Traum, weiter nichts.
Der vorläufige „Bürgermeister" von Karlsburg, Besser, der Ende 1673 nach Stockholm gereist war, um das Werk an der Geestemündung möglichst zu fördern, kehrte im Oktober 1674 mit schweren Enttäuschungen zurück. Dem Festungsbau brachte man dort Interesse genug entgegen, wiewohl es schwer hielt, rechtzeitig die große Anzahl der Geschütze, die nötigen Baumittel und die Löhne für die Truppen der Karlsburg zu beschaffen. Dagegen von dem Stadtgründungsplan wollte man nicht mehr viel wissen. Das Land war durch eine Mißernte schwer heimgesucht. Die Staatskassen waren leer. Die Welt stand gerade im Zeichen des ersten Raubkrieges Ludwigs XIV. Die bewegten und verwickelten politischen Verhältnisse, die auch Schweden in den Krieg hineinziehen mußten, nahmen die volle Aufmerksamkeit des Hofes in Anspruch und ließen eine Handelsstadt an der Geestemündung nicht aufkommen. Gleich nach Bessers Rückkehr wurde zwar versucht, etliche hundert Familien, die gerüchteweise aus Holland, das durch den Angriff der Franzosen in schwere Bedrängnis geriet, auswandern wollten, für die Karlsburg zu gewinnen. Doch alles vergeblich.
1674 trat auch das Reich dem Kampfe gegen Frankreich bei. Nun mußte der König von Schweden, durch Vertrag an Frankreich gebunden, von Pommern her den Kurfürsten von Brandenburg angreifen. Infolgedessen wurde (1675) auch Schweden zum Reichsfeinde erklärt, und bald begannen die Braunschweiger und die Münsterschen, mit den Brandenburgern und Dänen verbündet, den Feldzug gegen die Herzogtümer Bremen und Verden. Die Stadt Bremen hielt sich klugerweise neutral, leistete aber im geheimen den Verbündeten Vorschub. In kurzer Zeit ward den Schweden alles entrissen, mit Ausnahme der beiden Waffenplätze, der alten Festung Stade und der neuen Fortifikation Karlsburg. Der Angriff auf letztere sollte zu Wasser und zu Lande geschehen. Am 19. September9 erschien die vereinigte holländisch-brandenburgische Flotte mit neun Orlogschiffen und einer Menge von Begleitschiffen vor der Karlsburg. Alsbald erging die Aufforderung zur Übergabe. Der tapfere Kommandant Melle nahm sie nicht an und ließ dem brandenburgischen Admiral Simon de Bolsey erwidern, er wisse den Brandenburgern nichts als Kraut und Lot zuwillen. Die Beschießung begann. Sie dauerte vom frühen Morgen bis vier Uhr nachmittags. Aber die vielen Geschosse vermochten der Festung nur wenig anzuhaben. Bolsey beschloß deshalb, die Ankunft der verbündeten Landtruppen abzuwarten. Aber sie erfolgte nicht. Uneinigkeit herrschte im dortigen Lager, und insbesondere das Haupt der Alliierten, der trügerische Bischof von Münster, gönnte unter keinen Umständen Brandenburg Eroberungen an der Nordseeküste. In Stade fürchtete man, daß die Festung sich nicht halten würde. Eiligst brachte man von Stade Standarten Reiter und Dragoner zur Hilfe auf, die gerade an Land befindlichen Brandenburger, welche bei Weddewarden wieder die Schiffe besteigen wollten, mußten, 300 Mann stark, den berittenen Truppen sich ergeben. Auch die von Oldenburg herübergekommenen Fähnlein dänischer Reiter wurden überwältigt, gefangen genommen und zur Dienstleistung in der Festung gezwungen. Vergeblich hoffte die Flotte auf eine Verbindung mit den Verbündeten. Die holländischen Schiffe trennten sich alsbald von den brandenburgischen und gingen nach Kopenhagen. Die brandenburgischen Schiffe legten unter dem Kommando von Jacob Raule in die Elbe, ohne vor Stade etwas auszurichten. Endlich entschloß man sich im verbündeten Lager zu einer weitläufigen Zernierung der Karlsburg. Ein ganzes Vierteljahr hielt sich Melle. „Mangel an Holz, Salz und Volk" (Pratje) – ein großer Teil der Besatzung war durch Krankheit dienstunfähig geworden – nötigte ihn endlich am 28. Dezember zu dem Entschluß, mit den Belagerern das Abkommen zu treffen, daß er die Festung übergeben wolle, wenn in vierzehn Tagen kein Entsatz komme. Da dieser ausblieb, erfolgte am 12. Januar 1676 die Übergabe unter ehrenvollen Bedingungen. Erst als am 3. August desselbigen Jahres sich Stade ergab, war der Nordwesten Deutschlands ganz von den Schweden befreit. Lange wurde in Bremen, das klugerweise dem Kriege gegen Schweden sich nicht angeschlossen hatte, über das Schicksal der Karlsburg verhandelt und schließlich die Demolierung beschlossen. Doch war sie sehr unvollständig ausgeführt, als die Schweden im Sommer 169710 durch die Verträge, die Brandenburg und Bremen mit ihnen schlossen, wieder in den Besitz der Herzogtümer gelangt waren. Im Jahre 1683 schritten dann die Schweden selbst zu einer weiteren Demolierung der Festung. Die Palisaden wurden weggeschafft und die Geschütze nach Stade geführt. Wohl nicht nur Mangel an Brunnenwasser und Ansiedlern, wie sie angaben, trieb zu diesem Entschluß, sondern diplomatische Vorstellungen der Holländer, denen sich vielleicht auch Brandenburg und Dänemark anschlossen. Doch ganz wurde das Werk auch jetzt noch nicht zerstört. Noch immer gab es einen Kommandanten und zwei Kompanien deutscher Soldaten mit den Frauen und Kindern. Nur eine Kompanie war zur Zeit in der Festung, die andere lag in Lehe. 1685 wurde alles nach Lehe verlegt11. Die militärischen Gebäude verfielen immer mehr. Im folgenden Jahre erhielt Lehe, das wiederholt um Zuwendung des Abbruchmaterials gebeten hatte, eine verfallene Baracke, um das Holz zum Bau einer neuen Schule zu verwenden. Ein „Konstabel" war zwar noch auf der Karlsburg, um die paar Geschütze, die merkwürdiger-weise noch stehn geblieben waren, zu bewachen, doch fand er keine passende Gelegenheit für ein Quartier und zog es vor, in Lehe zu wohnen. Auf der verfallenen Festung war es ganz einsam geworden. Nur Claus Öhr12, der ehemalige Bäcker und Proviantmeister der Karlsburg, ein Stader Bürger, der erste Einwohner, konnte sich von dem Platze nicht trennen, er blieb bis zu seinem Tode.
Noch einmal schien es so, als sollte für die verfallene Karlsburg doch noch eine günstige Wendung des Schicksals eintreten. Der eben zur Regierung gekommene fünfzehnjährige tatkräftige und ehrgeizige Karl XII. von Schweden, angeregt durch eine schon 1694 verfaßte Denkschrift des Amtmanns Rift zu Bremervörde, war entschlossen, die Stadt und Festung Karlsburg wieder aufzubauen und befestigen zu lassen, nicht nur zur Defension und zum Schutze des Herzogtums Bremen, sondern auch zum Handel und Wandel. Der Feldmarschall Erich Dalberg mußte einen Riß zur Ausbesserung und Erweiterung des Platzes anfertigen. Die schwedischen Gesandten wurden aufgefordert, die Evangelischen in England und Holland, vor allem die aus Frankreich vertriebenen Reformierten, welche sich zahlreich in Deutschland aufhielten, unter der Hand davon in Kenntnis zu setzen, daß ihnen für den Fall ihrer Ansiedlung besondere Vorrechte auf dreißig Jahre gegeben werden sollten. Es geschah indes in der politisch unsicheren Zeit so gut wie nichts für die Ausführung des neuen Planes. Zu einer Handelsanlage kam es nicht. Durch die großen Kriege, welche der König von 1700 an gegen Dänemark, Rußland und Polen führte, geriet alles ins Stocken. In kurzer Zeit kam 1712 durch Eroberung das längst ersehnte Herzogtum Bremen in Dänemarks Besitz. In demselben Jahre besetzte Hannover das ehemalige braunschweig-lüneburgische Herzogtum, das seit 1692 zum Kurfürstentum erhoben war. Zwei Jahre später erhielt Kurfürst Georg durch Erbschaft die englische Königskrone. Einer solchen Macht gegenüber, die ebenfalls auf unsere Küstengegend Anspruch erhob, glaubte Dänemark das eroberte Land auf die Dauer nicht behaupten zu können. Schon 1715 gab es das Herzogtum Bremen gegen eine Geldentschädigung an Hannover ab. Dieses aber schien keine Neigung zu haben, noch einmal den Versuch zu machen, den vielumstrittenen Platz an der Geestemündung als große Handelsanlage auszunutzen. Die Karlsburg verödete, dem Sturm und Regen preisgegeben. Die Wälle sanken ein, die Gräben verschlammten, und die furchtbare Weihnachtsflut des Jahres 1717 vollendete das Zerstörungswerk. Es schien, als ob für immer der Platz seine Bedeutung verloren und das Schicksal sein endgültiges Urteil über diesen Zankapfel verschiedener Nationen gesprochen habe. Doch wurde der auf ein Handelemporium gerichtete Gedanke Karls XII. noch gegen Ende desselbigen Jahrhunderts wieder aufgenommen. Zunächst von Bremen. Der befreundete französische Gesandte bei den Hansestädten Karl Friedrich Reinhard hatte am 1. Dezember 1796 in einer ausführlichen Depesche an den Minister des Äußeren in Paris unter den besonderen Wünschen Bremens auch die Erwerbung eines Gebietes an der Unterweser erwähnt, wobei doch sicherlich an die Gegend der Geestemündung gedacht war. Die Wünsche Bremens fanden keine weitere Beachtung. Doch wurde lebhaft der Plan erörtert, den im Sommer 1798 der mit den Küstenverhältnissen seines Landes vertraute Advokat Johann Heinrich Wag ner in Celle zur Gründung einer Hafenstadt an der Geeste entworfen hätte. In Hannover zunächst abgewiesen, wandte Wagner sich nach Bremen. Ein hannöverscher Bürger sollte den Platz pachten und sich eine Handelsgesellschaft unter der Leitung einiger Senatsmitglieder aus Bremen bilden. Die Schiffahrtskreise erklärten sich entschieden für den Plan. Doch unter den bremischen Kaufleuten regte sich Mißtrauen in die Rentabilität eines Privatunternehmens. Auch hatte man eine gewisse Furcht vor der Konkurrenz des neuen hannöverschen Ortes.
Gleichzeitig mit Wagner hatte der in Lehe als Richter angestellte Dr. G. Ribbentrop auf die außerordentlich günstige Lage des Ortes hingewiesen, durch deren richtige Ausnutzung Lehe möglicherweise zu einem der „ersten Handelsplätze des nördlichen Deutschlands werden" könnte. Nachdem Wagner auch in Bremen nichts erreicht hatte, wandte er sich abermals nach Hannover und fand diesmal ein besseres Entgegenkommen. Das Kommerzkollegium war bereit, in der Gegend von Karlstadt einen Hafen anzulegen und dafür 3.000 Th. G. zu bewilligen. Diese lächerlich niedrige Summe aber bewies, wie wenig das genannte Kollegium solchen Aufgaben gewachsen war. Im Jahre 1800 wurde nun aber wirklich ein Projekt der Hafenanlage aufgenommen. Doch die folgende Kriegszeit vereitelte a Iles, veranlaßte aber eine nochmalige Verwertung des Karlstadt-AreaIs zu militärischen Zwecken. Dabei setzten sich nacheinander drei Nationen in seinem Besitz.
Durch die Franzosen unter Bernadotte wurde 1804 an derselben Stelle, wo Hannover später das Fort Wilhelm erbaute, eine neue Schanze errichtet, um dem Treiben der im ganzen Lande verteilten französischen Beamten den gehörigen Nachdruck zu geben und eine Landung der Engländer zu verhindern. Diesen aber gelang es, die Batterie im Jahre 1809 auf kurze Zeit zu besetzen. Dann kam sie wieder in den Besitz der Franzosen und wurde ausgebessert und neu armiert. Nachdem aber die befreiende Kunde von dem Untergang der Großen Armee in unsre Gegend gedrungen war, erhoben sich am 14. März 1813 die tapferen Wurster unter Führung des Anton Biehl aus Imsum, belagerten, unterstützt von englischen Soldaten, die Zwingburg, die sich dann am 15. März ergeben mußte. Aber zehn Tage darauf wurde sie durch eine von Bremen aufgebrochene französische Kolonne wieder eingenommen, wobei die Besatzung bis auf einen, der sich durch eilige Flucht gerettet hatte, sofort erschossen wurde. Nach dem unglücklichen Gefecht an der Geestebrücke bei Lehe wurde der Ort der Plünderung durch die französischen Truppen preisgegeben und die ganze Gegend kam wieder in die Hand der Feinde. Da kamen die Russen als Befreier in unser Land. Am 24. November 1813 ergab sich ihnen die Batterie von Karlstadt und wurde später zerstört. Nachdem auch die Russen das Unterwesergebiet wieder verlassen hatten und nach dem Rhein abgezogen waren, kam die Geeste- und Wesermündung mit den angrenzenden Landesteilen wieder an Hannover und unter britischen Schutz.
Nach dem Friedensschlüsse von 1815 gab es in unserer schwer heimgesuchten Gegend viele Mühe und Arbeit in der Wiederherstellung des Zerstörten und Geraubten. Die Ländereien lagen ringsum verödet da. Der Viehstand war fast ausgestorben. Es fehlte überall an dem Notwendigsten. Durch reiche Hilfe des Vizekönigs Georg IV. von England wurde wenigstens die größte Not beseitigt. Nachdem wieder Ruhe und geordnete Verhältnisse eingetreten waren, wurde eine Hafenanlage an der Geeste und Weser wieder ernstlich erwogen.
Als im Mai 1816 Smidt in Frankfurt die Verhandlungen wegen Aufhebung des von Oldenburg zum Schaden Bremens eingeführten Elsflether Zolles begann, kam es ihm in den Sinn, in einer Unterhaltung mit dem oldenburgischen Bevollmächtigten von Berg, „die mit Hilfe Hannovers durchzuführende Anlage eines Hafens am rechten Weserufer als Drohung gegen Oldenburg hinzuwerfen" (von Bippen, die Gründung Bremerhavens in „Johann Smidt", Gedenkbuch). Den einmal aufgestiegenen Gedanken besprach er dann näher mit dem hannoverschen Minister von Martens und fand bei diesem ein ziemlich bereitwilliges Entgegenkommen. Am 15. Mai berichtete er darüber an den Senat und empfahl den Plan zu erwägen, um so mehr, als das gegenwärtige Verhältnis zwischen Bremen und Hannover ein durchaus freundliches sei. Freilich bemerkte er damals, daß er hierbei nicht dächte „an Acquisition von Land und Leuten, die Hannover doch nicht zugestehen würde und die Bremen im Grunde wenig frommte, sondern an Handelsvorteile, die im Grunde auch nicht ohne Vorteil für Hannover seien". Sein Gedanke fand aber nicht die Zustimmung seiner Kollegen im Senat.
Wahrscheinlich war es doch auf diese von Smidt ausgegangene Anregung zurückzuführen, daß Hannover bald für eine Hafenanlage Landstrecken an der Geeste und Weser ankaufte. Freilich wurde der 1817 aufgenommene „Plan der Geeste von der Leher Brücke bis zur Mündung in die Weser, wegen projektierter Hafenanlagen13 nicht berücksichtigt. Nach diesem Projekte sollte eine Abdämmung der Abschnitte der alten Geeste, eine Eindeichung der alten Karlstadt, und von der Geeste am Welacker aus (s. die Karte 2 im Anhang mit dem zweiten Projekte: a, a...) die Ausgrabung einer neuen Mündung des Flusses nördlich des ehemaligen Geländes der Karlstadt im Flurgebiet des Wintzelweges stattfinden und so eine nahe Verbindung mit Lehe hergestellt werden. – Auch das erste schon im Jahre 1800 von Hannover aufgenommene Projekt wurde für die Hafenanlage nur soweit berücksichtigt, als es die Beibehaltung der jetzigen Mündung der Geeste vorsah (s. im Anhang die Karte 2 zum ersten Projekt, mit b, b... gekennzeichnet). Dagegen wurde Abstand genommen von der auf dem Plane gezeichneten Eindeichung der alten Karlstadt, von dem Durchstich der Geeste an der „Geestehelle", der Durchhammung der alten Geeste, von einem Steinweg vom Leher Zollhaus an die Geeste und der Errichtung eines Krans bei der Leher Brücke, kurz: von allen Vorkehrungen, welche den Flecken Lehe mit in die Hafenanlage einziehen sollten. Der Lauf der Geeste blieb unverändert und die Hafenanlage, die ziemlich fern vom Flecken Lehe lag, beschränkte sich auf das Gebiet der Geestemündung. In der unteren Geeste wurden einige Duc d'Alben eingeschlagen, an denen die Schiffe festlegen konnten, ein Hafenhaus wurde am rechten Ufer der Geeste erbaut und als Hafenmeister daselbst Johann Deetjen, Sohn des Oberlotsen Ludwig Deetjen in Geestendorf, eingesetzt Neben der Hafenmeisterwohnung wurde noch ein Materialienhaus errichtet.
Im Jahre 1820 wurde am rechten Ufer der Geeste durch das Schlickwatt der Weser ein Pfahlhöft erbaut und ein kleiner Teil des Weserufers mit Steinböschung versehen, um das Ufergelände vor Abbruch zu schützen. Später wurde noch am linken Ufer der Geeste bei dem sogenannten Ratjens Loch ein Kran aufgerichtet und ein Ausladungsplatz geschaffen. Zur Belebung des neu errichteten Geestehafens durch Gewerbe und Handel erließ die hannoversche Regierung durch den Oberdeichgraf Niemeyer eine Aufforderung zur Ansiedlung am rechten Geesteufer. Bis zum 6. Juni 1820 hatten sich vier Leute gemeldet, die sich am Hafen zwischen dem Schirmdeich und den Puttkuhlen als Gewerbetreibende anzubauen wünschten. Der erste war der Schmied Gideon Heinrich von Glahn aus Dingen im Wursterland. Er will nicht bloß eine Schmiede errichten, sondern auch „herbergieren, Brandweilschenken, logieren und speisen". Der zweite ist Friedrich Jantz en aus Dorum, welcher sich seinen Bauplatz gerade dem Ratjens Loch gegenüber, also im Angesicht des künftigen Krans und Ausladungsplatzes gewählt hat, um daselbst eine Bäckerei, Wirtschaft, etwas Handlung und „Speditionsgeschäft" zu betreiben. Der dritte, welcher sich gemeldet hat, ist der Maurer Johann Wilhelm Vaß, der mauern, auch zugleich backen will. Da der Hafen keiner Maurerarbeit bedarf, so würde dieser „Professioniste" keinen anderen Verdienst haben können, als durch die neuen Anbauer, und wenn diese mit ihren Häusern fertig sind, würde das Gewerbe still liegen, das ohnehin von jedem anderen Orte aus ebenso bequem betrieben werden kann. Und da an Bäckern fürs erste kein Mangel sein dürfte, Kalk- und Mehlarbeit beieinander auch nicht sonderlich zusammenpassen scheint, so wird dieser Mann „nicht weiter aufgemuntert" und sieht schließlich selber von seinem Vorhaben ab. Der vierte ist der Zimmerbaas Jantzen Cornelius zu Hucksiel in Oldenburg, der an der südöstlichsten Ecke der Karlstadt auf dem breiten Vorlande zwischen Schirmdeich und der Geeste eine Schiffszimmerwerft als ausschließliches Privilegium auf fünf bis sechs Jahre anlegen möchte.
Dem Schmied von Glahn wurde ein Bauplatz von 122 Quadratruten gegenüber der Wohnung des Zimmerbaas Cornelius angewiesen, doch konnte er zum Hausbau keinen Rat schaffen und begnügte sich für die ihm beim Hafenbau verdungene Schmiedearbeit mit einer Hütte im Außendeichslande nahe bei dem nördlichen Pfahlhöft, zu dessen Bau viel Eisen verwandt wurde. Schon im Jahre 1821 zeigte von Glahn bei dem Gericht Lehe an, daß er seine Gläubiger nicht zu befriedigen vermöge. Nach seinem Tode 1824 wurde der Konkurs eröffnet und der Abbruch seiner Außendeichswohnung beschlossen. Doch ehe es dazu kam, wurde das leicht aufgebaute Gewese im November 1824 durch die hohe Wasserflut zerstört und weggetrieben.
Im Jahre 1825 ließ die Witwe von Glahn, die bedeutende Unterstützungen gefunden, das von dem Tischlermeister Eiter in Lehe gezimmerte Fachwerkhaus auf einem anderen, ihr vom Oberdeichgrafen Callenius angewiesenen Bauplatz, neben Friedrich Jantzen aufrichten. Im Mai des folgenden Jahres heiratete der Schmiedegeselle von Glahns, Carsten Mehrtens aus Donnern, dessen Witwe. Die beiden Anbauer Jantzen und Cornelius waren in der Lage, nach der Anweisung ihres Platzes baldigst den Bau auszuführen.
Nach den Bestimmungen der Königlich Großbritannischen Hannoverschen Regierung zu Stade, die so ziemlich übereinstimmten mit den Vorschlägen, die Niemeyer in seinem Bericht vom 6. Juni 1820 über die Bedingungen der Aufnahme für die beim Hafen sich Anbauenden gemacht hatte, müssen die Hauptgebäude mit den Fronten an der Binnenseite des Deiches anderthalb Fuß von der Kante entfernt bleiben, damit der Austritt aus der Tür und das Öffnen der Fensterflügel nicht den zwanzig Fuß breiten Fahrweg auf dem Deiche beengen. Jedem Anbauer ist zum Auffahren seiner Hauswurt oder zur Erhöhung des ganzen Platzes die Benutzung der Erde und des Schlammes in den Puttkuhlen einzuräumen, jedoch nur unter der Aufsicht der Hafendirektion, welche den Anbauern das Maß und die Art und Weise der Wegnahme der Erde und des Schlammes zu bestimmen hat. - Den Anbauern wird ferner für drei Jahre Befreiung vom Grundzinse zugestanden und in bezug auf die Zahlung von Steuern in späteren Bestimmungen möglichste Erleichterung zugesichert.
Niemeyer rechnete in seinem Bericht an die hannoversche Regierung damit, daß auch Fischer sich zum Anbau am Hafen melden könnten, und fragte zugleich an, ob solche auch an den Gerechtsamen partizipieren sollten, welche den Fischern der Dorfschaft Geestendorf und dem Flecken Lehe zuständen. Aber kein Fischer siedelte sich am Hafen an. Wer konnte ahnen, daß einst auf diesem Terrain eine stattliche Hochseefischerei mit Dampferbetrieb erstehen würde und daß an der Unterweser jenseits der Geeste einst ein Hochseefischereibetrieb sich entwickeln sollte, der auf dem Kontinent seinesgleichen sucht?
Zu den drei Ansiedlern am Geestehafen kam keiner mehr hinzu. Der Schiffahrtsverkehr befriedigte nicht und bot infolge der nicht vertieften Geeste allerlei Schwierigkeiten. Das ganze Unternehmen, mit nicht ganz unbedeutenden Mitteln ins Leben gerufen, rentierte sich nicht. Das letzte Stadium der Vorgeschichte Bremerhavens – ein Bild vergeblicher Bemühungen Hannovers, den Geestehafen lebenskräftig zu gestalten!
Erst hanseatische Sachkenntnis, hanseatischer Weitblick und Unternehmungsgeist sollten durch die Gründung eines Seehafens an dieser Stätte die glorreiche Wendung für Bremens Schiffahrt und Handel bringen und zugleich zur Belebung des Handels und der Industrie Hannovers verhelfen.
1 Die Darstellung wesentlich nach D. R. Ehmck, Festungen und Häfen an der unteren Weser. Vgl. auch Staatsarchivar von Bippen, Geschichte der Stadt Bremen, II. Bd. Und H. Smidt, Zur Geschichte des Fleckens Lehe, Jahrbuch VIII.
2 Tonnen wurden auf der Weser wahrscheinlich zuerst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gelegt, während sie urkundlich erst 1426 vorkommen (Buchenau, Die freie Hansestadt Bremen 1900, Seite 70)
3 Vgl. Ramsauer, Pastor in Dedesdorf, „Das Land Wührden".
4 Die Burg lag in der Nähe des jetzigen Geestemünder Rathauses, vielleicht etwas südlicher (Fr. Plettke, Zur Geschichte von Geestemünde, Jubiläumsausgabe der Nordwestdeutschen Zeitung 1920)
5 Nach der Mitteilung des Bremischen Chronisten, aus der hervorgeht, daß die Burg mit Kanonen, wohl den ersten unserer Heimat, armiert war (Fr. Plettke).
6 Innerhalb der letzten Geesteschleife vor der alten Mündung der Geeste.
7 D.h. also südlich von der Geeste; denn das „Vieland" war der Landstrich südlich von der Geeste bis zur Rohr, dem Nebenflusse der Lune.
8 Siehe Studienrat Dr. Bessels Geschichte der Karlsburg in seinem Werk „Geschichte Bremerhavens".
9 Vgl. H. A. Schumacher: Aus den ersten Zeiten der preußischen Kriegsflotte. Weserzeitung 1869, 13. und 15. Juni.
10 1679; siehe Druckfehlerverzeichnis, S. 395
11 Nach Bessels Mitteilungen.
12 Nach Bessels Mitteilungen.
13 Der außerdem auf dem Plan gezeichnete lange Mündungskanal in die Weser, von der Geeste am „Vorhorn" aus, scheint nie ernstlich erwogen zu sein (s. die Karte)
Zweiter Teil
Die Entwicklung Bremerhavens von seiner Gründung bis zu seiner Stadtwerdung den 18. Oktober 1851 oder Alt-Bremerhaven
Die Gründung durch Bürgermeister Johann Smidt und der Definitivtraktat
Die Gründung Bremerhavens, mit der eine neue Ära nicht allein für Bremen, sondern für den Handel und die Schiffahrt der ganzen Weser begann, ist unzertrennlich verbunden mit dem Namen Johann Smidts. Führen wir uns in Kürze aus den Darstellungen von Otto Gildemeister, Elard Hugo Meyer und Wilhelm von Bippen den Lebensgang und die geistige Entwicklung des größten Sohnes Bremens vor Augen.
Johann Smidt, geboren am 5. November 1773, war der einzige Sohn des Predigers Johannes Smidt an der St. Stephanikirche, eines der letzten von jenen bremischen Geistlichen, welche von holländischen Universitäten die reformierte Lehre in die Vaterstadt zurückbrachten und deren Reinheit und starren Ernst mitten in der Zeit der Aufklärung behüteten. Nachdem der Sohn das Lateinische Pädagogium in Bremen absolviert hatte, bezog er im Oktober 1792 die Universität Jena, um nach der damals in Predigerfamilien herrschenden Sitte dem Studium der Theologie sich zu widmen. Jena war damals die bedeutendste deutsche Universität, in dem der Geist freier Wissenschaft wehte und Kants mächtiger Einfluß sich auf alle Gebiete der Wissenschaft erstreckte.
Griesbach führte ihn in das Neue Testament und die Kirchengeschichte ein. Weit tiefer wirkte Paulus auf ihn ein, der große Vater des Rationalismus, der Professor der natürlichen Wundererklärung, der für diese eine förmliche Methode erfand. Über der Theologie vergaß er die Philosophie nicht. In diese wurde er durch Reinhard eingeführt, der den Wißbegierigen das Verständnis von Kants „Kritik der reinen Vernunft und der praktischen Vernunft" eröffnete, und dem jungen Smidt persönlich nahetrat. Bei ihm hörte er Logik, Metaphysik und Geschichte der Philosophie. Smidts Freude an der Literatur bestätigte sich auch in dem Besuch der Vorlesungen, die Schütz hielt, der Leiter der „Allgemeinen Literaturzeitung", des erfolgreichsten Organs der Kantischen Lehre. So drang Smidt im Laufe eines Jahres in verschiedene Gebiete des Wissens ein und sammelte mit gewohnten Eifer eine Fülle neuer Kenntnisse und Anschauungen. Da reifte in ihm der Entschluß, sein Studium zu unterbrechen und für längere Zeit nach Bremen zurückzukehren. Der Tod seines treuen Freundes und Studiengenossen, des Mediziners Boismann und ein übermäßiger Arbeitseifer hatte seine Nerven hart angegriffen. Die Hinfälligkeit des hochbetagten Vaters, die bevorstehende Hochzeit der geliebten Schwester mit Dr. jur. Gerh. Castendyk und der Umstand, daß sein Bremer Freund, der Theologe Lange, der jetzt seinem Herzen am nächsten stand, nach überstandener Krankheit den Winter in Bremen zubringen wollte – das alles trieb zur Rückkehr in die Heimat.
Am 29. September traf er mit Lange in Bremen ein. Doch war auch diese Zeit in seiner Vaterstadt nicht ohne Arbeit und Frucht, denn schon am 7. April des folgenden Jahres bestand er sein theologisches Examen zur vollsten Befriedigung des Ministeriums. Die Prüfungskommission gab ihm indes zum Schluß den väterlichen Rat, sich ja vor Überarbeitung zu hüten. Dies hielt Smidt jedoch nicht ab, im Mai 1794 in seinem geliebten Jena einen zweiten Aufenthalt zu nehmen, der nun noch in höherem Grade als der erste seine Geisteskräfte anspannen sollte. Smidt setzte zwar seine theologischen Studien unter Paulus fort, aber einer war es, der seine Charakterbildung außerordentlich fördern sollte, der Philosoph J. G. Fichte, der im Frühjahr 1794 vor der erwartungsvollen Studentenschaft auftrat, zu einer Zeit, wo in Frankreich der blutdürstige Konvent alles Bestehende niederwarf. „Die Dinge werden erst durch unser Ich geschaffen; es gibt kein Sein, sondern nur Handeln, der sittliche Wille ist die einzige Realität." Solche Gedanken Fichtes weckten in Smidt zu jener Zeit, wo nach seinem eigenen Bekenntnis Hypochondrie und Kränklichkeit sein Wesen drückten, wieder Mut und Kraft und stärkten die Energie des Willens. Der politische demokratische Geist seiner Lehre, sein aufgeschlossener Sinn für die großen Zeitereignisse, vor allem aber seine Charakterstärke flößten Smidt die tiefste Verehrung ein. Dieser genoß die große Ehre, täglich mit Fichte zu verkehren und jeden Mittag bei ihm zu speisen in Gemeinschaft mit dem Historiker Woltmann und dem Philosophen und Theologen Niethammer. Auch lernte Smidt Goethe14, der sich öfters in Jena aufhielt, in geselligen Kreisen kennen und hatte Zutritt zu seinem Hause in Weimar.
Mächtig zog unseren Smidt auch der jugendliche Professor Woltmann an, der zugleich mit Fichte nach Jena kam und große Hoffnungen erregte. Er förderte sein Geschichtsstudium, dem er von jeher besonders zugetan war. Neben seinem Verkehr mit Fichte und anderen Professoren war wohl für Smidt das wichtigste Moment seines zweiten Jenenser Aufenthaltes die Teilnahme an der „Literarischen Gesellschaft der freien Männer" aus Fichtes Anhängern, mit der gegen das wüste Ordenswesen mancher Studierenden der Anfang zu einer geistigen Umbildung des deutschen Studentenlebens gemacht wurde. Dieser Verein zählte mehrere bedeutende Mitglieder, den Dänen von Berger, den Lübecker Köppen und den Oldenburger Herbart, die später alle als namhafte Professoren der Philosophie an Universitäten wirkten und mit denen Smidt in engerem Verkehr blieb. Smidt wollte ursprünglich noch bis Ostern 1796 in Jena bleiben, weil er zur Vorbereitung auf seinen geistlichen Beruf nirgends bessere Gelegenheit finde als dort. Er gab indes diesen Plan wieder auf, vornehmlich, um seinen abermals schwer erkrankten Freund Lange in die Heimat zu begleiten. Aber die am 2. April 1795 angetretene gemeinsame Fahrt fand in Naumburg ein jähes Ende, wo Langes Zustand eine Weiterreise ausschloß. In der Nacht vom 4. auf den 5. April sah Smidt den Freund sterben. Er mußte einsam in der fremden Stadt am Grabe Langes stehen, wie dieser selbst vor zwanzig Monaten an der Gruft Boismanns gestanden.
Mit Lange verlor Smidt den dritten seiner bremischen Jugendfreunde, denn auch Coch aus Bremeriehe, der vor drei Jahren mit Smidt und Lange zur Universität gegangen war, war nach einer vergeblichen Kur in Driburg schon im September 1794 in Bremen gestorben.
Tief erschüttert fuhr Smidt allein weiter und mußte in Braunschweig die Hilfe des Arztes in Anspruch nehmen, der erst nach etwa achttägiger Ruhe die Weiterreise gestattete.
Nach Bremen zurückgekehrt, blieb Smidt bis zu seines Vaters Tod 1796 ohne feste Anstellung, gelegentlich als Hilfsprediger und mit Unterrichterteilen beschäftigt. Besonders nahe stand ihm der freier gerichtete Prediger Stolz an St. Martini, ein geborener Züricher. Auf dessen Veranlassung reiste er 1797 nach der Schweiz, um in pfarramtliche Tätigkeit zu treten. Am 1. September wurde er nach kurzem Colloquium und einer Probepredigt über Ev. Joh. 8,36 („So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei") in Zürich ordiniert. Nur ganz kurze Zeit sollte er den Talar tragen. Die Schweizer Reise vermochte nicht, ihm den Beruf eines Geistlichen als seine Lebensaufgabe zu weihen. Smidt erkannte immer mehr, daß sein Interesse auf anderen Gebieten als auf dem der Theologie und der pfarramtlichen Tätigkeit lag. So nahm er denn mit Freuden die ihm im Oktober desselbigen Jahres angebotene Professur der Philosophie am Gymnasium illustre in Bremen mit Freuden an. Die Stelle gewährte ihm Muße genug, um andere Arbeit zu unternehmen, bei welcher er eifrig mit Politik sich beschäftigte und Vorlesungen vor weiteren Kreisen hielt, deren Ertrag ein notwendiger Zuschuß zu dem dürftigen Professorengehalt von 100 Th. G. wurde.
Am 1. Januar 1798 verheiratete er sich mit Wilhelmine (Minchen) Rode, der zweiten Tochter des Apothekers in der Sögestraße. Diese Ehe, welche die goldene Hochzeit überdauerte, brachte einen häuslichen Frieden, aus welchem dem späteren bedeutsamen Staatsmann die ungebrochene Kraft in seiner vielseitigen und mühereichen Arbeit erwuchs. Bald war sein Ansehen im Kreise seiner Mitbürger so gestiegen, daß im Jahre 1800 das einflußreiche Kollegium der Ältermänner beabsichtigte, ihn, einen Geistlichen und Nichtjuristen, zu seinem Syndikus zu erwählen.
Da trat im Dezember desselbigen Jahres eine Vakanz im Bremer Rat ein, die eine bedeutsame Wendung für sein Leben und Wirken brachte. Zur Überraschung mancher doctores utriusque Juris wurde Herr Johannes Smidt in den Rat der kaiserlichen Reichsstadt Bremen gewählt. Zwei Jahrzehnte später erreichte er die höchste Ehrenstufe des Staates, indem der Rat am 26. April 1821 ihn zum Bürgermeister erwählte. So Großes Smidt auch geleistet hat: in der französischen Zeit und nach dem Sturz Napoleons für die Rettung der politischen Selbständigkeit seiner Vaterstadt, als Bevollmächtigter auf dem Wiener Kongreß, als Gesandter in der Frankfurter Bundesversammlung durch die endgültige Beseitigung des Elsflether Zolls, dieser 200jährigen Plage für Bremens Handel und Schiffahrt, so erfolgreich seine von 1817 an beginnende Mitarbeit an einer Reihe von Handelsverträgen mit fremden Staaten15 war, so segensreich auch später Jahrzehnte hindurch seine Wirksamkeit war auf allen erheblicheren kommerziellen und industriellen Gebieten, allen größeren Staatsanlagen seiner Vaterstadt-die Gründung Bremerhavens ist seine größte Tat. Durch sie wurde die Weser zu einer des Welthandels würdigen Verkehrsstraße erhoben, der geretteten Selbständigkeit des bremischen Staates erst die volle Lebenskraft gegeben und Bremens Handelsgröße gegründet. –
Gründung Bremerhavens
Der von Hannover im Jahre 1818 gegründete Geestehafen mit seinen Duc d'Alben zur Festlegung der Schiffe, seinem Hafenhaus und später angelegtem Ausladungsplatz war immerhin ein günstig gelegener „Nothafen"16, in welchem einlaufende Schiffe bei schwerem Sturm oder auf dem Strom ankernde Fahrzeuge vor dem Eisgang Schutz fanden; aber damit war den wachsenden Bedürfnissen der bremischen Schiffahrt in keiner Weise genügt Die Austiefung der Geeste, eins der ersten Erfordernisse für einen ordentlichen Hafen, hatte Hannover völlig unterlassen. Zur Ebbezeit saßen die Schiffe ganz im Schlick, und zur Flutzeit war die Fahrrinne so eng, daß oberhalb liegende Fahrzeuge nur dann auslaufen konnten, wenn die weiter unten ankernden zuvor hinausgelegt wurden. – Im übrigen hatte die Versandung der Weser so zugenommen, daß Seeschiffe nicht mehr bis Vegesack hinaufkommen konnten. So sah sich Bremen nach wie vor im wesentlichen auf die oldenburgischen Hafenanstalten und Löschplätze, insbesondere auf Brake, angewiesen, das trotz des Mangels eines geschlossenen Hafens den damaligen Erfordernissen der bremischen Schiffahrt einigermaßen genügte.
Aber wie bedenklich mußte Bremens Abhängigkeit von Oldenburg werden, sobald dieses sich nicht mehr damit begnügte, die Dienerin des bremischen Handels zu sein, sondern Ernst machte, selbständig an den Vorteilen des internationalen Verkehrs teilzunehmen und als gefährlicher Konkurrent der Hansestadt aufzutreten. Durch die endgültige Aufhebung der drückenden Fessel des Elsflether Zolls, die Smidt 1820 beim Bundestag erwirkt hatte, zog Bremen sich die offene Feindschaft Oldenburgs, sowohl des Herzogs wie seiner Minister zu und war von jetzt an ganz der Willkür des feindseligen Nachbarn preisgegeben und seine Existenz als See- und Handelsplatz ernstlich gefährdet. Oldenburg konnte die Hafen- und Liegegelder ganz nach seinem Ermessen festsetzen. Redete doch kein fremdstaatlicher Hafen darein! Seine Lotsen besorgten das Einholen und Ausbringen der Schiffe bei der Lässigkeit der Hannoveraner fast allein. Die Handhabung der Quarantäne, die allein in seinen Händen lag, bot ihm günstige Gelegenheit, sich selbst zu bereichern, schädigte aber schwer den Handel. Die weite Entfernung der Löschplätze von Bremen, auf das die Güter bestimmt waren, und die schlechte Landverbindung mit den oldenburgischen Häfen wirkten lähmend auf den Handel. Dazu kam, daß der Senat endlich zu der Gewißheit gelangte, die oldenburgische Regierung erstrebe nichts Geringeres, als Brake zu einem wirklichen Konkurrenzhafen Bremens zu erheben und allmählich die Weserherrschaft an sich zu reißen. Als nämlich im Mai 1825 Senator Gildemeister nach Berlin reiste, um mit der preußischen Regierung wegen eines Streites zu verhandeln, der über die Erhebung des 1823 festgesetzten Lastgeldes zwischen Bremen und Oldenburg ausgebrochen war, hatte er das Glück, dort Kenntnis von einer Instruktion zu erhalten, welche die oldenburgische Regierung an seine Konsuln erlassen hatte. Diese Verfügung bezweckte vor allem, dem Glauben der fremden Schiffer, als sei Bremen noch ein Seehafen, ein Ende zu bereiten, den Namen Bremen aus den Schiffspapieren zu streichen und statt dessen das kleine Brake als den eigentlichen Seehafen der Weser in Konnossemente und Schiffslisten aufzunehmen. Dem Senate waren die Augen geöffnet. Schon am 1. .Juni (1825) beauftragte er die Kommission für die auswärtigen Angelegenheiten, deren Vorsitzender Smidt war, sich nach Mitteln umzusehn, den oldenburgischen Plänen entgegenzutreten. In der Nacht zu dem genannten Tage war es, wo, wie von Bippen uns aus einer von Smidts Hand aufbewahrten Notiz berichtet, zum ersten Male in ihm der Gedanke auftauchte, auf dem hannoverschen Geestegebiete einen eigenen Seehafen für Bremen zu erwerben. Freilich die Erreichung dieses Zieles blieb ein schwieriges Problem, dessen Lösung aber von der staatsmännischen Klugheit Smidts, die schon in schweren Zeiten Bremens sich bewährt, erhofft werden durfte.
Eine bessere Gegend für die Anlage eines Seehafens konnte für Bremen nicht in Betracht kommen als das Terrain an der Geestemündung. Hier war hannoversches, nicht oldenburgisches Gebiet. Hier befand man sich am östlichen Ufer der Weser, das die größere Tiefe des Fahrwassers aufweist und im Winter von schwerem Eisgang bewahrt bleibt, wenn durch den Ostwind das Treibeis zumeist nach der linken Seite der Weser getrieben wird. Hier, in der Nähe der Geestemündung, tritt das Fahrwasser dicht an das Ufer heran und bildet zugleich eine sichere und geräumige Reede, während weiter hinab infolge des weit ausgedehnten Schlickwattes größere Schiffe an die Küste nicht herankommen. Zudem gewährt die ziemlich breite Mündung der Geeste noch andere Vorteile für die Schiffahrt. –
Smidt, ganz erfüllt von dem Gedanken, der ihm aufleuchtete in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1825, besprach sich nun unverweilt mit den Kollegen der auswärtigen Kommission und mit einigen namhaften Vertretern der Kaufmannschaft aus dem Alterkollegium und legte einen eingehenden Bericht über die gepflogenen Beratungen am 17. Juni dem Senate vor. Dieser beschloß noch am Abend desselbigen Tages Smidts Sendung nach Hannover. Am 20. Juni hatte der Bürgermeister die erste Unterredung mit dem Minister von Bremer. Es kam alles darauf an, die hannoversche Regierung davon zu überzeugen, daß ihr Interesse und das bremische in bezug auf Schiffahrt und Handel Hand in Hand gehen, daß der Aufschwung Bremens für Hannover nur von Vorteil sein, und daß es im eigensten Interesse des Königreichs liege, wenn es die Hansestadt von der drohenden Weserherrschaft Oldenburgs befreie und zu einem selbständigen Seehafen an der Niederweser auf seinem Grund und Boden verhelfe. Die weiteren Verhandlungen wurden meistens mit dem Geheimen Kabinettsrat Rose geführt. Beide Herren zeigten für die Pläne des Bürgermeisters trotz aller Schwierigkeiten, die sich ihnen entgegenstellten, ein wohlwollendes Verständnis. Die verschiedenen Vertragsentwürfe mußten dem leitenden Minister Grafen Münster in London, der zeitweilig sich in Hannover oder auf seinem Schlosse Derneburg im Hildesheim'schen aufhielt, vorgelegt werden. Smidt, der wohl wußte, daß die Abtretung eines Areals mit voller Staatshoheit auf die größten Schwierigkeiten stoßen würde, vermied vorerst in den Verhandlungen die Sache beim Namen zu nennen. Doch wurden seine Absichten bald durchschaut. Bremer aber wie Rose widersetzten sich energisch dem Gedanken der Hoheitsabtretung. Auch für den dritten Vertragsentwurf vom 26. Oktober 1826, zu dem Smidt aufgefordert war, glaubte das Ministerium in Hannover nicht eintreten zu können, da auch die darin vorgeschlagene gemeinsame Hoheit beider Staaten über das Hafenterrain in London sicher zurückgewiesen würde. Die weiteren Verhandlungen führten endlich am 6. Januar 1826 zu Aufstellung eines gemeinsamen Entwurfs, der dem Grafen Münster nachdrücklich empfohlen werden sollte. Dieser Entwurf enthielt für den bremischen Staat bedeutende Konzessionen. Zwar war von einer Abtretung oder auch nur von einer Teilung der Hoheit nicht mehr die Rede, aber mit Ausnahme der Militärhoheit wurde Bremen die freie Ausübung aller der Rechte, welche die Staatssouveränität ausmachen, im einzelnen zugestanden, und zudem erklärte Hannover noch in einem geheimen Separatartikel, von seiner Hoheit über das Hafengebiet niemals Gebrauch zu machen und ferner einen noch näher zu bestimmenden Bruchteil des Hafengebietes17





























