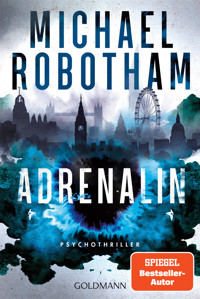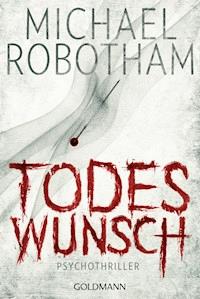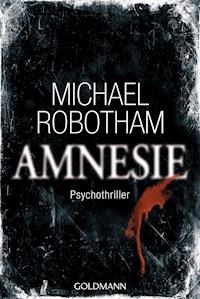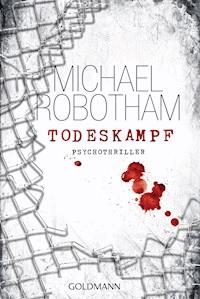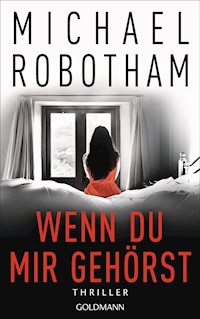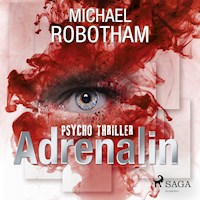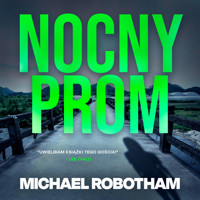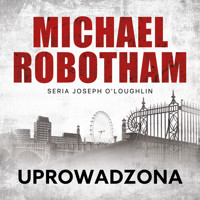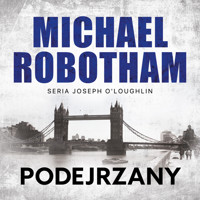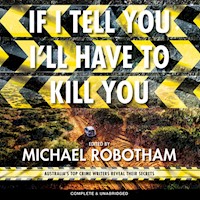9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joe O'Loughlin und Vincent Ruiz
- Sprache: Deutsch
In den frühen Morgenstunden erhält der Psychologe Joe O'Loughlin einen alarmierenden Anruf: Sein Vater William ist Opfer eines brutalen Überfalls geworden und liegt im Koma. Joe eilt ins Krankenhaus – und hält schockiert inne, als er das Zimmer betritt. Denn am Bett seines Vaters sitzt nicht Joes Mutter Mary, sondern eine völlig Fremde, tränenüberströmt, mit blutbefleckten Kleidern und der absurden Behauptung, Williams Ehefrau zu sein. Wer ist sie wirklich? Bekannte, Geliebte, verwirrte Seele – Mörderin? Gegen den Willen der Polizei beginnt Joe, eigene Ermittlungen anzustellen. Und muss erkennen, dass er für die Wahrheit einen hohen Preis bezahlt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Der Psychologe Joe O’Loughlin ist von Somerset nach London gezogen; ein kompletter Neuanfang soll ihm und seinen beiden Töchtern helfen, den überraschenden Tod seiner Frau zu verarbeiten und wieder neu Fuß zu fassen. Doch immer noch ist der Alltag schwierig, und vor allem Joes Tochter Charlie hat sehr mit dem Verlust ihrer Mutter zu kämpfen.
Mitten hinein in diese ohnehin komplizierte Situation erhält Joe einen alarmierenden Anruf: Sein Vater William, ein einst überaus renommierter Chirurg, den Joe im wohlverdienten Ruhestand auf dem Landsitz wähnt, ist mitten in London brutal überfallen worden. Aufgrund einer schweren Kopfverletzung liegt er im Koma, Joe soll sofort ins Krankenhaus kommen. Dort eilt er auf die Intensivstation, auch um seiner Mutter beizustehen. Doch die Frau, die in blutbefleckten Kleidern am Krankenbett seines Vaters sitzt, ist eine völlig Fremde. Und als sie aufsteht und behauptet, Williams »andere Frau« zu sein, bricht für Joe eine Welt zusammen.
Denn auch wenn er der Fremden kein Wort glaubt, so muss er doch erkennen, dass sein Vater nicht der Mensch ist, für den er ihn zeit seines Lebens gehalten hat. Und während er gegen den Willen der Polizei mit herausfindet, was hinter dem Überfall auf William O’Loughlin steckt und wer die Frau an dessen Seite wirklich ist, zerfällt auch Joes eigenes Leben nach und nach in Stücke …
Weitere Informationen zu Michael Robotham sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Michael Robotham
Die andere Frau
Psychothriller
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Other Wife« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London. Das Zitat von Oscar Wilde stammt aus: Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray. Übersetzt von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer, Leipzig: Insel Verlag 1909.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2018
Copyright © 2018 by Bookwrite Pty.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, nach einem Design von Blue Cork unter Verwendung von Motiven von Adobe Stock
Th · Herstellung: Han
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-23122-4V006
www.goldmann-verlag.de
Für Ian Stevenson
»Anfangs lieben Kinder ihre Eltern; wenn sie älter werden, halten sie Gericht über sie; manchmal verzeihen sie ihnen.«
Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray
Tag eins
1
Von der höchsten Stelle des Primrose Hill sehen die Türme und Kuppeln Londons im Gegenlicht des aufziehenden Tages aus wie eine gemalte Kulisse in einem Pinewood-Studio, die darauf wartet, dass die Schauspieler ihre Position einnehmen und ein unsichtbarer Regisseur »Action« ruft.
Ich liebe diese Stadt. Erbaut auf den Ruinen der Vergangenheit, jeder Quadratmeter genutzt, umgenutzt, dem Erdboden gleichgemacht, bombardiert, demontiert, wiederaufgebaut und erneut plattgemacht, bis die Ablagerungen der Geschichte wie Gesteinssedimente geworden sind, die zukünftige Archäologen und Schatzsucher eines Tages durchsuchen werden.
Mir geht es nicht anders – ich bin ein gebrochener Mann, der auf den Trümmern seiner Vergangenheit steht. Es ist jetzt dreizehn Jahre her, dass ich die Diagnose Parkinson bekommen habe. Mit einem unbewussten, willkürlichen Zucken in den Fingern meiner linken Hand fing es an; eine Gespensterbewegung, die aussah wie ein Zucken, sich jedoch las wie ein Schuldspruch. Ohne mein Wissen hatte mein Körper heimlich eine sich lange dahinschleppende Trennung von meinem Bewusstsein begonnen; eine Scheidung, in der niemand die Plattensammlung behalten darf und es keinen Streit gibt, wer den Hund bekommt.
Die kleine rollende Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger hat sich still in alle meine Glieder ausgebreitet, die mittlerweile ohne die Hilfe von Medikamenten nicht mehr tun, was ich will. Wenn ich die richtige Medizin nehme, kann ich beinahe symptomfrei wirken. Ein wenig gebeugt vielleicht und in meinen Bewegungen bedächtiger, aber weitgehend normal. Zu anderen Zeiten ist Mr Parkinson ein grausamer Puppenspieler, der unsichtbare Fäden zieht und mich zu einer Musik tanzen lässt, die nur er hören kann.
Es gibt kein Heilmittel – noch nicht –, aber ich lebe in der Hoffnung, dass die Wissenschaft das Rennen gewinnt. Bis dahin wird täglicher Sport empfohlen. Deshalb stehe ich hier vor dem Panorama von Londons verstümmelter und prächtiger Geschichte. Mein Blick schweift von Osten nach Westen und bleibt an den runden Dächern und Drahtnetzen des Londoner Zoos hängen. Ein paar Straßen von dort entfernt haben Julianne und ich unser erstes Haus gekauft. In warmen Nächten lagen wir bei offenem Fenster und wehenden Gardinen im Bett und lauschten den Schreien der Löwen, Hyänen und anderer Tiere, die wir nicht benennen konnten.
Es ist sechzehn Monate her, seit sie gestorben ist. Eine chirurgische Komplikation hieß es; ein Blutgerinnsel, das aus ihrem Unterleib bis zu ihrem Herzen gewandert ist und sich in der linken Herzkammer festgesetzt hat. Mithilfe lebenserhaltender Maßnahmen hat sie noch eine Woche durchgehalten, auf weißen Laken liegend, friedlich und schön, aber »nicht bei sich«, wie der Neurologe meinte. Wir haben die Maschinen abgeschaltet, und sie ist von uns geglitten wie ein leeres Ruderboot, das sich losreißt und in der Strömung davontreibt.
Die nachfolgenden Jahreszeiten waren wie die Stadien der Trauer. Der Sommer verging in Leugnung und Isolation, der Herbst brachte die Wut, der Winter die Schuld, und im Frühling hatte meine Depression mich dazu getrieben, Hilfe zu suchen.
Ich ertrage es um meiner Töchter willen, Charlie und Emma, die als Lebensmuster etwas Besseres verdient haben als Tragödie und in denen so viel von Julianne weiterlebt; von ihrem Haarscheitel, Tonfall und Gang bis zu ihrem Stirnrunzeln und ihrem Lachen.
Wir sind vor einem Jahr zurück nach London gezogen, nachdem wir das Häuschen in Somerset verkauft hatten. Mit dem Geld aus dem Verkauf und einem Bankdarlehen habe ich eine Wohnung in der obersten Etage eines Häuserblocks namens Wellington Court in Belsize Park gekauft, in der Nähe von Primrose Hill. Sie ist luftig und hell, mit hohen Decken und einem großen Erkerfenster im Wohnzimmer, hat drei weitere Zimmer und eine durchs Küchenfenster erreichbare kleine Dachterrasse, wo Emma und ich manchmal auf Liegestühlen sitzen wie Passagiere auf einem Ozeandampfer.
Emma ist zwölf. Ich habe sie in der Wohnung schlafen lassen und ihr einen Wecker für die Schule gestellt. Sie ist nicht mehr mein kleines Mädchen, sondern steht auf der Schwelle zum Frausein. Sie hat grüngraue Augen, lockige Haare, und ihre Haut ist so blass, dass sie fast aussieht wie eine gepuderte Kabuki-Tänzerin. Seit Januar geht sie auf die North Bridge House School, eine unabhängige Schule in North London mit Schulgebühren, die mir Tränen in die Augen treiben. Das Stipendium war ein Bonus und eine Überraschung.
Meine Älteste studiert im zweiten Jahr Verhaltenspsychologie in Oxford. Normalerweise sind Eltern stolz, wenn Kinder in ihre Fußstapfen treten, aber ich empfinde keine Freude daran, dass Charlie forensische Psychologin werden will, weil ich weiß, was sie fasziniert und wie diese Faszination begonnen hat. Sie will verstehen, warum manche Menschen schreckliche Taten begehen und von noch schlimmeren Verbrechen fantasieren; die Psychopathen und Soziopathen, die durch ihre Albträume geistern.
Ich laufe weiter den Hügel hinunter, überquere den Kanal und komme in den Regent’s Park. Eine junge Frau joggt an mir vorbei, die Pobacken von straffem Lycra umhüllt, ein Pferdeschwanz, der auf ihrem Rücken wippt. Ich überlege, sie einzuholen. Wir könnten gemeinsam laufen. Einen Draht zueinander finden. Ich träume. Sie ist weg.
Ich habe eine Verabredung mit Dr. Victoria Naparstek in einem Café in der Nähe ihrer Praxis in der Harley Street. Victoria ist eine gut aussehende Frau. Mitte vierzig. Schlank. Auffallend. Ich habe einmal mit ihr geschlafen, als Julianne und ich getrennt waren. Victoria hat die Affäre abgebrochen. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: »Du liebst immer noch deine Frau.« Ich fragte, ob das eine Rolle spiele. »Für mich schon«, erwiderte sie.
Sie wartet in einem Café am Portland Place auf mich. Sie trägt einen A-Linien-Rock und eine passende Jacke, dazu eine schlichte weiße Bluse mit offenem Kragen. Als sie lächelt, zeichnen Grübchen ihre Wangen.
»Professor O’Loughlin.«
»Dr. Naparstek.«
»Du schwitzt.«
»Da kannst du mal sehen, was du mit mir machst.«
Wir scherzen, flirten ein bisschen. Eine Kellnerin nimmt unsere Bestellung auf. Tee. Kaffee. Toast. Marmelade.
Nach Juliannes Tod haben mir alle gesagt, dass ich mit jemandem reden sollte. Ich kenne die Vorzüge einer Trauerberatung, aber ich habe mich dagegen gewehrt, bis Victoria mich einen »verdammten Idioten« und einen »typischen Mann« nannte, der dichtmacht und so tut, als würde das Problem gar nicht existieren.
»Gut siehst du aus«, sagt sie.
»Mir geht es auch gut.«
Meine erste Lüge.
»Schläfst du gut?«
»Ja.«
Eine weitere.
»Und die Träume?«
»Ein oder zwei.«
»Immer derselbe?«
Ich nicke.
Das ist Teil unserer Routine. Therapie, ohne eine Therapie zu machen. Sie fragt mich, ich antworte, und keiner fühlt sich in irgendeiner Weise verpflichtet, Vertrauliches zu enthüllen oder Ratschläge zu geben.
Victoria möchte, dass ich meine schlimmsten Ängste in Worte fasse, aber das muss ich nicht, weil ich sie jeden Tag durchlebe. Ich muss mir nicht ausmalen, allein zu sein, an einer Krankheit zu leiden oder über einer zerbrochenen Tasse oder einem heruntergefallenen Ei unvermittelt in Tränen auszubrechen.
»Wie geht es Emma?«, fragt sie.
»Gut. Besser. Gestern haben wir ihr Zimmer gestrichen und Folien an die Wand geklebt.«
»Hat sie Julianne erwähnt?«
»Nein.«
»Was ist mit Fotos?«
»Sie will sie nicht angucken.«
Bisher hat Emma weder geweint oder getobt, noch hat sie Fragen über den Tod ihrer Mutter gestellt. Sie weigert sich, Juliannes Grab zu besuchen, sich Fotos von ihr anzusehen oder sich an früher zu erinnern. Es geht nicht um Leugnung oder so zu tun, als hätte sich nichts geändert. Emma weiß, dass Julianne nicht zurückkommt, möchte das jedoch nicht weiter erörtern oder davon unser Leben bestimmen lassen.
In manchen Nächten habe ich sie zusammengerollt in ihrem Kleiderschrank versteckt gefunden.
»Was ist los?«
»Ich kann nicht schlafen.«
»Das ist okay. Mach einfach die Augen zu.«
»Was, wenn ich nie wieder schlafen kann?«
»Bestimmt kannst du wieder schlafen.«
»Was, wenn ich die Einzige bin, die wach ist? Die ganze Welt schläft, und ich bin allein im Dunkeln … ohne jemanden, der mir hilft.«
»Ich werde da sein.«
»Versprich mir, dass du nicht vor mir einschläfst.«
»Ich verspreche es.«
Emma macht sich Sorgen um mich, weil ich der letzte überlebende Elternteil bin. Wenn wir eine Straße überqueren, besteht sie darauf, meine Hand zu fassen – nicht zu ihrem Schutz, sondern zu meinem. Sie achtet darauf, dass ich gut esse, Sport mache und meine Medikamente nehme. Manchmal wache ich auf und sehe sie mit einer Hand auf meiner Brust über mein Bett gebeugt stehen. Sie zählt meine Atemzüge. Drei mal neun. Siebenundzwanzig. Das reicht normalerweise, um sie zu beruhigen.
Unser Kaffee ist gekommen. Victoria reißt ein Tütchen Zucker auf und kippt den Inhalt in den Milchschaum.
»Hast du Emma gefragt, ob sie mit mir reden würde?«
»Sie ist nicht so richtig überzeugt von der Idee.«
»Verstehe.«
»Ich möchte sie nicht drängen.«
»Das solltest du auch nicht. Lass sie selbst entscheiden, wann sie so weit ist.«
Den gleichen Rat habe ich vielen trauernden Eltern gegeben, die meine Praxis aufgesucht haben, aber wenn es um mein eigen Fleisch und Blut geht, fange ich an, dreißig Jahre klinischer Erfahrung als Psychologe zu hinterfragen.
Mein Handy vibriert auf dem Tisch. Die Nummer sagt mir nichts.
»Ist da Professor O’Loughlin?«, fragt eine Frau.
»Ja.«
»Hier ist das St. Mary’s Hospital in Paddington. Ihr Vater, William O’Loughlin, wurde mit schweren Kopfverletzungen bei uns eingeliefert.«
»Kopfverletzungen.«
»Er ist vor sechs Stunden operiert worden.«
»Operiert.«
»Um den Hirndruck zu entlasten. Er hatte innere Blutungen. Im Moment ist er in einem künstlichen Koma.«
»Koma.«
Warum wiederhole ich alles, was sie sagt?
In dem Café gibt es ein Regal mit Bonsai, Miniaturbäume mit knorrigen Stämmen und moosbedeckten Ästen. Ich ertappe mich dabei, diesen geschrumpften Wald anzustarren, ohne zu hören, was die Ärztin sagt. Meine Knie zittern.
»Sind Sie noch da, Professor?«
»Ja. Entschuldigen Sie. Was hat mein Vater in London gemacht?«
Welchen Unterschied macht das?
»Diese Information liegt mir nicht vor«, antwortet die Ärztin.
Natürlich nicht! Es ist eine dumme Frage.
»Weiß meine Mutter Bescheid?«
»Sie ist jetzt bei ihm.«
»Kann ich mit ihr sprechen?«
»Auf der Intensivstation sind keine Mobiltelefone erlaubt.«
»Verstehe. Sagen Sie ihr, ich komme.«
Ich beende das Gespräch und starre auf den leeren Bildschirm. Ich sollte meine Schwestern anrufen. Nein, das wird Mum schon erledigt haben. Ich sollte ein Taxi nehmen. Emma ist zu Hause. Ich soll sie zur Schule bringen, und danach habe ich Patienten. Meine Termine kann ich absagen.
Victoria sucht ihr Portemonnaie. »Geh nur. Ruf mich später an.«
Kurz darauf bin ich auf dem Bürgersteig und halte Ausschau nach einem Taxi. Drei fahren an mir vorbei. Besetzt. Ich jogge los und versuche verzweifelt, den linken Fuß zu heben und die Arme abwechselnd pendeln zu lassen. Auf der Euston Road staut sich der Verkehr. Ich durchquere den Regent’s Park und laufe den Primrose Hill hinauf. Meine Lunge schmerzt, und in meinen Beinen bildet sich Milchsäure.
Nachdem ich die Treppe im Wellington Court hinaufgestiegen bin, stehe ich kurz vor einem Kollaps.
»Bist du den ganzen Weg gerannt?«, fragt Emma, die in ihrer Schuluniform – gestreiftes Kleid, rote Strickjacke, schwarze Strumpfhose und Schnallenschuhe – auf der Küchenbank sitzt.
»Granddad … im Krankenhaus … ich muss los.«
»Was ist passiert?«
»Irgendein Unfall. Ich muss duschen.«
»Wird er wieder gesund?«
»Er ist in guten Händen.«
Emma folgt mir den Flur hinunter. »Im Krankenhaus passieren schlimme Sachen.«
»Was soll das heißen?«
»Menschen sterben.« Sie hat die Mundwinkel heruntergezogen, und ihre grüngrauen Augen leuchten.
»Nicht immer. Die meisten werden wieder gesund«, sage ich, wohl wissend, dass meine Worte für jemanden, der seine Mutter verloren hat, hohl klingen müssen.
»Ich will nicht, dass du gehst«, sagt sie.
»Mir wird nichts passieren.«
»Dann lass mich wenigstens mitkommen.«
»Du musst in die Schule.«
»Und wer bringt mich?«
»Ich rede mit den Jungs.«
Die Jungs sind Männer – Duncan und Arturo –, ein schwules Paar, das eine Etage unter uns wohnt. Der eine arbeitet in der Werbung, der andere führt eine Kunstgalerie in Islington. Nachdem ich geduscht und mich umgezogen habe, klopfe ich an ihre Tür. Duncan macht auf. Er trägt einen Bademantel, der gerade lang genug ist, seine Oberschenkel zu streifen.
»Joseph«, sagt er begeistert und küsst mich auf beide Wangen. Ich beuge mich ein wenig vor, um jeden Unterleibskontakt zu vermeiden.
»Mein Dad ist im Krankenhaus. Kann einer von euch Emma zur Schule bringen?«
Duncan gibt die Nachricht über die Schulter an Arturo weiter, der aus der Küche ruft: »Ich kann sie hinten auf dem Fahrrad mitnehmen.«
Ich will Nein sagen. Das übernimmt Duncan für mich. »Du nimmst sie nicht auf dem Fahrrad mit. Du fährst wie ein Irrer.«
»Ich habe einen Kursus in sicherem Fahren gemacht.«
»Bei Evel Knievel.«
Ich habe einen häuslichen Streit ausgelöst. Duncan scheucht mich mit einem Winken fort. »Geh schon, ich bring sie zu Fuß. Ich hoffe, dein Vater wird wieder gesund.«
Ein paar Minuten später sitze ich in einem Taxi, das im Verkehr auf der Edgware Road feststeckt, und lausche den Anrufern einer Talksendung im Radio, die sich über den Brexit, »Fake News«, Einwanderer und niedrige Löhne beschweren. Ich bin der Politik und des aktuellen Tagesgeschehens überdrüssig. Ich will nicht von Journalisten informiert und nicht von Politikern egal welcher Überzeugung regiert werden. Die Demokratie hat versagt. Versuchen wir es mit einer gütigen Diktatur.
Mein Vater liegt im Koma. Er ist dieses Jahr achtzig geworden, und ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals im Krankenhaus war – nicht als Patient. Vor langer Zeit habe ich ihm wegen seiner unerschöpflichen Energie und seinem unvergleichlichen Selbstbewusstsein den Beinamen »Gottes Leibarzt im Wartestand« gegeben. Mehr als fünfzig Jahre lang war er ein medizinischer Riese – Professor für Chirurgie und Gesundheitswissenschaft; Berater von Regierungen; Gründer des Internationalen Traumaforschungszentrums, Vortragsredner, Autor, Kommentator und Philanthrop. Unsere wohltätige Familienstiftung – die O’Loughlin Foundation – vergibt jedes Jahr Stipendien in Höhe von mehreren Millionen Pfund.
Ich habe Dad vor zwei Wochen gesehen, als wir in seinem Club in Mayfair zu Mittag gegessen haben; zwei durchaus angenehme Stunden auf die Art zweier traditioneller Gentlemen im Tweedjackett, die sich den Portwein anreichen. Ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Er sah gut aus. Glücklich. Er verbringt die meiste Zeit in seinem Farmhaus in Wales, kommt aber ziemlich regelmäßig zu Sitzungen und Vorträgen nach London.
Das Taxi hält vor dem St. Mary’s Hospital, und ich eile an einer Gruppe Krankenschwestern und Pflegern vorbei, die auf dem Bürgersteig rauchen. Die Haupttrauma-Station ist im neunten Stock. Während ich auf den Fahrstuhl warte, steigt mir der Krankenhausgeruch von Desinfektionsmitteln, Bohnerwachs und Körperflüssigkeiten in die Nase. Erinnerungen blubbern an die Oberfläche und verbrennen meinen Hals. Ich schlucke sie hart wieder hinunter und schmecke Erbrochenes.
Ich drücke auf die Klingel vor der Intensivstation. Eine Krankenschwester öffnet und zieht die schwere Tür mit einem Sauggeräusch auf, als würde sie eine Luftschleuse öffnen.
»Mein Vater ist hier. William O’Loughlin. Meine Mutter ist bei ihm.«
Ihr Lächeln ist aufmunternd. Ich frage mich, wie lange sie es geübt hat.
»Bitte waschen Sie sich die Hände«, sagt sie und weist auf ein Waschbecken mit antibakterieller Seife und Papierhandtüchern. Ich folge ihr durch die lange, schwach beleuchtete Station, vorbei an Reihen von Betten, die durch Apparate und Vorhänge voneinander getrennt sind. Jeder Lichtkreis umhüllt einen Menschen, der dem Tod nahe ist, verstöpselt, verklebt, gefüllt und entleert, beatmet und ausgepumpt, medikamentiert und sediert.
»Er liegt in der letzten Kabine«, sagt die Schwester. »Bitte versuchen Sie, ihn nicht zu wecken.«
Ich trete zögernd näher, werfe einen ersten flüchtigen Blick auf den gebrochenen Mann, der in dem Bett liegt, gefesselt mit Schläuchen und Kabeln. Sein Kopf ist dick bandagiert. Auf seinem Mund liegt eine Sauerstoffmaske. Über seinem Kopf hängen Infusionsbeutel. Kanülen sind gesetzt worden. Sensoren überwachen seine Lebenszeichen.
Ich will mich umdrehen und sagen: »Das ist nicht mein Vater. Das muss ein Irrtum sein.« Aber ich weiß, dass er es ist.
Neben seinem Bett sitzt halb im Schatten eine Frau. Sie blickt auf, als hätte ich sie überrascht. Ihre Augen sind rot gerändert und geschwollen.
Sie lässt Dads Hand los und steht auf.
»Joseph, nicht wahr?«
Ich nicke.
»Ich wollte nicht, dass wir uns so kennenlernen.«
»Ich verstehe nicht. Wo ist meine Mutter?«
»Sie ist nicht hier.«
»Aber man hat mir gesagt …«
»Ich habe das Krankenhaus gebeten, dich anzurufen.«
»Verzeihung, aber wer sind Sie?«
»Ich bin seine andere Frau.«
2
Wie lange stehe ich da, unfähig, etwas zu sagen? Ich lache unangenehm berührt, was für sie das Stichwort sein sollte zu sagen, dass es ein Scherz war. Sie lässt den Moment verstreichen. Ich komme mir schwach vor, beschämt und werde zunehmend wütend über ihr Schweigen. Was für ein grausamer Witz ist das? Wo sind die versteckten Kameras? Wann springt irgendjemand aus der Kulisse und ruft »April, April!«? Nur dass wir November und nicht April haben und man mich nicht so leicht zum Narren hält, glaube ich.
Der bandagierte Mann ist mein Vater. Die Frau neben ihm ist nicht meine Mutter.
»Ich bin Olivia Blackmore«, sagt sie und hält mir die Hand hin.
Ich betrachte ihre ausgestreckten Finger, als ob sie eine Waffe auf mich richten würde.
»Ich glaube, Sie haben sich geirrt«, sage ich. »Woher haben Sie meine Nummer?«
»William hat mir erklärt, wenn so etwas passiert, sollte ich dich als Ersten anrufen.«
»Wie, ›so etwas‹?«
»Ein Unfall oder etwas anderes Schlimmes.«
Sie ist Mitte vierzig mit dunklem Haar und Spuren von Make-up. Sie hat einen leichten Akzent, osteuropäisch vielleicht, der mit der Zeit verblasst ist. Sie trägt hochhackige Schuhe, eine dunkle Strumpfhose und einen locker mit einem Gürtel zugebundenen Trenchcoat.
»Man hat mir gesagt, meine Mutter sei hier …«
»Die Krankenschwester hat mich missverstanden.«
Ich suche vergeblich nach Worten. »Kommt meine Mutter?«
»Nein.«
Ich setze neu an. »Was ist ihm zugestoßen?«
»Ich habe ihn am Fuß der Treppe gefunden.«
»Welche Treppe?«
»Im Haus.«
»In wessen Haus?«
»In unserem.«
»Wer sind Sie?«
»Ich bin seine Frau.«
»Er ist schon verheiratet.«
»Seine andere Frau.«
»Sind Sie seine Geliebte?«
»Nein.«
Es ist eine alberne Unterhaltung. Ich möchte mich bremsen. Wieso rede ich überhaupt mit ihr? Sie ist offensichtlich verrückt. Wie ist sie an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen?
Ich versuche es erneut. »Er kann nur eine Frau haben. Wollen Sie behaupten, er wäre ein Bigamist?«
Olivia schüttelt den Kopf. »Es tut mir leid, Joseph. Ich drücke mich nicht sehr klar aus. Ich weiß, dass das ein Schock für dich sein muss. Dein Vater, William, hat mir ein Versprechen gegeben. Wir haben auf Bali geheiratet. Es war eine buddhistische Zeremonie.«
»Er war noch nie auf Bali.«
»Du irrst dich.«
»Er ist kein Buddhist.«
»Nein«, erwidert sie, »aber ich.«
Diesen Moment wählt mein Körper, um zu erstarren. Das macht er manchmal – blockiert oder verkrampft total, als würde ich Stopptanzen spielen und jemand hätte die Musik ausgeschaltet.
»Brauchst du deine Tabletten?«
Woher weiß sie das?
»Ich kann dir Wasser holen.« Sie berührt meinen Unterarm.
»Nein!«, fauche ich und wische ihre Hand weg. Mein Körper reagiert also wieder.
Olivia macht einen Schritt zurück, als hätte sie plötzlich Angst vor mir. Sie setzt sich wieder auf den Stuhl und will Dads Hand ergreifen.
»Ich möchte nicht, dass Sie ihn anfassen.«
»Verzeihung?«
»Nehmen Sie Ihre Hände weg, oder ich rufe die Polizei.«
»Nur zu.«
Mir kommt der Gedanke, dass niemand meine Mutter benachrichtigt hat. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche.
»Das darf man hier drinnen nicht«, sagt Olivia und zeigt auf ein Schild. »Dafür musst du rausgehen.«
Ich trete näher ans Bett und flüstere wütend: »Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie hier sind, aber mein Vater und meine Mutter sind seit sechzig Jahren verheiratet. Er hat keine ›anderen Frauen‹.«
»Nur mich«, sagt sie leise.
»Ich möchte, dass Sie gehen«, sage ich wütend auf sie.
»Bitte, werde nicht laut.«
»Ich mache, was mir, verdammt noch mal, gefällt.«
Eine Krankenschwester der Intensivstation ist von unserem Streit angelockt worden. Sie ist hübsch mit einem runden Gesicht und Dreadlocks. Sie fordert uns beide auf, leiser zu sein.
»Diese Frau ist nicht meine Mutter«, sage ich. »Ich will, dass sie hier verschwindet.«
Die Frau sieht Olivia argwöhnisch an. »Ist das wahr?«
»Nein, ich bin seine Ehefrau.«
»Ich habe sie nie zuvor gesehen«, erkläre ich. »Ich will, dass sie hier verschwindet.«
»Ich weiß, du bist erregt, Joseph, aber bitte tu das nicht«, fleht Olivia. »Geh und ruf deine Mutter an. Ich bleibe hier bei William.«
Ihr Trenchcoat hat sich geöffnet. Darunter trägt sie ein grünes Cocktailkleid mit dunkleren Flecken.
»Ist das Blut?«
Sie schließt den Mantel wieder. »Ich habe ihn gefunden. Er lag am Fuß der Treppe.«
»Wo?«
»Das habe ich doch schon gesagt. In dem Haus in Chiswick. Dort leben wir.«
Ich schüttele den Kopf. »Nein! Nein! Nein!«
»Ich sage die Wahrheit.«
»Sie leiden unter Wahnvorstellungen.«
Der Krankenschwester reicht es. »Ich möchte, dass Sie beide gehen.«
»Jemand muss bei ihm bleiben«, sagt Olivia und blickt zu Dad.
»Nein! Alle beide raus hier.« Sie wird sich nicht umstimmen lassen.
Olivia nimmt ihre Handtasche unter dem Stuhl. Ich warte, dass sie vor mir geht, damit sie nicht irgendwelche Tricks versuchen kann. Ich weiß nicht, was ich erwarte – sie könnte die Apparate sabotieren oder Dad mit einem Kissen ersticken.
Die Tür der Intensivstation fällt hinter uns zu. Olivia zieht ein Papiertaschentuch aus der Manteltasche und schnäuzt sich die Nase. »Ich habe so viel Gutes über dich gehört, Joseph, aber ich dachte nicht, dass du so grausam sein kannst.«
Sie hält inne und vergewissert sich, dass ich sie gehört habe, bevor sie ein paar Schritte den Korridor hinuntergeht und sich auf einen Stuhl setzt.
Ich wähle die Nummer meiner Mutter. Das Telefon klingelt. Ich stelle mir vor, wie sie durch den Flur in dem Farmhaus in Wales tappt, den Hörer abnimmt und ihre vornehm klingende Stimme aufsetzt. Aber sie antwortet nicht. Sie hat ein Handy. Ich versuche es bei dieser Nummer.
Sie geht dran und schreit, um sich bei dem Lärm im Hintergrund verständlich zu machen.
»Joseph?«
»Wo bist du?«
»Ich bin im Zug.«
»Kommst du nach London?«
»Nein. Warum?«
»Dad liegt im Krankenhaus. Auf der Intensivstation.«
Ich höre ein scharfes Einatmen.
»Er liegt auf der Intensivstation«, wiederhole ich. »Er wurde letzte Nacht operiert. Ich bin jetzt hier. Ich dachte, man hätte dich vielleicht angerufen.«
»Nein.«
Ihre Stimme zittert.
»Er hat schwere Kopfverletzungen. Ich kenne noch nicht alle Einzelheiten. Du solltest hier sein.«
»Ja, natürlich … ich … ich …«
»Was hat Dad in London gemacht?«, frage ich.
»Er hatte eine Aufsichtsratssitzung. Er ist gestern gefahren. Was ist passiert?«
»Ich glaube, er ist eine Treppe hinuntergefallen.«
»Wissen die Mädchen Bescheid?«
Sie spricht von meinen Schwestern: Lucy, Patricia und Rebecca.
»Ich rufe sie an.«
»Bitte lass deinen Vater nicht allein«, sagt sie. »Bleib bei ihm.«
»Das mache ich.«
Ich beende das Gespräch, blicke auf und sehe zwei Polizeibeamte aus dem Fahrstuhl treten, der eine in Uniform, der andere in Zivil. Der Detective ist älter und massiger, mit einer Nickelbrille und nordischen Gesichtszügen. Er spricht mit einer Krankenschwester, die den Flur hinunter in meine Richtung zeigt. Ich warte auf sie, aber sie suchen nicht mich. Sie bleiben vor Olivia stehen, die von ihrem Handy aufblickt. Ich kann ihre Unterhaltung nicht hören, doch ich sehe, dass sie sich empört. Sie ist verhaftet worden! Als Lügnerin entlarvt. Gut! Aber im selben Moment sehe ich in ihren Augen eher Verletzung als Furcht.
Sie wollen gehen. Olivia blickt auf ihre Füße, als hätte sie etwas fallen lassen.
»Wohin bringen Sie sie?«, frage ich und gehe ihnen nach.
Der Detective dreht sich um und baut sich breitbeinig vor mir auf. »Wie heißen Sie, Sir?«
»Joseph O’Loughlin.«
»Sind Sie verwandt mit William O’Loughlin?«
»Er ist mein Vater.«
»Kann ich einen Ausweis sehen?«
Ich zeige ihm meinen Führerschein.
Er zeigt auf Olivia Blackmore. »Kennen Sie diese Frau?«
»Nein.«
»Haben Sie sie je zuvor gesehen?«
»Nein, nie. Warum?«
Der Detective ignoriert meine Frage, wendet sich ab und geht Richtung Fahrstuhl. Ich folge ihm. »Was ist mit ihm passiert? War es ein Unfall?«
Keiner der Beamten verlangsamt seine Schritte. Sie haben den Aufzug erreicht. Ich blockiere die Türen.
»Hat sie das getan?«
»Bitte, treten Sie zurück«, sagt der Detective.
»Wohin bringen Sie sie?«
»Auf die Polizeiwache in Chiswick.«
Die Türen schließen sich. Olivia hebt den Blick und sieht mich an.
»Wenn er aufwacht, sag ihm … sag ihm … dass ich ihn liebe.«
3
Meine älteste Schwester Lucy wohnt in Henley, westlich von London, zusammen mit ihrem Mann Eric, einem Fluglotsen, und drei Kindern, deren Namen ich mir nie merken kann, weil sie alle auf »i« enden. Ich drücke ihre Nummer und lausche dem Klingeln.
Lucy nimmt ab. Mein linker Arm zittert. Sie ist im Auto.
»Kannst du telefonieren?«
»Ich habe auf Freisprechen gestellt. Was ist los?«
»Dad ist im Krankenhaus. Er hatte irgendeinen Unfall. Er wurde gestern Nacht operiert, um den Hirndruck zu entlasten.«
Ihre Stimme wird anders, höher. »Ist er gefahren?«
»Ein Sturz, glaube ich. Er liegt im St. Mary’s Hospital in Paddington.«
»Hast du mit ihm gesprochen?«
»Er liegt im Koma.«
»Mein Gott! Wo ist Mummy?«
»Sie nimmt einen Zug.«
»Was ist mit Patricia und Rebecca?«
»Ich hab dich als Erste angerufen.«
Lucy ist die natürliche Anführerin unter uns Geschwistern – die kompetente, organisierte Schwester, die Familienfeiern organisiert, keinen Geburtstag vergisst und jedes Weihnachten unseren »Heimliches-Christkind«-Geschenkeeinkauf koordiniert. Patricia, meine zweitälteste Schwester, lebt mit ihrem Mann Simon, einem Anwalt für Strafrecht, in Cardiff. Rebecca, die Jüngste, ist eine Überfliegerin, die für die Weltbank in Genf arbeitet. Ich bin das Baby der Familie – der lange erwartete Junge, aber nicht der kleine Prinz. Von dieser Position habe ich abgedankt, als ich entschied, nicht Chirurg, sondern Psychologe zu werden, und damit eine mehr als hundert Jahre zurückreichende medizinische Dynastie beendete.
»Ich ruf Patricia an«, übernimmt Lucy das Kommando. »Rebecca ist im Südsudan. Vielleicht erreichst du sie auf ihrem Handy. Ich komme, sobald ich kann.«
Nachdem Lucy aufgelegt hat, rufe ich Rebecca an und hinterlasse eine Nachricht, in der ich knapp die Details schildere und erkläre, sie solle sich keine Sorgen machen und mich zurückrufen. Und jetzt, was als Nächstes? Es muss noch andere Freunde der Familie geben, denen ich Bescheid sagen kann, doch ich will die Nachricht nicht teilen, noch nicht. Wie auf Autopilot starre ich aus dem Fenster – auf die von Kränen und halb fertigen Bürotürmen gesprenkelte Skyline. Tauben drehen flatternd ihre Runden am blassblauen Himmel, der von Düsenjets in der Troposphäre mit Streifen wie Kreidespuren verschmiert ist. Ein Tag wie dieser sollte dunkler und trüber sein, sollte die Nachricht oder meine Stimmung widerspiegeln.
Ich kehre zurück auf die Intensivstation, setze mich neben Dads Bett und fasse seine Hand – etwas, was ich seit meiner Kindheit nicht mehr getan habe. Habe ich es als Kind getan? Ich muss es getan haben.
Ich betrachte sein Gesicht. Bis Mitte fünfzig hat er sein dichtes Haar getönt. Als er das Färbemittel wegwarf, wurde er über Nacht schlohweiß und alterte so würdevoll, wie er lebte. Ein Fremder könnte die Linien um seine Augen für Lachfältchen halten, aber die Furchen sind am tiefsten, wo seine Haut sich am häufigsten gefaltet hat, und illustrieren perfekt sein kritisches Wesen und seine allgemeine Unzufriedenheit mit den Menschen, vor allem mit seinen Kindern, ganz besonders mit mir.
Es fühlt sich seltsam an, ihm so nahe zu sein. Ich glaube nicht, dass ich jemals zehn Minuten mit meinem Dad allein verbracht habe, in denen er mich nicht erniedrigt oder beleidigt hat. Das ist vielleicht übertrieben, aber seine Ansichten waren überwiegend missbilligend und ablehnend. Kinder sollte man weder hören noch sehen. Niemals verhätscheln oder zu sehr loben.
Mein Vater hat nichts Leichtes, Spielerisches oder Schelmisches. Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann in meiner Kindheit Liedchen gesungen, Tänzchen aufgeführt oder herumgealbert hat. Er hat uns nicht durch den Garten gejagt, mit uns Verstecken gespielt oder auch nur mal mit lustig verstellter Stimme gesprochen. Er hat uns nicht angezogen, das Frühstück gemacht, vor der Schule abgesetzt, zum Sport gefahren, beim Klavier üben zugehört oder bei den Hausaufgaben geholfen. Wenn wir gestürzt waren und uns wehgetan hatten, rannte keiner von uns zu Dad, rief seinen Namen oder krabbelte auf seinen Schoß.
Damit will ich nicht sagen, dass er uns vernachlässigt hat. Schließlich haben andere diese Aufgaben übernommen: meine Mutter, Kindermädchen, Au-pairs und Haushälterinnen. Dad wurde andernorts gebraucht. Die Verwundeten, Gebrochenen und Kranken bedurften seiner. Er rettete Leben. Er war ein Pionier neuer OP-Techniken. Er kämpfte gegen Krankheiten, die Kinder verschlangen und Familien zerrissen.
Von manchen Müttern sagt man, sie seien »geborene Mütter«, manche Väter nennt man »geborene Väter«. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Mein Vater ist einfach mein Vater. Steif. Gehemmt. Starrsinnig. Streitsüchtig. Fordernd. Abwesend.
Selbst wenn er zu Hause war, verbrachte er viele lange Stunden in seinem Arbeitszimmer. Wenn wir im Garten spielten, achteten wir darauf, nicht zu laut zu toben, weil wir sonst Gefahr liefen, dass er das Fenster aufriss und brüllte, wir sollten still sein. Einmal hat Rebecca sich in die Hose gemacht, als sie seine Stimme hörte, aber sie war auch berüchtigt dafür, sich vor Aufregung leicht in die Hose zu pinkeln.
Als ich acht oder neun war, klagte ich einmal, dass ich Hunger hätte; Dad hat mir daraufhin den ganzen Tag lang jegliches Essen verweigert, damit ich echte Entbehrung erfahren konnte und das Elementarste schätzen lernte. Und als ich einmal vergessen hatte, das Feuer in unserem holzbefeuerten Aga am Brennen zu halten, zwang er alle, am Abend ein kaltes Mahl zu essen, damit meine Schwestern meine Strafe »teilten«.
Wo war meine Mutter bei alldem? Mittendrin. Den Frieden bewahren.
Sie umarmte, küsste, verband und pflegte. Sie erklärte uns jeden Tag, dass Dad uns liebte, und hielt uns an, für ihn zu beten.
Als Junge wurde mir sehr schnell klar, dass mein Dad nicht wie andere Väter war.
Bei geselligen Anlässen stand er nicht am Grill und trank Bier, wendete Würstchen und redete über Fußball oder Rugby. Er hielt sich abseits, ein Glas Mineralwasser in der Hand, selbst im Sommer in grauer Flanellhose und schwarzen Schuhen.
In Gesellschaft stand er immer am Rand, linkisch, in einem umfassenderen Sinn fehl am Platz. Bei einem Väter-Söhne-Camping-Ausflug (ich war überrascht, dass er überhaupt mitgekommen war) saßen wir um ein Lagerfeuer, und einer der anderen Väter sagte, dass wir nur zehn Prozent unseres Gehirns nutzen würden.
»Das ist unzutreffend«, erwiderte Dad. »Diesem Irrtum unterliegen viele Menschen. Sie denken, ein Genie wie Albert Einstein oder Stephen Hawking nutzt einen größeren Teil seines Gehirns als wir. Das wird gerne von Selbstoptimierungspropagisten und Leuten verbreitet, die Mitglied bei Mensa werden – aber es ist nicht wahr. Ärzte haben das Gehirn zehntausend Mal mit MRT und PET gescannt. Es gibt keine inaktiven Areale.«
»Und was macht Sie zum Experten?«, fragte der andere Vater mit härter werdender Stimme.
»Ich bin kein Experte, ich bin Arzt.«
»Und damit wohl eine Gabe Gottes.«
»Ich glaube nicht an Gott.«
Um das Lagerfeuer erhob sich Gelächter.
Der andere Vater sagte, Dad sei ein Klugscheißer.
»Ich habe Sie offensichtlich verärgert«, erwiderte der. »Das tut mir leid. Es gibt zahlreiche medizinische Mythen. Menschen glauben, dass man durch Schwitzen Giftstoffe absondern kann, dass Lesen bei schwachem Licht schädlich für die Augen ist, dass man nach dem Essen nicht schwimmen gehen soll oder dass eine Rasur einen Bart dichter und dunkler nachwachsen lässt. All das ist nicht wahr. Bei kaltem Wetter kriegt man nicht mehr Erkältungen. Kaffee nüchtert nicht aus. Das Herz hat keinen Aussetzer, wenn man niest. Und ein Arschloch ist nicht schlauer als das andere, obwohl Proktologie eigentlich nicht mein Fachgebiet ist.«
Ich dachte, Dad würde Prügel beziehen, aber er hat diese eine unglaublich entwaffnende Eigenart – ein Lachen, bei dem sich sein Mund weit öffnet und ein freudiges Rumpeln freisetzt, das einem das Herz wärmt. Wenn er lacht, stimmen andere ein. Problem gelöst.
Im Halbdunkel sehe ich die Krankenschwester von eben auf einem Hocker hinter den Apparaten sitzen.
»Habe ich laut geredet?«
Sie nickt, tritt ins Licht und stellt sich als Henrietta vor. Mit ihrem jamaikanischen Akzent klingt der Name melodisch.
»Ist das wirklich William O’Loughlin?«, fragt sie.
»Ja.«
»Das ganze Krankenhaus redet über ihn.«
»Was sagt es denn?«
»Dass er ein berühmter Arzt ist.«
»Früher mal. Ja.«
Henrietta erklärt, dass sie seine Verbände wechseln müsse. Ich biete ihr meine Hilfe an. Sie gibt mir ein blankes Stahltablett mit Mull und Kompressionsverbänden. Als ich die zunehmend blutigeren Schichten des alten Verbandes abwickele, sehe ich die getackerte Naht, wo der zertrümmerte Schädel meines Vaters zusammengeflickt wurde. Ich sehe die Kuppel seines halb rasierten Kopfes, die nicht mehr symmetrisch, sondern auf der rechten Seite konkav ist wie die Schale eines hartgekochten Eis, die mit einem Löffel angeschlagen wurde.
Das Laken ist bis unter die blasse Brust meines Vaters aufgeschlagen, und ich bemerke massive Blutergüsse an seinem Brustkorb und den Seiten, die offensichtlich nicht von einem kürzlich erfolgten Sturz oder Wiederbelebungsmaßnahmen stammen. Blutergüsse ändern mit der Zeit ihre Farbe. Rot, blau und violett sind die frühen Farben. Grüntöne erscheinen nach vier oder fünf Tagen, Gelb nach einer Woche.
Ich nehme mein Handy und schalte die Kamera ein.
»Sie dürfen hier keine Fotos machen«, sagt Henrietta.
»Die wurden nicht von einem Sturz auf einer Treppe verursacht«, sage ich und halte meine Faust über den dunkelsten Bluterguss. »Sehen Sie die Form. Diese Verfärbung stammt von Fingerknöcheln. Jemand hat ihn verprügelt.«
Henrietta lässt mich fotografieren. Sie verbindet Dads Schädel neu und bettet seinen Kopf sanft auf das Kissen.
»Professor O’Loughlin«, sagt eine andere Stimme. Ich drehe mich um und sehe eine Pflegeschwester. »Der Neurochirurg möchte Sie gern sprechen.«
Ich werfe einen letzten Blick auf Dad und folge ihr durch die Intensivstation zu einer Patientenlounge gegenüber dem Eingang. In dem pastellfarben gestrichenen Raum gibt es Sofas, Getränke- und Süßigkeiten-Automaten und einen Stapel Zeitschriften. Der Chirurg zählt die Münzen in seiner Hand und greift in die Wechselgeldausgabe wie ein kleines Kind.
»Sie haben nicht zufällig ein Pfund, oder?«, fragt er.
Ich finde eins in meinem Jackett.
»Ausgezeichnet. Niedriger Blutzucker. Wenn ich die Mahlzeiten auslasse, fange ich an zu zittern.« Er füttert die Münzen in den Automaten und drückt auf einen Knopf. Ein Schokoriegel fällt ploppend in das Ausgabefach.
»Ich bin Pete Hannover«, sagt er und hält mir die Hand hin. Er ist freundlich und vergnügt, etwa in meinem Alter, trägt Chinos und ein Hemd mit offenem Kragen, das an seinem Bierbauch klebt. Er beißt ein Stück von dem Schokoriegel ab und redet beim Kauen. »Ihr Vater hat an meiner Universität gelehrt, als ich meine vormedizinische Ausbildung gemacht habe. Ein bemerkenswerter Mann.«
Das Wort »bemerkenswert« kann so viele Bedeutungen haben.
»Wird er durchkommen?«, frage ich. Die Direktheit der Frage entbindet uns von der Notwendigkeit, Smalltalk zu machen.
»Lassen Sie uns vorn anfangen«, sagt Hannover und weist auf ein Sofa. Er nimmt gegenüber Platz und entblößt seine Knöchel, als er die Beine übereinanderschlägt.
»Ihr Vater wurde um kurz nach Mitternacht mit katastrophalen Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Notärzte hatten ihn intubiert und mussten ihn während des Transports zweimal wiederbeleben. Er war bewusstlos und blutete aus beiden Ohren. Seine rechte Pupille war vergrößert und zeigte keine Reaktion.«
Die Worte »keine Reaktion« schwirren mir im Kopf herum und erinnern mich an das Gespräch von zwei Fachärzten über Julianne, als sie künstlich am Leben erhalten wurde.
»Ein unmittelbar durchgeführtes CT zeigte ein schweres Hirntrauma sowie ein akutes subdurales Hämatom.«
»Eine Blutung.«
»Ja. Ich habe sofort operiert, um den Schädeldruck zu entlasten; dabei konnte ich mehrere Gerinnsel im Vorderlappen des Kleinhirns entfernen. William liegt jetzt in einem künstlichen Koma. Das ist wichtig für den Fall, dass die ruptierten Blutgefäße sein Gehirn nicht mit der üblichen Menge Sauerstoff versorgen können. Außerdem bekommt er ein Diuretikum, um die Flüssigkeit in seinem Körper zu reduzieren, sowie Antikonvulsiva. Wenn die Schwellung abklingt, führen wir einen weiteren Scan durch. Das könnte noch fünf bis sechs Tage dauern. Dann werden wir die Dosierung der Medikamente langsam herunterfahren und ihn zurückholen.«
Hannover zerknüllt die Schokoriegelverpackung und wirft sie über seinen Kopf in Richtung eines Mülleimers. Daneben. »Keine Sorge. Ich bin ein besserer Chirurg als Basketballer.«
»Wird er wieder ganz gesund werden?«
»Der Druck auf sein Hirn war massiv und hat höchstwahrscheinlich zahlreiche kleinere Blutungen verursacht. Das ganze Ausmaß des Schadens können wir noch geraume Zeit nicht bestimmen. Ich nehme an, Sie haben mit der Polizei über den Überfall gesprochen.«
»Welchen Überfall?«
Er runzelt die Stirn. »Die Kopfverletzungen Ihres Vaters wurden durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht.«
»Man hat mir gesagt, er sei die Treppe hinuntergefallen.«
»Das mag sein, aber er wurde auch von hinten geschlagen. Mehrfach. Die Schläge waren so heftig, dass Stücke seiner Schädelplatte in sein Gehirn getrieben wurden.«
Es drängt mich zu voreiligen Schlüssen. Diese Frau – Olivia Blackmore – war mit seinem Blut bedeckt. Deswegen befragt die Polizei sie. Sie hat ihn angegriffen und irgendeine Geschichte erfunden, von wegen, er sei die Treppe hinuntergefallen.
Hannovers Handy zwitschert. Er nimmt den Anruf an. »Ich fürchte, ich muss los«, sagt er zu mir. »Sollte William weitere Operationen benötigen, spreche ich noch einmal mit Ihnen. In der Zwischenzeit überwacht der Neurologe seine Pflege.«
»Danke«, sage ich und reiche ihm die Hand. Ich drücke zu fest zu, und er weicht zurück.
»Berufsrisiko«, erklärt er. »Ich muss gut auf sie aufpassen.« Er hält seine Kinderhände hoch und zeigt seine zarten Finger und schlanken Handgelenke. »Ideal für den Job. Wer will schon einen Hirnchirurgen mit klobigen Händen?«
Nachdem er weg ist, suche ich die Herrentoilette, gehe in eine Kabine, klappe den Klodeckel herunter und setze mich. Ich möchte weinen, habe jedoch keine Ahnung, für wen die Tränen wären – für meinen Vater, meine Mutter, meine Schwestern oder mich.
Am Waschbecken wasche ich mir das Gesicht, betrachte mein tropfendes Spiegelbild und versuche zu erkennen, was andere sehen. Ich habe Augen, Mund und Nase meiner Mutter. Was ist von meinem Vater? Unsere Namen verschwimmen. Er ist William Joseph, und ich bin Joseph William, aber da enden die Ähnlichkeiten auch schon.
Hinter mir geht eine Tür auf. Ein elf- oder zwölfjähriger Junge mit einer OP-Haube und einem Infusionsbeutel an einem rollbaren Ständer kommt herein. Ich lächele ihn an, doch er wendet nervös den Blick ab. Man hat ihm erklärt, dass er nicht mit fremden Männern reden oder sie überhaupt beachten soll, was vernünftig, aber auch traurig ist. Ich frage mich, was ihm fehlt. Ist er kränker als mein Vater? Übertrumpft Jugend Intelligenz? Ich fühle mich schuldig wegen solcher Gedanken.
Zurück auf der Intensivstation setze ich mich ans Bett meines Vaters, bringe es jedoch nicht über mich, erneut seine Hand zu fassen. Ich habe vor einem Jahr eine Ehefrau verloren. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Ich habe meinen Tribut gezahlt. Jetzt ist ein anderer dran.
In meiner Fantasie schlägt mein Dad die Augen auf.
»Dieses ganze Theater«, sagt er. »Sieht aus, als würde ich sterben.«
»Du wirst wieder gesund«, erwidere ich.
»Versuch nicht, mir was vorzumachen, Joseph. Ich bin Arzt.«
4
Lucy trifft um kurz vor elf ein und schält sich in dem überheizten Krankenhaus atemlos aus diversen Schichten Kleidung. Sie umarmt mich, als wäre ich jahrelang weg gewesen. Seit wann riecht sie wie meine Mutter?
»Wie geht es ihm?«
»Nicht gut.«
»Stirbt er?«
»Er kämpft.«
Ich berichte ihr die Details, wobei ich den Teil mit der »stumpfen Gewalteinwirkung« und der mysteriösen Frau auslasse, die ich an seinem Bett angetroffen habe. Ich weiß nicht genau, warum. Wenn Olivia Blackmore unseren Vater angegriffen hat, wird sie nicht mehr lange geheim bleiben.
Ich warne Lucy vor dem, was sie erwartet, doch Dads Anblick schockiert sie trotzdem – die Schläuche aus Mund und Nase; die Infusionen und Kabel. Jemand hat mit schwarzem Filzstift auf den weißen Verband um seinen Kopf geschrieben: KEINKNOCHENDECKEL.
»Du dummer alter Trottel. Was hast du bloß angestellt? Uns solche Sorgen zu machen«, sagt Lucy und klingt, als hätte Dad sich das Knie aufgeschürft. Sie küsst ihn auf die Wange. Streicht über seine Hand. Dann gehen die Fragen los:
»Wo wurde er gefunden? Wer hat den Krankenwagen gerufen? Wie hast du es erfahren?«
Jede Frage führt zu weiteren. »Warum war er in Chiswick? Welche Freundin? Wer ist sie?«
Ich kann sie nicht länger hinhalten.
»Olivia Blackmore. Sie behauptet, sie wäre mit Dad verheiratet.«
Lucy reißt die Augen auf, packt meinen Arm und zieht mich vom Bett weg. »Wer ist diese Frau? Und warum behauptet sie so etwas?«
»Ich weiß es nicht.«
Lucy stößt ein höhnisches Schnauben aus. »Hast du die Polizei gerufen?«
Ich atme tief durch und erzähle ihr alles, was ich weiß, stelle mir den Überfall vor, die Notärzte, Sirenen und flackernden Lichter, Krankenhaustüren, die krachend auffliegen, weiße Kittel und grelle Leuchten in einem OP-Saal.
»Du hast gesagt, ihr Kleid war voller Blut.«
»Ja.«
»Hat sie ihn angegriffen?«
»Sie bestreitet es.«
»Aber die Polizei hat sie verhaftet.«
»Sie sprechen mit ihr.«
Lucy wirkt perplex und seltsam unsicher. »Ich glaube nicht, dass wir Mummy und Patricia etwas sagen sollten – nicht, bis wir mehr wissen.«
»Einverstanden.«
Meine Mutter trifft am Nachmittag ein und sieht wie immer aus wie der Inbegriff einer Landarztgattin, heute in ihrer Reisegarderobe: Tweedrock, weiße Bluse, Perlenkette. Ihr graues dauergewelltes Haar ist kurz geschnitten und rahmt ihr keilförmiges Gesicht ein. Wir umarmen uns. Sie küsst mich auf die Wange, nennt mich »Joseph, Liebling.«
»Was ist passiert? Hast du mit ihm gesprochen?«
»Er liegt im Koma.«
»Wo sind die Ärzte? Was tun sie? Wissen sie, wer er ist?«
»Das wissen sie.«
Sie sieht sich um, denkt, sie hätte ihre Handtasche verloren, die immer noch über ihrer Schulter hängt, dreht sich einmal im Kreis, entdeckt die Tasche und tadelt sich für ihre Dummheit.
Ich bringe sie auf die Intensivstation. Als sie meinen Vater sieht, stößt sie einen leisen Schrei aus, eilt an sein Bett, küsst ihn auf die Stirn und richtet seinen Pony, als würde sie minütlich einen Fotografen erwarten. Ich bin verlegen. Meine Eltern bekunden sich ihre Zuneigung nur selten. Ich glaube nicht, dass ich je mehr gesehen habe als ein Küsschen auf die Wange oder einen Händedruck.
»Musst du allen solche Umstände machen?«, fragt sie und rückt den obersten Knopf seines Pyjamas zurecht. »Es sind die hübschen Krankenschwestern, was? Du möchtest, dass man sich um dich kümmert.«
Lucy schnieft. Ich gebe ihr eine Packung Taschentücher. Ihr Blick sagt: Ich wusste, dass sie so sein würde.
Meine Mutter redet immer noch, hält kaum einmal inne, um Luft zu holen, und erklärt Dad, dass sie ihm seine Pantoffeln und eine Zahnbürste mitgebracht hat. »Und mach dir keine Sorgen, Voula Pierce kümmert sich um die Hunde.«
Sie setzt sich, nimmt seine Hand. Es ist derselbe Stuhl, auf dem vor ein paar Stunden Olivia Blackmore gesessen hat.
»Wo ist Patricia?«, fragt sie.
»Sie kommt«, antworte ich.
»Und Rebecca?«
»Ich habe ihr eine Nachricht hinterlassen.«
Henrietta steht von ihrem Hocker auf. Pro Patient sind nur zwei Besucher erlaubt. Einer von uns muss gehen.
Ich melde mich freiwillig. Es gibt Dinge zu erledigen. Zum einen muss ich mit der Polizei sprechen. Meine Mutter umarmt mich zum Abschied, und Jahre fallen von mir ab. Ich bin wieder ein Kind, verloren in der Wärme ihres Busens und den Falten ihres Rocks. Mum scheint es auch zu spüren, denn sie streicht mit dem Finger über meine Wange.
»Danke, Joseph. Du bist ein guter Junge.«
5
Die Polizeistation von Chiswick ist ein Gebäude aus Beton und rotem Backstein mit blauen Türen, einem doppelten Flaggenmast und einem Schwarzen Brett, das an Augenzeugen appelliert und für Verbrechenspräventionsprogramme wirbt.
Der Station Sergeant klappt eine Ausgabe der Daily Mail zu und erhebt sich müde, als wäre er verärgert über eine weitere Störung. Sein weißes Hemd hat auf der Brusttasche einen Tintenfleck, der farblich zu seinen Epauletten passt.
»Und Sie haben Informationen über diesen mutmaßlichen Überfall«, sagt er und notiert meinen Namen.
»Ich bin der Sohn des Opfers. Ich hatte gehofft, mit dem Detective sprechen zu können, der die Ermittlung leitet.«
Er macht einen Anruf. Ich warte. Im Foyer der Wache gibt es ein Dutzend Plastikstühle. Nur einer davon ist besetzt – von einem Mann mit Glatze in einem Rollkragenpullover, der ihn aussehen lässt wie ein Ei in einem Eierbecher. Er nickt mir zu. Danach stellen wir keinen Blickkontakt mehr her.
Stattdessen konzentriere ich meine Gedanken auf Olivia Blackmore und versuche, ihr Alter zu schätzen. Mitte vierzig. Sehr gepflegt. Teure Kleidung. Das Cocktailkleid, das sie trug, schmiegte sich an ihre Kurven und betonte ihre Figur. Ich kann mir vorstellen, dass Männer sich nach ihr umdrehen, aber nicht mein Vater. Gottes Leibarzt im Wartestand ist nicht irgendein alternder Schürzenjäger, der Frauen nachstellt. Er ist konservativ. Berechenbar. Ehrenhaft. Aufrecht. Beige.
Viele Männer beklagen in der Mitte des Lebens das Vergehen der Jugend und ihre unerfüllten Träume. Manche geben sich flotter neuer Kleidung, Sportwagen, Abenteuerurlauben und den Reizen jüngerer Frauen hin. So ist William O’Loughlin nicht. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass mein Vater auf mich immer asexuell gewirkt hat oder zumindest vollkommen desinteressiert an Frauen, sofern sie nicht anästhesiert als chirurgische Herausforderung auf seinem OP-Tisch lagen.
Ein Junior Detective tritt aus dem Fahrstuhl und macht mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Ich werde nach oben in einen Einsatzraum gebracht, in dem zerknitterte Männer an vollgemüllten Schreibtischen sitzen, Jackett über der Rückenlehne und Krawatte auf Halbmast.
Detective Inspector Stuart Macdermid ist gut vierzig, frühzeitig ergraut, mit einem verwitterten Gesicht, das an seinem Schädel klebt wie ein Ballon, dem die Luft halb abgelassen wurde. Seine rechte Hand ist geschwollen und nach innen verdreht. Arthritis. Früh ausgebrochen. Schmerzhaft. Er hält ein Telefon ans Ohr und weist auf einen Stuhl. Ich setze mich. Der Detective scheint mit niemandem zu sprechen. Entweder er hört zu, oder er nutzt den Moment, um mich zu mustern. Ich tue das Gleiche und sehe mich in dem Büro um. An der Wand hängt ein handsigniertes Glasgow-Rangers-Trikot neben einem Foto, wie das Team als schottischer Meister gekrönt wird und in einem Konfettiregen den Pokal in die Höhe reckt. Außerdem gibt es die Bronzestatue eines Rennpferdes im vollen Galopp, der Jockey aus dem Sattel, die Hand mit der Gerte erhoben.
Macdermid legt auf und zieht eine Braue hoch. »Sie haben meine Nachricht bekommen, Professor O’Loughlin.«
»Welche Nachricht?«
»Ich hatte Sie gebeten zu kommen.«
»Ich bin unaufgefordert hier.«
Er runzelt die Stirn. »Nun, jedenfalls sind Sie jetzt hier.«
Er klappt seinen Laptop auf und haut mit einem Finger auf eine Taste, als müsste man sie mit roher Kraft bedienen.
»Kennen Sie eine Frau namens Olivia Blackmore?«
»Ich habe sie heute Morgen getroffen.«
»Sie behauptet, mit Ihrem Vater verheiratet zu sein.«
»Sie lügt.«
»Sie leben zusammen.«
»Das ist ihre Geschichte.«
»Haben Sie einen Beweis dafür, dass sie lügt?«
»Sie ist halb so alt wie er.«
»Bereitet Ihnen das Sorge – der Altersunterschied?« Sein leichter Glasgower Akzent lässt ihn spöttisch klingen.
»Ihr Kleid war voller Blut«, sage ich.
»Ja. Danach habe ich sie auch gefragt. Sie behauptet, sie habe ihn im Arm gehalten, bis die Notärzte eingetroffen sind. Die bestätigen ihre Geschichte.«
»Sie könnte ihn trotzdem geschlagen haben.«
»Ja, deswegen ist sie auch eine Verdächtige – die offensichtliche Verdächtige –, aber bisher war sie vollkommen kooperativ, hat uns eine DNA-Probe und Fingerabdrücke nehmen lassen. Außerdem behauptet sie, ein Alibi zu haben, was wir überprüfen.«
Ich spüre eine Verspannung zwischen den Schulterblättern. »Am Körper meines Vaters sind alte Blutergüsse – an den Rippen und dem unteren Rücken.«
Macdermid beugt sich vor. »Was für Blutergüsse?«
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und suche die Fotos. »Die habe ich im Krankenhaus gemacht. Die sind mindestens eine Woche alt. Sehen Sie die Spuren von Fingerknöcheln?«
Macdermid betrachtet die Bilder. »Haben Sie irgendeine Ahnung, warum jemand ihn zusammengeschlagen haben könnte?«
»Es könnte Olivia Blackmore gewesen sein.«
»Wir werden das untersuchen. Wann haben Sie Ihren Vater übrigens zum letzten Mal gesehen?«
»Vor zwei Wochen. Wir haben in seinem Club zu Mittag gegessen.«
»Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?«
»Donnerstag oder Freitag.«
In Wahrheit kann ich mich nicht erinnern. Ich telefoniere alle paar Tage mit meiner Mutter, aber nur selten mit meinem Vater. Er ist nicht der Typ für Smalltalk und regelmäßige Wasserstandsmeldungen.
»Besitzt Ihr Vater ein Handy?«
»Er sieht nicht ein, wofür sie nützlich sein sollten.«
»Handys?«
»Er findet, dass Menschen Verabredungen treffen und sie dann einhalten sollten, ohne sich ständig SMS zu schicken, dass sie fünf Minuten zu spät kommen, gerade draußen parken oder eben durch die Tür gehen.«
Macdermid nickt zustimmend und blickt dabei auf das Handy in seiner linken Hand.
»Laut Mrs Blackmore ist er fast jede Woche hier.«
»Nicht jede Woche«, sage ich defensiv.
Der Detective hält einen Moment lang meinen Blick. Keiner von uns blinzelt. Er wirft seinen Stift auf den Schreibtisch, lehnt sich zurück und kratzt sich am Bauch.
»Vor zwei Wochen war ich bei einem Klassentreffen. Fünfundzwanzigjähriges Abschlussjubiläum. Die Hälfte meiner Klassenkameraden habe ich kaum wiedererkannt. Sie waren älter, fetter, grauer, kahler. Die meisten hatten keine Ähnlichkeit mit den Menschen, die sie einmal gewesen waren. Dann wurde mir klar, dass ich genauso war – alt und grau und dicker. Ich habe mit Typen geredet, von denen ich damals überzeugt war, sie würden eines Tages die Welt beherrschen, und die ihren Lebensunterhalt jetzt damit verdienen, Pakete zuzustellen. Frauen, die früher in meinen Augen Göttinnen gewesen sind, hatten spröde Haare, Botox-Lächeln und Rettungsringe um die Hüften. Nicht alle. Einige waren spät erblüht. Mädchen, die in der Schule keiner eines Blickes gewürdigt hatte, stolzierten bei diesem Klassentreffen herum wie Debütantinnen, neu und durch Diät, Sport oder eine OP verschönert oder einfach mit guten Genen gesegnet. Und sie wussten es auch.«
Worauf will er hinaus?
»Dann waren da die Nerds, die in der Schule immer von allen gehänselt worden sind, die Angeber und Streber. Manche hatten in der City ein Vermögen gemacht und lebten mit fünfzehn Jahre jüngeren, umwerfend aussehenden Ehefrauen in Surrey. Menschen verändern sich, Professor. Man kann nicht vorhersagen, was sie einmal werden. Sie glauben vielleicht, Sie könnten es, aber das ist Bullshit. Ihr alter Herr hat sich eine junge Geliebte geangelt und ein trautes Heim eingerichtet. Hat ihr sogar erfolgreich eingeredet, sie wären verheiratet. Er ist nicht der Erste, und er wird nicht der Letzte sein.«
»Sie lügt.«
»Warum sollte sie das tun?«
»Sie will uns erpressen.«
»Womit?«
»Sie könnte ihre Geschichte an die Zeitungen verkaufen.«
»Ist William O’Loughlin wirklich so berühmt?«
Früher vielleicht einmal. Jetzt nicht mehr.
»Fällt Ihnen jemand ein, der ihm vielleicht schaden oder wehtun wollte? Irgendjemand, der einen Groll hegen könnte?«
»Er ist Arzt im Ruhestand.«
»Chirurgen machen Fehler. Ein Ausrutscher mit dem Skalpell …«
»Er lebt in Wales, pflegt seine Rosen und löst das Kreuzworträtsel in der Times. Er hat keine Geliebte. Fragen Sie meine Mutter. Fragen Sie irgendjemanden.«
»Wo ist Ihre Mutter?«
»Im Krankenhaus.«
»Ich muss mit ihr sprechen.«
»Warum? Sie weiß nichts.«
»Wir müssen wissen, wo sie sich am Sonntagabend aufgehalten hat.«
»Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass sie ihn angegriffen hat.«
Mein Sarkasmus ärgert den Detective. Er richtet seinen knorrigen Finger auf mich. »Wo waren Sie denn gestern um Mitternacht?«
»Zu Hause im Bett.«
»Allein?«
»Ja.«
Er zeigt mir ein Foto. »Haben Sie dieses Haus jemals besucht? Es ist in der Barrowgate Road in Chiswick.«
»Nein.«
Es klopft. Eine Frau kommt mit einem Tablett herein. Nachmittagstee. Nur ein Becher. Macdermid nimmt ihn mit der linken Hand und trinkt einen Schluck.
»Wir wissen, dass Ihr Vater gestern Nachmittag einen Zug von Wales nach London genommen hat. Ein Taxi hat ihn gegen Viertel nach elf vor dem Haus abgesetzt. Ist er der Typ, der einen Fremden ins Haus lassen würde?«
»Nein.«
»Könnte er im Zug jemanden kennengelernt und zu sich nach Hause eingeladen haben?«
»Mein Vater schließt nicht leicht Freundschaften.«
Macdermid macht sich eine weitere Notiz. »Möglicherweise war es ein verpfuschter Raub, obwohl keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens gefunden wurden und offenbar auch nichts fehlt. In West London hat es in letzter Zeit eine Reihe von Hauseinbrüchen gegeben, aber dieser passt nicht so richtig ins Muster.«
»In welches Muster?«
»Die Bande überfällt für gewöhnlich Paare, fesselt die Frau und schlägt den Mann mit einer Pistole, bis einer von beiden die Kombination des Safes oder das Versteck der Wertsachen preisgibt.« Er trinkt einen weiteren Schluck Tee. »Wir ermitteln in die üblichen Richtungen – rekonstruieren die Aktivitäten Ihres Vaters, sehen uns seine Telefonate an, überprüfen jeden, der einen Grund hatte, ihn anzugreifen. Außerdem sichten wir die Aufnahmen der Sicherheitskameras in der Umgebung.«
»Was ist mit Spurensicherung?«
»Mitarbeiter der Spurensicherung haben Fingerabdrücke und Proben im Haus genommen, die wir mit der Datenbank abgleichen; aber eine DNA nützt uns nur etwas, wenn wir einen Verdächtigen finden.«
Er probiert einen neuen Ansatz. »Lassen Sie uns rein theoretisch annehmen, Olivia Blackmore sagt die Wahrheit.«
»Das tut sie nicht.«
»Wer könnte über die finanziellen Angelegenheiten Ihres Vaters Bescheid wissen – sein Vermögen, Lebensversicherung, ein Testament …?«
»Kenneth Passage, der Anwalt meines Vaters.«
»Könnte er auch von Williams Doppelleben wissen?«
Ich zögere. Kenneth ist der älteste Freund meines Vaters. Wenn jemand von Olivia gewusst hat, dann er. Ich scrolle mich durch die Kontakte in meinem Handy bis zu seiner Nummer. Macdermid macht sich wieder eine Notiz und blickt auf seine Uhr, bevor er aufsteht und zur Tür geht.
»Sagen Sie Ihrer Mutter, dass ich sie gern sprechen würde.«
»Sie wird Dad nicht allein lassen wollen.«
»Er geht nirgendwohin.«
Macdermid bietet mir seine linke Hand an. »Das mit Ihrem Vater tut mir leid, Professor. Ich hoffe, er kommt durch.«
»Wo ist Olivia Blackmore jetzt?«
»Sie wurde freigelassen.«
»Können Sie sie daran hindern, das Krankenhaus zu besuchen?«
»Wie soll ich das machen?«
»Weisen Sie sie an, sich fernzuhalten.«
Macdermids knorrige Hand dreht den Türknauf. »Wenn Sie keinen Beweis dafür haben, dass sie eine Bedrohung darstellt, habe ich keine Grundlage, auf der ich sie anweisen könnte, sich vom Krankenhaus fernzuhalten.«
»Bitte«, sage ich. »Meine Mutter weiß nichts von ihr.«
»Na, dann erzählen Sie es ihr besser.«
6
Mittlerweile wird Emma aus der Schule zurück sein. Andie, meine Haushälterin, wird sie am Osttor abgeholt und auf dem Nachhauseweg in einem Café auf einen heißen Kakao eingeladen haben. Andie ist Australierin und spricht mit einer antipodischen Betonung, die aus jedem Satz eine Frage macht; eine Marotte, die Emma sich auch langsam angewöhnt.
Ich rufe zu Hause an. Emma nimmt ab. »Wie geht es Granddad? Ist er okay? Lass ihn nicht im Krankenhaus bleiben.«
»Er ist nicht transportfähig. Noch nicht.«
Emma will widersprechen, doch das würde bedeuten, dass sie Julianne erwähnen und anerkennen müsste, was geschehen ist. Ich wechsle das Thema und frage sie nach der Schule. Sie verstummt.
»Ist alles in Ordnung?«, frage ich.
»Ja.«
Ich versuche, mich an den Namen ihrer besten Freundin zu erinnern.
»Feiert Zoe an ihrem Geburtstag eine Party?«
»Ja.«
»Was will sie denn machen?«
»Ich weiß nicht. Sie hat mich nicht eingeladen.«
»Habt ihr euch gestritten?«
»Nicht richtig.«
Emma klingt nicht allzu enttäuscht, doch sie tut mir leid. Julianne wüsste, was man sagen muss. In so was war sie gut; Probleme lösen oder den Lichtstreif am Horizont sehen.
»Kommst du nach Hause?«, fragt Emma.
»Noch nicht, Spatz.«
»Können wir uns was zu essen bestellen?«
»Okay. Sag Andie, ich geb ihr das Geld später zurück. Mach deine Hausaufgaben.«
»Hab ich schon.«
»Das hast du gestern Abend auch gesagt.«
»Ich muss Schluss machen.«
Ich gehe die Shepherd’s Bush Road hinunter in Richtung U-Bahn-Station Hammersmith. Den ganzen Nachmittag haben sich dunkle Wolken gesammelt und am westlichen Himmel geballt. Die ersten Salven prasseln, diagonal fallender, sintflutartiger Regen klatscht auf meine Wangen und klebt in meinem Haar. Pendler hasten mit gesenktem Kopf, hochgeschlagenem Kragen und aufgeklapptem Schirm über den Bürgersteig und versperren den Weg.
Vom U-Bahnhof aus rufe ich Lucy an. Sie und Patricia haben einen Schichtplan erstellt, damit Tag und Nacht immer jemand bei Dad ist.
»Heute Nacht möchte Mum bei ihm bleiben«, sagt Lucy. »Kannst du am Morgen übernehmen?«
»Klar.«
»Ist sechs zu früh?«
»Sechs ist kein Problem.«
»Hast du mit der Polizei gesprochen?«
»Sie denken, es könnte ein verpfuschter Einbruch oder eine Verwechslung gewesen sein.«
Lucy erwähnt Olivia Blackmore nicht, was bedeutet, dass meine Mutter in Hörweite ist. Ich biete ihr an, sie später noch einmal anzurufen, um ihr mehr zu erzählen.
Die ankommende U-Bahn lässt die Gleise vibrieren und schiebt eine Druckwelle brausender Luft vor sich her. Türen öffnen sich. Körper drängen vorwärts. Eingequetscht zwischen all den Menschen frage ich mich, wie viele von ihnen wohl ein Doppelleben führen oder Familien haben, von denen sonst niemand weiß. Die Vorstellung schockiert mich nicht. Ich habe darüber gelesen – die Zumba-Lehrerin, die heimlich als Callgirl arbeitet; eine vornehme Immobilienmaklerin, die als russische Spionin enttarnt wurde. Geheimnisse sind wertvoll. Wir lügen, um eine Beziehung zu retten, einen Job zu bekommen, den Frieden zu wahren, das Mädchen zu kriegen oder ein Kind zu schützen. Tiefenpsychologisch haben wir ohne Geheimnisse kein Ich. Auf sie greifen wir zurück, immer wenn wir uns zu verlieren beginnen – in unserer sozialen Gruppe, bei der Arbeit oder in der Ehe. Wir versichern uns unserer Identität wieder neu als Mensch, der abseits und für sich ist.
Als Psychologe habe ich Cross-Dresser, Transvestiten, Gender-verwirrte Teenager, Sexsüchtige und heimliche Alkoholiker behandelt – alle verbargen ihre Geheimnisse, manchmal sogar vor sich selbst. Der Vater eines meiner Freunde ist an AIDS gestorben. Erst hinterher erfuhr seine Familie von seinen regelmäßigen Besuchen in Schwulenclubs und -saunas. Ein Kollege von mir an meinem ersten NHS-Krankenhaus wurde an sein Heimatland Argentinien ausgeliefert und dort verurteilt, weil er während des »Schmutzigen Krieges« eine Todesschwadron angeführt hatte. Das sind lebensumwälzende Geheimnisse, keine harmlosen Notlügen oder Unterlassungssünden.
Bis jetzt hatte ich nie Anlass, an der Integrität meines Vaters oder seiner Liebe für meine Mutter zu zweifeln. Er ist ein Mann, der zu seinem Wort steht und von mir nie verlangt hat, Werte hochzuhalten oder Opfer zu bringen, die er nicht selbst gebracht hat.
Ich will nicht glauben, dass er ein Lügner, Feigling und Betrüger ist, aber was ist er dann? Jeder Mann, der eine Zweitfamilie unterhält, segelt auf einem Meer von Lügen, einem Ozean von Unwahrheiten, die sich übereinandertürmen, bis eines Tages irgendetwas den Tsunami auslöst, der alles wegspült.
Es kann nicht wahr sein.
Es darf nicht wahr sein.