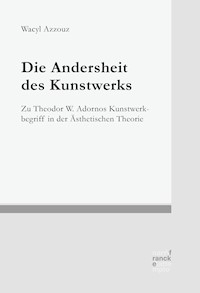
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Basler Studien zur Philosophie
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach dem Kunstwerkbegriff in Adornos 'Ästhetischer Theorie' formuliert sich als die Frage nach dessen Möglichkeit. Zugleich liegt mit der besonderen Krisenlage moderner Kunst aber auch der Kunstwerkbegriff in der Krise. Um in dieser Krisenlage dennoch die Möglichkeit des Kunstwerks zu denken, gilt es seine Ungewissheit ernst zu nehmen. Die Untersuchung des Kunstwerkbegriffs in der 'Ästhetischen Theorie' versucht ihn daher von zwei Richtungen her zu fassen: Sie fragt nach der Herstellung von Kunstwerken, nach ihrer Produktion, sowie nach der Kunsterfahrung, nach der Rezeption des Kunstwerks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wacyl Azzouz
Die Andersheit des Kunstwerks
Zu Theodor W. Adornos Kunstwerkbegriff in der Ästhetischen Theorie
DOI: https://doi.org/10.24053/9783772057816
© 2023 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-9918
ISBN 978-3-7720-8781-3 (Print)
ISBN 978-3-7720-0217-5 (ePub)
Inhalt
Für meine Grosseltern
Danksagung
Das vorliegende Buch ist die leicht überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die im Herbst 2021 an der Universität Basel angenommen wurde. Betreut und begutachtet wurde die Arbeit von Gunnar Hindrichs und Christoph Menke. Ihnen möchte ich für die wertvolle Unterstützung und die ertragreichen Diskussionen meinen grössten Dank aussprechen.
Ohne die grosszügige Unterstützung verschiedener Institutionen wäre die Durchführung dieser Arbeit nicht möglich gewesen. Mein ausdrücklicher Dank gilt der eikones Graduate School, in deren Rahmen dieses Projekt entstanden ist. Für die finanzielle Unterstützung wie auch für die anregenden Diskussionen im wöchentlichen Forschungskolloquium sei der eikones Graduate School herzlich gedankt.
Gefördert wurde dieses Projekt zudem durch eine Abschlussfinanzierung der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel sowie durch die Druckkostenzuschüsse der Nachwuchsförderung der Universität Basel und des Max Geldner-Dissertationsfonds. Ihnen gebührt mein Dank. Und nicht zuletzt gilt mein Dank Stefan Selbmann vom Narr Francke Attempto Verlag, Michael Schwarz vom Adorno Archiv sowie Sarah Wiesendanger für das Lektorat der Erstfassung.
Basel, im August 2022 Wacyl Azzouz
1Einleitung
Von der Andersheit des Kunstwerks zu sprechen, meint zweierlei. Erstens meint die Andersheit des Kunstwerks, dass das Kunstwerk das Andere ist. Und zweitens meint die Andersheit des Kunstwerks, dass das Kunstwerk seine eigene Andersheit zur Artikulation bringt. Die Andersheit des Kunstwerks besagt also einerseits, was das Kunstwerk ist und anderseits, was sich am Kunstwerk zeigt. Was aber die Rede von der Andersheit des Kunstwerks in diesem Doppelsinn für das Kunstwerk genau bedeutet, gilt es erst herauszuarbeiten. Zu klären wäre, wovon und wie das Kunstwerk das Andere ist. Und in seinem zweiten Sinn wäre zu klären, was sich als Andersheit am Kunstwerk zeigt und wie das Kunstwerk diese Andersheit an sich hervorzubringen vermag. Die vorliegende Arbeit versucht diesen Doppelsinn zu klären. Sie folgt dabei der These, dass Theodor W. Adornos Ästhetische Theorie diese Bestimmung für ihren Kunstwerkbegriff ausführt. Nach dem Kunstwerkbegriff in der Ästhetischen Theorie zu fragen, heisst demnach, sich über die Andersheit des Kunstwerks aufzuklären. Daher liegt es an den hier gemachten Ausführungen zu Adornos Kunstwerkbegriff, die Zweideutigkeit in der Formulierung von der Andersheit des Kunstwerks zu klären und zu ergründen. Es liegt daran zu verstehen, was der Doppelsinn in der Andersheit des Kunstwerks jeweils meint und wie die zwei Bedeutungen miteinander in Zusammenhang stehen.
Die Frage nach dem Kunstwerkbegriff ist nun aber keine beliebige Frage. Sie drängt sich nur schon deshalb auf, da Adorno in der Ästhetischen Theorie unentwegt vom Kunstwerk spricht. Es lässt sich kaum eine Passage finden, in der nicht in irgendeiner Weise vom Kunstwerk gesprochen wird. Und dennoch bleibt es, im Verhältnis zur Fülle der Aussagen über das Kunstwerk, weitgehend unklar, was Adorno genau mit der Rede vom Kunstwerk in der Ästhetischen Theorie im Sinn hat. Der Begriff ist dabei aber weder selbstverständlich noch bestünde an seiner Klärung kein Bedarf. In seiner Vorlesung des Wintersemesters 1959, in der er sich den Fragen der Ästhetik widmete, spricht Adorno vom Kunstwerk als einem «Objekt von einer vollkommen anderen Art»1 und hofft, dessen Konstitution in Zukunft genau darstellen zu können. Es ging ihm dabei um die Konstitution des Kunstwerks. Zwar bleibt nur zu vermuten, ob Adorno plante, die Ästhetische Theorie zum Schauplatz dieser Bemühungen zu machen, jenes Objekt vollkommen anderer Art in seiner «höchst merkwürdige[n] Logik»2 zur Darstellung zu bringen. Es lässt sich aber nicht von der Hand weisen, dass die Ästhetische Theorie wesentliche Stücke solcher Überlegungen versammelt. Wie eine solche Darstellung der Konstitution des Kunstwerks genau auszusehen hat, bleibt dabei aber weiterhin im Dunkeln. Auch die Ästhetische Theorie gibt hierzu keine klare Antwort. In ihren Äusserungen zum Kunstwerk deutet sie in die unterschiedlichsten Richtungen. Nur schwerlich lässt sich abschätzen, wohin sie führen, bevor sie bis in ihre letzte Konsequenz nachverfolgt werden. Es kann daher nicht im Voraus entschieden werden, welchen Linien nachzugehen ist, in denen die Ausführungen zum Kunstwerk in der Ästhetischen Theorie verstrickt sind. Aufgrund der vielfältigen Weisen und Kontexte, in denen Adorno über das Kunstwerk spricht – davon, wie es ist und was es tut – ist schwerlich zu entscheiden, welche Ausführungen die wesentlichen sind und wie sie in einen systematischen Zusammenhang zu bringen wären. Die spezifische Konstitution des Kunstwerks, der Adorno auf den Grund zu gehen hofft, kann daher für die Ästhetische Theorie in unterschiedlichster Weise befragt werden.
Die Schwierigkeiten, die sich mit der Frage nach dem Kunstwerkbegriff in der Ästhetischen Theorie stellen, haben aber noch einen weiteren, äusserlichen Grund. Dieser liegt im Umstand, dass die Ästhetische Theorie Fragment geblieben ist. Darüber lässt sich nicht hinwegtäuschen.3 Briefliche Erwähnungen lassen keinen Zweifel daran, dass die Ästhetische Theorie, so wie sie uns vorliegt, nicht die Endfassung darstellt. So schrieb Adorno noch am 9. Februar 1968 an Paul Celan: «Unterdessen ist mein ästhetisches Buch im Rohentwurf vorhanden, aber das Wort roh ist dabei mit einem schweren Akzent zu versehen – kein Stein wird auf dem anderen bleiben, ein Ende ist noch nicht abzusehen.»4 Ein Jahr später liegen die Dinge nicht besser. So schrieb Adorno an Gershom Scholem, dass das letzte, dritte Stadium, in dem «die endgültige Organisation des Ganzen»5 zu leisten wäre, noch aussteht. Zur Durchführung ist es aber bekanntlich aufgrund des plötzlichen Tods Adornos, nur wenige Monate nach dem Brief an Scholem, nicht mehr gekommen. Es lassen sich daher nur Vermutungen anstellen, wie die Textstücke durch Adorno schlussendlich in ihrer endgültigen Form organisiert gewesen wären.
Die Herausforderungen, die sich mit dem weitgehend unsystematischen und fragmentarischen Charakter der Ästhetischen Theorie für die Erarbeitung eines Kunstwerkbegriffs stellen, sind für den methodischen Zugang und einer entsprechenden Darstellung des Kunstwerkbegriffs ernst zu nehmen. Es reicht nicht aus, lediglich die verstreuten Aussagen zum Kunstwerk in einen systematischen Zusammenhang zu bringen, ohne dabei noch die vielschichtigen Bedeutungsebenen, die in jedem Satz mitschwingen, zu bedenken. Albrecht Wellmer machte hierzu den Vorschlag zu einer, wie er es nennt, stereoskopischen Lektüre. Dabei geht es ihm «um die Herstellung eines räumlichen Bildes, welches die latente Tiefendimension der Texte sichtbar machte.»6 Eine solche Lektüre nimmt also die Ästhetische Theorie in ihren eigenen Differenzierungen ernst und versucht die Kategorien und Begriffe in ihrer Vielschichtigkeit greifbar zu machen. Anstatt bei einer äusseren Kritik stehen zu bleiben, läge es daran, den überspitzten Formulierungen und vermeintlich hermetischen Sätzen nachzugehen, um zu sehen, wohin sie führen. Wellmer spricht daher von einer Konzentration der Kritik, der es daran liegt, die «zentrale[n] Kategorien gleichsam von innen her in Bewegung zu bringen und aus ihrer dialektischen Starre zu lösen».7
Dies gilt ebenso für den Kunstwerkbegriff. Um ihn greifbar zu machen, müssen die verschiedenen Bedeutungsschichten in der Ästhetischen Theorie so herausgelöst werden, dass sich die Konturen eines solchen Begriffs abzuzeichnen vermögen. Um welche Kategorien es sich dabei handelt, die nun für den Kunstwerkbegriff als zentral anzusehen und in Bewegung zu bringen sind, gehört selbst zur Erarbeitung des Kunstwerkbegriffs. Nach dem Kunstwerkbegriff in der Ästhetischen Theorie zu fragen, heisst also, Adornos vielschichtige Ausführungen so in Bewegung zu setzen, dass sich ihre Bedeutungsschichten voneinander abheben und konturieren.
Die folgende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, Adornos Ästhetische Theorie in dieser Weise nach dem Kunstwerkbegriff zu befragen. Um diesem Vorhaben gerecht zu werden, versucht die vorliegende Arbeit den Kunstwerkbegriff von zwei Seiten her zu fassen: von der Seite der Herstellung eines Kunstwerks, der Produktion, sowie von der Seite der Kunsterfahrung, von der Rezeption des Kunstwerks. Dadurch wird versucht, dem Kunstwerkbegriff in der Ästhetischen Theorie seine begriffliche Schärfe zu geben, indem einerseits verständlich gemacht wird, wie das Kunstwerk in die Welt kommt, wie es gemacht wird, und anderseits, wie es rezipiert wird, worin seine spezifischen Erfahrungs- und Verstehensvollzüge bestehen. Durch diese zwei Seiten hindurch soll sich das Kunstwerk in seiner Andersheit ausweisen, durch die es, so die These, letztendlich in der Ästhetischen Theorie seine Bestimmung hat.
Diese Form der Darstellung fordert ihre Rechtfertigung. Sie lässt sich aber erst von der Sache her verständlich machen. Im Durchgang durch die zwei Seiten wird ersichtlich werden, ob sie es vermögen, den Kunstwerkbegriff in der Ästhetischen Theorie zur Darstellung zu bringen. Es muss daher erst geklärt werden, worum es sich bei der Ästhetischen Theorie eigentlich handelt und welche Rolle der Kunstwerkbegriff in ihr spielt. Daher verhandelt das folgende Kapitel (Kap. 2), worin der Anspruch der Ästhetischen Theorie liegt und auf welche Weise der Kunstwerkbegriff in diesen eingebunden ist. Hieraus wird sich die Frage nach dem Kunstwerkbegriff als die Frage nach dessen Möglichkeit in der spezifischen Krisenlage der modernen Kunst ausweisen. Im Anschluss daran gilt es die zwei Seiten, von denen sich das Kunstwerk fassen lässt, zu erarbeiten: seine Produktion (Kap. 3) sowie seine Rezeption (Kap. 4). Durch sie wird der Rahmen ausgemessen, in dem das Kunstwerk seinen Ort hat. Für die Produktion ist hierzu die eigentümliche Lage, in die das Kunstwerk sich als Produkt menschlicher Tätigkeit einschreibt, auszuführen. Es ist die Beschreibung des Doppelcharakters des Kunstwerks, seiner Autonomie (Kap. 3.1) und seine damit einhergehende Verstrickung in die gesellschaftlichen Verhältnisse (Kap. 3.2). Im Anschluss daran lassen sich die Bedingungen der Kunstproduktion unter dem Anspruch des Doppelcharakters klären: die künstlerische Arbeit (Kap. 3.3) und das künstlerische Material (Kap. 3.4). Damit kommen die Ausführungen zur Kunstproduktion an ihr Ende.
Der zweite Teil der Arbeit wendet sich der Rezeption zu. Diese ist für Adorno auf den Wahrheitsgehalt der Kunstwerke ausgerichtet. Sie hebt dabei mit den für die Kunstwerke spezifischen Erfahrungs- und Verstehensvollzügen an. Daher gilt es in der Erörterung der Kunstrezeption zunächst die ästhetische Erfahrung (Kap. 4.1) und das ästhetische Verstehen (Kap. 4.2) in den Blick zu nehmen. Die Überlegungen zur ästhetischen Erfahrung und zum ästhetischen Verstehen führen dann zur Frage, um was für Erfahrungs- und Verstehensgehalte es sich genau handelt. Die ästhetische Transzendenz (Kap. 4.3) und letztendlich der Wahrheitsgehalt des Kunstwerks (Kap. 4.4) sollen hierzu die Antwort geben. Sind damit die Produktion und die Rezeption des Kunstwerks in der Ästhetischen Theorie erarbeitet, ist im Schlusskapitel (Kap. 5) die Andersheit des Kunstwerks vor dem Hintergrund der Kunstproduktion und der Kunstrezeption darzulegen. Der Durchgang durch die Bestimmung der Produktion und der Rezeption hat sich letztendlich als die Entfaltung der Andersheit des Kunstwerks zu zeigen, in der der Kunstwerkbegriff der Ästhetischen Theorie seine Bestimmung findet. Die Form der Darstellung findet darin ihre Rechtfertigung.
Es mag durchaus andere Wege geben, den Kunstwerkbegriff in der Ästhetischen Theorie herauszuarbeiten. Die Ästhetische Theorie hält genügend Ansätze offen, von denen aus sich Wege zu einem Kunstwerkbegriff bahnen. Es wird hier auch nicht der Anspruch erhoben, sämtliche Kategorien vollständig zu klären, die in irgendeiner Weise in der Ästhetischen Theorie den Kunstwerkbegriff betreffen. Nichtsdestotrotz erheben die hier gemachten Ausführungen den Anspruch, die grundlegende Struktur des Kunstwerkbegriffs in der Ästhetischen Theorie auszuführen und sie letztendlich als die Andersheit des Kunstwerks einzusehen. Mögen andere Wege andere Kategorien und Aspekte des Kunstwerkbegriffs in der Ästhetischen Theorie beleuchten – auch ihnen hätte der hier erarbeitete Kunstwerkbegriff die Grundlage abzugeben. Die grundlegende Struktur des Kunstwerkbegriffs bestimmt sich durch seine Andersheit und diese findet ihre Darstellung in der Produktion und Rezeption.
2Was ist ästhetische Theorie?
I. Philosophie der Kunst
Es ist naheliegend, die Ästhetische Theorie als eine Philosophie der Kunst zu verstehen. Als eine solche hätte sie es mit Fragen zu tun, die den Bereich der Kunst, deren Kategorien, Begriffe und Eigenheiten betreffen. Das Motto, unter dem die Ästhetische Theorie hätte stehen sollen, bestätigt diese Annahme.1 Im Fragment von Friedrich Schlegel, das der Ästhetischen Theorie vorangestellt hätte werden sollen, heisst es: «In dem, was man Philosophie der Kunst nennt, fehlt gewöhnlich eins von beiden; entweder die Philosophie oder die Kunst.»2 Das geplante Motto stellt die Ästhetische Theorie also ins Feld einer Philosophie der Kunst, wie es zugleich mit ironischer Spitze dessen Unzulänglichkeit hervorhebt. Das Ästhetik-Buch, wie Adorno die Ästhetische Theorie im Entstehungsprozess oft selbst genannt hat, ist also eine Ästhetik, die sich auf den Bereich der Kunst beschränkt. Ästhetik meint hier demzufolge nicht eine Ästhetik, wie sie Alexander Gottlieb Baumgarten, an ihren ursprünglichen Sinn erinnernd, als «Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis» (scientia cognitionis sensitivae)3 begründet hat. Adorno schliesst damit an der im Idealismus gemachten Gleichsetzung von Ästhetik mit Kunstphilosophie an.4 Seit Schelling, so heisst es in der Ästhetischen Theorie, «hat das ästhetische Interesse sich auf die Kunstwerke zentriert.»5 Der Bezug auf diese Theorietradition zeigt sich nicht nur, indem Adorno die Kunst als den Gegenstand einer Ästhetik versteht, sondern auch indem die Ästhetische Theorie sich mit und an den idealistischen Ästhetiken kritisch abarbeitet. Daher stellt die Ästhetische Theorie eigentlich eine Ästhetik der Kunst und des Kunstschönen und nicht der Natur und des Naturschönen, noch weniger eine Wissenschaft sinnlicher Erkenntnis dar. Der Begriff der Natur und das Naturschöne spielen in der Ästhetischen Theorie zwar eine zentrale Rolle, es lässt sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ästhetische Theorie wesentlich an der Kunst interessiert ist und die Natur und das Naturschöne aus der Perspektive der Kunst in den Blick nimmt. Kunst und Natur sind als «pure Antithesen» aufeinander verwiesen, so dass «die Besinnung über das Naturschöne der Kunsttheorie unabdingbar» ist.6 Ist also in der Ästhetischen Theorie von Ästhetik die Rede, so meint sie Ästhetik gerade in diesem engeren, auf den Bereich der Kunst eingeschränkten Sinn.7 Bereits in Adornos Vorlesungen zur Ästhetik, in denen er Vorarbeiten und Themen behandelt, die später Eingang in die Ästhetische Theorie finden werden, wird Ästhetik als eine Philosophie der Kunst verstanden.8
Neben dem geplanten Motto weist auch der erste Satz der Ästhetischen Theorie die Kunst als ihr Thema aus: «Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht.»9 Damit ist die Kunst als Problemfeld, an dem sich die Ästhetische Theorie abzuarbeiten hat, umrissen. Sie bestimmt die Ästhetische Theorie als eine Philosophie der Kunst, die sich der in die Problemlage der Moderne geratenen Kunst annimmt. Adorno stellt in diesem Satz die geschichtliche Situation moderner Kunst als einen dreifachen Verlust ihrer Selbstverständlichkeit dar. Sie lässt sich daher als dreifache Rechtfertigungskrise verstehen: Denn erstens ist die Kunst in ihrem Selbstverständnis ungewiss geworden. Ihre Kategorien und Normen sind der Kunst selbst unsicher. Keinen eingeschliffenen Kanon vermag sie mehr zu verbürgen. Zweitens ist ihr Aussenbezug ungewiss geworden. Ihre Stellung zum Ganzen, ihr Ort in dem, was Adorno die Totalität der Gesellschaft nennt, ist ihr weder von der Kunst noch von der Gesellschaft eindeutig zugewiesen. Daher ist ihre gesellschaftliche Stellung ebenso unbestimmt wie ungewiss. Und drittens ist die Kunst damit auch in ihrer Daseinsberechtigung ungewiss geworden. Wofür sie gut sein soll, hätte sie erst noch auszuweisen. Die Ästhetische Theorie hat daher die in Ungewissheit geratenen ästhetischen Kategorien und Normen, die Verortung des Bereichs der Kunst im Gefüge gesellschaftlicher Totalität sowie die Daseinsberechtigung in diesem Gefüge kritisch auszuhandeln und auszumessen.
Misst die Ästhetische Theorie den Bereich des Ästhetischen als den vermeintlich ungewissen Bereich moderner Kunst aus, so hat sie ebenso die Differenz zum Ausserkünstlerischen kenntlich zu machen. Diese Differenz zeigt sich aber als genauso fraglich wie es schon für die innere Bestimmung der Kunst gegolten hat. Ist die Kunst in sich ungewiss geworden, hat sie über sich selbst keine Klarheit, umso strittiger ist es auch, worin die Kunst ihre Grenze hat. Das Eigentümliche des Bereichs der Kunst, die sich in der dreifachen Rechtfertigungskrise befindet, hat in der Ästhetischen Theorie auch seine Grenzen auszuweisen. Die Eigenheiten der Kunst müssen daher erst in Aushandlung mit geschichtsphilosophischen und gesellschaftstheoretischen Überlegungen ihren Ort angeben. Die Kunst wäre abzugrenzen von dem, was Adorno in der Ästhetischen Theorie meist die empirische Realität nennt. Sofern sich die Ästhetische Theorie also als eine Philosophie der Kunst versteht, hätte sie ihren Bezug zum ausserästhetischen aufzuklären. Bekanntlich wird das Feld der Kunst von Adorno auf einen sehr exklusiven Bereich eingeschränkt. Wie wir sehen werden, verläuft diese Linie nicht, wie es Adorno oft zum Vorwurf gemacht wurde, seinen eigenen Präferenzen entsprechend, sondern hat deren Grund in der ausserkünstlerischen Verfügungsmacht, von der die Kunst sich gerade freimachen muss. Der Ungewissheit der Kunst theoretisch zu begegnen, heisst eben nicht der Kunst den Freipass zu einem anything goes zu geben, sondern den Bereich der Kunst aus der Ungewissheit heraus zu bestimmen.
Es kann zwar als ausgemacht gelten, dass die Ästhetische Theorie eine philosophische Aushandlung der modernen Kunst darstellt, doch scheint damit die Bestimmung dessen, wovon die Ästhetische Theorie nun handelt, noch nicht gänzlich ausgesprochen zu sein. Die eigentümliche Art, wie die Ästhetische Theorie von Kunst spricht, hat unterschiedlichste Interpretationen über ihre eigentliche Motivation herausgefordert. Ob nun die Ästhetische Theorie als eine Philosophie der Kunst das letzte Wort behält, gilt es noch zu prüfen, denn die Ästhetische Theorie verleitet leicht zur Annahme, dass sie zwar von Kunst handelt, durch die Behandlung der Kunst aber etwas über die Kunst Hinausgehendes zur Diskussion stellt. Die philosophische Erforschung der Kunst dient in dieser Deutung einem anderen Interesse. Die Annahme, dass Adorno in seiner Ästhetik eigentlich sein Projekt einer Vernunft- und Gesellschaftskritik weiterführt, auf dessen Gehalte die moderne Kunst sich abklopfen lässt, scheint ebenso berechtigte Argumente zu haben, wie sie im üblichen Sinne nur als eine Philosophie der Kunst zu verstehen wäre. So wird die Ästhetische Theorie dann im Blick auf Adornos Philosophie als die Weiterführung theoretischer Konsequenzen verstanden, in denen die philosophischen Bemühungen, etwa der Negativen Dialektik, im Besonderen aber der Dialektik der Aufklärung, aufgegriffen sind. Diese Indienstnahme der Ästhetik zu vernunft- und gesellschaftskritischen Absichten hat Zustimmung wie Ablehnung gleichermassen motiviert. Zustimmend heisst es etwa, dass erst die Ästhetische Theorie, in ihrer Form einer Philosophie der Kunst, es vermag in letzter Konsequenz die Antworten auf die vernunft- und gesellschaftskritischen Absichten theoretisch auszuarbeiten.10 Ablehnend dagegen formuliert etwa Jürgen Habermas den Vorwurf, dass letztendlich aus den Einsichten der Dialektik der Aufklärung, sofern man sie denn noch mitgehen will, man einsehen muss, dass es, «wenn überhaupt, einen Vernunftfunken nur noch in der esoterischen Kunst gibt.»11 Die Ästhetische Theorie wird hier nicht als ein Ausweg angesehen, in der sich vernunft- und gesellschaftskritische Absichten auflösen, sondern im Gegenteil als eine «Flucht in die Ästhetik».12 In diesen Interpretationen steht nicht die moderne Kunst zur Aushandlung, sondern sie stellt den Schauplatz einer anderen Verhandlung dar. Die Ästhetische Theorie wäre demnach mehr als eine Philosophie der Kunst oder etwas anderes als eine Philosophie der Kunst.
Eine weitere Deutung nimmt ihren Ausgang am Titel einer Ästhetischen Theorie, der zu weiteren Spekulationen über ihren eigentlichen Gehalt veranlasste. Die eigenwillige Darstellungsweise der Ästhetischen Theorie wird hierbei gerade als die konsequente Durchführung ihres Programms angesehen. Die Idee, dem Ästhetik-Buch den Titel Ästhetische Theorie zu geben, geht noch auf Adorno zurück. In einem Brief vom 4. Februar 1969, nur wenige Monate vor seinem Tod, schrieb Adorno an Samuel Beckett: «Mein Buch – es wird nun endgültig Ästhetische Theorie heißen – ist die letzten Monate recht befriedigend vorwärts gekommen […].»13 An die von Adorno getroffene Wahl des Titels schliesst sich eine Deutung der Ästhetischen Theorie an, die im Versuch besteht, den Titel in seiner Doppeldeutigkeit ernst zu nehmen. Das heisst, dass die Ästhetische Theorie als eine Theorie verstanden werden muss, die selbst ästhetisch sei. So stellte etwa Rüdiger Bubner diese Doppeldeutigkeit des Titels einer Ästhetischen Theorie als selbstverständliches Kennzeichen ihrer inhaltlichen Absicht voraus. Bubner schreibt hierzu:
«Der schillernde Titel einer ‹Ästhetischen Theorie› meint bekanntlich nicht allein theoretische Ästhetik als Unterabteilung eines umfassenden Theoriegebäudes. Vielmehr soll das Ästhetischwerden der Theorie selbst, die Konvergenz von Erkenntnis und Kunst Thema sein.»14
Wie schon für Habermas zieht auch nach Bubner die Ästhetische Theorie die in der Dialektik der Aufklärung angelegten Konsequenzen. Für Bubner stellt das Ästhetischwerden von Theorie gerade einen Prozess dar, der selbst aus den philosophischen Überlegungen einer kritischen Theorie erwachsen sei und zu einer «Aufhebung von Theorie in Ästhetik»15 geführt habe. Das Ästhetischwerden wird hier als philosophische Konsequenz gedacht und durch die Doppeldeutigkeit des Titels offen ausgesprochen.
Im Gegensatz zu Bubners Vorwurf des Ästhetischwerdens der Theorie als einer, wie schon für Habermas, Flucht in die Ästhetik, wurde die Doppeldeutigkeit des Titels einer Ästhetischen Theorie ebenso als deren Legitimierung verstanden. Das Ästhetischwerden der Theorie wird hier gerade als Schlüssel zu deren Verständnis und Rechtfertigung genommen. Je nachdem, wie man die These der Ästhetisierung von Theorie verstehen mag, wird sie als für den Gegenstand angemessene Theorieform verstanden.16 In ihrer Zuspitzung versteht die These von der Doppeldeutigkeit des Titels einer Ästhetischen Theorie, dass sie selbst als ein Kunstwerk verstanden werden will, oder zumindest einen Kunstcharakter hat.17 Ihr geht es dann wesentlich um die Form der Darstellung einer Ästhetischen Theorie, die sich ihrem Gegenstand gleichmacht. Gewiss ist die Behauptung nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Je nachdem was unter der Formulierung des Ästhetischwerdens oder -seins von Theorie verstanden wird, ob als konsequenter Irrweg oder Erfüllung theoretischer Forderungen, können mitunter überzeugende Argumente angeführt werden. Mit Rückgriffen auf Theorieanforderungen aus früheren Texten Adornos, etwa der konzentrischen und parataktischen Darstellungsform, kann die Ästhetische Theorie durchaus als konsequente Durchführung theoretischer Anforderungen begriffen werden.18
Obwohl die Ästhetische Theorie Züge einer Ästhetisierung von Theorie aufweist, so verführt diese Annahme zu einem voreiligen Fehlurteil.19 Einerseits verleitet sie zur problematischen Schlussfolgerung, dass die Ästhetische Theorie selbst ein Kunstwerk, oder zumindest ein Kunstwerkähnliches sei. Ihre Sätze, sofern die Ästhetische Theorie von Kunst handelt, hätte man daher auf sie selbst anzuwenden. Sie hätte daher in ihrer Durchführung die «Verschränkung von Darstellung und Dargestelltem»20 ernst zu nehmen. Dass sie diesem Anspruch aber nicht gerecht werden kann, scheint mit genauerem Blick in die Ästhetische Theorie in zweierlei Hinsicht offensichtlich. Erstens lässt sich schwerlich darüber hinwegtäuschen, dass die Ästhetische Theorie ihrem eigenen Kunstwerkbegriff nicht gerecht zu werden vermag. Im Durchgang durch die Bestimmungen des Kunstwerks in der Ästhetischen Theorie sollte deutlich werden, dass sie ihrem eigenen Anspruch nicht standhalten kann. Und zweitens hebt Adorno in der Ästhetischen Theorie immer wieder die Differenz zwischen Philosophie und Kunst hervor. Mögen sie zwar aufeinander verwiesen sein, ihre Differenz lässt sich dadurch nicht aufheben.21 Wie sich noch zeigen wird, liegt die Rechtfertigung der Ästhetischen Theorie gerade in dieser Differenz begründet. Die Verwässerung dieser Differenz würde daher die Legitimation der Ästhetischen Theorie, von der sie Ausgang nimmt, untergraben.
Die verschiedenen Deutungen mögen ihre berechtigten Argumente haben. So mag es richtig sein, dass sich die Ästhetische Theorie um eine konzentrische und parataktische Darstellung bemüht und damit Züge eines Ästhetischseins der Theorie vorantreibt. Es mag auch richtig sein, dass in der Ästhetischen Theorie Linien einer Vernunft- und Gesellschaftskritik, die Adorno in früheren Schriften angelegt hat, weitergeführt und auf dem Feld der Kunst ausgehandelt werden. Das Versäumnis dieser Deutungen liegt aber darin, dass die eigentliche Frage, wovon die Ästhetische Theorie nun handelt, voreilig übergangen wird.22 Ist die Ästhetische Theorie eine Philosophie der Kunst, so wäre zunächst zu klären, wovon überhaupt die Rede ist, wenn die Ästhetische Theorie von Kunst spricht. Obgleich die Ästhetische Theorie noch in so enger Korrespondenz mit anderen Schriften Adornos steht, stellt sie sich letztendlich doch als eine Philosophie der Kunst dar, die sich vorweg weder auf Vernunft- und Gesellschaftskritik reduzieren lässt noch das letzte Wort in ihrem Ästhetischsein hat.
Das Problem einer Deutung, wovon denn die Ästhetische Theorie nun handelt, hätte daher mit der Frage zu beginnen, wie Adorno die Kunst in ihrer Krise zu fassen versucht. Zwar wissen wir vom ersten Satz der Ästhetischen Theorie, dass die Kunst sich selbst ungewiss geworden ist, und sich daher vorweg einer Bestimmung entzieht, nichtsdestotrotz gibt Adorno die Richtung an, von der aus der Bereich der Kunst erst auszumessen wäre und von der aus die Ästhetische Theorie zu lesen wäre. Erst vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern die Ästhetische Theorie keine Philosophie der Kunst ist oder wodurch sie über eine solche hinausgeht. Diese Richtung, von der die Kunst her zu verstehen und von der aus die Problemlage der Ästhetischen Theorie zu fassen wäre, führt Adorno gegen ein gängiges Vorurteil der Kunst ein. Adorno bespricht zu Beginn der Ästhetik-Vorlesung von 1958/59, was in der Durchführung einer Ästhetik als Kunst zu verstehen sei. Hierin positioniert sich Adorno gegen die Vorstellung, die Kunst sei allein dem Bereich des Irrationalen, des Unbewussten oder der Gefühle zuzurechnen und stehe so der Rationalität entgegen:
«Also die Kunst ist nicht etwa einfach unter den Begriff der Vernunft oder der Rationalität zu subsumieren, sondern ist diese Rationalität selber, nur in Gestalt ihrer Andersheit, in Gestalt – wenn Sie wollen – eines bestimmten Widerstandes dagegen.»23
Vielmehr als dass die Kunst als eine «Domäne der Irrationalität»24 dem Rationalen gegenübersteht, stellt Adorno die These auf, dass Kunst selbst Rationalität sei, aber gerade in derjenigen Gestalt, in der sie selbst ein Widerstand gegen Rationalität ist. Es lässt sich freilich darüber streiten, welcher der vielen Bestimmungen der Kunst in der Ästhetischen Theorie, wenn überhaupt, ein hervorragenden Stellenwert beizumessen sei. Mit Blick auf die Ästhetik-Vorlesung scheint der Bestimmung der Kunst als Rationalität in Gestalt ihrer Andersheit denjenigen Gesichtspunkt der Kunst anzugeben, von der aus die Ästhetische Theorie versucht, das Feld der Kunst auszumessen.25 In veränderter Form findet sich dieser Ausgangspunkt in der Ästhetischen Theorie wieder. In der Diskussion über Mimesis und Rationalität schreibt Adorno:
«Kunst ist Rationalität, welche diese kritisiert, ohne ihr sich zu entziehen; kein Vorrationales oder Irrationales, wie es angesichts der Verflechtung jeglicher menschlichen Tätigkeit in die gesellschaftliche Totalität vorweg zur Unwahrheit verurteilt wäre.»26
Diese Bestimmung, dass Kunst Rationalität in ihrer Andersheit sei, als Widerstand und Kritik gegen diese selbst, muss in seiner ganzen Tragweite ernstgenommen und im Blick auf die dreifache Rechtfertigungskrise der Kunst bezogen werden. Besagte eine der Rechtfertigungskrisen der Kunst, dass der Ort der Kunst im Ganzen ungewiss sei, so sehen wir nun, dass Adorno aus der Totalität der Gesellschaft die Konsequenz für die Kunst gezogen hat. Die Kunst müsste sich in der gesellschaftlichen Totalität gegen die gesellschaftliche Totalität behaupten. Dieses Verständnis von Kunst als selbstkritische Rationalität leitet das ganze Unternehmen der Ästhetischen Theorie genauso an, wie es ihr Zustand dreifacher Ungewissheit tut.
Die Probleme einer Ästhetik sind für Adorno daher anderer Art. Sie erschöpfen sich nicht einfach in den Fragen, ob die Ästhetische Theorie eine ästhetisch verfasste Ästhetik sei, ob sie nicht eigentlich eine Flucht in die Ästhetik darstellt oder primär gar keine Philosophie der Kunst ist. Die Ästhetische Theorie hat nicht vornehmlich ihre Darstellungsform als Problem, sondern befragt als Philosophie der Kunst die spezifische Problemlage der ästhetischen Moderne. Für die Ästhetische Theorie als eine Philosophie der Kunst stellt sich daher die Schwierigkeit, dass ihr Gegenstand sich gegen eine theoretische Durchdringung sträubt. Die in die Krise geratene Kunst ist nicht nur ungewiss geworden, sondern widerstrebt als Rationalität in Gestalt ihrer Andersheit gerade der theoretischen Erfassung. Diese Problemlage muss daher als nächstes angegangen werden.
II. Probleme der Ästhetik
Will die Ästhetische Theorie den Bereich der Kunst als Rationalität in Gestalt ihrer Andersheit, in der geschichtlichen Situation ihrer dreifachen Rechtfertigungskrise in ihrem Möglichkeitsraum ausmessen, so hat sich eine solche Ästhetik den daraus folgenden Problemen zu stellen. Die Kunst als Rationalität in Gestalt ihrer Andersheit untergräbt ihre theoretische Ausmessung, da Theorie stets rational verfasst ist. Eine Ästhetik ist aber nur als Theorie möglich. Die Probleme der Ästhetik liegen daher in einem doppelten Anspruch der Ästhetik, der im vorgesehenen Motto von Schlegel zum Ausdruck kommt. Das Zitat von Schlegel darf dabei gerade nicht in der oben ausgeführten Deutung der Doppeldeutigkeit des Titels einer Ästhetischen Theorie missverstanden werden.27 Es geht nicht darum, Philosophie und Kunst aneinander anzugleichen und in einer Art von Mischform durchzuführen. Der schlechte Kompromiss von Kunst und Philosophie soll gerade vermieden werden. Vielmehr gilt es in der Ausformulierung einer Philosophie der Kunst, wie es die Ästhetische Theorie ist, weder ihr philosophisches Programm zugunsten einer Kunstähnlichkeit zu opfern noch über die Kunst hinweg theoretische Verallgemeinerungen zu betreiben. Sie hat daher einerseits den Forderungen von philosophischer Theoriebildung nachzukommen, denn die Ästhetische Theorie will ja gerade Theorie sein und nicht selbst zur Kunst werden, anderseits muss sie aber der Kunst, von der sie handelt, gerecht werden. Wir haben gesehen, dass eine solche Ästhetisierung der Theorie weder von Adorno intendiert war noch dazu taugt, zum eigentlichen Programm der Ästhetischen Theorie erhoben zu werden.
Die Probleme der Ästhetik sind aber nicht nur theoretischer Art, sondern liegen ebenso in ihrer geschichtlichen Lage, von der aus die Theorie anhebt. Hat Adorno die geschichtliche Lage der Kunst als eine dreifache Ungewissheit beschrieben, so wirkt sich dieser Zustand der Krise auch auf eine Ästhetik aus, die sie versucht theoretisch zu durchdringen. Die geschichtliche Situation der Kunst betrifft die Ästhetik ebenso, nicht nur weil die dreifache Ungewissheit in einer Ästhetik theoretisch erfasst und reflektiert werden müsste, sondern auch, weil mit ihrem Gegenstand ebenso die Ästhetik ihre Rechtfertigung einbüsst. Die Ästhetische Theorie steht und fällt daher mit der Möglichkeit ihres Gegenstands.
Der Frühen Einleitung folgend, geht daher von der Ästhetik «ein Ausdruck des Veralteten»28 aus. Adorno beruft sich an dieser Stelle auf einen Lexikoneintrag von Ivo Frenzel zum Begriff ‹Ästhetik›.29 Dieser stellt in jenem Artikel einen doppelten Grund fest, weshalb es die Ästhetik bis anhin nicht zu einem gesicherten Bestand geschafft hat, sondern sich stattdessen in einen wechselhaften Theorienpluralismus aufgefächert habe. Dieser doppelte Grund besteht nach Frenzel einerseits in der Schwierigkeit bis hin zur Unmöglichkeit, Kunst systematisch mittels philosophischer Kategorien aufzuschliessen, sowie anderseits in ihrer Abhängigkeit von erkenntnistheoretischen Vorentscheidungen.30 Adorno stimmt Frenzels Diagnose soweit zu, dass es der Ästhetik an gesichertem Bestand fehle, hält aber in Frenzels Analyse den Zustand für noch nicht zureichend erklärt. Dieser vermeintlich unzeitgemässe Zustand der Ästhetik sei vielmehr damit zu erklären, dass sich die Ästhetik in der Lage zweier Alternativen befindet, in die sie durch die dreifache Rechtfertigungskrise der Kunst geraten ist.31 Sind die ästhetischen Kategorien erst einmal explizit fragwürdig geworden, so kann eine Ästhetik nicht mehr länger über ihre Fragwürdigkeit hinwegtäuschen. So teilt sich die geschichtliche Lage an die theoretischen Forderungen einer Ästhetik mit.
Ästhetik gilt also nicht deshalb als veraltet, weil sie von Voraussetzungen abhängig ist, die sich ihrer Einflussnahme entziehen, sondern weil die ästhetische Moderne sie in die missliche Lage geführt hat, sich zwischen zwei schlechten Alternativen entscheiden zu müssen. So führt Adorno in der Frühen Einleitung weiter aus: «Philosophische Ästhetik geriet in die fatale Alternative zwischen dummer und trivialer Allgemeinheit und willkürlichen, meist von konventionellen Vorstellungen abgezogenen Urteilen.»32 Die Ästhetik befindet sich daher in der misslichen Lage, einerseits theoretisch verfasst zu sein, was sie nur in der Allgemeinheit von Begriffen tun kann, zugleich aber in enger Korrespondenz mit den Kunstwerken zu stehen, die sich einer solchen begrifflichen Durchdringung gerade widersetzen. Es liegt der Ästhetischen Theorie nicht daran sich auf die eine oder andere Seite der Alternativen zu schlagen. Würde sie sich auf die Seite der Allgemeinheit schlagen, so würde sie nicht mehr an die Kunst heranreichen. Sie würde als abgehobene Theorie unter dem Niveau der Kunst verbleiben. Als Philosophie der Kunst würde sie ihrem Gegenstand nicht mehr gerecht werden. Entschiede sie sich für das Besondere einzelner Werke, so wäre ihre theoretische Kraft eingebüsst. Sie würde als Kunstkritik unter das Niveau von Theoriebildung fallen.
Die Probleme der Kunst teilen sich so der Ästhetik als Forderungen mit, die von der Ästhetischen Theorie gerade zu lösen wären, statt sich für die eine oder andere der Alternativen zu entscheiden. Der Ästhetik liegt daher, wie es in der Frühen Einleitung heisst, eine immanente Not zugrunde, nämlich dass eine Ästhetik «weder von oben noch von unten konstituiert werden kann; weder aus den Begriffen noch aus der begrifflosen Erfahrung.»33 Die geschichtliche Konstellation fordert die Ästhetik heraus, einerseits den Zerfall der traditionellen ästhetischen Kategorien einzugestehen, sich aber anderseits nicht mit kunstkritischen Übungen einzelner Werke zu begnügen. Der geschichtlichen Situation der dreifachen Rechtfertigungskrise der Kunst hat eine Ästhetik sich zu stellen, sofern sie überhaupt philosophische Ästhetik bleiben will. Die gegenläufigen Alternativen haben sich deshalb der Theoriebildung mitzuteilen, indem sie die eigentliche Problemlage der Ästhetischen Theorie bilden. Vor dieser Problemlage fragt die Ästhetische Theorie also nach der Kunst. Die Ausgangslage verkompliziert sich aber noch mehr. Will die Ästhetische Theorie die Kunst als Rationalität in Gestalt ihrer Andersheit verstanden haben, so erweist sich die Problemlage als unauflöslich:
«Der Ästhetik haftet der Makel an, daß sie mit ihren Begriffen hilflos hinter einer Situation der Kunst hertrabe, in der diese gleichgültig was aus ihr wird, an den Begriffen rüttelt, die kaum von ihr weggedacht werden können. Keine Theorie, auch nicht die ästhetische, kann des Elements von Allgemeinheit entraten. Das führt sie in Versuchung, Partei zu ergreifen für Invarianten von eben der Art, wie die emphatisch moderne Kunst sie attackieren muß.»34
Die Problemlage der Ästhetik ist also dahin zugespitzt, dass der Versuch, die Kunst theoretisch zu bestimmen, von der modernen Kunst, um die sich Adorno erst bemühen will, selbst immer schon untergraben wird. Die moderne Kunst verurteilt die Ästhetik zur theoretischen Unzulänglichkeit. Es wird ersichtlich worin die Tragweite liegt, die Kunst als Rationalität in Gestalt ihrer Andersheit zu verstehen. Die theoretische Arbeit einer Ästhetik sieht sich nicht einfach mit der Frage konfrontiert, wie mit rationalen Mitteln sich einem irrationalen Bereich theoretisch zu bemächtigen wäre. Die Lage der Ästhetik ist eine andere. Die theoretischen Bemühungen stehen nicht einfach dem irrationalen Bereich der Kunst gegenüber, der sich gleichgültig gegen die Theorie hält. Die theoretischen Bemühungen sollen gerade die Rationalität in der Gestalt einer Widerständigkeit gegen sich selbst zur theoretischen Aushandlung bringen. Die zentralen ästhetischen Begriffe, um die sich eine Ästhetik bemühen müsste, stellen sich widerspenstig gegen die Theorie, welche sie erst versucht zu fassen.35
Ein solches ästhetisches Grossprojekt, wie es die Ästhetische Theorie sein möchte, scheint also zum Scheitern verurteilt. Ein solches Projekt müsste konsequenterweise unter seinem eigenen Anspruch zurückbleiben, und zwar genau aufgrund der Probleme, die es selbst einbekennt. Und trotzdem hielt Adorno an seiner Möglichkeit und Dringlichkeit fest.36
III. Rechtfertigung der Ästhetik
Genau in den Problemen der Ästhetik liegt für Adorno ihre Rechtfertigung. Ihre geschichtlichen wie auch theoretischen Schwierigkeiten fordern gerade nach einer Ästhetik, welche die Probleme in sich aufnimmt und reflektiert. Dies meint aber nicht einfach, dass eine aktuellere Ästhetik gefordert ist, da die älteren Ästhetiken von Entwicklungen innerhalb des Kunstbetriebs und seinen Erzeugnissen eingeholt wurden und als veraltet gelten. Es liegt ihr nicht daran, lediglich der Vollständigkeit halber den neuesten Entwicklungen der Kunst eine philosophische Rechtfertigung zu liefern, da diese von der älteren Ästhetik nicht mehr eingefangen werden können. Die Rechtfertigung liegt vielmehr in der spezifischen geschichtlichen Situation der dreifachen Rechtfertigungskrise der Kunst begründet, durch welche die Ästhetische Theorie erst in ihre Problemlage gebracht wurde.
Die Kunst fordert in der Situation ihrer Krise eine Ästhetik heraus, in der die traditionellen Kategorien in ihrer Unzulänglichkeit reflektiert werden. Mit dem dreifachen Verlust der Selbstverständlichkeit der Kunst liegt es einer Ästhetik eben nicht daran, einen etablierten Bereich der Kunst theoretisch auszumessen, sondern in ihrer Ungewissheit erst nach seiner Möglichkeit zu fragen. Erinnern wir uns daran, dass die Rechtfertigungskrise nicht nur das Selbstverständnis der Kunst betrifft, sondern auch ihren Ort im gesellschaftlichen Gefüge, wie überhaupt ihr Existenzrecht. Darin kehrt die Kunst nach Adorno gerade ihr kritisches Potential nach aussen. Und sie tut dies als Rationalität in Gestalt selbstkritischer Widerständigkeit. Diese kritische Wendung der Kunst verlangt daher nach einer philosophischen Untersuchung, durch welche die kritischen Potentiale der Kunst erst eingesehen werden und sich begrifflich zur Artikulation bringen. Damit verschiebt sich auch der Bewertungsmassstab der Kunst. Für Adorno bedeutet diese kritische Wendung, die Kunst primär nach ihrer Wahrheit zu befragen. Eine Ästhetik fragt deshalb nach dem Wahrheitsgehalt der Kunst. Die Ästhetische Theorie ist daher wesentlich eine Wahrheitsästhetik und keine Ästhetik des Schönen. Sie misst die Kunst an ihrem Wahrheitsgehalt.
Philosophisch wird die Kunst durch ihren Wahrheitsgehalt. Dieser allein legitimiert nach Adorno überhaupt erst eine Ästhetik. So heisst es über den Wahrheitsgehalt in der Ästhetischen Theorie: «Der [Wahrheitsgehalt, W.A.] ist allein durch philosophische Reflexion zu gewinnen. Das, nichts anderes rechtfertigt Ästhetik.»37 Wäre die Kunst sich selbst in ihrer Stellung innerhalb der gesellschaftlichen Totalität und damit auch in ihrem Existenzrecht nicht problematisch, so hätte die Kunst eine Ästhetik, die die Kunst nach ihrer Wahrheit befragt, gar nicht erst nötig. Ist die ästhetische Moderne aber gerade durch die dreifache Rechtfertigungskrise der Kunst bestimmt, so hat eine Ästhetik nicht einfach einen etablierten Bereich, wie kontrovers er in sich auch immer diskutiert sein mag, zu rechtfertigen, sondern sie hat den Bereich der Kunst in seiner Fragwürdigkeit anzunehmen. Die Rechtfertigung der Ästhetik liegt dabei gerade darin, dass die Kunst ihren Wahrheitsgehalt nicht selbst auszusprechen vermag, von dem gesagt wurde, dass er allein durch philosophische Reflexion zu gewinnen sei. Was zuvor in der immanenten Not der Ästhetik als begrifflose Erfahrung bezeichnet wurde, kann nun dahin gedeutet werden, dass es einer Ästhetik daran liegt, diese begrifflich aufzuschliessen, ohne sie aber einfach ins Feld des Begrifflichen zu übersetzen. Dass Kunst selbst philosophisch wurde, heisst daher, dass sie aufgrund ihres Wahrheitsgehalts eine philosophische Deutung herausfordert. Die Kunst ist somit auf die Philosophie angewiesen. In der Kunst sind Potentiale angelegt, die von einer philosophischen Deutung zu artikulieren wären. Sowenig wie Theorie ästhetisch wird, meint auch das Philosophischwerden von Kunst nicht, dass Philosophie und Kunst sich angleichen, dass Kunst zur Philosophie wird oder die Philosophie zur Kunst. Die Konvergenz von Philosophie und Kunst liegt ja gerade nur in ihrem Wahrheitsgehalt, ohne dabei ineinander überzugehen. Ihre Differenz ist von einer Ästhetik aufrechtzuerhalten, genauso wie die Kunst sich nicht einreden darf, selbst Philosophie zu sein. Philosophisch ist die Kunst, indem sie sich durch ihren Wahrheitsgehalt als philosophischer Gegenstand aufdrängt. Wie die Kunst ihren Wahrheitsgehalt selbst nicht ausspricht, so kehrt die Kunst als Gegenstand der philosophischen Untersuchung ihre Widerständigkeit entgegen. Die Ästhetik kann nicht einfach ihren Gegenstand positiv bestimmen. So heisst es von ihr:
«Ihr Gegenstand bestimmt sich als unbestimmbar, negativ. Deshalb bedarf Kunst der Philosophie, die sie interpretiert, um zu sagen, was sie nicht sagen kann, während es doch nur von Kunst gesagt werden kann, indem sie es nicht sagt.»38
Eine Ästhetik hätte also der Negativität der Kunst insofern Rechnung zu tragen, als sie die Negativität ihres Gegenstandes nicht übergeht. Da er sich eben nicht positiv ausformulieren lässt, hat die Ästhetik die Kunst in ihrer Unbestimmbarkeit zu bestimmen. Dies wäre die Form, in der es eine Ästhetik vermag, sich der Kunst anzunehmen, ohne ihren theoretischen Anspruch zu opfern. Sie würde dann die Kunst nicht von oben her in vorgeformte Kategorien pressen. Ästhetik hätte den Wahrheitsgehalt der Kunst in seiner Widerständigkeit zu fassen. Eine solche Wahrheitsästhetik wird zu einer negativen Wahrheitsästhetik, indem sie um des Wahrheitsgehalts willen die Negativität ihres Gegenstandes respektiert:
«Damit beugt Ästhetik sich dem, was ihr Gegenstand, gleich einem jeden, unmittelbar zunächst will. Jedes Kunstwerk bedarf, um ganz erfahren werden zu können, des Gedankens und damit der Philosophie, die nichts anderes ist als der Gedanke, der sich nicht abbremsen läßt.»39
Es scheint nun so, als bemühe sich die Ästhetische Theorie um die Deutung von Kunstwerken um ihres Wahrheitsgehalts willen. Ästhetik wäre dann Interpretation von Werken ihres Wahrheitsgehalts wegen. So hiess es ja, dass die Kunst der Philosophie bedarf, da sie von sich aus den Wahrheitsgehalt nicht auszusprechen vermag. Eine Ästhetik hätte dann gerade in der Negativität der Kunstwerke ihre Deutung vorzunehmen und diese Negativität zu artikulieren. Ästhetik wäre dann in der ästhetischen Moderne in Kunstkritik einzelner Werke übergegangen und damit gar keine Ästhetik mehr im Sinne einer Philosophie der Kunst. Wenn dem so wäre, dann hätte die Ästhetische Theorie sich die schlechte Alternative der Deutung einzelner Kunstwerke ausgesucht, ohne noch den Anspruch auf Allgemeinheit erheben zu können. Sie wäre dann vielmehr das, was man eine materiale Ästhetik nennen könnte, eine, die in je einzelnen Werken versucht in philosophischer Deutung den Wahrheitsgehalt zu fassen.40 Die Ästhetische Theorie erhebt aber weder den Anspruch, eine solche materiale Ästhetik zu sein, noch vollzieht sie eine solche. In dieser Weise, von der die Ästhetische Theorie selbst immer wieder von Ästhetik spricht, wäre sie selbst keine Ästhetik. Rechtfertigt der Wahrheitsgehalt der Kunst erst eine Ästhetik, so hätte sie sich aber zugleich auch davor zu hüten, wiederum in eine der fatalen Alternativen zu geraten, von der sie ausgegangen war und durch die hindurch sie sich erst legitimiert hat. Eine Ästhetik moderner Kunst hätte dann zwar ihre Dringlichkeit ausgewiesen, ihre Durchführung steht aber immer noch im Ungewissen. Die Ästhetische Theorie als eine Philosophie der Kunst muss daher in einer anderen Weise verstanden werden.
IV. Theorie der Ästhetik
Die Ästhetische Theorie ist keine Ästhetik, die sich in Werke vertieft, um ihren Wahrheitsgehalt aufzuschliessen. Ihr liegt es vielmehr daran, den in der dreifachen Rechtfertigungskrise befindlichen Bereich der Kunst in seiner Möglichkeit auszumessen. Dafür hätten sich die traditionellen ästhetischen Kategorien in ihrer Ungewissheit einer erneuten kritischen Reflexion zu stellen. Was die Ästhetische Theorie also selbst immer wieder von einer Ästhetik fordert und als ihre Rechtfertigung angibt, nämlich in Interpretationsarbeit den Wahrheitsgehalt aufzuschliessen, bringt sie nicht zur Durchführung. Ihr Programm gleicht vielmehr einer Ästhetik, die sich von oben her konstituiert, während sie eine Ästhetik von unten predigt.
Liegt die Rechtfertigung der Ästhetik in der Konvergenz des Wahrheitsgehalts von Kunst und Philosophie, so löst die Ästhetische Theorie die damit einhergehende Forderung, sich in die Werke zu vertiefen, nicht ein. Die spärlichen und knappen Sätze zu einzelnen Kunstwerken mögen Belege dafür sein. Kaum können sie als das verstanden werden, was Adorno selbst von einer solchen materialen Ästhetik fordert und wie er sie selbst an anderen Stellen durchaus durchgeführt hat. Eine solche materiale Ästhetik würde es zwar vermögen über einzelne Kunstwerke oder über das Œuvre einer Künstlerin zu sprechen.41 Sind darin auch immer Erkenntnisse gewonnen, die die Kunst im Ganzen betreffen, sie vermögen den Bereich der Kunst nie in seiner Gänze auszumessen.42
Zwar wurde die Ästhetische Theorie in der dreifachen Rechtfertigungskrise der Kunst in die Lage zweier schlechten Alternativen gedrängt, doch sie vermochte sich zumindest darüber aufzuklären. Obwohl die Ästhetische Theorie ihre missliche Lage einbekennt, verwirft sie nicht einfach die Bemühungen um eine Ästhetik und mit ihr die ästhetischen Kategorien. Darin versteht sich die Ästhetische Theorie als eine Philosophie der Kunst im traditionellen Sinn, indem sie an ihren Kategorien festhält. Die Ästhetische Theorie hält aber den traditionellen ästhetischen Kategorien zugleich den kritischen Spiegel der modernen Kunst entgegen, die dadurch bestimmt wurde, dass sie sich widerständig gegen die begriffliche Festsetzung in Invarianten stellt. Ästhetik diktiert so der Kunst nicht mehr von oben her ihre Kategorien, sondern befragt kritisch die traditionellen Kategorien zum Zeitpunkt ihrer Krise. Die Rücksprache mit den Kunstwerken wird so zur Voraussetzung einer Ästhetik, wie sie die Ästhetische Theorie sein möchte. Dies macht Adorno in der Ästhetischen Theorie deutlich: «Unabdingbar setzt Ästhetik die Versenkung ins einzelne Werk voraus.»43 Was sie als Voraussetzung hat, führt sie aber selbst nicht durch. Mögen diese Voraussetzungen an anderer Stelle geleistet sein, in der Ästhetischen Theorie finden sie nur noch in verkürzten und thesenhaften Sätzen Eingang.
Die Aushandlung des Möglichkeitsraums von Kunst in jener geschichtlichen Situation, in der die Kunst selbst in dreifacher Weise fragwürdig geworden ist, wird in der Ästhetischen Theorie unter der Voraussetzung der philosophischen Deutung moderner Kunstwerke vollzogen. Der Unterschied zwischen einer materialen Ästhetik und dem Projekt einer Ästhetischen Theorie wird daher in der Ästhetischen Theorie selbst ausgehandelt. Sie klärt sich also in ihrer misslichen Lage zwischen den zwei schlechten Alternativen auch über sich selbst auf. Wird die Ästhetische Theorie in dieser Weise verstanden, so wird auch ersichtlich, warum sich Adorno vermeintlich nicht auf die Kunstproduktionen der 1950er und 1960er Jahre bezieht. Die Ästhetische Theorie versucht ja gerade nicht, das Kunstgeschehen dieser Zeit theoretisch einzufangen.44 Ihr Ansatz ist ein anderer. Sie setzt dort an, wo die Kunst durch ihre Krise ihr kritisches Potential als Rationalität in Gestalt ihrer Andersheit hervorkehrt und wendet dieses kritische Potential zurück auf die ästhetischen Kategorien.
Der Titel einer Ästhetischen Theorie ist daher in anderer Weise zu verstehen. Er ist nicht als ein Hinweis dafür zu nehmen, dass es sich um eine ästhetisch verfasste Theorie, noch, dass es sich um eine traditionelle oder eine materiale Ästhetik handelt. Weder wird Theorie selbst zum Ästhetischen noch schlägt sich die Theorie auf eine Seite der schlechten Alternativen. Nimmt man den Anspruch der Ästhetischen Theorie ernst, so wäre eine weitere Deutung vorzuschlagen. In diesem Vorschlag ist das Projekt der Ästhetischen Theorie vielmehr das einer Theorie, die den Möglichkeitsraum und die Kategorien nicht nur der Kunst, sondern auch einer materialen Ästhetik ausmisst. In der Ästhetik-Vorlesung von 1958/59 spricht Adorno analog zur Physik von Grundlagenforschung, die angesichts der Ungewissheit sämtlicher materiellen und theoretischen Bedingungen für den Bereich der Kunst ihre Dringlichkeit anmeldet. Durchzuführen wären sie «von Menschen […], die sich einbilden, etwas von Kunst und von Theorie zu verstehen».45
Daher lässt sich die Ästhetische Theorie als eine Theorie der Ästhetik verstehen. Führte die Doppeldeutigkeit des Titels einer Ästhetischen Theorie noch in die Irre, so lässt sich in der Umformulierung zu einer Theorie der Ästhetik eine neue Doppeldeutigkeit gewinnen, die dem Gehalt der Ästhetischen Theorie näherkommt. Ästhetische Theorie als Theorie der Ästhetik ist dann eine Theorie, die sowohl den Bereich des Ästhetischen zum Gegenstand hat als sich auch durch den Bereich des Ästhetischen, nämlich mit den Kunstwerken selbst formuliert. In einer solchen Theorie würde es erst ausstehen, in kritischer Reflexion der ästhetischen Kategorien und Begriffe die Möglichkeit von Kunst auszuformulieren.
V. Begriff des Kunstwerks
Wird Ästhetische Theorie so verstanden, so kommt dem Kunstwerkbegriff, da er in eigentümlicher Weise in die Problemlage der Ästhetischen Theorie verwickelt ist, eine besondere Stellung zu. Ein Kunstwerkbegriff, der sich mit der Kunst in der dreifachen Rechtfertigungskrise befindet, ist von der damit verbundenen Problemlage nicht ausgenommen. Bemüht sich die Ästhetische Theorie um einen Kunstwerkbegriff, so müsste auch von ihm gelten, dass er der Kunst nicht von oben her diktiert wird. Und ebenso gilt für ihn, dass seine Konzeption die kritische Reflexion der modernen Kunst in sich aufnehmen muss. Der Begriff des Kunstwerks erhält daher in der Ästhetischen Theorie eine ambivalente Rolle. Einerseits muss er sich genauso der kritischen Prüfung moderner Kunst stellen wie schon alle anderen ästhetischen Begriffe und Kategorien, anderseits benennt der Kunstwerkbegriff aber genau diejenige Instanz, nämlich das Kunstwerk, von der die Theorie dauernd in Frage gestellt wird. Ein solcher Kunstwerkbegriff hätte also auch jenes Moment in sich aufzunehmen, das ihn selbst fortwährend in Frage stellt.
Trotz diesen Schwierigkeiten hält Adorno aber an einem Kunstwerkbegriff fest, von dem eigentlich schon in den 1960er Jahren behauptet wurde, dass seine Werkform sich im Zerfall befinde; wie zweifelhaft es auch erscheinen mag, ob es ein solches Werkideal in der Kunst jemals wirklich gab.46 Daher macht etwa Bubner den Vorschlag, in seiner Abrechnung mit den nachidealistischen Ästhetiken, den Werkbegriff überhaupt zu verwerfen. Mit der modernen Kunst und ihrer Emanzipationsbewegung machen sich Tendenzen breit, die auf die Überwindung der Werkeinheit des klassischen Kunstwerkbegriffs zielen. Eine Ästhetik, die einfach über die Krise des Werkbegriffs hinwegschaut, macht sich nach Bubner für einen wesentlichen Zug der ästhetischen Moderne blind. Ästhetiken, die einen unveränderten Werkbegriff unterstellen oder gar emphatisch hervorheben, seien daher wenig geeignet, die gegenwärtige Kunst begrifflich einzufangen.47 Mit Blick auf die Nachkriegskunst scheint daher die Abwendung vom Kunstwerkbegriff und dessen Ersetzung durch andere Begriffe, etwa jenen der ästhetischen Erfahrung, theoretisch erforderlich.
Den Kunstwerkbegriff zu verwerfen würde das Projekt einer Ästhetischen Theorie untergraben, denn mit diesem steht ebenso das werkzentrierte Interpretieren und Verstehen in der Krise.48 Ohne einen angemessenen Kunstwerkbegriff lässt sich schwerlich noch von einem Wahrheitsgehalt sprechen, der nach einer philosophischen Deutung der Werke fragt. Ohne einen Kunstwerkbegriff geht daher auch die Rechtfertigung einer Ästhetik verloren. Mit dem Kunstwerkbegriff geht der Wahrheitsgehalt der Werke verloren, so wie es dann auch keiner philosophischen Ästhetik mehr bedarf, die ihn zu fassen versucht.
Für einen Kunstwerkbegriff gilt es in einem solchen Vorhaben, wie es die Ästhetische Theorie





























