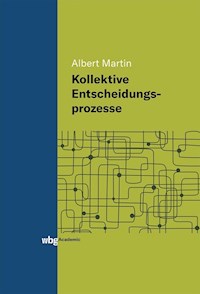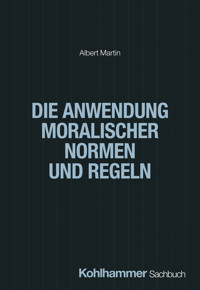
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In Zeiten der Veränderung, der Unruhe und des Konflikts sucht man verstärkt nach Orientierung, Selbstvergewisserung und der Bestätigung, auf der richtigen Seite zu stehen. Sich auf die Moral zu besinnen, kann als Versuch gelten, den Halt zurückzugewinnen, der angesichts der Unbestimmtheit und Komplexität der Verhältnisse verloren zu gehen droht. Wenn es allerdings beim Einklagen moralischer Postulate bleibt, ist wenig gewonnen. Die Vorstellung einer reinen Morallehre, die sich ohne Weiteres in konkretes Handeln umsetzen lässt, ist nicht nur intellektuell unterkomplex, sondern auch moralisch bedenklich. Denn die moralischen Regeln und Normen selbst sind oft wenig strittig, Probleme entstehen primär bei ihrer Konkretisierung, bei der Abwägung der Mittel, der Vermittlung von Interessenlagen, der Einbindung moralischer Ideale in Strukturzusammenhänge. Das vorliegende Buch befasst sich mit dieser Anwendungsproblematik und behandelt verschiedene Lösungsansätze zum Umgang mit den sich dabei stellenden Herausforderungen. Veranschaulicht werden die Überlegungen durch zahlreiche Alltagsbeispiele aus den Bereichen der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Albert Martin
[3]Die Anwendung moralischer Normen und Regeln
Verlag W. Kohlhammer
[4]Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-045697-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-045698-3
epub: ISBN 978-3-17-045699-0
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
[5]Inhaltsverzeichnis
1
Die Unabdingbarkeit der Moral
2
Allgemeines und Besonderes
3
Praktischer Syllogismus
Aussagegehalt
Normative Grundlegung
Handlungsrahmen
Handlungsvoraussetzungen
4
Klugheit
Urteilsvermögen
Klugheitsregeln
Positive Heuristik
5
Ungewissheit
Information und Entscheidung
Definition der Situation
Willensbildung
6
Moralisieren
Begriffe
Quellen des Moralisierens
Moral und Moralisieren
7
Moralische Politik
Politische Klugheit und Moral
Machtposition
System- und Kulturveränderung
Einzelinteressen und persönliches Machtstreben
8
Kasuistik
Elemente
Stärken
Schwächen
Reflektives Gleichgewicht
9
Problemlösen
Moral als Problemlösung
Aufgaben des Problemlösens
Aufmerksamkeit
Problemdefinition
Handhabung
Umsetzung
Vorzüge einer Problemlösungsethik
10
Schlussbemerkungen
11
Literatur
[7]1Die Unabdingbarkeit der Moral
Die Moral setzt die Maßstäbe für die Beurteilung unseres Sozialverhaltens. Man sollte also meinen, dass man sich in allen Dingen, die einen nicht gänzlich allein betreffen, von moralischen Einsichten leiten lässt. Wie jeder weiß, ist das nicht der Fall. Menschen weichen in ihrem Handeln nicht nur von den allgemein als gültig erachteten, sondern auch von den ganz persönlich als richtig erkannten moralischen Vorstellungen ab und sie besitzen eine große Begabung, ihr nicht normgerechtes Verhalten als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Obwohl die hierbei ins Spiel gebrachten Gründe nicht selten fadenscheinig sind, ist nicht zu leugnen, dass es mitunter auch gute Gründe dafür gibt, moralischen Vorgaben nicht immer zu folgen, jedenfalls nicht ohne Weiteres. Ein guter Grund, sich moralisch gefärbten Handlungsaufforderungen zu verweigern, liegt vor, wenn Moral nur behauptet wird, wenn also kein ethisches Fundament für die geltend gemachte Verhaltensvorschrift existiert, wenn etwas für moralisch geboten erklärt wird, das im Lichte einer verständigen moralischen Betrachtung gar nicht gefordert werden kann, das möglicherweise sogar unmoralisch ist. Das ist allerdings der triviale Fall, um den es im vorliegenden Buch nicht weiter gehen soll. Stattdessen soll es im Folgenden nur um die Fälle gehen, die auf Normen und Regeln rekurrieren, die in der Philosophie und in praktisch allen modernen Gesellschaften weitgehend unstrittig sind. Beispiele sind das Gebot, seinen Mitmenschen mit Respekt zu begegnen, Personen in Not zu helfen, keinen Betrug zu begehen, niemandes Freiheit zu beschränken, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen usw. Dass über deren moralischen Wert weitgehend Konsens besteht, bedeutet allerdings nicht, dass sich aus ihnen ganz unmittelbar und eindeutig schon konkrete, auf die gegebene Problemsituation zugeschnittene Handlungsanweisungen ableiten lassen. Bei der Anwendung moralischer Regeln müssen vielmehr [8]zahlreiche Bestimmungsleistungen erbracht werden, man muss sich ein realistisches und möglichst vollständiges Bild von der Handlungssituation verschaffen und man braucht Wissen über die Wirkungszusammenhänge, die sich mit alternativen Handlungsweisen verknüpfen. Ein Beispiel liefert die folgende, wohl universell gültige, moralische Regel: »Füge Deinen Mitmenschen keinen Schaden zu!« Was gefordert wird, lässt sich kaum missverstehen. Tatsächlich stellen sich bei ihrer Befolgung aber dennoch zahlreiche Fragen. Eine Auswahl: Wie strikt ist dieses Gebot zu beachten, gibt es also Ausnahmen? Sind Schädigungen immer vermeidbar? Wie lässt sich ein Schaden bemessen? Sind finanzielle, soziale, psychische Schädigungen miteinander vergleichbar? Was definieren die Betroffenen, was definiert die Gemeinschaft als Schaden? Wann kann man von einem wirklichen Schaden sprechen, wann liegt ein bloß vermeintlicher Schaden vor? Steckt in einer Ungleichheit, einer Benachteiligung, einem Zurückbleiben, immer schon auch eine moralisch einklagbare Schädigung? Gibt es nicht höhere Güter, um derentwillen es manchmal notwendig ist, mögliche Schädigungen in Kauf zu nehmen? Lassen sich Schädigungen kompensieren? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmtes Handeln einen wirklich großen Schaden anrichtet? In welchem Umfang sind schädigende Handlungen zulässig, unter welchen Umständen, von jedem und gegen jeden? Bei der Betrachtung dieser und ähnlicher Fragen, kann sich leicht der Eindruck aufdrängen, als ließe sich eine doch eigentlich von jedermann befürwortete Regel ganz leicht zerreden, als sei es möglich, sie ohne weiteres, z.B. durch begriffliche Wendungen oder durch Reklamation besonderer Umstände außer Kraft zu setzen. Dieser Gedanke vermittelt sich aber nur bei einem sehr eingeschränkten Moralverständnis. Moral erschöpft sich nämlich nicht in der Formulierung ethisch gut begründeter Regeln. Die angeführten und viele weitere ähnliche Fragen gehören ebenfalls ganz fundamental zu einem moralischen Diskurs und die Antworten, die darauf gegeben werden, müssen ebenfalls in Licht ethischer Überlegungen beurteilt werden. Hierzu zählt ganz ausdrücklich nicht nur die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik, sondern auch die Art und Weise, in der die Fragen erörtert werden und wie man hierbei miteinander umgeht.
Die Schwierigkeiten in der konkreten Anwendung moralischer Regeln gründen ganz wesentlich in deren Allgemeinheitsanspruch und ihrer hohen Abstraktheit. Der Pfad der Überlegungen, ausgehend von den mit den [9]Regeln gemeinten Intentionen hin zu deren Abbildung innerhalb einer ganz konkreten Handlungssituation, ist mitunter lang und verschlungen und damit anfällig für mentale und motivationale Verirrungen. Dies gilt zumal für die universellen moralischen Regeln, deren Konstrukte (Freiheit, Gerechtigkeit, Gemeinwohl usw.) auf einer sehr hohen Begriffsebene angesiedelt sind. Größere Robustheit versprechen Regeln auf einer mittleren Ebene. Man findet sie in speziellen Handlungsfeldern, in der Medizin, der Politik, der Ökonomie, der Arbeit und dem Berufsleben, der Publizistik, der Wissenschaft, der Schule, der Familie und der Erziehung, dem Rechtswesen und dem Verwaltungshandeln. Ein Beispiel ist die Verpflichtung des Arztes, seine Patienten über die möglichen Folgen eines medizinischen Eingriffs aufzuklären. In der Politik (jedenfalls in freiheitlichen Demokratien) gibt es die Verpflichtung, die Interessen von Minderheiten zu schützen. In der Publizistik soll klar zwischen Berichterstattung und Kommentierung getrennt werden. In der Wissenschaft müssen alle Erkenntnisquellen offengelegt und das methodische Vorgehen muss nachvollziehbar dokumentiert werden. Wirtschaftsunternehmen müssen bei der Bewertung von Vermögen und Schulden das Prinzip der Vorsicht walten lassen, bei der Leistungserstellung ist Verschwendung zu vermeiden und für die Beziehungen zwischen den Wirtschaftsakteuren ist Vertragstreue einzufordern. Bereichsspezifische Normen und Regeln richten sich auf die Aufgaben und Probleme, die sich in speziellen Handlungsfeldern stellen und anderweitig weniger bedeutend oder gänzlich irrelevant sind. Die ethischen Herausforderungen bei der embryonalen Stammzellenforschung beispielsweise sind anderer Natur als beim Gläubigerschutz in Insolvenzfällen, die Frage nach dem richtigen Umgang mit straffällig gewordenen Jugendlichen hat es mit anderen Phänomenen zu tun als die Frage, wie eine Regierung auf feindselige Attacken einer fremden Macht reagieren sollte. Verschiedentlich findet man die Vorstellung, wegen der bereichsspezifischen Besonderheiten brauche es jeweils auch eine bereichsbezogene Sondermoral, eine Vorstellung, die auf eine gewisse Entkoppelung der bereichsspezifischen von allgemein geltenden Regeln und Normen hinausläuft. In der Politik beispielsweise gehe es im Wesentlichen um die Gewinnung, die Verteilung und die Anwendung von Macht und Einfluss und dafür brauche es eigene Spielregeln. Nun hat man es aber beispielsweise auch in der Kindererziehung ganz zentral mit Fragen der Einflussnahme zu tun. Man wird in der Kindererziehung deswegen aber nicht den Regeln folgen, die in der politi[10]schen Auseinandersetzung anzutreffen sind, die Unterschiede sind schließlich eklatant, im einen Fall geht es um die Durchsetzung von Interessen und im anderen Fall um Persönlichkeitsentwicklung, Wissenserwerb und Kulturvermittlung. Vor allem aber hat man es mit ganz unterschiedlichen Akteuren zu tun. Lehrer sollen ihre Schutzbefohlenen z.B. nicht hart angehen, einschüchtern und manipulieren. Hartgesottene Politiker erwarten dagegen nicht, dass man sie mit Samthandschuhen anfasst und haben oft keine Skrupel, selbst ordentlich auszuteilen. Auch für den Bereich der Wirtschaft wird gern eine besondere Moral propagiert, die verlangt, jede Möglichkeit der Gewinnerzielung und Produktivitätssteigerung zu nutzen, weil einem sonst droht, von der Konkurrenz ausgebootet zu werden. Da man der Marktlogik nicht entrinnen könne, seien die Wirtschaftsakteure gezwungenermaßen Opportunisten, für die Eigensucht und Tücke zu Tugenden werden müssten. Entsprechend sei beispielsweise Rücksichtslosigkeit im Wirtschaftsleben anders zu bewerten als etwa in privaten Beziehungen oder im Straßenverkehr.
Beim ersten Hören klingt dies irgendwie plausibel. Tatsächlich ist die dahinterstehende Vorstellung aber nicht haltbar. Erstens ist die Abkopplung einer Bereichsethik von der Allgemeinen Ethik gefährlich und zweitens ist sie auch gar nicht notwendig. Nicht notwendig sind Bereichsethiken, weil die Allgemeine Ethik durchaus in der Lage ist, den Besonderheiten von Handlungsanforderungen Rechnung zu tragen. Sie erschöpft sich nämlich nicht im Durchreichen abgehobener Postulate zur gefälligen Beachtung in jeder passenden und unpassenden Situation, sondern sie befasst sich ganz wesentlich auch mit der Erarbeitung moralisch begründeter Verfahrens- und Argumentationsregeln, die in der konkreten Anwendung ihrer Regeln zum Zuge kommen sollten. Gefährlich ist die Variation moralischer Maßstäbe je nach Handlungsfeld, weil sie mit der Anmaßung einhergeht, moralische Gebote gegebenenfalls einfach ausblenden zu dürfen. Ausdruck findet dies beispielsweise im Verhalten von Experten, die Einwände von Laien mit überheblichem Lächeln abtun, bei Ärzten, die ihre Patienten wie unmündige Kinder behandeln, bei Vorgesetzten, die ihre Mitarbeiter herumdirigieren, bei Behörden, die Bürger als lästige Bittsteller betrachten, bei Geschäftemachern, die nicht an den Bedürfnissen ihrer Kunden, sondern ausschließlich an deren Geld interessiert sind. Derartige Verhaltensweisen vergiften nicht nur das soziale Miteinander, sie schädigen auch den Charakter ihrer Protagonisten.
[11]Die Vorstellung, man könne Elemente der Ethik für bestimmte Handlungsbereiche ausgrenzen, führt außerdem leicht dazu, diese Handlungsbereiche gleich vollends als unethisch oder als moralisch irrelevant zu deklarieren. Ein prominentes Beispiel ist, wie schon erwähnt, die Entgegensetzung von Ökonomie und Ethik, die man in vielen Diskussionen antrifft. Auf der einen Seite wird beklagt, dass das, was eigentlich moralisch geboten ist, sehr häufig von ökonomischen Interessen beiseitegeschoben wird, auf der anderen Seite wird kritisiert, dass moralische Anwürfe oft von wenig ökonomischen Sachverstand zeugen. Daraus wird nicht selten ein Kampf um die Priorisierung entweder von Moral oder von Ökonomie. Dabei gibt es diesen Gegensatz überhaupt nicht. Schließlich ist Wirtschaften eine hochmoralische Angelegenheit, bei der es um die Erarbeitung unserer Lebensgrundlagen geht, um Wohlstand und um die sich daraus ergebende Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Einen Gegensatz zwischen der Moral und der Ökonomie zu konstruieren ist schon aus diesem Grund widersinnig. Bezogen auf konkrete Entscheidungen können ökonomisch verankerte Überlegungen natürlich mit anderweitigen Überlegungen kollidieren, etwa wenn zwei wünschenswerte Ziele sich nicht gleichermaßen erreichen lassen wie z.B. bei der Erschließung neuer Gewerbeflächen die Sicherung von Arbeitsplätzen und der Naturschutz. Aber beide Ziele haben ein solides ethisches Fundament und daher lässt sich auch nicht pauschal das eine gegen das andere Ziel ausspielen. Was in solchen Fällen zu tun ist, kann nicht allgemein gesagt werden, sondern muss auf der Grundlage einer gewissenhaften Situationsklärung immer erst herausgearbeitet werden. Dabei muss es im Übrigen nicht nur um ökonomische und ökologische, sondern um viele weitere Fragen gehen. Dass dies nicht immer in wünschenswerter Weise geschieht, lässt sich nicht leugnen. Bei dem Bemühen, ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen, versuchen die Akteure die ihnen dienlichen Argumente zu stärken und wenn ökonomische (oder andere) Gründe für oder gegen eine Entscheidung vorgebracht werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dabei immer das Gemeinwohl im Auge behalten wird. Nichts spricht allerdings per se gegen ökonomische, ökologische, politische, technische oder andere Argumente, eine kritische Prüfung verdienen alle. Und das gilt auch für den Gebrauch der Argumente, denn Moral hat es nicht nur damit zu tun, welche inhaltlichen Gründe mehr überzeugen, sondern auch mit der Redlichkeit in der Argumentationsführung.
[12]Moralische Regeln und Normen sind nicht nur relevant bei der Beurteilung von konkreten Entscheidungen und Handlungen, sondern auch für die Konzipierung, die Implementierung und die Analyse des Funktionierens von Handlungssystemen, d.h. von Interaktionsformen im öffentlichen Raum, Versammlungen, Gesprächsformaten, Gemeinschaftsprojekten, Familien und Partnerschaften, sozialen Gruppierungen, Organisationen, Gesellschaften. Moralische Kritik an der Ökonomie entzündet sich daher nicht nur an der Parteilichkeit bei der Durchsetzung rein wirtschaftlicher Interessen, sondern auch an der Art des Wirtschaftens insgesamt, d.h. an der Wirtschaftsordnung und den sie tragenden Institutionen sowie an den damit verwobenen Überzeugungen und Handlungsdispositionen. Ein Beispiel betrifft die Frage nach der Rolle des Staates bei der Lenkung der Wirtschaft. Adam Smith, einem der Gründungsfiguren der Wirtschaftswissenschaften, wird beispielsweise häufig die Auffassung zugeschrieben, der Staat solle sich möglichst aus allen Aktivitäten einer Volkswirtschaft heraushalten. Tatsächlich vertraut Smith sehr stark der Leistungsfähigkeit einer »natürlichen« Selbststeuerung des Wirtschaftslebens. Andererseits hat er auch einen klaren Blick für die Mängel einer Laissez-faire-Politik und gibt selbst Ratschläge für mögliche Staatseingriffe. Wie lässt sich dieser Widerspruch im Denken von Adam Smith erklären? Dazu schreibt Jacob Viner:
»Smith ist selten auf Fälle gestoßen, in denen die Regierung dem allgemeinen Wohl einen nützlichen und wirksamen Dienst erwiesen hatte … Zu seiner Zeit lag die englische Regierung in den Händen einer aristokratischen Clique, einer intriganten, korrupten, zynischen und von Klassenvorurteilen bestimmten Gruppe des britischen Adels … Selbst wenn Smith einräumen mußte, daß das System der natürlichen Freiheit das Gemeinwohl nicht optimal fördere, so zog er daraus doch nicht unbedingt die Folgerung, staatliche Intervention sei dem laissez-faire vorzuziehen. Das Übel eines hemmungslosen Gewinnstrebens war für ihn noch eher zu ertragen als das Übel einer inkompetenten und korrupten Regierung.« (Viner 1971, 81)
Diskussionen über die richtige Ordnungspolitik sind stark geprägt von den historischen Umständen, von der Ideengeschichte, vom herrschenden Menschenbild, vom Stand von Wissenschaft und Technik. Dass Adam Smith z.B. nicht das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft entwickelt hat, kann man ihm daher kaum vorwerfen, schließlich waren die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 18. Jahr[13]hunderts gänzlich andere als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und eine endgültige Lösung für eine nicht nur funktionstüchtige, sondern auch für eine moralisch vollständig befriedigende Wirtschaftsordnung wird es wohl nie geben. Dabei verfolgen ordnungspolitische Konzepte in aller Regel die besten Absichten. Ein Wirtschaftssystem soll die materiellen Grundlagen für eine sinnvolle Lebensgestaltung schaffen. Es soll außerdem gerecht sein, also sowohl die Lasten als auch die Erträge in angemessener Weise verteilen. Zu gewährleisten ist daneben der Schutz vor Ausbeutung und staatlicher Willkür und, zumindest in einer offenen Gesellschaft, außerdem die Freiheit, unternehmerisch tätig zu sein, den Beruf selbst bestimmen und den Arbeitsplatz selbst auswählen zu können. Die Begrenzung und Kontrolle von wirtschaftlicher Macht, der sorgsame Umgang mit der Natur und die Vorsorge für eine lebenswerte Zukunft sind weitere elementare Ziele. In Wirtschaftsordnungen steckt also viel moralischer Anspruch. Ihm in allen Belangen gerecht zu werden ist so gut wie unmöglich, weil moderne Gesellschaften zu komplex sind, als dass sie sich auf nur einen einzigen moralischen Nenner bringen ließen. Das aber macht den moralischen Diskurs nur um so wichtiger, weil ansonsten, in Anbetracht der Vielfalt der Bedürfnisse, Interessen, Ideologien und Überzeugungen, die Gefahr besteht, dass die Maßstäbe des Handelns verrutschen und dem Belieben der Mächtigen oder der Beliebigkeit des wankelmütigen Zeitgeistes anheimgestellt werden.
Auch auf dem sehr hochaggregierten Niveau, auf dem die Fragen nach den Ordnungsmustern der Wirtschaft (und anderer gesellschaftlicher Sphären) zu diskutieren sind, ist eine Vergewisserung über deren moralische Fundierung also in höchstem Maße zu wünschen. Das betrifft auch alle Regularien und Institutionen, die die Wirtschaftsordnung im Eigentlichen erst konstituieren z.B. die Gerichtsbarkeit und die Gesetze, die Fiskalpolitik, die Sozialpolitik, die staatlichen Fördermaßnahmen, Behörden wie die Arbeitsvermittlung und die Gewerbeaufsicht, Verbände, Beratungsgremien, Lobbygruppen und Nichtregierungsorganisationen und nicht zuletzt die Bildungsorganisationen, in denen die (allgemeinen und speziellen) Qualifikationen vermittelt werden, die in einer leistungsstarken Wirtschaft gebraucht werden. Die Ausgestaltung all dieser Bereiche ist eng mit moralischen Fragen verknüpft: Welche moralischen Regeln liegen der vorfindlichen Praxis zugrunde? In welchem Umfang werden sie befolgt? Lassen sich die moralischen Regeln überhaupt anwenden? Was [14]erschwert die Umsetzung? Welche Kompromisse werden gemacht? Wie werden diese begründet? Welche Möglichkeiten gibt es, dem moralischen Standpunkt mehr Gehör zu verschaffen? Warum werden sie nicht genutzt? Was spricht dafür, die gängige Praxis zu verändern oder sie beizubehalten? Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ist lohnenswert, nicht nur, weil damit das moralische Bewusstsein auf ein höheres Niveau gebracht wird, sondern auch deswegen, weil bei der Beschäftigung mit diesen Fragen oft Ideen entstehen, wie außerdem die Funktionstüchtigkeit der in Frage stehenden Regulierungen verbessert werden kann. Und nicht zuletzt zeigt die moralische Reflexion, dass die Wirtschaft mit allen anderen Bereichen der Gesellschaft eng verflochten ist und deswegen auch nicht bloß eine Wohlstandsmaschine sein kann, die man getrost ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten überlassen sollte.
Wie bedeutsam der ethische Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ist, wird anschaulicher und auch praktisch greifbarer bei der Betrachtung der verschiedenen auf einer mittleren Ebene angesiedelten gesellschaftlichen Institutionen und Praktiken. Im ökonomischen Kontext gehören hierzu insbesondere die Strukturen und Strategien von Wirtschaftsunternehmen. Ganz am Anfang steht die Frage nach den Produkten und Leistungen, d.h. nach dem gesellschaftlichen Nutzen, den sie stiften und nach den Qualitätsstandards, denen sie genügen. Eine hohe Moralaffinität besitzen außerdem der Umgang mit Kunden und Lieferanten, die Informationspolitik, die Produktionstechnologie, der Umweltschutz sowie die Wahrnehmung der Verantwortung für die öffentlichen Belange der Region. Ein besonders moralsensibles Themenfeld ist die Personalpolitik. Dazu gehört u.a. die Ausgestaltung der Arbeitsverträge, die Inhalte und die Organisation der Arbeit, die betriebliche Mitbestimmung und nicht zuletzt die Lohngestaltung. Löhne sollen gerecht sein, woraus sich ein unmittelbarer Bezug zu einem der Schlüsselbegriffe der Allgemeinen Ethik ergibt. Das Bedeutungsspektrum des Gerechtigkeitsbegriffs ist allerdings enorm. Viele Philosophen verstehen unter Gerechtigkeit ein Produkt von Übereinkünften, andere Philosophen gehen davon aus, dass Gerechtigkeit nicht nur empirisch bestimmt, sondern gewissermaßen erkannt werden kann und unabhängig von soziokulturellen Gegebenheiten existiert. Gerechtigkeit gilt als Tugend, aber auch als Eigenschaft von Sozialsystemen, Gesetzen, Regeln, Konzepten und Maßnahmen. Gerechtigkeit wird als Fairness definiert, als Sittlichkeit, als Rechtstreue [15]usw. Es gibt die Auffassung, Gerechtigkeit ließe sich nur formal bestimmen (etwa als Prinzip Gleiches gleich, Ungleiches ungleich zu behandeln) andere Ansätze beschreiben dagegen umfängliche inhaltliche Ausformungen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. In der Literatur über die Lohngerechtigkeit wird meist die Leistungsgerechtigkeit herausgestellt. Wer mehr leistet, soll einen höheren Lohn haben. Das leuchtet ein, weist aber eine erhebliche Unschärfe auf und ist erst noch zu konkretisieren. Leistung lässt sich beispielsweise rein mengenmäßig bestimmen, wichtiger ist mitunter aber die Qualität und in bestimmten Fällen besteht sogar eine negative Korrelation zwischen Menge und Qualität. Weitere Leistungskriterien sind Materialersparnis, Ausschussvermeidung, die Einhaltung von Zeitvorgaben, die Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen, der wirtschaftliche Erfolg einer Betriebseinheit oder auch des Gesamtbetriebs. Zur Leistungserbringung gehört und bei der Lohnfindung zu berücksichtigen ist außerdem der Erwerb von Qualifikationen, die zur Ausübung einer Tätigkeit notwendig sind und die Übernahme der Verantwortung für die Erledigung der anstehenden Aufgaben. Manche Leistungen lassen sich nur schwer erfassen und werden in der Leistungsbestimmung daher oft ignoriert. Ein Beispiel ist der Beitrag, den jemand zur Förderung eines guten Arbeitsklimas leistet, ein anderes Beispiel ist der Aufbau einer Kundenbeziehung, aus der vielleicht kurzfristig keine sonderlichen Umsätze erwachsen, die sich wegen ihrer Verlässlichkeit langfristig jedoch durchaus auszahlt. Ob Lohnzahlungen, die sich ausschließlich am Leistungsgedanken orientieren, wirklich gerecht sein können, ist umstritten. In vielen Fällen ist es geboten, weitere Aspekte in die Betrachtung einzubeziehen. Große Bedeutung kommt beispielsweise auch der Schwere der Arbeit zu, also den Arbeitsbelastungen, mit denen sich Stress und Beeinträchtigungen der Gesundheit verbinden. Zum Zuge kommen außerdem Aspekte, die jenseits einer vorgeblich nur auf Tausch gegründeten Arbeitsbeziehung angesiedelt sind. Dazu zählen beispielsweise die Beschäftigung von Leistungsgeminderten, die Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall und z.B. auch die Prämierung von Betriebstreue. Ein großes Problem ist die Vergleichbarkeit. So lässt sich der Verkaufserfolg von Außendienstmitarbeitern im Vertrieb normalerweise leicht beziffern, für die Innovationen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder für die Arbeit im Justiziariat fällt dies schon wesentlich schwerer. Besonders problembehaftet ist die Leistungsbewertung im Ma[16]nagementbereich. Hier wird daher gern die Marktgerechtigkeit ins Spiel gebracht, gemäß der Angebot und Nachfrage entscheiden sollen, welche Gehaltszahlungen angemessen sind. Es ist allerdings umstritten, ob diesbezüglich immer die Bedingungen gegeben sind, die in den Marktmodellen der Mikroökonomie, auf die man sich hierbei bezieht, vorausgesetzt werden können. Ganz generell gilt, dass es mitunter große Mühe macht, die Gerechtigkeitsaspekte zu spezifizieren, die der jeweiligen Arbeitssituation angemessen sind. In den Arbeitswissenschaften wird beispielsweise die Durchführung von Arbeitsbewertungen empfohlen. Die hierbei zum Einsatz kommenden Schemata können allerdings nicht allen Belangen genügen. Insbesondere lösen sie nicht das Problem der Gewichtung der verschiedenen Gerechtigkeitsaspekte. Letztlich wird man um eine gewissen Pauschalierung nicht herumkommen, weil es schwierig ist, jeden Einzelfall gesondert zu behandeln und dabei scharf gegen andere Fälle abzugrenzen. Zwar gibt es personalwirtschaftliche Instrumente, die darauf abzielen, insbesondere die Leistungsgerechtigkeit zu erhöhen (Kennziffern, Mitarbeiterbeurteilungen, Zielvereinbarungen, Wettbewerbe), ihr Einsatz ist aber nicht uneingeschränkt zu empfehlen, weil sie einen großen Spielraum für subjektive Bewertungen lassen und weil in ihnen oft eine Überbetonung bestimmter Teilaspekte steckt, weshalb ihr Gebrauch nicht selten mehr Gerechtigkeitsprobleme aufwirft als löst.
Strukturen und Institutionen kanalisieren das soziale Verhalten, ihre Bedeutung für die Moral kann daher kaum überschätzt werden. Letztlich ist es aber immer die einzelne Person, die die Verantwortung für ihr Handeln trägt, gleichgültig ob sie sich im Sinne der vom sozialen Gefüge vorgeprägten Erwartungen verhält oder gegebenenfalls dagegen wendet. Sie entscheidet, welchen moralischen Regeln sie folgt, ob sie sich also kooperativ oder egoistisch verhält, sich an Versprechen hält, großzügig oder kleinlich, kalt- oder warmherzig, geradlinig oder intrigant ist, ob sie ihre Fahne nach dem Wind dreht oder ob sie die Kraft aufbringt, sich ihr eigenes Urteil zu bilden und dazu zu stehen. In dem zuletzt angeführten Punkt steckt eine moralische Metaregel, die u.a. von Immanuel Kant mit dem berühmten Leitsatz der Aufklärung (»sapere aude«) herausgestellt wird. Eng damit verwandt ist die Aufforderung, keiner Idee und damit auch keiner vorgeblich höheren Moral blind zu folgen. So sind beim Rekurs auf eine moralische Regel z.B. immer auch deren Anwendungsbedingungen im Auge zu behalten. Die meisten Fälle sind diesbe[17]züglich sicher trivial: Jemanden zu bestehlen lässt sich wirklich nur in wenigen Fällen rechtfertigen, oder jemanden zu betrügen, ihn seiner Freiheit zu berauben, ihn zu verletzen usw. Es gibt aber auch viele Fälle, in denen nicht von vornherein klar ist, was wirklich jeweils der Fall ist und wie er moralisch zu bewerten ist. Markant stellt sich dieses Problem in Dilemma-Situationen, in denen alle aufscheinenden Verhaltensalternativen gleichermaßen unerfreulich sind. Problembehaftet ist außerdem die Befriedung von Konflikten, in denen die Parteien gleichermaßen berechtigte, aber unvereinbare Positionen einnehmen, das Verhalten in Risikosituationen, die Abwägung von Individual- und Kollektivinteressen sowie von lang- und kurzfristigen Handlungsfolgen. Nicht immer einfach zu beantworten sind außerdem Fragen wie die, ob und inwieweit man verpflichtet ist, sich einzumischen, wenn Dritten Unrecht geschieht, in welchen Fällen es erlaubt ist, sich über gesetzliche Regelungen hinwegzusetzen, wieviel soziales Engagement man einfordern darf usw.
Ganz allgemein und nicht zuletzt gerade aus ethischer Sicht besonders schwierig sind Fälle großer Komplexität und Unbestimmtheit, in denen nur fragmentarische und unsichere Informationen nicht nur über die Problemlage, sondern bereits über die Natur des Problems vorliegen und in denen sich Sachfragen eng und fast unauflöslich mit Bewertungsfragen verzahnen. Unübersichtlichkeit, emotionale Verunsicherung, querliegende Interessen, sollten eigentlich Anlass sein, sich in besonderem Maße um die Aufklärung der Sachlage und die Erarbeitung möglicher Lösungen zu bemühen. Weil dies allerdings oft anstrengend ist oder gar als aussichtslos gilt, geschieht nicht selten das Gegenteil, d.h., statt nüchterner Analyse regieren Ideologie, Wunschdenken und Rechthaberei, bei der Argumente (und zwar auch moralische Argumente) bewusst selektiv, d.h. ausschließlich strategisch verwendet werden. So schwierig sich das auch gestalten mag, gerade in diesen Situationen sollte man sich stattdessen um eine sorgfältige Ausleuchtung der Problemlage und der moralischen Implikationen von Lösungsvorschlägen nicht herumdrücken, also klären, welche moralischen Regeln anzuwenden sind, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, was die Regeln im vorliegenden Fall genau bedeuten, wie man ihnen gerecht werden kann, welchen Regeln warum im Zweifel Vorrang einzuräumen ist und welche Kompromisse akzeptabel sind (für Kompromisse gibt es nicht nur schlechte, sondern oft auch gute Gründe). Dass sich jedermann um eine gewissenhafte Beurteilung seiner [18]Handlungen bemüht, lässt sich natürlich nicht erzwingen, vielleicht kann es aber gelingen, ein größeres Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich in Denkfaulheit ein erheblicher Mangel an moralischer Reife offenbart.
Zusammenfassend sei festgehalten: Moral ist kein Sonderthema, das bedarfsweise aufgerufen oder ignoriert werden kann, denn Moral setzt die Maßstäbe für die Beurteilung unseres Sozialverhaltens und ist daher in fast allem, was wir tun, präsent. Es gibt eine ganze Reihe von moralischen Regeln, die die Zustimmung fast aller Menschen finden und die auch aus einer normativ-ethischen Perspektive heraus als universell gültig zu betrachten sind. Dass sie im konkreten Handeln nicht immer befolgt werden, lässt sich nicht bestreiten und kann meistens auch erklärt (deswegen aber nicht schon gerechtfertigt!) werden. Die damit verbundenen Fragen sind aber nicht Gegenstand des vorliegenden Buches. Hier geht es vielmehr um die Umsetzung der in den moralischen Regeln formulierten Verhaltensvorgaben. Ein Hauptproblem ergibt sich dabei aus der Abstraktheit der meisten Regeln und damit der Notwendigkeit, ihnen in konkreten Handlungssituationen praktischen Gehalt zu geben. Dies gilt insbesondere für universale Normen wie z.B. das Hilfegebot. Handlungsnäher sind die zahlreichen auf einer mittleren Ebene angesiedelten bereichsspezifischen Regeln der Erziehung, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Politik usw. Verschiedentlich wird für diese Bereiche jeweils eine Sondermoral reklamiert, was sich nicht wirklich gut begründen lässt und letztlich unmoralisch ist, weil dies darauf hinausläuft, bestimmte Handlungsfelder aus dem Anspruch der Allgemeinen Ethik zu entlassen. Es gibt im menschlichen Zusammenleben keine moralfreien Zonen.
Normalerweise richten sich moralische Regeln und Normen auf das unmittelbare Handeln. Sie besitzen jedoch die gleiche Relevanz für die Beurteilung und Ausgestaltung von sozialen Systemen und Institutionen, aus dem einfachen Grund, weil diese das individuelle Handeln kanalisieren und Verhaltensweisen stimulieren können, die als moralisch fragwürdig gelten müssen. Dass die Moral in allen Lebensvollzügen steckt, zeigt sich schließlich auch in der engen Verzahnung von fachlich-sachlichen mit wertend-moralischen Fragen. Selbst die nüchternste Sachfrage hat ihre moralische Dimension. Selbstverständlich lassen sich z.B. ingenieurtechnische und selbst sozialtechnische Probleme wertfrei erörtern. Man kann ohne jeden Bezug zu moralischen Überlegungen eine Maschine auf ihre Funktionstüchtigkeit hin untersuchen, die Belastbarkeit einer [19]Brücke berechnen, den Code eines Computerprogramms vereinfachen, die Nachfragewirkung unterschiedlicher Preisstrategien erörtern. Wann immer es aber darum geht, die erörterten Maßnahmen auch zu ergreifen, die entwickelten Technologien auch einzusetzen, kommt unvermeidlich die Moral ins Spiel. Dass sich in praktischen Angelegenheiten die Moralfrage immer stellt, spricht aber nicht etwa gegen, sondern für eine unvoreingenommene Erörterung aller Sachfragen. Nur auf dieser Grundlage ist verantwortliches Handeln überhaupt möglich. Kaum jemand wird dieser moralischen Einsicht widersprechen. Ihr zu folgen ist eine andere Sache. Viel zu oft werden moralische Urteile vorschnell getroffen und benutzt, die Überlegenheit der eigenen Vorstellungen zu proklamieren, ohne den »Details« ihrer Konsequenzen die notwendige Beachtung zu schenken. Moral ohne Sachverstand ist unmoralisch wie umgekehrt Sachverstand ohne Moral ebenso.
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten, die einer Anwendung moralischer Normen, Regeln und Einsichten entgegenstehen. Das Anwendungsproblem gibt es deswegen, weil Handlungen immer konkret und speziell, moralische Regeln aber abstrakt und allgemein sind. Es ist daher mitunter ein langer Weg von den moralischen Überzeugungen und Einsichten bis zu den handlungsleitenden Motivationen. Moralische Normen lassen sich jedenfalls nicht ohne Zusatzüberlegungen auf den durch Zeit, Ort und Umstände gegebenen je spezifischen Handlungskontext anwenden. Hierauf wird im nächsten Kapitel näher eingegangen. Im darauf folgenden Kapitel 3 werden mit dem praktischen Syllogismus als dem einfachsten Ableitungsfall zunächst einige grundlegende Probleme im Übergang vom Allgemeinen zum Besonderen erörtert. Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Funktion, die der Urteilskraft bei der Lösung des Anwendungsproblems zukommt. Man könnte ja versucht sein, das Anwendungsproblem dadurch zu lösen, dass man Regeln für die Anwendung von Regeln vorgibt. Diese Regeln müssten allerdings auch wieder für die jeweilige Situation passen, so dass situationsgerechte Regeln für die Regelanwendung zu wünschen wären. Wie sollte man diese allerdings bestimmen? Am besten wäre es, in dieser Logik fortzufahren und für die Ermittlung der Regeln zur Anwendung von Regeln neue Regeln entwickeln, was man dann immer so weitertreiben müsste, was aber natürlich unsinnig ist. Zur Anwendung von Regeln braucht man daher Urteilskraft oder Klugheit oder zumindest Heuristiken, die bei der Regelanwendung zu [20]Rate gezogen werden können. Kapitel 5 thematisiert das Problem der Ungewissheit, das in Diskussionen über das moralisch angemessene Verhalten oft ausgeblendet wird. Um in einem strittigen Fall der eigenen moralischen Haltung Geltung zu verschaffen, wird nicht selten ein Wissen unterstellt, das gar nicht vorhanden ist, ein Verhalten, das in sich – ganz unabhängig von der Sachfrage – höchst unmoralisch ist. Mit einer zweifelhaften Moral beschäftigt sich auch Kapitel 6, in dem es um das Moralisieren geht, also darum, dass Moral gern als rhetorische Waffe benutzt wird. Moralisierer sind Besserwisser, die das vermeintlich verwerfliche Treiben anderer mit hochmögenden Moralfloskeln brandmarken, ohne sich allerdings mit dem Klein-Klein abzugeben, mit dem man bei der Lösung komplexer Probleme konfrontiert wird und ohne sich ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen, wie man die von ihnen propagierten Umkehrprojekte moralisch unbefleckt in einer von Widersprüchen und Unwägbarkeiten gekennzeichneten Welt umsetzen kann. Kapitel 7 befasst sich mit der Sphäre der Politik, die oft wenig moralsensibel ist, obwohl sie dies in besonderem Maße sein sollte. Im Einzelnen geht es in diesem Kapitel um Bedingungen, die die Berücksichtigung des moralischen Standpunkts erschweren und um Möglichkeiten, ihm Gehör zu verschaffen. Kapitel 8 beschreibt die Programmatik der Kasuistik, die die Schwierigkeit der Anwendung allgemeinverbindlicher moralischer Regeln auf die denkbar einfachste Art und Weise beseitigt, indem sie sie leugnet. Im Zuge einer intensiven, methodisch gestützten Beschäftigung mit der jeweiligen Problemsituation sollte sich, so die Vorstellung, das moralisch angemessene Verhalten gewissermaßen induktiv erschließen. Im Kapitel 9