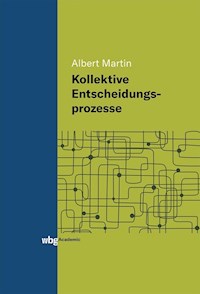Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zur Beschreibung und Erklärung des Personalgeschehens in Organisationen dient diesem Lehrbuch der funktionalistische Ansatz. Dieser befasst sich mit den Kräften und Handlungen, die dazu beitragen, den Bestand einer Organisation zu sichern und deren Entwicklung zu fördern. Im Lichte dieses Ansatzes kommt einer fundierten personalwirtschaftlichen Gestaltung eine elementare Bedeutung für das Wohlergehen einer Organisation und ihrer Mitglieder zu. Ein erster Schwerpunkt des vorliegenden Buches befasst sich daher mit der Frage, welche Überlegungen bei der Praxisgestaltung anzustellen sind und welche Maßnahmen man ergreifen sollte, damit sich die gewünschten Ergebnisse auch einstellen. Personalarbeit lässt sich dabei nicht auf die Tätigkeiten etwa der Personalabteilung reduzieren, Personalarbeit geschieht selbst dann, wenn es überhaupt keine Personalabteilung gibt, denn Personen werden eingestellt, entlassen, bezahlt, geführt usw., gleichgültig ob es für diese Tätigkeiten spezialisierte Stellen gibt oder nicht. Der zweite Schwerpunkt des Buches liegt auf der Erklärungsaufgabe. Präsentiert und diskutiert werden ausgewählte Theorien sowohl zur Erklärung des Verhaltens der Mitglieder einer Organisation als auch zur Erklärung des Verhaltens der Organisation selbst, wobei diesbezüglich der Schwerpunkt auf die Erklärung der Personalpolitik und der Muster der Personalarbeit gelegt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Albert Martin
Susanne Bartscher-Finzer
Personal
Sozialisation Integration Kontrolle
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2015
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-029686-2
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-029687-9
epub: ISBN 978-3-17-029688-6
mobi: ISBN 978-3-17-029689-3
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort
Wir leben in einer Welt der Organisationen. Organisationen haben große Macht, sie entscheiden darüber, was wir konsumieren, wie wir uns begegnen, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen, wie wir denken und wie wir arbeiten. Dazu kommt, dass wir die meiste Zeit des Tages in Organisationen verbringen. Mit einem Wort: Organisationen bestimmen zu einem erheblichen Teil, wie wir leben. Dabei sind Organisationen künstliche Gebilde. Ihre Substanz sind Normen, Verfahren und Regeln. Und es fragt sich natürlich, wie es dazu kommt, dass sich Menschen Organisationen anschließen und sich den dort geltenden Verhaltensvorschriften unterwerfen. Denn im Eigentlichen sind es natürlich nicht Normen, Verfahren und Regeln, sondern Personen, die eine Organisation ausmachen. Sie sind es, die sich in die organisationale Ordnung einfügen, sie schaffen und stützen und jeden Tag neu mit Leben erfüllen. Wie ist das möglich? Was veranlasst Menschen, sich Organisationen anzuschließen und wie gelangen Organisationen zu ihrer Funktionsfähigkeit? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das vorliegende Buch.
Um sie zu beantworten muss man sich zuerst Klarheit darüber verschaffen, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit Organisationen lebensfähig sind. Wir unterscheiden drei »funktionale Erfordernisse« des Überlebens von Organisationen, d. h. grundlegende Voraussetzungen ohne die keine Organisation bestehen kann: Kooperation, Leistung und Lernen.
Wie gelingt es Organisationen nun aber, diese Grunderfordernisse zu erbringen? Durch die Ausbildung von »funktionalen Subsystemen«, deren Aufgabe eben darin besteht, Kooperation, Leistung und Lernen zu fördern. Sie sind gewissermaßen der substantielle Unterbau, auf den sich die Funktionserfüllung abstützt. Und sie sind daher auch der Gegenstand dieses Buches. Genauer gesagt: Wir befassen uns im vorliegenden Buch mit drei ganz grundlegend wichtigen Grundfunktionen: Kontrolle, Sozialisation und Integration. Es sind dies Funktionen, die sich sehr stark auf das soziale Miteinander in Organisationen, auf die Einbindung der Mitarbeiter in die Organisation und die Abstimmung ihrer Verhaltensweisen richten. Drei weitere Grundfunktionen (oder funktionale Subsysteme) – das System der Anreize, der Aufgaben und der Selektion – haben wir bereits in dem Buch »Personal. Theorie, Politik und Gestaltung« näher behandelt.
Die Lehre von der Personalwissenschaft ist eine angewandte Wissenschaft. Bei unseren Betrachtungen kommen daher auch beide Seiten einer solchen Wissenschaft zu Wort. Das ist zum einen die im engeren Sinne wissenschaftliche Seite, der es primär darum geht, die vorfindliche Wirklichkeit zu erklären und zum anderen die eher gestaltungsorientierte Seite, die sich (idealerweise) darauf richtet, die bestehende Wirklichkeit zu verbessern. Was die Gestaltungsaufgabe angeht, ist es uns ein besonderes Anliegen herauszustellen, dass es immer alternative Vorgehensweisen gibt und dass das praktische Handeln nicht irgendwelchen Patentrezepten folgen sollte, sondern auf die Besonderheiten der jeweiligen Situation hin auszurichten ist. Praxisgestaltung ist eine kreative und anspruchsvolle Aufgabe.
Damit richten wir uns an Studierende aber auch Praktiker, die das eigene Personal-bezogene Handeln mit Hilfe unseres Analyseansatzes systematisch reflektieren können. Gewissenhafte Praktiker zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich Klarheit darüber verschaffen, was ihr Handeln lenkt, welche Überzeugungen (»Wirkungshypothesen«) ihren gestalterischen Bemühungen zugrunde liegen, unter welchen Umständen diese Geltung beanspruchen können und welche Gesichtspunkte bei der Beurteilung praktischer Maßnahmen zu beachten sind.
Das vorliegende Buch liefert angesichts der Komplexität des Gegenstandes mit dem wir es zu tun haben, daher auch keine Sammlung von so genannten »best practices«, die vermeintlich einfach aus dem Regal entnommen und gebrauchsfertig zu übernehmen wären. Es soll vielmehr deutlich machen, dass eigenständiges Nachdenken und reflektiertes Handeln nicht nur bessere Lösungen erbringt, sondern auch intellektuell und motivational befriedigender ist – zumal in einem Bereich, der für unser Leben eine derartig wichtige Rolle spielt: dem Leben und Wirken in Organisationen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Grundlagen
1 Einführung
2 Funktionen, Aufgaben, Ziele
3 Grundfunktionen
4 Gestaltungsansätze
5 Strategie und Politik
6 Theorie und Gestaltung
7 Gestaltungselemente
8 Die Beurteilung von Gestaltungshandlungen
9 Nochmals: Voluntarismus und Determinismus
10 Konzept des vorliegenden Buches
Kapitel 2: Integration
1 Einführung
2 Theorie
2.1 Extra-Motivation
2.2 Rückzugsverhalten
3 Politik
3.1 High Commitment Management
3.2 Die Flexible Firma
4 Gestaltung
4.1 Integrationsmaßnahmen
4.2 Beschäftigungsmanagement
Kapitel 3: Sozialisation
1 Einführung
2 Theorie
2.1 Der Psychologische Vertrag
2.2 Sinngebung (Sense-Making)
3 Politik
3.1 Kulturdesign
3.2 Sozialisationspraktiken
4 Gestaltung
4.1 Patensystem
4.2 Teamentwicklung
Kapitel 4: Kontrolle
1 Einführung
2 Theorie
2.1 Die Selbstbestimmungstheorie
2.2 Die Feedback-Interventions-Theorie
3 Politik
3.1 Kontrollformen
3.2 Partizipation
4 Gestaltung
4.1 Personalbeurteilung
4.2 Machtkontrolle
Literatur
Stichwortverzeichnis
Kapitel 1: Grundlagen
1 Einführung
Organisationen sind soziale Systeme. Sie haben daneben aber auch Eigenheiten, die sie von anderen sozialen Systemen unterscheiden. Dazu gehört beispielsweise der Tatbestand, dass Organisationen nicht Selbstzweck sind, sondern zur Erreichung ganz spezifischer Zwecke gegründet werden. Zudem kann nicht jedermann ohne weiteres Mitglied einer Organisation werden, die Aufnahme in eine Organisation unterliegt vielmehr formalen Bestimmungen. Ferner gründen die sozialen Beziehungen in einer Organisation auf sachlichen Festlegungen und sind nicht etwa dem persönlichen Gutdünken anheimgegeben. Ein weiteres wichtiges Merkmal, das Organisationen von anderen sozialen Systemen unterscheidet, ist dass sie eine »Verfassung«, d. h. ein rechtlich und sozial verbindliches Regelwerk haben. All dies ändert aber nichts am Grundcharakter von Organisationen, an der Tatsache, dass sie soziale Systeme sind und deswegen aus nichts anderem bestehen als aus ihren Teilnehmern – und aus deren Beziehungen untereinander. Häufig wird dies vergessen oder verschleiert. So wird beispielsweise in vielen Darstellungen des Personalwesens und der Personalarbeit von Organisationen gesprochen, als handle es sich hierbei um eigenständige Akteure, d. h. um lebendige Wesen mit eigenem Verstand und eigenen Willen. Gemäß dieser Perspektive geht es darum, die »Elemente« der Organisation dazu zu veranlassen, den Zielen dieses vermeintlichen Akteurs zu folgen. Das »betriebliche Personalwesen« ist aus dieser Sicht lediglich eine abgeleitete Größe, ein disponibler Faktor, der letztlich nur dazu dient, den strategischen Absichten »der Organisation« zum Erfolg zu verhelfen. Viele fachspezifischen Publikationen vermitteln den Eindruck, als habe man es beim Personal mit etwas Dinglichem zu tun: So wie ein Betrieb eine Maschinenausstattung hat, so hat er eben auch eine Personalausstattung. Die Verwertungslogik, die hinter diesem Sprachgebrauch steckt, ist unverkennbar. Sie gründet in dem Tatbestand, dass Organisationen Zweckgebilde sind und sich das Interesse an den Mitgliedern einer Organisation daher – einer vorgeblichen Sachlogik folgend – vor allem auf deren Arbeitskraft richtet. Personen werden damit zu Personal.
Es ist ja durchaus ein legitimes, ja notwendiges Anliegen, sich der Frage zu stellen, wie man das Zusammenwirken der Organisationsmitglieder gestalten soll, damit die Organisationszwecke erreicht werden. Aus der Tatsache, dass man mit »Personalangelegenheiten« strategisch und praktisch umgehen muss, folgt allerdings nicht, dass man das »Personal« wie ein Ding betrachtet und es in technokratischer Weise einem oberflächlichen Optimierungskalkül unterwirft. Das verbietet sich nicht nur aus ethisch-moralischen und sozialpolitischen Gründen, sondern auch deswegen, weil man der komplexen sozialen Wirklichkeit des Personalgeschehens nicht mit simplen Patentrezepten beikommt. Bevor man zu Gestaltungshandlungen schreitet, sollte man sich Klarheit darüber verschaffen, was man mit ihnen bewirkt und was man dafür in Kauf nimmt. Praktiker brauchen nicht nur Werkzeuge, mit deren Hilfe sie in die Lage versetzt werden, die soziale Wirklichkeit zu gestalten, sie brauchen zuallererst ein Verständnis für die Gesetzmäßigkeiten des sozialen Geschehens. Sie sollten also verstehen, was das Handeln der Organisationsteilnehmer bestimmt, in welche sozialen Prozesse es eingebettet ist und in welcher Weise strukturelle und institutionelle Voraussetzungen hierauf Einfluss nehmen. Und man sollte sich als verantwortungsbewusster Mensch auch über die herrschende Gestaltungspraxis selbst Klarheit verschaffen, sich also fragen, warum es diese oder jene Praxis gibt, warum Arbeitsprozesse unterschiedlich gestaltet werden, warum in Organisationen sehr unterschiedlich geführt, belohnt und bestraft wird. Zu untersuchen wäre also, wie es kommt, dass sich manche Praxisformen (zeitweise) durchsetzen, andere dagegen nicht. Auch diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man die Bestimmungsgründe für das Handeln von Menschen und die Eigengesetzlichkeiten des sozialen Geschehens versteht, wenn man durchschaut, welche sozialen Prozesse dafür verantwortlich sind, dass sich bei der Gestaltung der organisationalen Wirklichkeit bestimmte Lösungen aufdrängen, andere dagegen ignoriert, beiseitegeschoben, verwässert oder pervertiert werden. Wenn man zu haltbaren und qualitativ hochwertigen Praxislösungen kommen will, dann muss man verstehen, welche Gesetzmäßigkeiten das organisationale Verhalten bestimmen. Außerdem sollte man von einem gestalterisch tätigen Menschen verlangen, dass er sich darüber Gedanken macht, welche materiellen und immateriellen Kosten mit einer konkreten Praxislösung verbunden sind und welche Neben- und Folgewirkungen mit ihr einhergehen.
Mit all diesen Fragen beschäftigt sich das vorliegende Buch. Wir behandeln ausgewählte personalwirtschaftliche Gestaltungsansätze, betrachten die Gestaltungsparameter, die diesen Ansätzen ihre je spezielle Gestalt geben und diskutieren die Wirkungen, die von alternativen Gestaltungshandlungen ausgehen können. Außerdem behandeln wir ausgewählte Theorieansätze, die Auskunft über Verhaltensmechanismen geben und die dabei helfen, zu tieferen Einsichten über das personalwirtschaftliche Geschehen zu gelangen. Zunächst gehen wir aber auf einige grundlegende Überlegungen ein. Wir folgen dabei dem Grundkonzept, das in dem Buch »Personal. Theorie, Politik, Gestaltung« (Martin 2001) ausführlicher beschrieben ist. Das vorliegende Buch versteht sich als Fortführung der dort behandelten Fragen.
2 Funktionen, Aufgaben, Ziele
Bei der Betrachtung des betrieblichen Personalgeschehens bedienen wir uns einer funktionalistischen Argumentation. Wir beschäftigen uns mit den grundlegenden Anforderungen (den »Grundfunktionen«), denen Organisationen gerecht werden müssen und mit den wichtigsten Funktionen des Personalwesens (dessen »Funktionsfeldern«). Im Kern geht es dabei um die für das Bestehen und das Gedeihen jeder Organisation essentiellen Vorgänge und Voraussetzungen. Von Funktionen zu sprechen hat allerdings leicht etwas Beliebiges. Die Funktion einer Armbanduhr besteht darin, die Zeit anzuzeigen, sie kann aber auch darin bestehen, Geschmack zu beweisen; ein Automobil braucht eine Lichtmaschine um die elektrischen Geräte mit Strom zu versorgen und um die Batterie aufzuladen; der Magen dient der Verdauung und zeigt Hungergefühle an; die Anweisung eines Vorgesetzten kann eine bessere Aufgabenerledigung voranbringen, sie kann aber auch seine Macht demonstrieren; ein Buch zu lesen kann der Entspannung dienen, der Information oder der Belehrung. Man muss also bei der Betrachtung von Funktionen immer die Frage stellen, wofür das Objekt, das Verhalten, der Prozess (oder was immer der Funktionsträger sonst ist), eine Funktion sein soll. Häufig unterbleibt der explizite Hinweis auf den Funktionszweck, was unproblematisch ist, wenn der Problemkontext bekannt ist. Nicht selten führt der Verzicht auf die genaue Spezifikation der Funktion aber auch zu Missverständnissen und Ungenauigkeiten.
Funktionen sind etwas anderes als Aufgaben. Aufgaben sind verbindliche, d. h. auf autorisierten Entscheidungen beruhende Regelungen, die für bestimmte Personen, Stellen oder Instanzen gelten. Sie machen eine Aussage darüber, welche Tätigkeiten von wem (und häufig auch: wie) zu erbringen sind. Aufgaben werden also ganz bewusst konzipiert, es werden hierfür Verantwortlichkeiten festgelegt, deren Erfüllung eingefordert wird. Funktionen gewinnen ihre Bedeutung dagegen nicht durch Entscheidungen und Anordnungen. Sie sind einfach »unumgänglich«, d. h. man kann sie nicht abschaffen, denn sie gewinnen ihre Kraft nicht durch einen Willen, sondern durch die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten – im Falle von sozialen Funktionen also durch Gesetzmäßigkeiten, die das Funktionieren von sozialen Systemen betreffen.
Funktionen sind auch nicht etwa Ziele. Ziele sind Ausdruck des Anspruchs bestimmte wünschenswerte Zustände herbeizuführen. Es handelt sich bei Zielen um »Entscheidungsprämissen«, die man seinem Handeln zugrunde legt. Zwei Beispiele sollen die Unterschiede zwischen Funktionen, Zielen und Aufgaben veranschaulichen. Betriebswirten ist unmittelbar einsichtig, dass ein Unternehmen dafür sorgen muss, dass es über ausreichend Liquidität verfügt. Wer kein Geld hat, kann keine Waren beschaffen, keine Zinslasten bedienen, seine Mitarbeiter nicht bezahlen. Die Sicherstellung der Liquidität ist eine Grundfunktion bzw. genauer, ein funktionales Erfordernis des Überlebens, wird es nicht eingelöst, wird das Unternehmen nicht fortbestehen können. Nun gibt es keine spezielle Aufgabe »Liquiditätssicherung«. Liquidität entsteht aus der Geschäftstätigkeit, aus den richtigen Preisentscheidungen, dem sparsamen Umgang mit Ressourcen, der investiven Kapitalbindung, klugen Finanzanlagen, kooperativen Geschäftsbeziehungen, der Reputation und vielen weiteren Größen. Das heißt nun wiederum nicht, dass es keine Stellen oder spezielle Teilaufgaben geben kann, die sich mit Liquiditätsproblemen beschäftigen. Ein Beispiel ist die Finanzplanung, die in jedem Unternehmen einen Platz haben sollte. Nur wird dadurch, dass in einem Unternehmen eine Finanzplanung durchgeführt wird, natürlich noch nicht dessen Liquidität gewährleistet, sie leistet hierzu nur einen Beitrag. Und in diesem Sinne sind auch Ziele zu verstehen. Man kann z. B. das Ziel verfolgen, eine möglichst hohe Rendite der Finanzanlagen zu erreichen, was normalerweise bedeutet, dass man sein Geld langfristig anlegen muss. Man kann aber auch hohe Finanzierungsreserven anstreben, was allenfalls kurzfristige Geldanlagen gestattet. Ähnlich kann man auf der Beschaffungsseite das Ziel ausgeben, möglichst alle Skonti auszunützen, die sich normalerweise mit kurzen Zahlungsfristen verknüpfen, man kann aber auch längere Zahlungsfristen präferieren usw. Ein Beispiel für ein funktionales Grunderfordernis aus dem Personalbereich ist die »Personalbereitstellung«: Gelingt es nicht, geeignete Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, wird sich das nicht nur irgendwie nachteilig auf das Unternehmen auswirken, es wird vielmehr gezwungen sein, seinen Betrieb einzustellen. Die Funktion der Personalbereitstellung lässt sich ebenfalls keinem einzelnen Aufgabenträger zuordnen, ihre Erfüllung hängt vielmehr von vielen Teilaspekten ab, so unter anderem von den Arbeitsmarktgegebenheiten, der Attraktivität der Vergütung, den Arbeitsbedingungen, dem Führungsverhalten usw. Dessen ungeachtet, gibt es Teilaufgaben, die einen Beitrag zur »Personalbereitstellung« leisten: In der Personalabteilung beschäftigen sich Personen z. B. mit der Gestaltung des Außenauftritts, andere beraten die Vorgesetzten bei der Personalauswahl, die Geschäftsführung macht sich Gedanken über die Ausgestaltung der Gehaltsgruppen, die Lohnhöhe usw.
Die personalwirtschaftlichen Zielsetzungen sind innerhalb und zwischen den Unternehmen oft alles andere als einheitlich. So findet man beispielsweise bezüglich der Lohngestaltung in vielen Unternehmen eine übertarifliche Bezahlung. Anderswo hält man sich strikt an Tarifvorgaben und in etlichen Unternehmen ignoriert man das Tarifgefüge völlig. Ähnlich heterogen sind die Ziele und die damit verbundenen Vorstellungen in der Regel auch bei den anderen personalwirtschaftlichen Aufgabenfeldern, also beispielsweise bei der Personalgewinnung und -auswahl, der Personalförderung, der Arbeitsvertragsgestaltung, der Personalführung und der Sozialpolitik. Eine weitere Komplikation ergibt sich aus dem Tatbestand, dass nicht nur Ziele und Funktionen auseinanderfallen, sondern dass es neben »tatsächlichen« auch noch »vorgebliche« Ziele gibt. Manchmal begründet sich der Unterschied in taktischem Verhalten, manchmal irrt man sich aber auch über die eigenen Motive und Ziele. Beispiele hierfür dürfte jeder aus dem Alltag kennen. Wenn man einen Kollegen fragt, warum er sich damit hervortun muss, seine vielen Erfolge und Erfolgsrezepte so ausführlich zu schildern, dann wird er wahrscheinlich antworten, dass er uns einfach informieren will, was wir ihm aber oft nicht glauben. Wir vermuten eher, dass sein eigentliches Ziel darin besteht, uns zu beeindrucken und von uns bewundert zu werden, was sich unser Kollege aber schwerlich eingestehen will. Möglicherweise geht es in seinem Verhalten aber gar nicht um solche Ziele, sondern um eine tiefer liegende psychische Funktion, etwa um die, mit seinem Renommiergehabe den eigenen Minderwertigkeitskomplex zu beschwichtigen und damit seiner psychischen Stabilität aufzuhelfen. Beispiele für den Unterschied zwischen tatsächlichen und vorgeblichen Zielen auf Unternehmensebene findet man häufig in der Beschäftigungspolitik. Unternehmen bauen oft »Randbelegschaften« auf, die weniger attraktive Beschäftigungsverhältnisse genießen als die »Stammbelegschaften«. Begründet wird dies normalerweise mit dem Wunsch, flexibel auf Beschäftigungsschwankungen reagieren zu können, tatsächlich geht es aber oft einfach um Kosteneinsparungen. Doch die eigentlich interessante systemstabilisierende Funktion beruht nicht so sehr auf den mit den entsprechenden Maßnahmen anvisierten Wirkungen, sondern darauf, dass die Segmentierung der Belegschaft gewissermaßen »nebenbei« die Identifikationsbereitschaft der Kernbelegschaft stärkt.
Die Funktionsbetrachtung hat durchaus Schwächen. Die Aussagen, die sie liefert, haben einen begrenzten Informationsgehalt. Die inhaltlichen Aussagen erschöpfen sich oft in Behauptungen wie der, dass jedes soziale System über Anreizmechanismen verfügt, die die Mitglieder des Systems dazu veranlassen, Beiträge zu erbringen, die den Bestand des sozialen Systems gewährleisten. Welche Anreizmechanismen (Kontrollmechanismen, Integrationsmechanismen usw.) dazu geeignet sind, die Funktionstüchtigkeit des sozialen Systems sicherzustellen, bleibt dabei offen. Auch lassen sich Funktionen manchmal nur schwer lokalisieren, weil sie nicht immer von einem und nur einem exakt zu beschreibenden Funktionsträger (Aggregat, Organ, Rolleninhaber, Wirkungszusammenhang) ausgefüllt werden. Ein Beispiel ist der Interessenausgleich, der erfolgen muss, wenn es um die Zuteilung von Arbeitszeit geht, wenn also z. B. Schicht-, Nacht- und Wochenenddienste zu leisten sind. Beteiligt an diesem Interessenausgleich sind Planverfahren, Gehaltszulagen, Abreden zwischen den Mitarbeitern und die Moderationsleistung des Vorgesetzten. Eine weitere Unbestimmtheit ergibt sich daraus, dass der Ausfall eines Funktionsmechanismus nicht selten durch das Wirksamwerden eines anderen Funktionsmechanismus – durch ein sogenanntes funktionales Äquivalent – kompensiert werden kann. Ein Beispiel sind die sogenannten Führungssubstitute, die an die Stelle persönlicher Einflussnahme treten können. Ein Beispiel hierfür sind Leistungskennzahlen, an denen sich die Bezahlung orientiert und die damit dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiter bemühen, ein hohes Leistungsniveau zu erreichen. Ein anderes Beispiel ist das Fließband, das die Koordination der Arbeitsschritte übernimmt. Und schließlich kommt es darauf an, unter welchem Blickwinkel man ein Objekt analysiert, je nachdem kommt man nämlich zu anderen »Funktionszusammenhängen«. Wenn man den Menschen beispielsweise als biologisches System betrachtet, hebt man gänzlich andere Aspekte heraus, als wenn man den Menschen als psychologisches System betrachtet. Wenn man in einem Unternehmen lediglich ein System von Produktionsfunktionen sieht, kommt man bezüglich der Personalfunktion zu anderen Einsichten als wenn man unter einem Unternehmen ein soziales System versteht usw.
Trotz dieser und weiterer Schwächen (Martin 2001, 2012) ist die Funktionsbetrachtung hilfreich. Sie lenkt den Blick auf Tatbestände, die »nicht hintergehbar« sind, deren Missachtung also die Gefährdung eines sozialen Systems zur Folge hat. Außerdem verlangt sie ein transparentes Nachdenken über grundlegende Wirkungszusammenhänge. Zwar kann der funktionalistische Ansatz das Funktionieren sozialer Systeme nicht wirklich erklären, er bietet aber einen wohl begründeten Denkrahmen, in den sich inhaltliche Erklärungsansätze gut einbetten lassen und er gibt uns damit ein wirksames Mittel an die Hand, um das Geschehen in sozialen Systemen gedanklich zu durchdringen und systematisch zu ordnen.
3 Grundfunktionen
Eines der Anliegen der Funktionalbetrachtung besteht – wie beschrieben – in der Identifikation von Grundfunktionen, deren Gewährleistung überlebensnotwendig ist. Aus der Alltagserfahrung ist jedem bekannt, dass der Zusammenhalt und damit die Weiterexistenz von sozialen Gruppierungen vielfach gefährdet ist. In sozialen Systemen ist die Einhaltung bestimmter Funktionsvoraussetzungen also nicht immer und von selbst gewährleistet. Je ausdifferenzierter soziale Systeme sind, desto mehr muss erstaunen, dass überhaupt »Ordnung existiert«, die Systeme also nicht auseinanderbrechen oder zerfallen. Je komplexer Systeme sind, desto stärker müssen die Bindungskräfte sein, die sie zusammenhalten. Dabei ist zu beachten, dass es hierbei nicht nur um die Teilnahmebereitschaft der einzelnen Organisationsmitglieder, sondern auch um die Subsysteme der Organisation und um deren Zusammenhalt und Zusammenwirken geht. Es wurden nun in der Forschung verschiedentlich Versuche unternommen, allgemeine Systemprobleme zu finden, deren Nichtbewältigung zu einer Auflösung der Organisation führt. Ein sehr allgemeines Schema wurde von Talcott Parsons entwickelt (Parsons 1951). Gedacht war dieses Schema als Hilfsmittel zur Analyse von Gesellschaften, es kann aber leicht auf Organisationen übertragen werden (Katz/Kahn 1978, Quinn/Rohrbaugh 1983). Demnach lässt sich organisationales Geschehen als Versuch verstehen, mit vier Grundproblemen zurechtzukommen: der Abstimmung mit der Umwelt (Anpassung), der Einlösung des Organisationszwecks (Zielerreichung), der Abstimmung der Subsysteme innerhalb der Organisation (Integration) und der Kulturerhaltung. In unserer eigenen Betrachtung vereinfachen wir dieses Schema, zumal die vierte Funktion bei Parsons (die Kulturerhaltung) eine eigentümliche Stellung innehat, die nicht so recht zu den anderen Grundfunktionen passt (Esser 1992). Wir unterscheiden drei Grundfunktionen: Kooperation, Leistung und Lernen. Diese Grundfunktionen, oder genauer: diese funktionalen Erfordernisse des Überlebens, ergeben sich bereits aus dem Begriff der Organisation. Organisationen sind zweckorientierte, auf Dauer angelegte, soziale Systeme. Die Kooperationsfunktion ergibt sich also aus dem Tatbestand, dass Organisationen soziale Gebilde sind, die notwendigerweise auf Kooperation angewiesen sind. Wenn sich Menschen nicht zusammentun, dann gibt es auch keine Organisationen. Um den Bestand von Organisationen zu sichern, muss daher gewährleistet werden, dass die Organisationsteilnehmer zusammenarbeiten wollen und dass sie die Organisation nicht ohne weiteres wieder verlassen. Organisationen sind aber nicht nur kooperative, sie sind auch zweckorientierte Gebilde. Sie werden gebildet und am Leben erhalten, weil es Personen gibt, die erwarten, durch ihre Teilnahme an der Organisation ihre je eigenen Ziele erreichen zu können. Werden diese Ziele nicht erreicht, dann wird sich die Organisation auflösen. Die Ziele werden durch Leistungsbeiträge der Organisationsteilnehmer verwirklicht. Entsprechend müssen Organisationen dafür sorgen, dass diese Leistungen auch erbracht werden. Die dritte Funktion betrifft die Veränderung von Organisationen. Organisationen sind keine statischen Gebilde. Wären sie starr und unbeweglich und vor allem unveränderlich, dann würden sie sehr schnell wieder verschwinden. In einer bewegten Umwelt muss sich auch eine Organisation bewegen oder anders ausgedrückt: sie muss lernen.
Die Funktionsbetrachtung richtet sich nicht nur auf das Gesamtsystem, sie steht auch vor der Frage, welche Funktionen den Subsystemen zukommen. Bezüglich dieser Subsysteme muss man zwischen »natürlichen« und »funktionalen« Systemen unterscheiden. Wenn Subsysteme konkret benennbare Klassen von Personen sind (z. B. die Personalabteilung, die aus der Gesamtheit ihrer Mitglieder besteht), dann spricht man von natürlichen Subsystemen. Sind die Subsysteme aber Klassen von Aktivitäten (also z. B. die Personalarbeit), dann spricht man von funktionalen Subsystemen. Diese Unterscheidung macht deutlich, dass sich die Personalarbeit nicht auf die Tätigkeiten etwa der Personalabteilung beschränken lässt, Personalarbeit geschieht selbst dann, wenn es überhaupt keine Personalabteilung gibt, sie wird dann »nebenbei« von verschiedenen Stellen (z. B. den Vorgesetzten) ausgeführt. Personalarbeit ist also in gewisser Weise unvermeidlich: Personalarbeit findet in jeder Organisation statt, ob man dies nun will oder nicht, denn Personen werden eingestellt, entlassen, bezahlt, geführt usw., gleichgültig ob es für diese Tätigkeiten spezialisierte Stellen gibt oder nicht.
Doch davon ganz unabhängig stellt sich auf jeden Fall die Frage, welche Funktionen die »Personalarbeit« einer Organisation erfüllen muss. Ähnlich wie bezüglich der funktionalen Erfordernisse des Überlebens einer Organisation (Leistung, Kooperation, Lernen) setzt man auch bei dieser Frage am besten an den Aktivitäten an, die »unvermeidlich« sind, also schlechterdings in jeder Organisation auftreten – d. h. an Aktivitäten, ohne die eine Organisation keinen Bestand hätte. Die Aufgabe der Personalplanung beispielsweise kann man ernst nehmen oder auch nicht. Ähnliches gilt z. B. für das Personalcontrolling, die Betriebsklimaförderung und die Personalführung. Dies ist anders bei den sechs von uns unterschiedenen personalwirtschaftlichen Grundfunktionen (▸ Tab.1.1). Diese Grundfunktionen liegen, ebenso wie die allgemeinen Funktionsanforderungen sozialer Systeme, gewissermaßen in der Natur von Organisationen begründet.
Zwischen beiden Funktionsgruppen gibt es eine gewisse Entsprechung. Jeweils einem der in Tabelle 1.1 angeführten personalbezogenen Funktionspaare ist eine der drei allgemeinen Funktionsanforderungen sozialer Systeme zugeordnet. Allerdings ist diese Zuordnung nicht strikt zu verstehen, es handelt sich hier nur um Affinitäten, denn prinzipiell trägt jede der personalbezogenen Grundfunktionen zu allen allgemeinen Funktionsanforderungen bei. In jedem Funktionspaar zeigt sich im Übrigen die Doppelnatur von Organisationen. Organisationen konstituieren sich aus nichts anderem als aus ihren Teilnehmern. Gleichzeitig sind Organisationen aber auch eigenständige Gebilde, die unabhängig davon funktionieren, welche Teilnehmer ganz konkret der Organisation angehören. Organisationen sind also einerseits darauf angewiesen, Teilnehmer zu gewinnen, an sich zu binden und zu der gewünschten Beitragsleistung zu motivieren. Andererseits kommt es auf die einzelnen Teilnehmer nicht so sehr an, jedenfalls insoweit als sie sich ersetzen und so beeinflussen lassen, dass sie, unabhängig von ihren jeweiligen Eigenheiten, dazu beitragen, die mit der Existenz der Organisation verknüpften Ziele zu erreichen. Unsere drei Funktionspaare sind Ausdruck der in dieser Doppelnatur liegenden Widersprüchlichkeit. Die »Pull-Faktoren« Anreize, Integration, Selektion zielen primär darauf, die Organisation für ihre Teilnehmer attraktiv zu machen, die »Push-Faktoren« Kontrolle, Sozialisation, Aufgabengestaltung bringen dagegen vor allem den überindividuellen Charakter der Organisation und dessen »Ansprüche« zur Geltung. Besonders deutlich zeigt sich dieser Gegensatz im ersten
Leistung Anreizgestaltung
Tab. 1.1: Grundfunktionen der Personalarbeit
Funktionspaar. Warum sollte jemand bereit sein, seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen? Weil er hierfür eine Gegenleistung erhält. Dies ist jedenfalls die klassische ökonomische Sicht der Dinge, die ganz zentral auf Anreizstrukturen abstellt. Betrachtet werden dabei primär monetäre Anreize. Daneben finden aber auch geldwerte Leistungen (Karrierechancen, Dienstwagen usw.) und immaterielle Anreize wie Status und interessante Arbeitsaufgaben Beachtung. Die anreizbezogene Betrachtung basiert auf der »freundlichen« und »freiheitsorientierten« Denkhaltung des mündigen und gleichberechtigten Wirtschaftsbürgers. Sie wird der Realität des Arbeitshandelns in Organisationen aber nur bedingt gerecht. Insbesondere in der Soziologie wird daher auch die »dunkle Seite« von Organisationen herausgestellt. Organisationen werden verschiedentlich sogar als »eiserne Käfige« beschrieben, in denen Organisations-»Insassen« mit mehr oder weniger subtilen Mitteln zur Arbeit angehalten und abgerichtet werden. Wie immer man dies im Einzelfall bewerten mag, es ist zweifellos richtig, dass allein mit der Gewährung von Anreizen die Leistungserbringung nur schwerlich gesichert werden kann. Anreize werden z. B. dann ihren Zweck verfehlen, wenn die Arbeitnehmer die angebotenen »Entgelte« zwar »kassieren« können, die versprochene eigene Gegenleistung allerdings nicht unbedingt erbringen oder vorzeigen müssen. Um das mögliche eigensüchtige Verhalten zu verhindern, gibt es in Organisationen zahlreiche Mechanismen zur Kontrolle der Leistung. Der tiefere Grund für die Notwendigkeit der Kontrollfunktion in Organisationen liegt aber nicht so sehr im Interesse, das Leistungsverhalten der einzelnen Mitarbeiter zu überwachen, sondern in dem besonderen Vertragsverhältnis zwischen der Organisation und ihren Mitgliedern. Anders als beim Markttausch beruht ein Beschäftigungsverhältnis auf einem weitgehend unspezifizierten (unvollständigen) Vertrag, weil die exakte Bestimmung der gewünschten Arbeitsleistung nach Art, Güte und Zeit meist nicht möglich oder aber sehr kostenaufwändig ist. Wäre dies anders, dann könnten Arbeitsleistungen auch über den Markt jeweils neu erworben werden. In diesem Fall genügte auch eine reine Anreizpolitik, weil man sich dann ja die gebrauchsfertigen Arbeitsergebnisse einfach einkaufen könnte. Tatsächlich erfordert die Erstellung der meisten marktfähigen Güter aber die ständig neu zu erbringende Koordination unterschiedlichster Handlungen, die nicht über Marktprozesse geleistet werden kann. Daher wird der Koordinationsmechanismus »Markt« durch den Koordinationsmechanismus »Hierarchie« ersetzt. Hiermit entfällt die Notwendigkeit, die zu erbringenden Arbeitsleistungen nicht immer wieder neu auszuhandeln, die Koordination in Organisationen erfolgt stattdessen durch Anordnung und Inanspruchnahme der versprochenen Arbeitsbereitschaft und die Sicherstellung, dass die Anweisungen auch befolgt werden. Hierarchie impliziert also notwendigerweise Kontrolle.
Damit kommen wir zum zweiten Funktionspaar, der Komplementarität von Integration und Sozialisation. Die Funktion Integration richtet sich allgemein auf die Beziehung zwischen den Subsystemen und das Verhältnis der Subsysteme zum Gesamtsystem. Dabei geht es zum einen sehr umfassend um das Institutionengefüge einer Organisation und die Frage, in welchem Maße es geeignet ist, den vielfältigen und vielschichtigen Verhaltensprozessen in einer Organisation eine tragfähige Ordnung zu geben. In einem engeren Sinne geht es um das Verhältnis der Organisationsmitglieder zu ihrer Organisation. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob die sogenannten »Mitarbeiter« oder Arbeitnehmer als eine spezifische Gruppe von Organisationsteilnehmern gleichberechtigte »Träger« der Organisation oder nur »gekaufte« und »disponible« Arbeitskräfte sind. Von der Natur dieser Beziehung hängt es zum Beispiel ab, welche Wirkungen von den angebotenen Anreizen und den implementierten Kontrollmaßnahmen ausgehen. Wenn die Arbeitnehmer in die Organisation integriert sind (z. B. weil sie an Entscheidungen beteiligt werden und sich daher mit ihrer Organisation identifizieren), dann brauchen sie nicht durch ausgeklügelte Anreizsysteme zu höheren Leistungen angestachelt oder durch strenge Kontrollen zu besonderen Anstrengungen gezwungen zu werden. Auch bezüglich der Sozialisation empfiehlt es sich zwischen einem engeren und einem weiteren Sozialisationsverständnis zu unterscheiden. Bei der Sozialisation im engeren Sinne geht es um das Hineinwachsen in eine Organisation. Jeder Neuling wird mit ihm zunächst fremden und der Organisation eigentümlichen Erwartungen und Werthaltungen konfrontiert, mit Normen und Rollenbeziehungen, auf die er sich einstellen muss. Die Regeln des sozialen Lebens müssen erst erlernt werden, die Teilnehmer von Organisationen müssen Verhaltensweisen entwickeln, die sie zu akzeptierten Organisationsteilnehmern machen. Die Sozialisationsproblematik betrifft aber nicht nur die »neuen«, sondern grundsätzlich alle Teilnehmer an der Organisation, und es handelt sich dabei auch nicht um einen vorübergehenden Prozess, der nach einer gelungenen Einführung neuer Mitarbeiter zum Stillstand käme. Sozialisation hat eine wesentlich größere Bedeutung, letztlich geht es bei ihr nämlich ganz fundamental um die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit, um die Bestimmung des sozialen Miteinanders, um die Herstellung von Sinn und Verständnis für das gemeinsame Tun, um die Legitimität der Institutionen und Regeln. Und diese Prozesse stellen sich auch für langjährige Mitarbeiter immer wieder neu.
Unser letztes Funktionspaar richtet sich unmittelbar auf die konstitutiven Merkmale einer Organisation, die Menschen und ihre Aufgaben. Die Aufgaben, die Aufgabenteilung, die technische Ausstattung, die Hilfsmittel und Verfahrensregeln zur Erledigung der Aufgaben bilden die sachliche Substanz von Organisationen. Die Menschen in einer Organisation sind dagegen aktive Elemente, sie sind gewissermaßen die Beweger der Materie. Entsprechende Bedeutung kommt der »Ausstattung« der Organisation mit Menschen und Sachen zu. »Human- und Sachkapital« definieren Rahmenbedingungen, die der Wirksamkeit von Anreizen, Kontroll-, Sozialisations- und Integrationsmaßnahmen Grenzen setzen. Die Selektionsfunktion kann daher in ihrer Bedeutung kaum überschätzt werden, denn sie bestimmt darüber, wer in die Geschicke der Organisation einzugreifen in der Lage ist. Eine nicht minder große Bedeutung kommt der Gestaltung der Aufgaben zu. In ihr materialisiert sich gewissermaßen die Intelligenz der Organisation. Es mag überraschen, dass wir die Funktionen Selektion und Aufgabengestaltung der Funktionsanforderung des Lernens zuordnen. Schließlich lassen sich die mit diesen beiden Funktionen verknüpften Strukturen und Aktivitäten nicht so ohne weiteres ändern und zurücknehmen, was ganz offensichtlich die Anpassungsfähigkeit, die zum Lernen gehört, beschränkt. Selektion und Aufgabengestaltung sind in der Tat nur bedingt geeignete Mittel, um kurzfristige Anpassungsleistungen der Organisation zu erbringen. Umso gewichtiger sind sie jedoch in ihren langfristigen Wirkungen und in ihrer Nachhaltigkeit. Sie determinieren damit die Fähigkeit von Organisationen, sich selbst zu transformieren. Wenn beispielsweise in einer Organisation nur hochspezialisierte Mitarbeiter beschäftigt werden (z. B. an einer Hochschule nur Teilchenforscher, Veterinärmediziner und postmodern schreibende Soziologen), dann wird die Anpassungsfähigkeit dieser Organisation (in unserem Universitätsbeispiel z. B. bei rückläufigen Studentenzahlen) erheblich eingeschränkt. Ähnliches gilt für die Aufgabengestaltung. Um bei unserem wissenschaftlichen Beispiel zu bleiben: Was lässt sich mit einem Teilchenbeschleuniger anfangen außer eben Teilchen zu beschleunigen? Selektion und Aufgabengestaltung sind gerade auch wegen ihres nur schwer revidierbaren Charakters wesentliche Bestimmungsgrößen für die Anpassungsfähigkeit, die Innovationskraft und das Lernpotential der Organisation.
Festgehalten sei abschließend noch eine wichtige Einsicht der funktionalistischen Betrachtungsweise: Es ist eine viel zu enge Sicht der Dinge, soziale Systeme (also Familien, Arbeitsgruppen, Organisationen, Unternehmen usw.) nur unter einem einzelnen Gesichtspunkt – etwa dem der Gewinnerzielung – zu betrachten. Zwar geht auch die Funktionsbetrachtung davon aus, dass wirtschaftliche Ziele für Unternehmen eine zentrale Bedeutung besitzen (Grundfunktion: Zielerreichung), sie betont aber gleichzeitig, dass es zur Sicherung des Überlebens der Unternehmung nicht ausreicht, nur die wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Die mit den anderen Grundfunktionen verknüpften Probleme können ebenso wenig vernachlässigt werden.
4 Gestaltungsansätze
Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, mit denen man mögliche Gestaltungsansätze bezeichnet: Methoden und Verfahren, Techniken, Strategie, Konzepte, Pläne, Leitlinien und Leitprinzipien, Praktiken und Werkzeuge. Nicht selten ist auch die Rede von »Modellen«. Die Begriffe werden allerdings nicht einheitlich verwendet. Viele Autoren verstehen z. B. unter dem sogenannten Assessment Center ein Instrument, andere Autoren sprechen dagegen von einem Assessment Center Verfahren, bezüglich der Anforderungsanalyse sprechen manche Autoren von einem »methodischen Instrumentarium«, sie unterscheiden also nicht klar zwischen einem Instrument und einer Methode, Führungsmodelle und Führungsprinzipien werden oft gleichgesetzt usw. Die Begriffsverwendung ist jedenfalls sehr lose, und es macht auch keinen Sinn, diesbezüglich auf strikten Abgrenzungen zu bestehen. Wir unterscheiden vier Klassen von Gestaltungsmöglichkeiten: Maßnahmen, Instrumente, Strategien und Ansätze der Strukturgestaltung. In Tabelle 1.2 sind diese Begriffe definiert und mit Beispielen aus den sechs Grundfunktionen (oder Funktionsfeldern) des Personalwesens versehen.
Strukturen sind kollektive Denkmuster und Werthaltungen, Normen, Regeln
Tab. 1.2: Personalwirtschaftliche Gestaltungsansätze (Beispiele)
Die Strukturgestaltung setzt nicht unmittelbar an spezifischen und konkreten Handlungen an. Sie beeinflusst das Geschehen stattdessen gewissermaßen von »außen« in dem sie die Handlungssituation vorstrukturiert, also die »Rahmenbedingungen« des Handelns oder die »Verhaltensarena« verändert. Die Strukturgestaltung ist der anspruchsvollste Gestaltungsansatz, sie ist dafür aber auch das wirksamste Mittel, um Handlungen nachhaltig zu beeinflussen. Was genau versteht man aber unter einer » Struktur«? Was ist das gemeinsame von Personalstrukturen, Organisationsstrukturen, Entscheidungsstrukturen, Arbeitsstrukturen usw.? Ein wichtiger Aspekt einer Struktur ist ihre Dauerhaftigkeit. Strukturen verändern sich unter gewöhnlichen Bedingungen nur sehr langsam. Dass etablierten Strukturen eine »natürliche« Trägheit innewohnt, zeigt sich augenfällig spätestens dann, wenn man versucht, Strukturveränderungen zu beschleunigen. Es ist weder ein Zufall noch ein Ausdruck des Unvermögens der Akteure, dass Revolutionen selten gelingen. Selbst relativ bescheidene organisatorische Veränderungen führen oft zu erheblichen Verunsicherungen, zu »Gerangel« um Aufgaben und Zuständigkeiten, zu Verweigerung und passivem Widerstand. Dies ist leicht zu verstehen, weil in Strukturen vielfältige und vielschichtige Aspekte des Organisationsgeschehens miteinander verwoben sind und Strukturveränderungen daher oft eine umgreifende Neujustierung der gegebenen Verhältnisse notwendig machen. Ein weiteres Merkmal von Strukturen ist ihr Prämissen-Charakter. Strukturen werden nicht unentwegt in Frage gestellt, sie werden als selbstverständliche Verhaltensvoraussetzungen akzeptiert. Außerdem sind Strukturen verschachtelte Gebilde, d. h. sie bestehen aus sich wechselseitig stützenden Substrukturen mit einer großen Persistenz, d. h. man kann sich ihnen nicht entziehen. Sie wirken nachhaltig und mit hartnäckiger Kraft. Und – wie eingangs bereits angeführt – Strukturen bilden den Rahmen von Prozessen, sie sind der Hintergrund, das »Gelände«, innerhalb dessen sich die Akteure bewegen. Strukturen kanalisieren Verhaltensweisen, sie regulieren Interaktionen, lenken sie in vorgegebene Bahnen oder zumindest in bestimmte Verhaltenskorridore, die den Akteuren nur einen umgrenzten Gestaltungsspielraum zugestehen. Die Planung von Strukturveränderungen erfordert aus den angeführten Gründen besondere Sorgfalt in der Vorbereitung der Veränderungsschritte, Realismus in der Einschätzung der eigenen Steuerungsmöglichkeiten, Gewissenhaftigkeit in der Abschätzung der Auswirkungen der eingeleiteten Maßnahmen und eine ständige Prozessbegleitung, um evtl. fehllaufende und prinzipiell nicht vorhersehbare Entwicklungen auffangen zu können.
In der personalwirtschaftlichen Literatur wird der Aspekt der Strukturgestaltung nur sehr selten thematisiert. Meistens kreist die praktische Diskussion um die Wirksamkeit von personalwirtschaftlichen Instrumenten. Präsentiert werden z. B. Varianten von Beurteilungssystemen, Erfahrungen mit bestimmten Personalauswahlverfahren, Möglichkeiten der Ausgestaltung von Förderprogrammen für bestimmte Mitarbeitergruppen usw. Eine gewissenhafte Prüfung der wissenschaftlichen Fundierung – aber auch der praktischen Ergiebigkeit dieser Instrumente – findet leider nur sehr selten statt. Es dominieren pauschale Einschätzungen über die Wirksamkeit im jeweiligen Anwendungsfeld und relativ unbestimmte Hinweise auf praktische Erfahrungen. Instrumente werden oft isoliert – also »für sich« – und nicht etwa im Wirkungsverbund mit der personalwirtschaftlichen Gesamtausrichtung eines Unternehmens beurteilt. Statt methodisch fundierte Wirkungsanalysen durchzuführen, erkundigt man sich über Erfahrungen, die in anderen Unternehmen gemacht wurden oder orientiert sich ganz generell an »guter Praxis«. Das führt nicht selten dazu, dass man lediglich den gerade gängigen Modeerscheinungen folgt und aus dem Blick verliert, dass es bei der personalwirtschaftlichen Gestaltung ganz maßgeblich darauf ankommt, die je spezifischen Besonderheiten vor Ort, unter anderem die bestehenden Strukturen, zu beachten. Wir kommen auf die Anforderungen an eine gute Instrumentengestaltung weiter unten noch ausführlich zurück.
Instrumente werden oft zur Unterstützung von einzelnen Maßnahmen »eingesetzt«. Bei dem Bemühen, eine freigewordene Stelle zu besetzen, werden z. B. Stellenanzeigen platziert, es werden Tests angewandt, Interviews durchgeführt und Personalfragebögen verwendet. Zur Kategorie der personalwirtschaftlichen Maßnahmen zählen neben personen- und gruppenbezogenen Einzelentscheidungen auch Programme, Projekte, die Verabschiedung von Richtlinien und die Einführung von Verfahren und Verhaltensregeln. Maßnahmen sind oft eigentlich »Maßnahmenbündel«. Ein Beispiel hierfür ist das Vorgehen bei der Anwerbung und Auswahl von Auszubildenden, das mit vielen Einzeltätigkeiten verknüpft ist (z. B. Informationsveranstaltungen in Schulen, Tage der offenen Tür, Einrichtung spezifischer Internetseiten, Durchführung von Eignungstests usw.). Beispiele für personalbezogene Einzelmaßnahmen sind Entlassungsaktionen, die Einrichtung einer Stabsstelle »Personalentwicklung« oder die Entwicklung und Implementierung von personalwirtschaftlichen Instrumenten.
Bei der Durchführung von Einzelmaßnahmen und beim Instrumenteneinsatz geht es meist um konkret benennbare Ergebnisse. Weniger spezifisch, gleichzeitig aber umgreifender in ihrem Anspruch ist die Verfolgung von Personalstrategien. Strategien sind durch eine Vielzahl von mehr oder weniger eng miteinander verknüpften Aktivitäten gekennzeichnet, die darauf abzielen, der Personalarbeit eine Richtung zu geben. Hierauf wollen wir etwas näher eingehen.
5 Strategie und Politik
Wir machen einen Unterschied zwischen den Begriffen »Strategie« und »Politik«. Dabei orientieren wir uns an der Entgegensetzung von voluntaristischer und deterministischer Betrachtungsweise. Die voluntaristische Sicht bedient sich bei der Erklärung des Verhaltens der Gründe, die Personen bei der Wahl ihres Verhaltens erwägen. Die deterministische Sicht fragt dagegen allgemeiner nach den Ursachen des Verhaltens. In dem Wort Strategie steckt ein Gestaltungswille. Man hat ein Ziel, das man in konsequenter Weise anstrebt. Hierzu entwickelt man ein Konzept, man macht Pläne, beschafft die notwendigen Mittel usw. In diesem Sinne gibt es viele Personalstrategien, man möchte die eigene Attraktivität als Arbeitgeber herausstellen, die Produktivität steigern, unrentable Unternehmensbereiche ausgliedern, die Produktion auf Teamfertigung umstellen usw. Strategisches Denken gründet auf den Überlegungen, die man anstellt, um ein bestimmtes Handlungsergebnis zu erreichen. Man entwickelt Absichten und versucht, diese zu realisieren. Bei der Willensbildung denkt man darüber nach, welche Gründe für oder gegen ein bestimmtes Verhalten sprechen. Wenn es darum geht, zu erklären, warum sich eine Person in einer bestimmten Weise verhalten hat, fragt man sinnvollerweise nach den Gründen, die diese Person zu ihrem Verhalten bewogen haben. Und es sind tatsächlich oft ganz maßgeblich Gründe, die das Verhalten von Menschen motivieren. Gründe sind in diesem Fall also auch Ursachen. Die Sachlage ist allerdings etwas komplizierter, denn erstens werden nicht alle Absichten auch realisiert, Gründe für ein bestimmtes Handeln münden also nicht notwendigerweise auch in entsprechendes Verhalten und zweitens wird das Verhalten einer Person nicht ausschließlich von Erwägungen bestimmt, bei der Ausführung von Handlungen kommt vielmehr eine ganze Reihe zusätzlicher Bestimmungsgrößen zum Zuge. Eine weitere Komplikation ergibt sich daraus, dass man mit seinem Handeln zwar ganz bestimmte Ergebnisse erreichen will, die Handlungsziele aber nicht selten verfehlt. Es wäre also ein Fehler, wenn man glaubt, man könne von dem beobachteten Verhaltensergebnis direkt auf die Handlungsabsicht und von da weiter zurück auf die Handlungsgründe schließen. Und die Sache ist naturgemäß noch etwas komplizierter, wenn man das Handeln von Unternehmen betrachtet. Unternehmen sind keine einheitlichen Akteure, sie bestehen vielmehr aus einem Konglomerat von Handlungsgelegenheiten, Handlungsaufforderungen, Handlungsroutinen und von mehr oder weniger zufällig entstandenen Formen der Arbeitsteilung. Es entsteht aus dem Zusammenwirken der jeweils zum Zuge kommenden Personen und wird außerdem stark von Machtstrukturen, institutionellen Regeln, Möglichkeiten und Mitteln bestimmt. Die Annahme, man könne aus den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten (den vorfindlichen Strukturen, den eingesetzten Instrumenten und den jeweils ergriffenen Maßnahmen) schlankweg auf die dahinterstehenden Absichten des Unternehmens, auf dessen Erwägungen und Begründungen, zurückschließen, ist daher einigermaßen »heroisch«. Und erweitert man die angeführte Kausalkette um einen weiteren Punkt, nämlich um die oft unterstellte enge Verknüpfung von Handlung und Handlungserfolg, dann wird die Situation noch irrealer: Es führt kein direkter Pfad von Gründen, die für oder gegen eine betriebliche Praktik sprechen zu dem (wie auch immer und von wem auch immer) definierten Erfolg.
In Abbildung 1.1 sind diese Überlegungen schematisch zusammengefasst, die Abbildung enthält außerdem den Hinweis darauf, dass tatsächliche und intendierte Wirkungen nicht notwendigerweise übereinstimmen. Außerdem ist zu beachten, dass die Ursachen und Gründe, die ein bestimmtes Handeln veranlassen, oft nicht dieselben Ursachen und Gründe sind, die den Erfolg des Handelns bestimmen. Aus all dem folgt nun allerdings nicht, dass es sinnlos wäre, sich über Gründe und Begründungen des praktischen Handelns Gedanken zu machen. Tatsächlich sind und bleiben es Menschen, die handeln, und diese machen sich auch begründete Gedanken über die »richtige« Gestaltung der Arbeitswelt. In die praktischen Handlungen fließen diese Überlegungen durchaus ein und sie sind auch nicht völlig willkürlich, weil man mit ihnen schließlich hantieren muss, um andere Personen von der Qualität der Pläne und Maßnahmen zu überzeugen. Diskussionen darüber, warum man etwas ganz Bestimmtes tut und warum man ganz bestimmte andere Dinge dafür eher lässt, greifen immer auch auf Gründe zurück. Das bedeutet nun aber nicht, dass diese Gründe immer überzeugend oder wirklich handlungsbestimmend sind.
Abb. 1.1: Gründe und Ursachen
Aber letztlich interessieren denn doch die eigentlichen Ursachen und die daraus sich ergebenden Wirkungen (deterministische Betrachtungsweise). Es reicht also nicht aus, sich auf die (vorhandenen oder auch nicht vorhandenen) personalpolitischen Programme zu konzentrieren, wenn man die betriebliche Personalarbeit beschreiben will. Anders ausgedrückt, mindestens ebenso wichtig wie die Betrachtung der explizit formulierten personalwirtschaftlichen Strategien ist die Betrachtung der sich letztlich herausbildenden Handlungsmuster. Nur in diesen zeigt sich die Bedeutung der tatsächlich wirksamen, das Unternehmenshandeln bestimmenden Kräfte. Wir gebrauchen den Politikbegriff im letztgenannten (deterministischen) Sinne als Muster der Personalarbeit, d. h. als Resultante der Kräfte, die auf die Personalarbeit einwirken. Abgrenzen wollen wir unseren Politikbegriff von zwei weiteren Bedeutungen.
Häufig versteht man unter Politik die (»politische«) Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Interessenträgern. Beispiele, in denen Politik in diesem Sinne zum Ausdruck kommt, sind Lohnverhandlungen, der Abschluss von Betriebsvereinbarungen, wilde Streiks, offener und verdeckter Widerstand gegen Entscheidungen der Unternehmensführung, Durchsetzung von Managerinteressen trotz gegenläufiger Vereinbarungen, Missachtung gesetzlicher Regelungen oder deren halbherzige Umsetzung, Lobbyismus und die Einflussnahme von Unternehmensvertretern auf kommunale Entscheidungen. Ein anderes Begriffsverständnis versteht unter »Politik« einer Organisation deren grundsätzliche Verhaltensausrichtung. Politik manifestiert sich danach in Leitlinien, Maximen, Handlungsgrundsätzen und dergleichen mehr. Eine Staatsregierung verfolgt eine bestimmte Außenpolitik (z. B. die europäische Integration) oder eine bestimmte Finanzpolitik (z. B. eine Konsolidierungspolitik). Ein Unternehmen verfolgt eine bestimmte Unternehmenspolitik (z. B. den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten) oder eine bestimmte Personalpolitik (z. B. die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der Arbeitsorganisation). Dabei handelt es sich allerdings oft nur um die »proklamierte« Politik. In unserem eigenen Begriffsverständnis geht es dagegen um die tatsächliche Politik, die sich – gewollt oder nicht gewollt – letztlich in den Handlungsmustern niederschlägt, die das Verhalten einer Organisation kennzeichnen. In Tabelle 1.3 sind Beispiele für sehr verschiedenartige Ausrichtungen der tatsächlichen Personalpolitik aufgeführt. Die Unterscheidung dieser Politikmuster folgt Überlegungen der Anreiz-Beitrags-Theorie (Bartscher-Finzer/Martin 1998, zu theoretischen Ansätzen zur Erklärung der Herausbildung von personalpolitischen Mustern vgl. Martin 1996; Alewell/Hansen 2012). Die Qualität der Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestimmt sich danach zum einen durch die Komplexität der Aufgabe und zum anderen durch die soziale Distanz zwischen den Arbeitsparteien. Durch Kombination dieser Variablen erhält man vier prototypische Beziehungsformen (die sich im konkreten Einzelfall weiter ausdifferenzieren werden). Handelt es sich bei der Arbeit um relativ einfache Tätigkeiten, die sich klar abgrenzen, leicht beobachten und bewerten lassen und für die man keine sonderlichen betriebsspezifischen Kenntnisse braucht, wird sich eine stark marktbestimmte Form der Beziehung herausbilden. Dies gilt insbesondere dann, wenn es wenig gemeinsame Interessen zwischen dem Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern gibt und wenn sich die Arbeitsparteien eher fremd gegenüberstehen. Ist die soziale Distanz dagegen eher gering, findet man häufig eine paternalistische Personalpolitik, in der der Arbeitgeber sich für das Wohlergehen seiner Arbeitnehmer in hohem Maße verantwortlich fühlt. Beide Formen werden sich durch ein je spezifisches »Set« von Strukturen, Instrumenten und Maßnahmen auszeichnen. Beispiele für drei unserer sechs Funktionsfelder haben wir in Tabelle 1.3 angeführt.
Eine strikt am ökonomischen Tausch orientierte Personalpolitik wird sich z. B. nicht durch intensive Sozialisationsbemühungen auszeichnen. Bei den Anreizen wird man vor allem auf materielle Mittel setzen, sich an der Leistung orientieren und an den Qualifikationen, die jemand mitbringt, also z. B. kaum Fördermaßnahmen ergreifen und sich das Personal auch für die gehobenen Positionen eher am externen Arbeitsmarkt beschaffen, als es sich intern »heranzuziehen«. Einer paternalistischen Personalpolitik geht es dagegen sehr stark um die Förderung der sozialen Beziehungen und sie setzt daher auch auf Maßnahmen, die diesem Zweck dienen. Beim Regulierungstyp findet man häufig eine gut organisierte Vertretung der Arbeitnehmerinteressen und eine durch entsprechend viele, formalisierte Regeln gekennzeichnete Personalarbeit. Beim sozialen Tausch schließlich wird man verstärkt Maßnahmen finden, die darauf gerichtet sind, die gemeinsamen Interessen zu betonen.
Ökonomischer TauschPaternalismusRegulierungSozialer Tausch
Tab. 1.3: Ausgewählte personalpolitische Muster gemäß der Anreiz-Beitrags-Theorie
6 Theorie und Gestaltung
Das primäre Ziel der Wissenschaft ist der Erkenntnisfortschritt. Wissenschaftler sollen erforschen, was jenseits landläufiger Auffassungen und oberflächlicher Beobachtungen »wirklich« geschieht und warum es geschieht. Sie sollen die Tiefenstrukturen und grundlegenden Zusammenhänge der Welt erforschen. Forschern geht es dabei nicht um die Anhäufung von Faktenwissen, sondern um eine Verdichtung des Wissens und sie entwickeln hierzu beispielsweise vereinheitlichende Begriffssysteme, Klassifikationen, Analysevorschriften und Modellbeschreibungen. Die eigentliche Aufgabe der Wissenschaft ist nicht die mit diesen Aktivitäten einhergehende Konservierung und Verwaltung von Wissen, sondern die Erweiterung des Wissens und – damit verbunden – die Verbesserung und Überwindung vermeintlich festgefügter Wissensbestände. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Wissenschaft ganz zentral mit Theorien, denn es sind die Theorien, die die Essenz des Wissens ausmachen (zu anderen Wissensformen vgl. Martin 2001, 75 ff.). Eine Theorie ist ein Aussagensystem, dessen Kern aus Gesetzesaussagen besteht. Theorien sagen uns, worauf es bei der Betrachtung der Wirklichkeit ankommt, und worauf nicht. Ein einfaches Beispiel soll diesen Gedanken erläutern. Es ist zwar hoch plausibel und wird von der Alltagserfahrung immer wieder bestätigt, dass Menschen, die mit ihrer Arbeit unzufrieden sind, weniger, und Menschen die mit ihrer Arbeit zufrieden sind, mehr und bessere Leistungen erbringen. Nun zeigen aber zahllose empirische Studien, dass der angeführte Zusammenhang sehr häufig nicht existiert. Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Hierzu hilft eine theoretische Betrachtung. Sie macht deutlich, dass bereits in der Erfassung der Arbeitszufriedenheit viele Probleme stecken. Wenn jemand Auskunft über seine Zufriedenheit gibt, dann sagt er damit nicht nur etwas über die Arbeitsbedingungen, sondern auch etwas über sich selbst, z. B. über seine Fähigkeit, eine befriedigende Arbeit zu finden. Entsprechend uneindeutig ist das, was mit der Frage nach der Zufriedenheit tatsächlich erfasst wird. Außerdem wäre erst noch zu klären, in welcher Weise sich ein pauschales Gesamturteil über die Arbeitssituation auf das konkrete Verhalten auswirken sollte, denn schließlich wird man sich bei der Entscheidung, mehr oder weniger Leistung zu zeigen, eher von den Konsequenzen dieses Verhaltens lenken lassen als von seinen Einstellungen. Die besseren Motivationstheorien gehen jedenfalls nicht davon aus, dass sich Menschen bewusst vornehmen, zufrieden sein zu wollen (Zufriedenheit ist kein Verhaltensziel), sie sehen die verhaltensbestimmende Kraft vielmehr in den Anreizen, die die jeweiligen Verhaltensalternativen bieten. Zufriedenheit ist aus dieser Sicht eher das Ergebnis und nicht die Veranlassung für Leistungsverhalten. Dennoch steckt in der Auffassung, dass die Zufriedenheit für das Verhalten wichtig ist, ein Kern Wahrheit. Es ist aber nicht die Beurteilung der Arbeitssituation, die zählt, sondern das unmittelbare Erleben, es sind die das Arbeitshandeln begleitenden Gefühle, die einen unmittelbaren Einfluss auf unser Verhalten haben. Diese Gefühle führen aber nicht etwa auf direktem Wege zu einer höheren oder geringeren Leistung. Sie bestimmen lediglich die Arbeitshaltung und ob jemand seine Arbeit eher proaktiv oder eher reaktiv angeht, ob man also nur das macht, was notwendig ist, weil es z. B. überwacht wird, oder ob man auch über seine unmittelbaren Pflichten hinausblickt, nach neuen Lösungen sucht und sich ganz allgemein für die Organisation engagiert. Theoriegestützte Überlegungen sind also in vielerlei Hinsicht hilfreich. Theorien können dazu beitragen, irrige Vorstellungen aufzudecken. Sie liefern die sprachlichen Mittel, um eine Situation zu analysieren, sie beschreiben die Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens und sagen damit, was möglich ist, was funktionieren dürfte und was nicht. Und weil Theorien die Mechanismen beschreiben, die das Verhalten lenken, kann man sie für Erklärungen und Prognosen nutzen.
Zweifellos gibt es nicht nur gute, sondern auch schlechte Theorien. Das ist auch nicht anders zu erwarten und muss einen daher nicht irritieren. Zur Beurteilung der Qualität einer Theorie gibt es Kriterien, an denen man sich gut orientieren kann. In Tabelle 1.4 sind die wichtigsten Fragen zusammengestellt, die man bei der Beurteilung von Theorien berücksichtigen sollte. Wir werden auf sie exemplarisch bei der Beschreibung der in diesem Buch behandelten Theorien zurückkommen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse geben uns die geistigen Mittel an die Hand, neue Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Doch es gibt nur selten einen direkten Weg vom Wissen zum Handeln. Dieser Tatbestand ist jedermann aus seiner Alltagserfahrung vertraut, weshalb es verwundern muss, dass der Ruf nach einer unmittelbar praktischen Wissenschaft ein so breites Echo findet. Offenbar gibt es, was das Verhältnis zwischen »Theorie und Praxis« angeht, viele Missverständnisse. Das wohl Bedeutsamste besteht darin, dass man Theorien mit Gestaltungskonzepten verwechselt. Theorien geht es aber gar nicht um Gestaltung, sondern darum, möglichst wahre Aussagen über bestimmte
BeschreibungBewertung
Tab. 1.4: Beschreibung und Beurteilung von Theorien
Aspekte der Wirklichkeit zu formulieren. Sie können damit auch die sogenannte »Praxis« zum Gegenstand haben, aber sie machen dann Aussagen »über« und nicht »für« die Praxis. Da Theorien keine Praxisempfehlungen sind, gibt es auch keine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Es ist allenfalls denkbar, dass Theorien die Wirklichkeit nicht richtig beschreiben. Darin zeigt sich dann eine Diskrepanz zwischen »Theorie und Realität« und nicht etwa zwischen »Theorie und Praxis«. Diese Problematik (der Unterschied zwischen Theorie und Realität) bezieht sich auf die Beschreibung der Welt. Das, was häufig als Kluft zwischen Theorie und Praxis beklagt wird, betrifft die Theorie gar nicht, es handelt sich hierbei vielmehr um eine Kluft zwischen einem Gestaltungsideal und der Gestaltungswirklichkeit, um den Unterschied zwischen der Vorstellung, wie man etwas am besten machen sollte und den Möglichkeiten, die die konkret gegebene Handlungssituation oder auch die Wirklichkeit insgesamt überhaupt bereithält.
Abbildung 1.2 gibt diese Überlegungen schematisch wieder. Ideale Vorstellungen richten sich auf die »richtige« (nicht: die tatsächliche) Praxis, sie entwerfen das Bild eines wünschenswerten Zustandes, auf dessen Verwirklichung man hinarbeiten will (durchgezogener Pfeil). Ideale haben allerdings häufig ein gestörtes Verhältnis zur Realität (gestrichelter Pfeil). Dieses gestörte Verhältnis ist es, das häufig als Kluft zwischen Theorie und Praxis beklagt wird, was aber, wie beschrieben, die Sache nicht trifft. Denn schließlich geht es um etwas anderes, nämlich um den Unterschied von Ideal und Wirklichkeit oder um das Auseinanderfallen von Plan und Verwirklichung. Dessen
Abb. 1.2: Theorie, Ideal und Wirklichkeit
ungeachtet wirken sich Normen und Ideale natürlich auf das Verhalten der Akteure aus, sie werden also Teil der Wirklichkeit und man sollte den Einfluss, der von ihnen ausgeht, entsprechend auch untersuchen.
Theorien befassen sich mit der Wirklichkeit. Sie sind keineswegs etwas »Abgehobenes«, das allenfalls intellektueller Selbstbeschäftigung dient. Der Ausdruck »weltfremde Theorie« ist ein Widerspruch in sich, denn es ist ja geradezu das Wesen einer Theorie, dass sie sich mit den innersten Strukturen der Realität beschäftigt. Einer Theorie geht es dabei aber nicht um die Formulierung eines idealen, sondern um die Beschreibung des tatsächlichen Zustands der Welt. Es geht ihr nicht um Normsetzung, sondern um Verstehen, um die objektive Erfassung und Erklärung der Wirklichkeit. Die gepunkteten Pfeile in Abbildung 1.2 sollen zum Ausdruck bringen, dass Theorien trotz ihres primär analytischen Anspruchs durchaus auch Einfluss auf die Praxis nehmen, dieser Einfluss ist allerdings indirekter Natur. Theorien sind bewusstseinsbildend und damit auch verhaltensrelevant, sie fließen beispielsweise als Hintergrundwissen in die Entwicklung von Idealen, Normen, Plänen usw. ein. Und die von ihnen vermittelten Einsichten sind auch ganz unmittelbar bei praktischen Tätigkeiten nützlich, weil sie Auskunft darüber geben, was bei Gestaltungshandlungen zu beachten ist, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Plänen auftauchen können und welche besonderen Bedingungen vorliegen müssen, damit das Handlungsziel erreicht werden kann und was ganz generell möglich ist und was nicht (ausführlich hierzu Martin 2001).
Theorien haben damit für konkrete praktische Probleme eine ganz elementare Bedeutung. Mit ihrer Hilfe kann es gelingen, die Bewegungskräfte des Geschehens richtig zu beschreiben. Sie liefern gewissermaßen die Erkenntnisgrundlage für gestalterische Handlungen und haben damit einen wesentlich grundlegenderen Status als Ratschläge, Verhaltensrezepte oder Handlungsanweisungen. Theorieverächter unterliegen häufig einem weiteren Missverständnis. Sie verwechseln Theorien häufig mit abstrakten inhaltsleeren Modellen oder glauben irrtümlich, theoretische Auseinandersetzungen hätten etwas mit unfruchtbaren spitzfindigen Begriffserörterungen zu tun. Am häufigsten werden Theorien aber gemieden, weil man meint, ohne sie auskommen zu können. Dabei wird übersehen, dass man seinem Handeln immer – ob man das nun will oder nicht – bestimmte theoretische Überlegungen zugrunde legt. Diese zu reflektieren macht daher auf jeden Fall Sinn. Es sei denn, man meint, man habe es nicht nötig, sein Wissen zu verbessern oder alles Wissen sei ohnehin Schall und Rauch.
7 Gestaltungselemente
Erfolgreiche Gestaltung gründet immer auf einem Denken in Alternativen. Es gibt nicht die eine und die einzig richtige Praxis. Praxisgestaltung ist außerdem ein Konstruktions- und Umsetzungsprozess. Bei der Gestaltung sind daher Phantasie und Realitätssinn gleichermaßen gefordert. Phantasie ist sowohl notwendig bei der Erfindung eines Instruments als auch bei seinem situationsadäquaten Einsatz. Die Vorstellung, ein gegebenes Instrument ließe sich »schablonenhaft« umsetzen, führt unausweichlich zum Misserfolg. Jede konkrete Situation enthält ihre eigenen Herausforderungen, die Beachtung verdienen. Praktisches Handeln muss also die jeweils gegebenen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen beachten, es muss berücksichtigen, welche Personen und Institutionen von den Maßnahmen betroffen sind, in welchen Traditionen das organisationale Handeln steht, welche Erfahrungen die Organisationsmitglieder mitbringen usw. Daher ist neben Kreativität auch der Sinn für das Machbare und seine Folgen gefragt, das Erkennen und Verstehen der jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten, um Instrumente und Maßnahmen daran ausrichten zu können, um sie so anzupassen, dass sie überhaupt positiv wirksam werden können. Außerdem braucht es die Fähigkeit und nicht minder die Bereitschaft, Gegebenes und neu Geschaffenes einer kritischen Prüfung zu unterziehen und gegebenenfalls neuen Einsichten und veränderten Bedingungen anzupassen.
In Tabelle 1.5 findet sich ein allgemeines Schema zu den Grundfragen der personalwirtschaftlichen Gestaltung (Martin/Drees 2001).
BeschreibungBeispiel: Zielvereinbarung
Tab. 1.5: Grundfragen bei der personalwirtschaftlichen Gestaltung (Beispiel: Zielvereinbarung)
Zur Veranschaulichung sei beispielhaft auf das Instrument der Zielvereinbarung eingegangen. Danach geht es zunächst darum, sich über die Ziele, die man mit dem Einsatz des Instrumentes verfolgt, Klarheit zu verschaffen. Wobei zu beachten ist, dass man mit »Universalinstrumenten«, also Instrumenten, die vielen Zwecken gleichzeitig dienen sollen, immer auch Kompromisse im Hinblick auf die einzelnen Zwecke eingehen. Anders ausgedrückt, je stärker man ein Instrument auf einen spezifischen Zweck ausrichtet, desto größer ist normalerweise auch sein Wirkungsgrad, allerdings auf Kosten der Breite seiner Einsatzmöglichkeiten. Die Zielbestimmung hat natürlich eine unmittelbare Bedeutung für die Ausgestaltung eines Instruments. Ein Zielvereinbarungsgespräch wird man anders gestalten müssen, wenn es dazu dient, Leistungsziele festzulegen, die der Gehaltsfindung zugrunde gelegt werden, als wenn es in dem Gespräch darum gehen soll, einen Plan zu entwerfen, der darauf gerichtet ist, das berufliche und betriebliche Vorankommen des Mitarbeiters zu unterstützen. Zur Instrumentengestaltung gehört es außerdem, sich über die Teilelemente, die es ausmachen sollen, Gedanken zu machen. Zum Instrument »Zielvereinbarung« gehört beispielsweise nicht nur das Formular, das als Gesprächsgrundlage zur Anwendung kommen soll, sondern auch dessen Erläuterung, z. B. in Handreichungen und Broschüren sowie Hilfsmitteln für die Vor- und Nachbereitung des Gesprächs, die zu beachtenden Regeln, etwa was die Protokollierung und Einigung angeht usw. Die Festlegung auf die konstituierenden Elemente eines Instruments gehört zu den wichtigsten Gestaltungsmaßnahmen. Daneben gibt es viele weitere Ansatzpunkte zur Ausgestaltung des Zielvereinbarungs-Instruments. Alternative Gestaltungsmöglichkeiten gibt es z. B. im Hinblick auf den Gestaltungsparameter »Zielinhalt«. Man kann beispielsweise Ergebnisziele, aber auch Ablaufziele vereinbaren. Während bei Ergebniszielen der Weg der Zielerreichung offen bleibt, wird bei Ablaufzielen auch die Art und Weise der Zielerreichung mehr oder weniger eindeutig festgelegt. Daneben gibt es etliche weitere Gestaltungsoptionen, die der Zielvereinbarung ein je eigenes Gepräge geben: man kann kurz- oder langfristige Ziele vereinbaren, nach einer bestimmten Zeit Zielkorrekturen zulassen oder nicht, Individual- oder Gruppenziele vereinbaren, auf Leistungsanreize verzichten oder diese gezielt zur Anwendung bringen, wobei zu klären wäre, wie die Anreizlinie verlaufen sollte (z. B. linear, progressiv, degressiv).
Man sollte sich bezüglich all dieser Gestaltungsparameter und ihrer Gestaltungsalternativen Gedanken darüber machen, welche Wirkungen man mit ihnen in der ganz konkreten betrieblichen Situation erzielen wird. Außerdem sollte man sich darüber Rechenschaft geben, ob die Kombination der verschiedenen Gestaltungsmerkmale Sinn macht und welche besonderen Wirkungen aus der Gesamtkonfiguration der gewählten Gestaltungsalternativen erwachsen. In Tabelle 1.6 findet sich ein Schema, das bei der Beantwortung dieser Fragen gute Dienste leistet. Am Beispiel eines ausgewählten Gestaltungsparameters – dem Ausmaß, in dem es zu einer echten Partizipation bei der Zielfestlegung kommt – sind mögliche Wirkungen auf die Bereiche Kooperation, Lernen und Leistung aufgeführt. Ganz allgemein werden einer partizipativen Mitarbeiterführung durchweg positive Auswirkungen zugeschrieben (Klein u. a. 1999). Für eine partizipativ gestaltete Zielvereinbarung dürfte dasselbe gelten. Eine ganz bedeutsame Wirkung, die sich aus der Partizipation ergibt, ist die damit einhergehende Selbstverpflichtung der Akteure. Der Grund hierfür ist leicht einzusehen: »Echte« Partizipation erschöpft sich nicht in der Zustimmung zu einem mehr oder weniger vorgegebenen Ziel, sondern setzt eine aktive Mitarbeit an der Erarbeitung des Zielinhalts und des Zielausmaßes voraus. Gehen nun in das Ergebnis der Zielbestimmung sehr stark die eigenen Vorstellungen ein, dann fällt es schwer, sich hiervon ohne weiteres wieder zu distanzieren. Und ergeben sich bei dem Bemühen um Zielverwirklichung besondere Schwierigkeiten, dann werden Personen mit einer hohen Selbstverpflichtung nicht ohne weiteres zurückstecken. Ihr Streben danach, die vereinbarten Ziele zu erreichen, wird damit eher noch angestachelt. Außerdem werden sie nach neuen Lösungsansätzen suchen und versuchen, auch unkonventionelle Wege zu gehen, weshalb durch Partizipation nahezu zwangsläufig auch die Lernbemühungen stimuliert werden.
Gestaltungsparameter: Hohes Ausmaß der Partizipation bei der ZielfestlegungWirkungs- bereichWirkungs- hypotheseBegründung/ ErklärungBedingung
Tab. 1.6: Wirkungshypothesen am Beispiel von Zielvereinbarungen
Auch auf die Kooperation wirkt sich Partizipation sehr positiv aus. Dies liegt vor allem an der »Selbstwirksamkeit« (Bandura 1982), die durch die Partizipation gefördert wird. Wird ein Mitarbeiter als Partner ernst genommen, dann wird das die Beziehung zu seinem Vorgesetzten nicht unberührt lassen, zumal sich damit die Erfahrung verknüpft, dass man sich kommunikativ behaupten und seine Interessen wirksam vertreten kann. Die tatsächliche Wirkung einer Gestaltungsalternative hängt, ganz allgemein gesprochen, in aller Regel von den konkreten Gegebenheiten ab. Das gilt auch in dem von uns gewählten Beispiel. Wie beschrieben, dürfte eine partizipative Vereinbarung die Akzeptanz der Zielsetzung und damit die Voraussetzungen für ein gesteigertes Leistungsverhalten verbessern. Andererseits liegt es nicht unbedingt im Interesse des Mitarbeiters, dass ihm sehr hohe Leistungsziele gesetzt werden. Mit der Festlegung des Zielausmaßes bestimmt sich nämlich auch der Bewertungsmaßstab, an dem man schließlich gemessen wird. Insgesamt kann es also sein, dass sich die Partizipation bei der Zielfestlegung negativ auf die Leistung auswirkt. Zwar dürfte die Partizipation die Chancen für die Zieldurchsetzung verbessern. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass der Mitarbeiter auf ein nur moderates Zielniveau hinwirkt, was den Leistungseffekt natürlich mindert. Ein derartiges Verhalten dürfte allerdings nur dann zu beobachten sein, wenn der Mitarbeiter (aus welchen Gründen auch immer) eine ohnehin nur geringe Leistungsmotivation mitbringt. Es kommt also sehr auf die Bedingungen an, welche Wirkungen sich aus einer Gestaltungsalternative ergeben. Entsprechend sind auch die anderen in Tabelle 1.6 aufgeführten Wirkungshypothesen situativ zu relativieren. Ähnliches gilt für die Gesamtwirkung des Instruments. In manchen betrieblichen Situationen machen Zielvereinbarungen einfach keinen Sinn, in anderen Fällen sind sie dagegen ein gutes Mittel, um ein Projekt gemeinsam voranzubringen. Man sollte also immer die Anwendungsvoraussetzungen eines Instrumenteneinsatzes beachten. Und schließlich genügt es nicht, nur die Zweckerreichung oder die Systemverträglichkeit im Auge zu haben. Bei der Beurteilung eines Instruments ist eine ganze Reihe weiterer Punkte zu beachten, worauf im Folgenden eingegangen wird.
8 Die Beurteilung von Gestaltungshandlungen
Woran erkennt man den Wert praktischer Gestaltungsmaßnahmen? In Tabelle 1.7 findet sich ein Überblick über wichtige Beurteilungskriterien. Eine erste Gruppe von Fragen richtet sich auf die »Effizienz«, die Wirksamkeit und Ökonomie des Handelns. Eine zweite Gruppe von Fragen thematisiert die normative Komponente von Gestaltungshandlungen, bei der es um die Einsicht geht, dass praktisches Handeln die Welt verändert und man sich daher auch in einem umfassenden Sinn Rechenschaft darüber geben sollte, ob man mit seinen Handlungen hierzu einen positiven Beitrag liefert. Und schließlich ist drittens zu fragen, in welchem Umfang praktisches Handeln sich auf gute Gründe stützt, also eine Verankerung in »gesicherten« Erkenntnissen besitzt.
Formale RationalitätMateriale RationalitätQualität der Wissensbasis
Tab. 1.7: Kriterien zur Beurteilung von Gestaltungsansätzen
Das Beurteilungskriterium, das am unmittelbarsten ins Auge springen dürfte, ist die Zweckeignung. Die Beurteilung einer Gestaltungshandlung anhand dieses Kriteriums gestaltet sich nicht immer einfach, da von einer Maßnahme, vom Einsatz eines Instruments usw. oft mehrere Ziele gleichzeitig betroffen sind. Da sich diese nicht selten widersprüchlichen Ziele nicht alle in gleichem Umfang erreichen lassen, wird man im praktischen Leben um Kompromisse nicht herumkommen. Die Frage nach der Zweckeignung ist auch deswegen nicht immer einfach zu beantworten, weil man oft nicht genau weiß, welche Wirkungen von einer Maßnahme tatsächlich ausgehen werden. Die Klärung dieser Frage mit Hilfe methodisch sauberer empirischer Studien ist sehr aufwändig. Außerdem verstellen einem widerstreitende Interessen und Wunschdenken nicht selten die nüchterne Urteilsbildung. Während es bei der Betrachtung von Zweck-Mittel-Beziehungen um die rein faktische Wirksamkeit geht, kommen durch das Ökonomiepostulat zusätzliche Gesichtspunkte ins Spiel. So kann ein gegebener Zweck normalerweise durch unterschiedliche Mittel erreicht werden. Das Ökonomiepostulat fordert nun, für den vorgegebenen Zweck den geringstmöglichen Mitteleinsatz zu wählen. Umgekehrt soll mit den gegebenen Mitteln die maximal mögliche Zielerfüllung angestrebt werden. Das Ökonomiepostulat impliziert zum einen das Prinzip der Sparsamkeit (also das Vermeiden von Mittelverschwendung) und zum anderen die Aufforderung, nach Mitteln zu suchen, die eine gleiche Zweckeignung besitzen, aber weniger kostenintensiv sind. Ein scheinbar triviales Effizienzkriterium ist das der Realisierbarkeit. Es ist natürlich nur sinnvoll, ein Instrument einzusetzen, wenn mit seiner Hilfe der damit bewirkte Zweck auch erreicht werden kann. Entsprechend sollte man sich z. B. bei der Entwicklung von Instrumenten Klarheit darüber verschaffen, ob sie überhaupt funktionieren können. Hierzu gehört auch die Frage, ob es soziale Hindernisse für ihren Einsatz gibt (z. B. eine geringe Akzeptanz oder ungünstige Machtkonstellationen). Es geht bei der Realisierbarkeit in einem weiteren Sinn also auch um das Kriterium der Situationsadäquatheit, das z. B. in dem Sprichwort, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen soll, bezeichnet wird. Allgemeiner meint Situationsadäquatheit, dass Maßnahmen in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Wirkungen besitzen können, dass man also bei der Gestaltung die jeweiligen Besonderheiten der Situation in Rechnung stellen sollte. Und schließlich gibt es kaum eine Handlung, die neben der anvisierten Hauptwirkung nicht auch zahlreiche Neben- und Folgewirkungen hätte. Wünschenswert sind nur solche Gestaltungshandlungen, die mit möglichst wenig schädlichen Neben- und Folgewirkungen einhergehen. Zu bedenken ist außerdem, ob es flankierende Maßnahmen gibt, die in der Lage sind, mögliche Begleitschäden abzumildern.