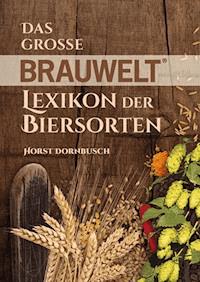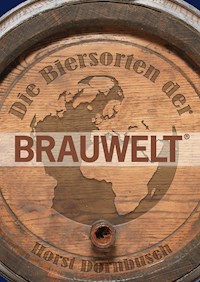
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CARL, HANS, FACHVERLAG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist eine einzigartige Sammlung von 117 der wichtigsten Bierrezepturen der Welt, einschließlich einiger historischer Biersorten der Weltgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Jede ausführliche Sortenbeschreibung wird ergänzt durch eine Brauanleitung mit einer Zutatenliste, deren Mengenangaben sowohl für kommerzielle Brauereien auf den Hektoliter, als auch für Hobby-Brauer auf den Maßstab von 20 Litern bezogen ist. Der Autor Horst Dornbusch ist ein Bierexperte und FAchmann mit jahrzehntelanger Erfahrung. "Die Biersorten der BRAUWELT" ist als Referenzwerk einmalig in deutscher Sprache und darf in keiner Bier-Bibliothek fehlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Dornbusch
Die Biersorten
der BRAUWELT
Ihre Geschichte und Rezepte
Haftungsausschluss
Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt und gemeinsam mit dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch lassen sich (im Sinne des Produkthaftungsrechts) inhaltliche Fehler nicht vollständig ausschließen. Die Angaben verstehen sich daher ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie seitens des Autors oder des Verlages. Autor und Verlag schließen jegliche Haftung für etwaige inhaltliche Unstimmigkeiten sowie für Personen-, Sach- und Vermögensschäden aus.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnd.d-nb.de abrufbar.
Verlag Hans Carl
© 2014 Fachverlag Hans Carl GmbH, Nürnberg
3. Auflage 2019
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.
Gestaltung: Wildner+Designer GmbH, Fürth
ISBN: 978-3-418-00901-8eISBN 978-3-418-00905-6
Für Elva
Inhalt
Vorbemerkungen
Vorbemerkungen des Autors
Vorwort von Professor Dr. Ludwig Narziß
Vorwort von Karl Schiffner
Dank
Biersorten sind schwankende Gestalten!
Das Reinheitsgebot contra internationale und historische Biere
Braukulturen, Brauverfahren und Sudhauskonfigurationen
Historische Brauliteratur
Rezepte
Adambier, Dortmunder
Altbier, Düsseldorfer
Altbier, Westfälisch
Amber Ale, American
Amber Ale, English
Barleywine, English & American
Berliner Weiße
Bière de garde
Bière de mars, Belgisch
Bière de mars, Elsass
Bière de saison
Bitter, Best
Bitter, Extra Special (ESB)
Bitter, Ordinary
Blond Ale, American
Blond Ale, Belgisch
Bockbier, Hell
Bockbier, Dunkel
Maibock
Doppelbock
Eisbock
Braggot
Broyhan-Bier
Brown Ale, American
Brown Ale, Northern English
Brown Ale, Southern English
California Common
Colonial Ale, American
Cream Ale
Dampfbier, Bayerisch
Dark Ale, American
Dark Ale, Belgian
Dark Ale, English
Dinkelbier
Dortmunder Export
Dunkel, Bayerisch
Dunkel, Böhmisch
Extreme Ale, American
Fruit Ale, American
Golden (Strong) Ale, Belgian
Gose, Leipziger
Gotlandsdricka
Grätzer Bier
Gruitbier
Ice Beer
Imperial IPA, American
Double Imperial IPA, American
India Dark Ale, American
India Pale Ale, American (IPA)
India Pale Ale, Englisch (IPA)
Kartoffelbier
Kellerbier
Keutebier
Kölsch
Kriek
Lager, American
Lager, Bernstein, European
Lager, Hell (Helles)
Lager, Light, American
Lager, Light, European
Lager, Premium, American
Lager, Red, European
Lager, Wiener
Lambic
Lichtenhainer Bier
Malt Liquor, American
Mild Ale
Mumme, Braunschweiger
Oktoberfestbier / Märzen
Old Ale
Oud Bruin, Ostflandern
Oud Bruin, Westflandern
Pale Ale, American
Pale Ale, English
Pharaonenbier, Altägyptisch
Pilsner, American
Pils, Pilsener, Pilsner, Deutsch
Pilsner, Böhmisch, „Klassisch“
Pilsner, Böhmisch, Modern I
Pilsner, Böhmisch, Modern II
Pilsner, Böhmisch, Modern III
Porter, Baltic
Porter, Deutsch
Porter, Dry
Porter, London
Porter, Robust
Pre-Prohibition Lager, American
Pub Wheat, American
Pumpkin Ale, English/American
Rauchbier
Red Ale, Irish
Roggenbier
Rye Ale, American
Sahti
Schwarzbier, Fränkisch
Schwarzbier, Thüringisch
Scottish Ale I
Scottish Ale II
Smoked Ale, American
Sticke
Doppelsticke
Stout, Black, Belgian
Stout, Foreign Extra (FES)
Stout, Irish
Stout, Oatmeal
Stout, Russian Imperial
Stout, Sweet (Milk Stout)
Trappistenbier, Dubbel/Double
Trappistenbier, Tripel/Triple
Weizen, Hell
Weizen, Dunkel
Weizenbock
Wiess
Witbier/Bière blanche
Zerbster Bitterbier
Zoiglbier
Zwickelbier
Definitionen der Rezeptparameter
Über den Autor
Bildnachweis
Vorbemerkungen des Autors
Es lebe, wer sich tapfer hält!Faust, Der Tragödie erster Teil, ZueignungJohann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Dem aufmerksamen Beobachter der gegenwärtigen internationalen Brauszene können zwei inzwischen dominante Globalisierungsströmungen kaum verborgen bleiben: Die eine Entwicklung ist der fast unaufhaltsame Sog der gigantischen Konsolidierung der weltweiten Brauriesen. Die klarste Manifestation dieses Trends war die Übernahme von InterBrew durch AmBev im Jahre 2004 gefolgt von der Übernahme von Anheuser-Busch durch die aus InterBrew und AmBev entstandene InBev vier Jahre später und die Fusion von Anheuser-Busch-InBev mit SABMiller im Jahre 2016. Die heutigen Großbrauereien beherrschen nun den Löwenanteil fast aller nationaler Märkte der Welt. Für diese brauen sie fast ausschließlich Ströme von Einheitsbieren des Typs „internationales Pilsner“ bzw. „internationales Lager“ – oft mit viel Malzersatz aus Mais und Reis sowie mit „down-stream“ Hopfenprodukten.
Der zweite Trend läuft parallel zur Konsolidierung und ist die zunehmende Internationalisierung der hoch differenzierten Biersortimente der kleineren, oft mittelständischen Brauereien. In diesem Welt-„Craft“-Biersegment, welches in manchen Ländern bzw. Regionen fast 20 % des Gesamtbiermarktes ausmacht, blüht die Biervielfalt wie vielleicht noch nie in der Geschichte des Bierbrauens. Zum Beispiel ist es heutzutage genauso wahrscheinlich, dass ein kanadischer Craft Brewer ein deutsches Altbier oder ein belgisches Witbier braut, wie ein norwegischer Craft Brewer ein amerikanisches Pre-Prohibition Lager, ein englisches India Pale Ale (IPA) oder ein französisches Bière de garde.
Auch ist es inzwischen klar, dass diese beiden Internationalisierungswellen – die Konsolidierung der Großen und die Sortimentsdifferenzierung der Kleinen – selbst vor der deutschen Brauindustrie mit ihrer langen, internen Reinheitsgebotstradition und der überwiegend mittelständischen Branchenstruktur nicht Halt machen werden. Die Riesen haben schon seit vielen Jahren deutsche Brauereien akquiriert, und viele deutsche mittelständische Brauereien, Gasthausbrauereien und Braumanufakturen, wie auch viele Hobbybrauer fangen nun langsam an, einige bisher in Deutschland kaum bekannte oder gar verpönte Biersorten wie irische Stouts, Scotch Ales, belgische Abteienbiere oder amerikanische „imperial“ IPAs mit interessanten Hopfensorten zu brauen.
Sicher ist nur, dass die deutsche Brauindustrie, besonders seit der Jahrtausendwende, immer mehr nach Strategien sucht, um den Verlust an Marktanteilen an andere Getränke wie Wein und Spirituosen wie auch den Margenschwund aufgrund der Sortendominanz des Pils, welche den Brauriesen eindeutige Effizienzvorteile einräumt, rückgängig zu machen. In vieler Hinsicht bedeutet das, dass man auch einmal über den eigenen Tellerrand hinweg schauen muss, nicht nur über die Landesgrenzen hinaus, sondern auch in die eigene Vergangenheit, denn es ist vielleicht kein Zufall, dass die größten Wachstumsraten in den gegenwärtigen – wie auch in den vergangenen – Bierkulturen dort zu beobachten sind, wo es gelingt, Bier mit kreativen Innovationen für den Verbraucher interessant zu machen und zu halten. So kann die heutige, „wilde“ amerikanische Craft-Beer-Szene seit der Jahrtausendwende jährliche Wachstumsraten von oft mehr als 10 % in einem Gesamtmarkt verbuchen, der schon seit langem stagniert oder sogar leicht rückläufig ist!
Es passt zu dieser Logik, dass die deutsche Brauindustrie ihre größte Blütezeit im 19. Jahrhundert erfuhr, als sie – neben der britischen Brauindustrie – die bedeutendste internationale Innovationsküche für Biersorten wie auch für Brautechnologien und Braustudiengänge war. In jenem Jahrhundert, der Belle Époque des deutschen Bieres, wurden im deutschen oder deutsch-beeinflussten Bierkulturraum Biersorten wie Altbier, Bock, Doppelbock, Eisbock, Dortmunder Export, Helles und Pils für die Moderne kodifiziert. Außerdem gab es damals noch starke, oft regionale Biersorten wie Berliner Weiße, Dampfbier, Kellerbier, Leipziger Gose, Lichtenhainer Bier, Rauchbier, Schwarzbier und Weißbier. Die vielleicht letzte deutsche Biersorteninnovation war das Kölsch, welches sich nach dem Ersten Weltkrieg aus dem lokalen Wiess entwickelte und sich schließlich im Jahre 1985 innerhalb der Kölsch-Konvention als regionale Biersorte fest etablierte.
Selbst in der deutschen Brauvergangenheit gab es viele einst bedeutende Biersorten, die heutzutage vollkommen in Vergessenheit geraten sind. Das ist der Grund, weshalb dieses Buch auch einige dieser alten Rezepte zur Anwendung in modernen Sudhäusern mit modernen Zutaten wiederbelebt. Wer kennt denn heute noch ein Broyhan Bier, ein Keutebier, ein Lichtenhainer oder ein Grätzer, geschweige denn die alten Benediktinerbiere aus der Zeit um die erste Jahrtausendwende wie das Cervisa, das Celia, oder den Conventus? Auch so ehrenhafte deutsche Sorten wie Haferbiere, Roggenbiere und Dinkelbiere sind heute selten geworden. Warum? Liegt es am Reinheitsgebot? [Zur Thematik der Biervielfalt innerhalb des heutigen Reinheitsgebots in der Fassung des „vorläufigen Biergesetzes von 1993“ (Stand 2014) siehe das Kapitel Das Reinheitsgebot contra internationale und historische Biere in diesem Buch.]
Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Gesamtentwicklung in Deutschland fast unaufhaltsam in Richtung Pils oder pilsähnliche, untergärige Biere, deren Unterschiede – abgesehen vom Preis – ein Normalverbraucher kaum nachvollziehen kann. Deutschland ist nicht das einzige Land, das von Bierlangeweile heimgesucht wurde, nur in Deutschland hielt sich diese Langeweile auf einem verhältnismäßig hohen Qualitätsniveau. Weltweit brachten anspruchslose Einheitsbiere die Revolutionäre auf die Bühne – zunächst in den USA, aber inzwischen auch, vielleicht überraschend, in Ländern wie Norwegen, Schweden, Italien und Frankreich. Diese Craft-Beer-Szene hat eines verstanden: Wenn man einen fairen Preis sowie wirtschaftlich vertretbare Margen erzielen will, muss man sein Produkt wieder interessant machen. Besonders in Nordamerika hat sich die Craft-Brew-Bewegung mit diesem Ansatz als sehr dynamisch und robust erwiesen und die internationale Führungsrolle in Bezug auf Biervielfalt, Kreativität, Sorteninnovation und mittelständische Brauunternehmensrentabilität übernommen. Die Zukunft gehört damit heute unbestritten den „Jungen Türken“ der Neuen Welt und ihren Epigonen in der Alten Welt.
Im modernen Konkurrenzkampf zwischen den Kleinen und den Großen hinkt die deutsche Brauindustrie im Vergleich zu vielen anderen Ländern nach. Während die Brauriesen aufgrund von Skaleneffekten trotz minimaler Margen pro Einheit immer größer werden, haben die kleinen und mittleren Brauunternehmen mit ihren relativ höheren Betriebskosten im Einheitsbiermarkt kaum noch wirtschaftliche Chancen, besonders, wenn sie praktisch das gleiche Sortiment von etwa einem halben Dutzend Biersorten wie die Großen anbieten und sich daher aus Verbrauchersicht kaum von diesen unterscheiden. Denn selbst die Großen bringen für die meisten Verbraucher eine akzeptable Qualität bei einem vertretbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit bleibt den Kleinen vielleicht nur noch die Biervielfalt bei hoher Qualität als Garant für die zukünftige Rentabilität, besonders, weil ein Massenausstoßkonzern auf dem Gebiet der Vielfalt einfach nicht konkurrieren kann. Für die deutschen Brauer bedeutet das ganz einfach, sich neu zu orientieren und zu überdenken, was machbar ist. Die Herausforderung für das Traditionsbierland Deutschland heißt einfach, den Anschluss an globale Entwicklungen zurückzugewinnen und sich autonom wieder neu zu profilieren. Das wiederum heißt, dem Verbraucher echte neue Geschmackserlebnisse anzubieten und schmackhaft zu machen, damit er auch bereit ist, dafür wieder einen extra Cent auf den Tisch zu legen.
Fragt man deutsche Brauer, was sie von der nordamerikanischen Bierrevolution halten, so hört man oft den Einwand: „Ich kann doch kein Stout, Porter oder extremes IPA brauen, denn so etwas trinkt doch hier keiner.“ Redet man hingegen mit deutschen Biertrinkern über ausländische Biersorten, so hört man oft: „Ich habe keine Ahnung, von welchem Bier du redest, denn so etwas braut ja hier keiner.“ Genauso war es auch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in Nordamerika, als die Einheitsbierproduzenten noch fast 100 % des Marktes unter sich aufteilen konnten. Dort waren es die Brauer und nicht die Verbraucher, die den circulus vitiosus durchbrachen und Biere herstellten, von denen sie wussten, dass „die keiner trinkt“. Der Anfang der Craft-Beer-Bewegung war damals schwer und viele Starter-Unternehmen mussten den Bankrott erklären. Auch an Spöttern mangelte es nicht. Aber mit Ausdauer, Guerilla-Marketing, Sortimentsvielfalt, und auch Qualitätsverbesserungen hat sich das Craft-Segment inzwischen zu einem nicht mehr wegzudenkenden Player im amerikanischen Biermarkt entwickelt. Wichtig ist dabei, dass kein einziger amerikanischer Craft Brewer es je versucht hat, im Bereich American [Light] Lager mit den Großbrauereien zu konkurrieren, anders als in Deutschland, wo jede mittelständische Brauerei genau wie jede Großbrauerei ein Pils anbietet. Stattdessen erzogen die Craft Brewer sich ganz allmählich ihren eigenen Verbrauchertyp, der Willens war und ist, beim Biereinkauf auch einmal etwas zu wagen und dafür einen guten Preis zu zahlen.
In Deutschland wird es noch ein langer Weg sein, bis der eingefleischte Sortenkonservatismus und das damit verbundene erstarrte Konsumverhalten des Verbrauchers überwunden ist. Jedoch scheint dieser Weg notwendig. Dazu muss der deutsche Brauer, nicht der Verbraucher, als erster den Teufelskreis durchbrechen und es wagen, wieder jenseits des bewährten Pils – und dessen Mitläufern Weißbier, Bockbier, Dunkel, Export und Leicht – innovativ und zukunftsorientiert zu brauen. Mangelndes Verbraucherinteresse allein gilt dabei nicht als Ausrede, denn Kauflust kann, wie bei vielen anderen Produkten überwältigend bewiesen, durch entsprechendes Marketing und Positioning erweckt werden. Dabei sollte es dem deutschen Brauer Hoffnung geben, dass ein Biertrinker, der sich dem Wein zuwendet, wenigstens Bewegung zeigt. Konsumverhalten, das im Fluss ist, kann mit den richtigen Produkten und Marketingmitteln bestimmt wieder zurück zum Bier geleitet werden. Was dieses Bestreben u. U. langfristig für das Reinheitsgebot bedeutet, sei dahin gestellt. Sicher ist nur, dass das, was die Urgroßväter im 19. Jahrhundert geschafft haben, als sie Deutschland zur führenden Biernation der Welt machten, auch heute noch einmal möglich sein sollte! Das hier vorliegende Buch versucht, mit seinen internationalen Rezepten aus der Gegenwart und der Vergangenheit, einen Beitrag zu diesem Neubeginn zu liefern.
Prost und Cheers.
Horst DornbuschWest Newbury, Massachusetts, USAJanuar 2014
Vorbemerkung des Autors zur dritten Auflage
Die Entwicklung beider Trends—die Konzentration der globalen Industriebraukonzerne und die Internationalisierung der Craft-Biervielfalt—hat sich selbst in den fünf Jahren seit des Erscheinens der 1. Auflage im Jahre 2014 radikal beschleunigt und hat damit die dominante Bedeutung dieser Trends nur bestätigt. Nicht nur hat die Nummer Eins der Welt mit der Nummer Zwei fusioniert, sondern die globalen Brauriesen haben sich in vielen Ländern auf eine Akquisitionsjagd nach erfolgreichen Craft-Brauereien begeben. Das beweist zwei Dinge: Viele Craft-Brauereien haben wirtschaftliches Stehvermögen und werden daher als attraktive Ankaufobjekte angesehen; und Großbrauereien mit Durchsetzungskraft im Distributionswesen wollen in allen Marktsegmenten—vom hochwertigen Boutique-Spezialbier bis zum anspruchslosen Massenbier—aktiv sein. In dem Maße, in dem die Riesen inzwischen zunehmend in allen Bierkategorien mitspielen, können sie die Auswirkung etwaiger Verschiebungen im Konsumverhalten neutralisieren, denn egal zu welchem Bier der Verbraucher nun greift, der Profit geht in die gleiche Tasche. Das Ergebnis ist eine zunehmende Zweiteilung der Brauwirtschaft in wenige globale Riesen und deren Satelliten auf der einen Seite und eine große Vielfalt von sehr kleinen, heimatverbundenen, handwerklichen Brauereien. Damit stellt sich die Frage, wie viel Platz der Biermarkt der Zukunft noch für mittelständische Brauereien haben wird, die aufgrund ihrer Geschäftsstruktur weder riesig genug noch winzig genug sind, um entweder „oben“ oder „unten“ wirtschaftlich mitspielen zu können.
Horst DornbuschJuli 2019
Vorwort von Professor Dr. Ludwig Narziß
Vor etwa drei Jahren bekam ich das Ringbuch „The Ultimate Almanac of World Beer Recipes“, a „Practical Guide for the Professional Brewer to the World’s Classic Beer Styles from A to Z“ von Horst Dornbusch in die Hand. Beim Lesen der Schilderungen über weltweit hergestellte Biertypen kam mir der Gedanke: “Dieses Buch müsste es eigentlich auch in deutscher Sprache und mit vielleicht noch etwas mehr Beispielen aus dem engeren europäischen und deutschen Markt geben”. Nunmehr liegt uns das Buch vor. Es wird sicher von allen interessierten Brauern – konventionellen, vor allem „Hobby- und „Mikrobrauern“ – mit Begeisterung gelesen werden und Pioniergeist entweder wecken oder diesen weiter fördern. Die Entwicklung der „Craft Brewers“ Szene in den USA seit den 1980er Jahren ist höchst bemerkenswert und sie fasste auch in anderen Ländern wie in Skandinavien, in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, Spanien, Italien und selbst in Russland Fuß. In Deutschland gibt es eine ermutigende Zahl dieser speziellen Biere, die entweder von Mikro- und Hobbybrauern, oder „nebenbei“ von engagierten kleineren und mittleren Brauereien gebraut werden. Selbst große Brauerei-Gruppen brauen in ihren Pilotanlagen oder in zugehörigen kleinen Brauereien Biere für diese „Schiene“. Ohne Zweifel wird die jeweilige Bierlandschaft eines Landes durch diese Produkte „belebter“ und „farbiger“.
Immer wenn ein „globaler Brauer“ über die Biere in aller Welt berichtet, kommt das Thema „Reinheitsgebot“ zur Sprache, da eben viele Biere aus dem „Weltsortiment“ nicht nach diesem hergestellt werden (können). Der Autor geht auf dieses Problem ein, ist aber in seinen Ausführungen neutral und fair. Bei näherem Hinsehen sind aber doch viele der genannten Schüttungsanteile durch Gaben aus dem Portefeuille von Malzen, Spezialmalzen – auch aus anderen Getreidearten – zu ersetzen, wie auch die breite Auswahl an Hopfen oder an Heferassen aus aller Welt zur Differenzierung beiträgt. Und es gibt auch noch die Brauerei-Technologie! Bei der Betrachtung früherer deutscher Biersorten (z. B. Kartoffelbier!) ist zu beachten, dass das Reinheitsgebot nach vorangegangenen Verfügungen, 1516 für ganz Bayern (aber auch nur für Bayern) galt. Von den anderen deutschen Staaten verfügten es das Großherzogtum Baden 1896, das Königreich Württemberg 1900 und schließlich 1906 das gesamte deutsche Reich.
In dem Kapitel „Braukulturen, Brauverfahren und Sudhauskonfigurationen“ wird ebenfalls die Geschichte des Brauens durch die Jahrhunderte lebendig. Sie unterscheidet zwischen der kontinentalen Brauweise mit Dekoktions-Verfahren und der angelsächsischen mit Infusions-Verfahren mit zum Teil unterschiedlicher Überschwänztechnik und hieraus abzuleiten, mit partienweiser Kochung von Vorderwürze und Nachgüssen. Dies ist aber nach dem Autor „kein Dogma, sondern es ist wichtig ein leckeres Bier zu brauen, statt authentisch in Schönheit zu sterben“.
Das Kapitel „historische Brauereiliteratur“ bietet einen guten Überblick, wobei Quellen in englischer Sprache, zurück bis 1669 oder in deutscher Sprache zurück bis 1573 genannt wurden. Dies ist dem mehrsprachigen Autor zu verdanken…
Die insgesamt 117 Bierbeschreibungen und Rezepte reichen von A (wie Adambier) bis Z (Zoigl-Bier), mit z. B. drei Altbiertypen, neun verschiedenen Ales, mehreren India- und Imperial-Ales, sechs Pilsener Typen, sechs Stouts, ferner Trappisten-Bieren, Weißbier, Wiess und Wit.
Alle Biere werden nach ihrer Geschichte erklärt, die Geschmacksrichtungen nebst den analytischen Merkmalen dargestellt, das Maischverfahren, ferner Würzekochung, Hopfung, Hefetyp, Gärverfahren, Reifung und Lagerung. Diese Schilderungen dürften genügen, um die Biere wunschgemäß herstellen zu können. Manches (z. B. das Maischen) ist vereinfacht um eben auch einfachen Brauerei-Einrichtungen zu entsprechen.
Herr Dornbusch hat drei Sponsoren, die auch viel zu Rezepten und Technologie beitragen: Die Firma Weyermann® mit ihrem vielfältigen Angebot an Malzen verschiedenster Typen, auch aus anderen Getreidearten, die Firma Barth mit ihrem weltweiten Hopfensortiment für normale und „Kalthopfung“, wobei beide Firmen mit ihren Pilotanlagen viele Erfahrungen sammelten. Nicht zuletzt die Firma Kaspar Schulz für Brauereianlagen, als Älteste der bestehenden Anlagenbauer, die große und kleinste Einheiten plant.
Das Buch ist für jeden Interessierten eine Fundgrube; es ist unentbehrlich für alle, die sich in der Herstellung besonderer Biere engagieren. So bleibt mir, den Autor zu beglückwünschen und allen „Unternehmern“ ein „GgG“ – Gott gebe Glück – ins Sudbuch zu schreiben.
Dr. Ludwig NarzißProfessor Emeritus, TU-München-WeihenstephanFreisingJanuar 2014
Vorwort von Karl Schiffner
Die Bierwelt scheint in einer Aufbruchsstimmung zu sein, bei der ständige Veränderung der einzelnen Rezepte ebenso auf der Tagesordnung stehen, wie die vielen neuen Bierstile, die sich weltweit in einem schier grenzenlos wirkenden Wachstumsstadium befinden. Zu dieser Entwicklung hat schon die Herausgabe des „The Ultimate Almanac of World Beer Recipes“ von Horst Dornbusch sicher seinen Beitrag geleistet. Wird man heute gefragt, wie viele Bierstile weltweit angeboten werden, so ist es unmöglich, eine exakte Zahl zu nennen, da sich dieser Prozess nun auch auf die deutschsprachigen Länder ausgebreitet hat.
Sich in diesem Dschungel der Biersorten und Stile zurechtzufinden fällt sogar denjenigen schwer, die sich täglich mit der Materie auseinandersetzen. Als praktizierender Gastronom und Biersommelier habe ich das Glück, täglich meiner liebsten Freizeitbeschäftigung nachzugehen und immer neue Kombinationen mit dem genussreichen Getränk Bier zu entdecken.
Dieses Buch wird vielen Bierbegeisterten eine große Hilfe sein, einerseits eine gewisse Ordnung zu finden, andererseits als Fundgrube für neue Entwicklungen im Bierbereich zu dienen. Da das Sichbeschäftigen mit Bier nicht beim Brauer bzw. Erzeuger endet, sondern dort erst seinen Weg mit unterschiedlichsten Verwendungsmöglichkeiten startet, sehe ich es als Herausforderung, gewisse Bierstilentwicklungen einzufordern und auf der anderen Seite trotzdem Tradition zu bewahren.
Bier kann so einfach sein und ist trotzdem so vielseitig. Kein anderes Getränk bietet einen solchen Farbenreichtum. Die Stärke von alkoholfrei bis weit über 25 % Alkohol ist ebenso einzigartig. Dazu kommt noch, dass der Aromenreichtum mit allen Grundgeschmacksrichtungen von süß, sauer, salzig und bitter unendliche Variationen des Geschmacks eröffnet.
Wenn man sich dann noch vorstellt, dass jeder unterschiedliche Bierstil sein eigenes Glas benötigt, um die bestmöglichen Eigenschaften für die geschmackliche Wahrnehmung zu erlangen und vom Einlagern bis hin zur perfekten Zelebration des Einschenkrituals bei verschiedensten Anlässen auch noch differenzierte Temperaturen abverlangt, wird einem der Reichtum, den uns unser liebstes Getränk bietet erst bewusst.
Dieses Buch mit seinen akribischen Ausarbeitungen, Rückblenden und Visionen wird dazu beitragen, dass der Stellenwert des Bieres in der Genusswelt der Menschen einen Rang in der ersten Reihe innehat.
Karl SchiffnerBiersommelier WeltmeisterInhaber, Biergasthaus SchiffnerAigen-Schlägl, ÖsterreichJanuar 2014
Dank
Die ich rief die Geister, werd‘ ich nun nicht los.Der ZauberlehrlingJohann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Had We But World Enough, and Time.To His Coy MistressAndrew Marvell, (1621–16 August 1678)
No man is an island.Meditation XVIIJohn Donne (1572–1631)
Ein Buch wie das hier vorliegende ist niemals das Produkt nur einer einzigen Person. Genau wie sich eine Gesellschaft organisch entwickelt, indem die gegenwärtige Generation immer auf den Schultern aller Vorgängergenerationen steht, so lernt ein Autor von den Werken anderer, die vor ihm kamen. Die hunderte – vielleicht tausende – von gedruckten Abhandlungen, die mich bewusst oder unbewusst geformt haben und letztlich dazu geführt haben, dieses Buch zu schreiben und in der hier vorliegenden Gestalt dem Fachverlag Hans Carl zu übergeben, sind zu viele, um sie hier aufzulisten. Auch lernt ein Autor von den Anregungen und Einflüssen der Menschen in seinem Umfeld. Von diesen Personen möchte ich einige besonders erwähnen, denn ohne deren Vertrauen in meine Arbeit wäre dieses Buch nie entstanden.
Die ursprüngliche Idee einer internationalen Bierrezeptsammlung kam mir vor mindestens zwei Jahrzehnten. Irgendeiner, so dachte ich damals, sollte doch irgendwann solch ein Buch verfassen und wenn sich niemand an das Projekt herantraut, vielleicht sollte ich es wagen? Aber wie es oft im Leben geht, man kratzt eben erst dort, wo es juckt und schiebt die großen, strategischen Aufgaben gerne auf die lange Bank. Trotzdem erwähnte ich hin und wieder meine ambitiöse Buchidee gegenüber Freunden. Zu meinem Erstaunen erhielt ich meistens Ermunterung, besonders nachdem ich bereits viele Fachartikel und Bücher über Bier veröffentlicht hatte. Unter den frühen und besonders enthusiastischen Befürwortern meiner Idee waren Sabine Weyermann und Thomas Kraus-Weyermann, die seit Jahren im Dienste ihrer Malzfabrik die Welt bereisen und sich daher wie kaum jemand anderer in Deutschland mit internationalen Biersorten auskennen.
So schlug ich schließlich vor, dass ich solch ein Buch auf Englisch schreiben könnte, sofern es gelingt, ein Sponsoren-Konsortium zusammenzuschmieden. Von da war es nur ein kleiner Schritt, bis ich mich auf der Drinktec in München im September 2009 zu einem Treffen mit Sabine Weyermann, Thomas Kraus-Weyermann, Johannes Schulz-Hess von Kaspar-Schulz, der ältesten Braumaschinenfabrik der Welt, sowie Stephan Barth und Dr. Christina Schönberger vom weltweit bekannten Barth-Haas Hopfenunternehmen zusammenfand. Dort wurde das Projekt geboren, ein Buch mit internationalen Bierrezepten auf Englisch herauszubringen. Daraus wurde dann ein Jahr später The Ultimate Alamanc of World Beer Recipes. Ich danke diesen Sponsoren für ihre Begeisterung für das englische Projekt! Die Arbeit an jenem Buch legte auch den Grundstein für meine weiteren Forschungen über aktuelle internationale wie auch lange verschollene deutsche Biersorten sowie über deren Zutaten, Brauverfahren und historische Hintergründe.
Eine Kopie des englischen Buches fiel bald in die Hände meines Freundes Michael Schmitt, dem Geschäftsführer des Fachverlags Hans Carl GmbH, der sofort den Wunsch anmeldete, ein ähnliches, speziell auf deutsche Brauer abgestimmtes Buch auf Deutsch zu veröffentlichen. Da Michael es gewohnt ist, mit Koryphäen der Branche zu verkehren, war es für mich eine große Ehre, gefragt zu werden. Aber gleich groß war auch die mit diesem Anliegen verbundene Aufgabe! Ich zauderte, denn ein solches Buch verschlingt wahnsinnig viel Zeit und ich hatte eigentlich vor, erst einmal eine Schreibpause einzulegen. Aber am Ende gab ich doch nach.
Meinem Freund Dr.-Ing. Roland Folz, dem damaligen Leiter der Abteilung Brewing & Beverage Science and Applications der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) e.V. bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, da er trotz seiner gewaltigen Lehr-, Vortrags- und Reisebelastung Zeit fand, einen Teil der Rezepte in Manuskriptform durchzulesen und mir aufschlussreiche Anmerkungen, Korrekturen und Anregungen zukommen ließ. Seine Hinweise waren oft rezeptübergreifend und haben mir geholfen, einige faux pas zu vermeiden. Roland, ich stehe in deiner Schuld!
Schließlich geht ein besonderes Dankeschön an meine Frau Elva, die wieder einmal mit ansehen musste, wie ich für einige Monate in meine Höhle (mein Büro) „verschwand“ und mich auf einen weiteren einsamen Schreibmarathon konzentrierte. Ich danke dir für deine Geduld, Elva, und hoffe, dass sich deine Unterstützung in kosmischer Gerechtigkeit bald ausgleichen wird.
Biersorten sind schwankende Gestalten!
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!Faust, Der Tragödie erster Teil, ZueignungJohann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Wir wissen alle, was Bier ist: Bier ist vergorener Getreideextrakt – im Gegensatz zu Wein, welcher vergorener Fruchtsaft ist, und zu Met, welcher vergorener Honig ist. Archäologen sind davon überzeugt, dass die ersten alkoholischen Getränke der Menschheit eine Mischung aus Bier, Wein und Met waren. Einer der handfestesten Beweise dafür stammt aus Ausgrabungen in Gordion, in der Nähe von Ankara, im zentralanatolischen Plateau der Türkei. Dort entdeckten Forscher der University of Pennsylvania im Jahre 1957 die Grabkammer des phrygischen Königs Midas, der in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. regierte. Unter den kostbaren Grabbeigaben befanden sich stattliche 157 Trinkgefäße, deren Rückstände inzwischen mit hochmoderner Infrarotspektrometrie und Gaschromatographie-Massenspektrometrie eindeutig als eine Mischung aus Kalziumoxalat (ein Bierrückstand), Tartarsäure (ein Weinrückstand) und Bienenwachs (ein Honigrückstand) identifiziert worden sind. Siehe dazu besonders Patrick E. McGovern, Uncorking the Past (Berkeley, Los Angeles, London 2009), S. 131-135.
Es wird heute allgemein angenommen, dass unsere Zivilisation in der Jungsteinzeit vor etwa 10000 bis 12000 Jahren im Fruchtbaren Halbmond Vorderasiens in Gang kam. Dort wurden die Menschen zum ersten Mal sesshaft und verschrieben sich dem Ackerbau und der Viehzucht. In Folge dieser so genannten Neolithischen Revolution lernten die Menschen bald, wie man Keramikgefäße herstellt, Gedanken schriftlich niederlegt, sich beruflich spezialisiert, sich politisch und sozial organisiert – und eben auch, wie man Bier und andere alkoholische Getränke braut. Diese Entwicklungen markierten das Ende der Urgeschichte und den Beginn der modernen Menschheitsgeschichte.
Seit dieser Revolution haben die Menschen überall auf der ganzen Welt immer wieder Wege gefunden, aus Getreide alkoholische Getränke zu zaubern. Dabei benutzten sie natürlich immer alle vergärbaren Rohstoffe, die sie zufällig in ihrer Umgebung fanden. So hatte jedes Bier, um einen Begriff aus der Weinsprache zu nehmen, sein Terroir. Es spielte also keine Rolle, welches Getreide den Rohstoff lieferte – ob nun Dinkel, Einkorn, Emmer, Gerste, Hafer, Hirse, Mais, Quinoa, Reis, Roggen, Sorghum oder Weizen. Auch war es irrelevant, ob das Getreide roh verarbeitet wurde oder ob es vor dem Brauen erst einmal gemälzt oder gebacken wurde. Das heißt, dass selbst chinesischer Reis-„Wein“ oder japanischer Sake „Biere“ sind, da diese Getränke aus Reis hergestellt und mit Schimmelpilzen (statt mit Hefen) vergoren werden.
Zusätzlich haben die Brauer während der gesamten, langen Geschichte des Bieres alle möglichen Zutaten zur Geschmacksverfeinerung oder Haltbarkeitsverlängerung ihrer Produkte verwendet. Wir wissen zum Beispiel, dass Biere gelegentlich mit Alraune, Baumrinde, Beifuß, Blaubeeren, Bohnen, Cranberries, Datteln, Erdbeeren, Feigen, Granatäpfeln, Heidekraut, Holunder, Hühnerblut, Ingwer, Kartoffeln, Kirschen, Koriander, Kümmel, Kürbis, Melasse, Minze, Myrte, Nüssen, Orangenschalen, Oxengalle, Palmfrüchten, Passionsfrucht, Pilzen (harmlosen und giftigen), Schafgarbe, Schilf, Süßholz, Wacholder oder Zimt gemischt bzw. gewürzt wurden. Der heute universell benutzte Hopfen ist in diesem Zusammenhang ein ausgesprochener Nachkömmling, da Hopfenbiere auf dem europäischen Kontinent erst im 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung anfingen, die alten Gruitbiere (Kräuterbiere, siehe Gruitbier) zu verdrängen. Auf den britischen Inseln setzte sich der Hopfen sogar noch später durch, denn erst im 15. Jahrhundert brachten flämische Einwanderer den Hopfenanbau nach Kent. Danach fand das neue Biergewürz nur langsam und zögernd Akzeptanz in der Zubereitung von Ales.
Die breite Definition von Bier als vergorener Getreideextrakt mit Geschmacksanreicherungen hat sich bis heute trotz beachtlicher brauwissenschaftlicher und brautechnologischer Errungenschaften weltweit gehalten. Dabei sind die Permutationen der Zutaten und der Brauverfahren natürlich unendlich, was automatisch die Frage aufwirft, welche Kriterien nun ein „Bier“ von einer „Biersorte“ unterscheidet. Selbst von professionellen Brauern erhält man dazu selten zweimal die gleiche Antwort. Zum Beispiel gibt es gravierende Meinungsverschiedenheiten unter Fachleuten über die mathematischen Eckdaten vieler, wenn nicht der meisten Biersorten. So zitiert vielleicht der eine Experte einen höheren Bitterwert für eine Sorte; ein anderer einen höheren Stammwürzewert und ein dritter besteht auf seine eigenwillige Meinung über die sortenspezifisch korrekte Hopfenwahl oder die optimale Komposition der Malzschüttung. Der eine schwört auf die Notwendigkeit für eine Dreifachdekoktion, wohingegen ein anderer glaubt, das gleiche Bier genauso gut auch mit einer simplen Infusionsmaische hinzubekommen.
Gleichfalls streitet man sich über die brautechnischen Parameter, mit denen man zum Beispiel ein Märzenbier von einem Oktoberfestbier abgrenzen kann. Ähnlich darf man sich fragen, gibt es in der heutigen experimentierfreudigen Craft-Beer-Welt eine definierbare Abgrenzung zwischen einem American Pale Ale und einem American Imperial Pale Ale? Selbst die Organisatoren der vielleicht anerkanntesten internationalen Bierwettbewerbe wie dem World Beer Cup® und dem European Beer Star revidieren beständig die Definitionen ihrer Medaillenkategorien. Dann gibt es die leidige Frage, wo denn genau die Farbgrenze zu ziehen sei, zum Beispiel zwischen einem Dunkel und einem Schwarzbier oder zwischen einem Porter und einem Stout. Bei welcher exakten Wellenlänge auf dem Spektrum geht ein goldenes Pilsner in ein bernsteinfarbenes Lager über?
Der offenbare Mangel an exakten und universell verbindlichen Biersortenkriterien mag vielleicht einige Empiristen stören, aber er liegt einfach in der Natur der Sache. Man muss bedenken, dass die meisten Biersorten über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte gewachsen sind und selbst heute noch im Fluss zu sein scheinen. Was zum Beispiel ein Engländer am Anfang des 19. Jahrhunderts unter einem India Pale Ale verstand, hat kaum noch etwas mit dem zu tun, was ein heutiger Amerikaner unter dem gleichen Begriff versteht. Selbst ein Oxymoron wie ein Dark India Pale Ale, also ein „dunkles“, „helles“ Obergäriges, existiert heute. Eine einfache Google-Suche auf dem Internet bestätigt das sofort (siehe hier unter India Dark Ale, American). Gleichfalls benutzen in Deutschland einige Brauereien zum Beispiel den Begriff Zoiglbier auf ihren Etiketten, obwohl solch ein Bier rein historisch ein helles oder dunkles, ausschließlich hausgemachtes (!) Kommunbrauerbier aus der Oberpfalz ist, welches nach sehr unterschiedlichen Rezepten mit großen Geschmacksschwankungen seit der Feudalzeit dort gebraut wird. Ist Zoiglbier nun eine Sorte oder nicht? Wenn ja, so scheint das einzige Definitionskriterium dessen Hausbrau-Terroir zu sein. Wenn nein, warum erscheint der Begriff als Klassifizierung auf einem kommerziellen Bieretikett? Schließlich darf man fragen: Gilt ein in der Oberpfalz heimgebrautes Stout auch als ein Zoiglbier? Wo sind die Grenzen? Siehe zu diesem Thema auch die Sortenbeschreibungen in den Rezepten für Kellerbier, Zoiglbier und Zwickelbier.
Diese Beispiele zeigen, dass eine Diskussion über Sorten und deren Definitionskriterien nie ganz objektiv sein kann. Wir können Mathematik verwenden, um bestimmte Parameterintervalle festzulegen. Wir können brautechnische Verfahren spezifizieren. Im Endeffekt bleibt jedoch immer noch ein großer Spielraum für subjektive, kreative Entropie. Deshalb ist es auch unmöglich, genau festzulegen, wie viele Biersorten es gibt. Viel hängt davon ab, wie detailliert man die Kategorien unterteilt. Ist zum Beispiel ein Weizeneisbock eine separate Sorte oder nur eine Untergruppe einer breiteren Klassifizierung von Weißbier, von Bockbier oder von Eisbock? Ist ein Bier bereits eine Sorte, wenn es ganz neu ist, oder muss es sich erst einmal bewährt haben? Sind ganz verrückte Biere mit Trauben, Feigen, Datteln, Zitrusfrüchten oder gar Tabak (ja, die gibt es!) neue Sorten oder nur ulkige Experimente? Besonders eklatant wird diese Frage bei den tausenden von Pilsner-Interpretationen, die es heute auf der Welt gibt. Ist ein Pilsner noch ein Pilsner, wenn es mit viel Reis oder Mais gebraut wird oder mit hartem Wasser und fast ohne Hopfen? Ist ein Pilsner ein Pilsner, wenn es sich American Imperial Pilsner nennt und 60 BE auf die Waage bringt, die aus dem pampelmusigen Cascade-Hopfen stammen? Oder was machen wir mit einem „Belgian IPA“? Für diese jüngst entwickelte „Sorte“ gibt es kaum verbindliche Richtlinien. Im Grunde qualifiziert sich jedes belgische Bier – ob Dubbel, Oud Bruin oder Golden Strong Ale (siehe alle dort) – als Belgian PA, solange es sich durch eine Unmenge von amerikanischem Hopfen von den anderen Belgiern absetzt. Dann gibt es heute die belgische „Sorte“ Champagnerbier, auch als Bière de champagne oder Bière brut bekannt. Das ist ein beliebiges „normales“ Bier, welches vor dem Abfüllen wie Champagner nach der méthode champenoise behandelt wird, mit einer prise de mousse für die Flaschennachgärung, der regelmäßigen remuage im Flaschenregal, dem dégorgement der Ablagerung aus dem eingefrorenen Flaschenhals, gefolgt von einer dosage aus Zuckersirup und natürlich der Abfüllung mit Korken und Drahtkäfig nach echter Champagner-Art. Aber kann man ein Bier, das eigentlich nur über seine Produktionsmethode statt über seine Zutaten und seinen Geschmack definiert ist, als „Sorte“ bezeichnen?
Dann stellt sich das Problem der Sortenüberlappung. Zum Beispiel entwickelte sich in England im 18. Jahrhundert zum Teil aus dem Old Ale (siehe dort) die Sorte Porter. Als einige Brauereien anfingen aus dem neuen Porter ein Starkbier zu machen, nannten sie es „stout“ Porter (also „korpulentes“ oder „stämmiges“ Porter), woraus sich schließlich das Stout als separate Sorte im Bewusstsein der Gesellschaft verankerte, aber wo liegt die Grenze? Sind das London Porter und das Baltic Porter zwei eigenständige Sorten oder sind sie nur Variationen über das Thema Porter? Diese Definitionsschwierigkeit kommt auch beim Irish Stout zutage, welches ein typisches Beispiel eines Bieres ist, das im Laufe seiner Geschichte eine spektakuläre Metamorphose von einem Starkbier zu einem Leichtbier durchgemacht hat (siehe dazu Stout, Irish). Dem englischen Mild Ale (siehe dort) ging es praktisch genauso, als es sich von einem Starkbier zu einem Leichtbier entwickelte. Ähnlich ist es schwierig, eine allgemein akzeptierte Grenze zwischen einem Brown und einem Dark Ale zu finden (siehe Brown Ale und Dark Ale). Wo liegt die Schwelle, jenseits welcher ein Wiener Lager (siehe dort) besser als Münchener Märzen (siehe Oktoberfestbier) bezeichnet wird? Kann der Entstehungsort allein ausschlaggebend für die unterschiedliche Klassifizierung sein? Als weiteres Beispiel der Definitionsentropie von Biersorten nehme man den Begriff „Trappistenbier“. Diese Biere werden von einem Klosterkartell hergestellt, zu dem unter anderem die Marken Chimay, Orval, Westmalle und Westvleteren gehören. Aber diese „echten“ Trappistenbiere aus den Klosterbrauereien unterscheiden sich oft in wichtigen Parametern stärker voneinander, als dass sie sich von den vielen säkularen Bieren unterscheiden, die aus rechtlichen Gründen nur als Abteienbiere vermarktet werden dürfen.
Die Markenmacher helfen ebenfalls nicht dabei, diese Definitionsschwierigkeiten zu überwinden. Ganz im Gegenteil: Sie sind oft Teil des Problems. Was die Marketing- und Reklameleute heute manchmal auf ihre Etiketten schreiben, dient nicht unbedingt als Hinweis darauf, was sich tatsächlich im Gebinde befindet. So gibt es amerikanische Craft Brewer, die ein „Altbier“ mit Cascade-Hopfen brauen, ein „Oktoberfestbier“ mit Ale-Hefe vergären, oder ein „Bayerisches Dunkel“ mit britischem Black Patent Röstmalz herstellen. Dann gibt es die leidige Spielerei mit dem Wort „Light“, wobei es einer Großbrauerei in den USA sogar gelungen ist, ein Bier mit 6 % Volumenalkohol als „Light“ zu vermarkten! Stilistisch falsche Etikettierungen, ob nun beabsichtigt oder nicht, sind nicht ungewöhnlich. In einigen Regionen ist Verschleierung sogar ein gesetzlicher Imperativ. So muss zum Beispiel im amerikanischen Bundesstaat Texas jedes Bier mit einem hohen Alkoholgehalt als „Ale“ – also als obergäriges Bier – auf dem Etikett ausgewiesen werden, selbst wenn es ein deutsches, untergäriges Bock- oder Doppelbockbier ist.
Die Alternative zu diesen unbefriedigenden Definitionskriterien liegt nicht in der größeren mathematischen Präzision der technischen Sortenvariablen, sondern in der Destillation der Kerneigenschaften einer Sorte unter Einbeziehung ihrer brautechnischen, soziologischen, historischen, kulinarischen und künstlerisch-ästhetischen Eigenschaften. Die historischen Wurzeln einer Sorte sind dabei genauso wichtig wie die Spezifizierung ihrer Bitter- oder Farbwerte. Es gehört also auch (aber nicht ausschließlich) zur Definition einer Sorte, wo sie entwickelt wurde und in welcher Epoche. Eine Biersorte ist wie ein Familienstammbaum mit tiefen Wurzeln. Sie hat einen wahrnehmbaren, aber nicht immer geraden Stamm mit vielen Verzweigungen und Verästelungen. Das heißt, ein Bier wird erst zur Sorte, wenn es langlebig ist. Es muss von mehreren Generationen von Brauern gemeistert werden, vorzugsweise in mehr als nur einer Brauerei.
Auf keinen Fall sollte eine Diskussion über Sortenkriterien in Dogmatismus ausarten, denn Biersorten sind schwankende, schlüpfrige, amorphe Wesen, die viele Formen annehmen können. Im Reich der Biersorten, bzw. „Beer Styles“, wie man heute sagt, herrscht also weder Diktatur noch Anarchie. Vielmehr gibt es bei Biersorten, genau wie in der Thermodynamik, eine gute Portion Entropie. In einer lebendigen, dynamischen Bierkultur herrscht weder die totale Ordnung einer statischen Gesellschaft noch die totale Freiheit des Wilden Westens. Stattdessen können und sollen sich Freiheit und Ordnung, wie in allen anderen sozialen Bereichen, die Balance halten, denn Bierbrauen ist nicht nur eine Herausforderung an Wissenschaftler und Ingenieure, sondern auch ein Stück Kunst und kulinarisches Brauchtum – ein komplexes Amalgam aus Technologie, Rohstoffen, Spezifikationen, Terroir, Geschichte, Handwerk und Genie. Die in diesem Buch vorgeführten Rezepte zeigen an vielen Beispielen, wie die weite Welt heute braut und auch, wie sie früher einmal gebraut hat. Die hier angebotenen Brauanleitungen sind daher mehr als Anregungen denn als feste Fahrpläne gedacht. Sie sind nicht nur eine Einladung zum Nachahmen, sondern auch Inspiration zur kreativen Innovation.
Das Reinheitsgebot contra internationale und historische Biere
Nicht, was lebendig, kraftvoll sich verkündigt,Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganzGemeine ist’s, das ewig Gestrige,Was immer war und immer wiederkehrt,Und morgen gilt, weil’s heute hat gegolten!WallensteinFriedrich von Schiller (1788–1805)
Dreifach ist der Schritt der Zeit:Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,Ewig still steht die Vergangenheit.Sprüche des KonfuziusFriedrich von Schiller (1788–1805)
In einem Buch über internationale (und einige historische) Bierrezepte für deutsche Brauer ist es fast unmöglich, der Frage der Konformität der hier vorgestellten Rezepte mit den Vorschriften des Reinheitsgebotes auszuweichen, denn in Deutschland, wo das Reinheitsgebot zum Zeitpunkt der ersten Drucklegung dieses Buches (Stand Februar 2014) in der Form des „vorläufigen Biergesetzes von 1993“ regiert, hat Bier eine wesentlich engere Definition als irgendwo anders auf der Welt oder irgendwann vor der modernen Zeit. In Deutschland darf sich ein Getränk nur Bier nennen, wenn es ausschließlich aus Wasser, gemälzter (!) Gerste, Hopfen und Hefe hergestellt wird, wobei in allen Bundesländern, mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg, einige untergärige Biere zusätzlich auch eine begrenzte Anzahl von anderen Kohlehydraten wie Zuckercouleur oder Invertzucker beinhalten dürfen. Dabei muss ein Bier, das sich Weizen- bzw. Weißbier nennt, immer obergärig vergoren werden und aus mindestens 50 % Weizenmalz bestehen. Untergärige Weißbiere sind damit aus brautechnisch und historisch unerfindlichen Gründen in Deutschland verboten. Auch verstößt der Gebrauch von ungemälzter Getreiderohfrucht gegen das Gesetz. Letztlich sind bakterienvergorene Biere wie Berliner Weiße und Leipziger Gose nur als Ausnahmen erlaubt. Selbst das Hopfenstopfen war bis vor kurzem in Deutschland ein umstrittener Punkt, der erst 2012 durch klarstellende Verlautbarungen einiger Brauerverbände offiziell legitimiert wurde. Aus deutscher Perspektive braut daher der Rest der Welt viele Biere, welche nach dem Biergesetz von 1993 gar nicht als solche anerkannt werden dürfen. Das gleiche gilt auch für die meisten Biere, die die Menschheit selbst in deutschen Landen von der Urzeit bis ins 16. Jahrhundert gebraut hat.
Dabei ist zu bemerken, dass das auf jedem Etikett zitierte „Deutsche Reinheitsgebot von 1516“ ein ausgesprochener Anachronismus ist! Zunächst war die fürstliche Verordnung keine deutsche, sondern eine rein bayerische Angelegenheit. Das Wort „Reinheit“ kommt darin nicht vor. Auch fehlen die Wörter „Malz“ und „Hefe“, wie auch jeder Bezug auf den Unterschied zwischen untergärigen und obergärigen Bieren. Jedoch sind alle diese damals fehlenden Faktoren heute zentrale Pfeiler in der Zutatenregelung des gegenwärtigen Reinheitsgebots „von 1516“! Es ist bemerkenswert, dass von den 315 Wörtern des Originaltextes von 1516 sich nur 31 Wörter (also 9,85 %) auf Bierzutaten beziehen. Der Rest der Verordnung von 1516 behandelt Bierrichtpreise und die Bestrafung für Vergehen gegen die Preisverordnung. Im Laufe der Jahrhunderte hieß das „vorläufige Biergesetz“ übrigens „Surrogatsverbot“ oder auch „Substitutionsverbot“. Es bekam seinen heutigen Namen erst am 4. März 1918, als der bayerische Landtagsabgeordnete Hans Rauch, der hauptberuflich in Weihenstephan unterrichtete, den Begriff „Reinheitsgebot“ in einer Biersteuerdebatte zum ersten Mal prägte (siehe Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des bayer. Landtages 1917/18, Stenogr. Berichte, Bd. 18, Seiten 162, 164; wie auch Professor Dr. Erich Stahleder, „Bayerische Bier-Acta: Fünfhundert Jahre Reinheitsgebot“, in Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens e.V., Berlin 1985, S. 28–53).
Man kann als unvoreingenommener Beobachter zwei ganz unterschiedliche Bewertungen – eine innerdeutsche und eine internationale – des heutigen Reinheitsgebotes feststellen. In Deutschland ist der dominante Ansatz der Brauer, aber auch der Verbraucher, dass die Zutatenrestriktionen des Gebotes nicht nur ein „reines“ Bier garantieren, sondern auch eine Herausforderung an die Brauer darstellen: Ein deutscher Brauer muss mit einer geringen Anzahl von Zutaten eine große Biervielfalt herstellen. Daher ist deutsches Brauen mutmaßlich die haute ecole der Braukunst überhaupt und die hoch trainierten Brauingenieure der deutschen Universitäten sorgen dafür, dass diese Perfektion auch auf ewig bestehen wird! Wenn dem jedoch wirklich so wäre, dass nämlich der deutsche Brauer a priori die besten Biere der Welt herstellt, so muss man sich fragen, warum denn diese Kostbarkeiten in so großem Ausmaße über Aktionspreise veräußert werden? Warum ist der deutsche Kunde so ein Billigbierkonsument, der nicht bereit ist, auch nur einen einzigen extra Cent für das „beste Bier“ der Welt auszugeben? In der normalen Umgangssprache sind doch Spitzenqualität und Billigware keine Synonyme, sondern Antonyme!
Eine andere Einstellung zum deutschen Reinheitsgebot findet man oft bei Brauern jenseits der deutschen Grenzen. Aus der internationalen Perspektive ist die heutige deutsche Zusatzstoffzulassungsverordnung weniger ein Garant der Qualität als eine Eingrenzung der Innovation, ein Dämpfer der Experimentierfreude und eine Zwangsjacke für die Kreativität. Das deutsche Bier bietet damit kaum Biervielfalt, sondern nur Markenvielfalt. Das Einheitspils, welches in Deutschland mehr als 50 % Marktanteil hat, ist schlechthin die Ausgeburt der Bierlangeweile, zwar auf einem technisch hohen Niveau, aber eben doch der Langeweile, was viele Beobachter der deutschen Brauwirtschaft als Hauptgrund für den Schwund der Margen und Marktanteile ansehen. Deutsches Bier ist eben nicht mehr interessant.
Dem kann man entgegenhalten, dass deutsche Brauer ihre Biere selbst innerhalb der gegenwärtigen Formulierung des Reinheitsgebotes wieder interessant machen könnten. Es gibt keinen Grund, weshalb man nicht zum Beispiel eine Variante eines Stouts, Porters, IPAs, Brown Ales oder Irish Red (siehe Rezepte für diese Biere) Reinheitsgebots-konform brauen könnte, um den Verbraucher anzusprechen, zu überraschen und auch zu fordern. Objektiv kann sich daher kein Brauer ungeschoren hinter dem Reinheitsgebot als Ausrede für den Mangel an Innovation, Risikobereitschaft und echtem Marketing verschanzen! Die Langeweile ist also kein rechtlicher Zwang, sondern eine soziale Norm, sowohl von Seiten der Brauer als auch der Verbraucher. Zugegebenermaßen ist es wesentlich schwieriger, wenn nicht unmöglich, dem Reinheitsgebot bei Bieren zu genügen, die Bakterienvergärung, Reifung in gebrauchten Fässern, Rohfrüchte in der Maischeschüttung oder Kandiszucker in der Würze vorschreiben, sofern man nicht bereit ist, darauf zu verzichten, diese Biere als „Bier“ zu vermarkten.
Der vielleicht interessanteste Unterschied zwischen Deutschland und den meisten anderen Bierkulturen der Welt (und den Bierkulturen der Vergangenheit) ist die Tatsache, dass trotz der vielen Alkoholgesetze, Verordnungen und Bestimmungen – meistens mit der Besteuerung von Bier verbunden – Bier außerhalb Deutschlands eher als Nahrungsmittel gilt, dessen Zusammensetzung Sache des Brauers statt des Gesetzesgebers und der Aufsichtsbehörden ist, solange die Zutaten nicht gesundheitsschädlich sind. Dieser Unterschied ist umso bemerkenswerter wenn man bedenkt, dass in Deutschland Bier als „flüssiges Brot“ angesehen wird, wobei es würzige Roggenbrote mit und ohne Kümmel, schlichte Weißbrote und Semmeln aus Weizen, Mehrkornbrote mit und ohne Sonnenblumenkerne und sogar Brotarten wie Stuten und Stollen gibt, die den Gaumen mit Angelika, Zitronat, Rosinen, Nüssen und Früchten schmeicheln. Jedoch ist eine „Verflüssigung“ dieser deutschen Brotvielfalt in eine vergleichbare deutsche Biervielfalt vom Gesetzgeber strikt untersagt.
Aus diesen Überlegungen wird klar, dass im Ausland, besonders in den USA und in Belgien, Biervielfalt auf einem Verständnis von Braufreiheit beruht, welches man in Deutschland nicht antrifft. Die Frage, ob es denn „erlaubt“ sei, ein bestimmtes Bier zu brauen, kommt den Brauern außerhalb Deutschlands einfach nicht in den Sinn. Ein Craft Brewer hat keine Bedenken, mit allen möglichen „flüssigen Broten“ zu experimentieren, wie allein das heute so beliebte, würzige, saisonale Pumpkin Ale – also eine alkoholische „Verflüssigung“ der klassischen amerikanischen Thanksgiving-Kürbistorte – beweist (siehe Pumpkin Ale). Wie der Text der amerikanischen Nationalhymne besagt, „in the land of the free and the home of the brave“ ist Bierfreiheit einfach selbstverständlich – und das trotz der anal-retentiven Exzesse vieler religiöser Fanatiker, die dem Land damals zwischen 1919 und 1933 die totale Prohibition beschert haben!
Das Original der bayerischen Verordnung von 1516
Dieses Buch ist keine Polemik für oder gegen das deutsche Reinheitsgebot, jedoch ist es unvermeidlich, dass ein Werk mit Brauanleitungen für Weltbiersorten der Gegenwart und der Vergangenheit darauf verweisen muss, dass viele der hier vorgestellten Rezepte gegen das heutige Reinheitsgebot verstoßen. Dieses Buch wurde primär für deutsche Bierfachleute verfasst, die aus verschiedenen Gründen selten mit ausländischen Braukulturen und Brauverfahren in Berührung kommen, die aber dennoch neugierig sind, wie sich die Bierszenen jenseits der deutschen Grenzen und ganz besonders in den rasanten Bierwachstumsmärkten der Welt gestalten. Ein Blick über den Zaun mit offenem Gemüt und frei von Vorurteilen – und auch in die historische Vor-Reinheitsgebot-Vergangenheit des deutschen Bieres! – kann einem in der deutschen Brautradition ausgebildeten Brauer viele Überraschungen bringen und interessante Anregungen eröffnen.
Braukulturen, Brauverfahren und Sudhauskonfigurationen
Omnes Viae Ducunt Romam[Alle Wege führen nach Rom]Römisches Sprichwort
Wir wissen, dass die Menschheit bereits seit der Steinzeit Bier braut, aber es ist ein großes Rätsel, wie wir vom Getreide auf das Malz, vom Malz auf die Würze und von der Würze aufs Bier kamen. Die Getreidemaischen der Antike beruhten nach unserem Wissen meistens auf halb gebackenen Fladenbroten oder zwiebackähnlichen getrockneten Broten, die eingeweicht wurden, wobei Getreideenzyme aktiviert wurden. Die Gärung geschah dann spontan mit den Mikroorganismen, die als schlummernde Zellen in den Brauutensilien hausten, in den Spelzen des Getreides sich versteckten oder sich als Sporen opportunistisch in der Luft aufhielten, wo sie auf ihre nächste Nahrung und Fortpflanzungsmöglichkeit warteten. Die antiken Brauer hatten irgendwie gelernt, die richtigen Methoden anzuwenden, um ans gewünschte Ziel zu gelangen. Sie haben ganz offensichtlich solange improvisiert, bis es funktionierte und dann einfach das wiederholt, was sie aus ihrer Erfahrung gelernt hatten.
Dass überhaupt so früh schon Bier gebraut wurde, ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die biochemischen Prozesse, die in einer Maische ablaufen, von den Wissenschaftlern erst in der ganz jüngsten Neuzeit erschlossen wurden. So entdeckte zum Beispiel der britische Chemiker Cornelius O’Sullivan (1841–1907) erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Arbeitsweise der Enzyme, die Getreidestärke in vergärbaren Zucker umwandeln. O’Sullivan war seit 1866 bei der Bass Brauerei angestellt, wo es ihm in den Jahren 1872 bis 1876 zum ersten Mal gelang, zu entschlüsseln, wie Amylase unter dem Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit unvergärbare Stärke in vergärbare Maltose als Reaktionsprodukt abbaut. Es ist erstaunlich, dass das, was O’Sullivan endlich wissenschaftlich belegen konnte, Brauer mindestens eintausend Jahre vorher bereits intuitiv verstanden haben, denn wir wissen aus den frühen schriftlichen Überlieferungen der Benediktiner Mönche, dass sie spätestens im 9. Jahrhundert bereits eine Form des Maischens praktizierten, die wir selbst heute noch als solche erkennen würden.
Ein römisches Gewerbegebäude in Großprüfening bei Regensburg
Der genaue Zeitpunkt des Übergangs von der Brotmaische zur Malzmaische ist schwer zu fixieren. Archäologen haben jedoch in Bayern einen umstrittenen Hinweis entdeckt, der vermuten lässt, dass bereits seit dem Anfang unserer Zeitrechnung echt gemaischt wurde. Der Beweis ist ein römisches Gewerbegebäude aus der Zeit des Kaisers Mark Aurel, welches am Donauufer, im Westen von Regensburg, im Stadtteil Großprüfening ausgegraben wurde.
Dieses Modell des Klosters Sankt Gallen basiert auf einem Architekturgrundriss, der vermutlich zwischen 819 und 837 entworfen wurde und der drei Brauereien zeigt, deren Funktionen mit Vermerken identifiziert wurden — wie zum Beispiel: ”ubi … cervisa preparatur” (wo … Cervisa-Bier hergestellt wird); “domus conficiendae celiae” (etwa: Brauhaus), „hic celia colatur“ (hier wird das Celia-Bier gepflegt), „hic fratribus conficiatur cervisa“ (hier wird das Cervisa-Bier für die Brüder bereitet“, sowie “hic refrigerator cervisa” (hier wird das Cervisa-Bier gekühlt
Dieses Gebäude war offenbar eine komplette Mälzerei und Brauerei. Es datiert aus dem Jahr 179 v. Chr., ist etwa 80 m x 60 m groß und war Teil eines römischen Kastells. Wenn die Interpretation dieses Fundes als römische Brauerei korrekt ist, stellt diese Installation die älteste uns bekannte „moderne“ Brauerei der Welt dar. Das wiederum bedeutet, dass die technologische Innovation der Malzmaische viel früher aufkam als bisher allgemein angenommen. Nach der bisher geläufigen Interpretation wurde unser modernes Maischen von Benediktinermönchen während der Blüte des frühmittelalterlichen monastischen Brauens entwickelt. Siehe zu diesem Thema auch den Artikel von Dr. Andreas Boos, „Eine Brauerei aus der Römischen Kaiserzeit in Regensburg-Großprüfening“, im Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens, Institut für Gärungsgewerbe, Berlin 2010.
„Modernes“ Maischen im Mittelalter
Unabhängig davon, wann und wo zum ersten Mal mit Malz statt mit Brot oder Getreiderohfrucht eingemaischt wurde, ist das gemeinsame Ziel aller Maischverfahren natürlich die enzymatische Lösung der Getreidekomponenten, so dass diese Bestandteile der Würze werden; und die Würze schließlich von der Hefe in Bier umgewandelt wird. Etwa um die Zeit Kaiser Karls des Großen war das moderne Maischen auf jeden Fall weitgehend bekannt. So erfahren wir zum Beispiel aus dem Nachlass der Benediktiner des Klosters Sankt Gallen in der heutigen Schweiz, welches um 590 gegründet wurde und um etwa 800 bereits eine der bedeutendsten kaiserlichen Abteien Europas war, dass dieses Kloster drei separate Brauereien hatte. Diese sind klar auf einem uns erhaltenen, vermutlich zwischen 819 und 837 entworfenen Architekturgrundriss des dortigen Klosterbezirks skizziert. Dieser Klosterplan ist 112 cm x 77, 5 cm groß und besteht aus fünf zusammengenähten Pergamentsegmenten. Er zeigt ungefähr vierzig Gebäudekomplexe – einschließlich Klosterkirche, Unterkünften für Gastmönche, Dormitorien, Speisesaal, Krankenbereich, Wirtschaftsbauten, Handwerksbetrieben, Küchen und eben Back- und Brauhäusern. Es ist nicht sicher, ob das Kloster jemals genau nach diesem Plan gebaut wurde, denn das Kloster Sankt Gallen ging im Jahre 937 in einem von Klosterschülern entfachten Feuer in Flammen auf. Allerdings darf man annehmen, dass der Plan eine typische Klosterkonfiguration aus jener Zeit darstellt, denn es ist nicht plausibel, dass ein Architekt Brauereien auf einem Klosterplan skizzieren würde, wenn diese nicht im Klosterbetrieb einer frühmittelalterlichen Mönchsgemeinschaft die Norm gewesen wären.
In diesen Brauereien wurde das starke celia – wohl ein Vorderwürzebier – aus Gerstenmalz oder Weizenmalz oder aus beiden gebraut, welches nur für den Abt und seinen inneren Kreis reserviert war. Ein Durchschnittsbier war offenbar das Cervisa, ein milchig-saures Kräuterbier (siehe Gruitbier), das überwiegend oder ganz aus Hafer gebraut und manchmal mit Honig verstärkt wurde, in welchem Fall es Cervisa Mellita genannt wurde. Cervisa war das Alltagsbier der Mönche und Pilger, von dem jeder Mönch – nach Abschaffung der spartanischen Mönchskostregeln durch Kaiser Ludwig dem Deutschen im Jahre 854 – etwa 5 Liter pro Tag zugeteilt bekam. Schließlich produzierten die Mönche in Sankt Gallen noch ein Dünnbier, conventus genannt, welches aus den Nachgüssen der anderen Biere hergestellt und dann oft mit Haferbier verschnitten wurde. Dieses Bier war für die Laienarbeiter der Abtei und für Bettler bestimmt.
Brauen war eine wichtige Aktivität in Sankt Gallen. Wir wissen, dass im Jahr 895 etwa 100 Mönche, 200 Leibeigene und eine noch größere Anzahl von Klosterschülern die umliegenden Hafer- und Gerstenfelder bestellten und mit dem Bierbrauen beschäftigt waren. Auch wissen wir aus verschiedenen Abteidokumenten, einschließlich der von mehreren Äbten um die Jahrtausendwende verfassten Geschichte Sankt Gallens, Casus Sancti Galli, dass die Abtei eine Tenne besaß, in der die Mönche ihr Braugetreide aufbewahrten, droschen und keimten, bevor sie das so entstandene Grünmalz in einer Darre trockneten, die ihre Wärmequelle mit der Beheizung eines der Sudhäuser teilte. Das fertige Malz wurde dann in einem wassergetriebenen Mörser und Stößel zerkleinert. Jede Sudpfanne diente gleichzeitig als Maischebottich und Kochkessel. In jenen Zeiten wurde die Maische in vielen Sudhäusern noch in (oft hölzernen) Sudpfannen mit heißen Steinen aufgeheizt. Die Sudpfannen in Sankt Gallen standen stattdessen über Öfen, von denen sie direkt beheizt wurden. Die Mönche „läuterten“ die Maische, indem sie die Würze mit Eimern aus den Maischebottichen schöpften und dann über gepresstes Stroh in flache, hölzerne Gärbottiche filtrierten. Die Gärbottiche waren ausgehöhlte Baumstämme und befanden sich in Kühlräumen neben den Sudhäusern. Offenbar kannten die Mönche damals schon die Vorteile, etwas bereits gärendes Bier (mit aktiver Hefe) einem frisch angesetzten Sud beizugeben, um die Gärung anzukurbeln.
Herttel Pyrpreu, ein fränkischer Bierbrauer aus dem Jahre 1403
In dieser Beschreibung liegt der Grundstein der uns gut bekannten mittelalterlichen, monastischen Braumethode, die ganz offensichtlich eine Art Kochmaischverfahren war und die wir auch aus der ältesten Darstellung eines fränkischen Bierbrauers aus dem Jahre 1425 kennen. Diese Darstellung stammt aus den Hausbüchern der Nürnberger Zwölfbrüderstiftung und zeigt einen Bierbrauer namens Herttel Pyrpreu (alt-deutsch für Brauer) – der zwar wie ein Mönch gekleidet erscheint, allerdings keiner war! Der Pyrpreu rührt mit einem langen Stab die Maische in einer Sudpfanne in einer gemauerten Feuerstelle. Diese Braumethode, die wir klar als Kochmaische identifizieren können, hat sich seitdem in Zentraleuropa in mehr oder weniger abgewandelter Form bis heute erhalten! Während in heutigen, modernen Dekoktionsverfahren nur Teilmaischen gekocht werden, wurde offenbar in den alten Zeiten die Gesamtmaische in einem einzigen Bottich nach dem Einmaischen langsam bis zum Kochen aufgeheizt.
Ganz anderes verlief die Entwicklung auf den britischen Inseln. Dort wurden im frühen Mittelalter zwar unter dem Einfluss der Mönche ähnliche Braumethoden praktiziert wie auf dem Kontinent, indem auch dort die Maische in einem Gefäß gekocht wurde. Jedoch setzte sich, wie uns einige historische Quellen vermitteln, bereits im 14. Jahrhundert in Britannien allmählich eine alternative Sudhausmethode durch, in der Maisch- und Kochvorgänge getrennt wurden. Die wichtigste Innovation bestand darin, dass das Einmaischen (der Schüttung; ohne Kochen) und das Kochen (nur der Würze; nicht der Maische!) in zwei unterschiedlichen Gefäßen stattfand. In dieser neuen Sudhauskonfiguration war der Maischebottich oft aus Holz gefertigt, während die Sudpfanne aus Kupfer bestand. Daher kommt der noch heute gebräuchliche britische Name für eine Sudpfanne: „copper“. Die Amerikaner nennen dieses Gefäß einen „brew kettle“.
Die im Jahre 1340 gegründete Brauerei des Queen’s College in Oxford war eine der frühen, fortschrittlichen Brauereien jener Art auf den britischen Inseln. Dort existierte nachweislich spätestens im 16. Jahrhundert eine Zwei-Gefäß-Sudhauskonfiguration mit Maischebottich und Copper. In dieser Brauerei wurde die aus dem Maischebottich ablaufende Würze mittels einer Handpumpe aus Blei und Holz in die Sudpfanne gepumpt. Auch hatte diese Brauerei einen „surface cooler“ (einen „Oberflächenkühler“), d. h. ein Kühlschiff, in welches die gekochte Würze über eine hölzerne Rinne hineinfloss und wo sie mehrere Stunden verblieb. Dieses Sudhausverfahren des Queens College ist ein klarer Vorläufer des heute noch typischen, britischen Infusionsverfahrens, in dem im Läuterbottich eingemaischt wird und die Würze — und nicht mehr die Maische — im Copper gekocht wird.
Zwei idealtypische Sudhauskonfigurationen
Die Brauverfahren, die sich seit jener Zeit in Europa technologisch entwickelt haben, werden zum Teil von diesen unterschiedlichen Herkünften in der „britischen“ und „kontinentalen“ Bierkultur geprägt. Beim Nachbrauen internationaler Bierrezepte ist es daher nützlich, die Unterschiede der Braumethoden, aus denen diese Rezepte hervorgegangen sind, sowie deren Anforderungen an die Gerätekonfiguration im Sudhaus zu verstehen. Obwohl moderne Brauanlagen, besonders in den höchstmodernen, vollautomatischen Edelstahlsudhäusern der Großbrauereien auf der ganzen Welt einheitlich nach internationalen, wissenschaftlichen Effizienzmaßstäben gebaut werden, findet man besonders bei kleineren Gasthaus- und Craft-Brauereien noch Spuren der traditionellen Unterscheidung zwischen einer Sudhauskonfiguration mit einem Maische-Läuterbottich einerseits und einer Maische-Sudpfanne andererseits. Eine ideale, kosmopolitische Konfiguration, mit der man praktisch alle in diesem Buch vorgestellten Rezepte ohne Schwierigkeiten verarbeiten könnte, wäre eine Anzahl von beheizbaren Gefäßen mit jeweils nur einer Funktion fürs Einmaischen, Maische- bzw. Cerealienkochen, Abläutern, Würzepuffern, Würzekochen und Whirlpooling.
Ob man im Läuterbottich oder in der Sudpfanne einmaischt, ob man die Maische bzw. Cerealien und auch die Würze kocht, oder ob man nur die Würze, aber nicht die Maische kocht, hat fundamentale Konsequenzen nicht nur für die Konstruktion des Sudhauses, sondern auch für das Verständnis der Rezepte in diesem Buch. Es ist zum Beispiel schwierig, eine klassische Brauanleitung für ein historisches britisches Ale für eine Brauerei zu entwerfen, in der es nicht möglich ist, im Läuterbottich einzumaischen und wo eine Überschwänzvorrichtung (ein „sparge ring“ oder „sparge arm“) im Maischebottich oder eine Beheizung des Bottichs für eine Mehrstufeninfusion fehlt. „Sparging“ ist eines der kritischen Elemente des britischen Sudhausverfahrens, welches für das Verständnis der englisch-amerikanischen Braumethode absolut entscheidend ist. Die wörtliche Übersetzung von „to sparge“ ist bespritzen, besprühen, besprengen. Dabei geht es darum, soviel Zucker wie möglich aus der meist dicken Maische herauszuwaschen, ohne dabei zu viele herbe Tannine aus den Getreidespelzen zu extrahieren.
Maischen in einem spätmittelalterlichen Sudhaus
Die Sparging-Überschwänzmethode wurde offenbar in ihrer heutigen Form in Schottland im frühen 19. Jahrhundert entwickelt. Die erste Beschreibung von Sparging in der Brauliteratur finden wir in der dritten Ausgabe von 1847 des ursprünglich 1837 in Edinburgh erschienenen Werkes von W.H. Roberts, The Scottish Ale Brewer and Practical Maltster. In den folgenden Jahren kam Sparging auf den britischen Inseln praktisch universell zum Einsatz. Der „sparge ring“ oder „sparge arm“ im Läuterbottich besteht dabei einfach aus einem perforierten Metallrohr, aus welchem das heiße Schwänzwasser in den Bottich gesprenkelt werden kann, ohne die Treber aufzurühren. Dazu benutzt der Brauer etwa anderthalbmal so viel Wasser zum „Sparging“ als zum Maischen. Während britische Sudhäuser mit Sparge-Vorrichtungen ideal für britische Ales konzipiert sind, ist es im Umkehrschluss schwierig für solche Brauereien, in denen eine Kesselmaische nicht möglich ist, eine klassische Brauanleitung für ein historisches kontinentaleuropäisches Lager wie ein Dunkel oder ein Doppelbock zu entwerfen. Einige Sudhauskonfigurationen sind eben grundsätzlich besser für Ale-Dickmaischen als für Lager-Dünnmaischen geeignet. Das heißt jedoch nicht, dass man kein Ale in einem Lager-Sudhaus herstellen kann, oder umgekehrt. Nur verlangt das in der Praxis für einige Rezepte ein wenig Improvisation und Einfallsreichtum. Die wichtigsten Unterschiede im Ergebnis sind dabei wohl die Würze- und Bierparameter, die am stärksten von der Maischeviskosität beeinflusst werden. Eine dieser Variablen ist die Effizienz der Beta-Glucanase, die in einer Dickmaische Endosperm-Zellwände weniger effektiv sprengen kann als in einer Dünnmaische. Das ist einer der Gründe, weshalb die Extrakteffizienz britischer Brausysteme oft unter der kontinental-europäischer Systeme liegt. Auch hat eine aus einer Dickmaische abgeläuterte Würze aufgrund des langen „Sparging“ oft einen angehobenen Gehalt an Tanninen und einen höheren pH-Wert. Andererseits behaupten viele Befürworter des britischen Maischverfahrens, dass Dickmaischen ein „malzigeres“ Bier produzieren als Dünnmaischen, was bestimmt nur bedingt gültig ist.
Alte Anleitung zum Bierbrauen
Bei einer britisch-amerikanischen Infusionsmaische bleibt nach dem Einmaischen eine etwa 5 cm tiefe Brauwasserschicht über der dicken Maische stehen. Bei „Jodnormal“ geschieht dann das normale Kreislaufpumpen bis die Würze blank ist. Danach erfolgt parallel (!) das „Lautering” und das „Sparging”, also das gleichzeitige Abläutern und Überschwänzen, wobei das Brauwasser etwa 82 °C bis 85 °C heiß ist. Dabei steigt die Maischetemperatur ohne zusätzliche Rast ganz allmählich (vielleicht über 90 min) bis auf maximal 78 °C. Die Temperatur des Überschwänzwassers richtet sich dabei nach dem Gefälle zwischen der Rasttemperatur und der gewünschten Abmaischtemperatur. Die den deutschen Brauern so geläufige Zuckerrast bei 72 °C entfällt bei diesem Verfahren. Stattdessen wird diese Funktion der Dextrose-Produktion der Alpha-Amylase zum Teil durch die langsam ansteigende Temperatur der Gesamtmaische gesichert. Sobald die Abmaischtemperatur erreicht ist, wird die Temperatur des Schwänzwassers gedrosselt, um ein Überhitzen der Maische zu verhindern. Eine Dampfummantelung des Maischebottichs hilft oft ebenfalls, die Temperatur der Maische zu steuern.
Bei einem solchen Infusionsverfahren hängt die gewählte Einmaischtemperatur von den jeweiligen Brauzielen und den verwendeten Rohstoffen ab. Gibt man dieser Maische im Mehrstufenverfahren zum Beispiel eine Eiweißrast, wird die Maische zum Temperaturanstieg auf die Beta-Verzuckerungsrast mit einer heißen Brauwasserinfusion verdünnt, ohne dass bereits abgeläutert wird. Das Ziel dieser Dickmaischmethode ist es, die Treber während der Rast(en) ungestört unter der Wasserschicht zu halten und die Abmaischtemperatur mittels (!) des Schwänzwassers – also nicht bereits vor dem Beginn des Abläuterns sondern durch das Abläutern – zu erzielen. Dabei wird die Würze mit der größten Dichte im Treber allmählich durch Würze mit einer immer geringeren Dichte bis hin zum Glattwasser ersetzt. Der „run-off“ des Glattwassers wird unterbrochen sobald die gewünschte Stammwürze in der Pfanne erreicht ist oder sobald die Pfanne voll ist. In der Praxis ist es selten, dass ein Brauer die Dichte des Glattwassers unter 3 % bis 2 % sinken lässt.
Zusammenfassend gibt es daher idealtypisch drei verschiedene Methoden, das Wasser auf britische oder kontinentale Manier durch die Maische zu schicken:
(1) Bei der alt-englischen Methode, die besonders beim Parti-Gyle-Brauen von Old Ales (siehe dort) angewandt wurde, wird die Maische ungekocht beim ersten Durchgang ohne „Sparging“ praktisch vollkommen abgeläutert. Die so gewonnene Würze produziert ein starkes Hauptgussbier. Danach wird die Maische wieder mit Brauwasser gemischt und nochmal ganz abgeläutert. Dieses Nachschwänzen produziert eine dünnere Würze, die entweder mit der Hauptwürze in der Sudpfanne gemischt oder in ein separates Bier verarbeitet wird, wobei ein solches wesentlich dünneres Nachgussbier oft als „small beer“ bezeichnet wird. Je nach dem Verhältnis von Wasser zur Schüttung in den beiden Güssen kann man sogar noch einen dritten Guss nachschieben, aus dem man dann aber kaum mehr als Glattwasser extrahieren kann, woraus nur ein sehr bescheidenes Dünnbier herstellbar ist.
(2) Im Gegensatz dazu gibt es besonders auf dem europäischen Kontinent eine traditionelle Methode, wonach die Maische von vornherein mit vielleicht bis zu 80 % des Ausschlagwürzevolumens mit Brauwasser versorgt wird und diese recht dünne Maische, nachdem sie sich abgesetzt hat, einmal abgeläutert wird. Dabei sind die Nachgussvolumen relativ gering. Im englischen Sprachgebrauch nennt man diese Methode oft „batch sparging“. Diese Methode wird typischerweise verwendet, wenn in der Pfanne eingemaischt wird (selbst ohne Maischekochen) und die Maische dann in den Läuterbottich umgepumpt wird.