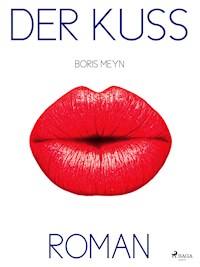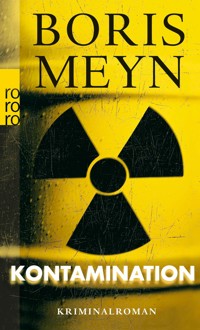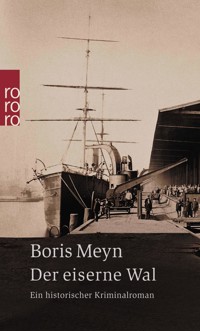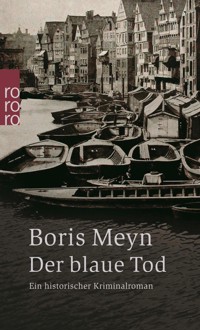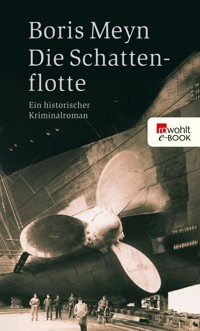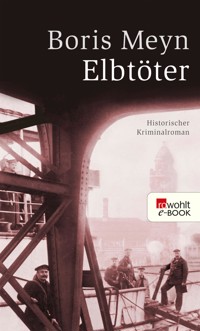7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Kunstwerk verschwindet, eine Leiche taucht auf. Und bei einer wird es nicht bleiben. Aber ist die erotische Zeichnung von Modigliani wirklich so wertvoll, dass mehrere Menschen dafür sterben müssen? Wer außer der jungen Kunsthistorikerin Grit jagt eigentlich noch hinter der Mappe mit den nackten Tatsachen her? Was haben Schweizer Banken und Museen in Amerika mit der Sache zu tun? Und ist es wirklich nur Dankbarkeit, was Grit gegenüber dem Taxifahrer Zart empfindet, der sie kundig durch die Villenviertel und Schmuddelecken von Hamburg kutschiert? Ein raffinierter Hamburg-Krimi mit nicht nur einem doppelten Boden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Boris Meyn
Die Bilderjäger
Kriminalroman
Über dieses Buch
Ein Kunstwerk verschwindet, eine Leiche taucht auf.
Und bei einer wird es nicht bleiben. Aber ist die erotische Zeichnung von Modigliani wirklich so wertvoll, dass mehrere Menschen dafür sterben müssen? Wer außer der jungen Kunsthistorikerin Grit jagt eigentlich noch hinter der Mappe mit den nackten Tatsachen her? Was haben Schweizer Banken und Museen in Amerika mit der Sache zu tun? Und ist es wirklich nur Dankbarkeit, was Grit gegenüber dem Taxifahrer Zart empfindet, der sie kundig durch die Villenviertel und Schmuddelecken von Hamburg kutschiert?
Ein raffinierter Hamburg-Krimi mit nicht nur einem doppelten Boden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2011
Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther
Umschlagabbildung masterfile
ISBN 978-3-644-45261-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Eltern
Paris 1917
Natürlich hatte Zborowski seine Frau auf den Blättern erkannt, was den Kunsthändler vielleicht überrascht, keineswegs aber geniert oder gar geärgert hatte. Schließlich war es ihre Entscheidung, und wie es aussah, würde niemand außer ihm selbst davon erfahren. Nicht einmal Berthe war es aufgefallen, obwohl er das anfangs vermutet hatte, denn eigentlich hatte sie für so etwas ein gutes Auge. Aber so ungezwungen, wie sie den ganzen Abend Anna gegenüber aufgetreten war, konnte sie es unmöglich wissen. Eigentlich war es auch völlig gleich. Dennoch, zugetraut hätte er das Anna nicht. Selbst heute Abend hatte sie so unnahbar und distinguiert gewirkt wie immer. Auch als sie gemeinsam vor den Bildern standen, hatte sie sich nichts anmerken lassen. Der amüsierte Blick, mit dem sie ihn aus dem Augenwinkel streifte – hatte sie sehen wollen, ob er vielleicht die Fassung verlöre angesichts ihres kühnen Vorstoßes, die Toleranzgrenzen ihrer Ehe auszuloten? Hatte sie sich seinem begabten Schützling angeboten, oder war sie dessen Überredungskünsten erlegen? Natürlich kannte er ihre Sehnsüchte nur zu gut. Jedes Mal, wenn sie eines seiner Gedichte las, deren Zeilen nicht zu veröffentlichen waren, erkannte er, wie schwer es ihr fallen musste, ihr Verlangen und ihre Gier zu zügeln. Es war wohl diese Atmosphäre in seinem Atelier, die sie zu einem solchen Schritt veranlasst haben mochte.
Zornig hingegen machte ihn der beflissene Eifer, mit dem man die Blätter konfisziert hatte. Diese lüsternen Blicke, diese heuchlerische Moral, mit der man darüber hergefallen war. Er kannte einige der kunstrichternden Philister als Gäste von Lokalen, die auch er selbst gerne besuchte. Verbotene Institutionen waren es, deren Existenz abgestritten, deren Besuch bei Entdeckung mit Ausschließung aus der Gesellschaft, wenn nicht mit Zuchthaus bestraft wurde.
Ein gellender Schrei hatte genügt, um die ruhige und intime Stimmung im Salon zu beenden. Ein Höllenspektakel brach los; nach wenigen Minuten konnte man zwischen Freund und Feind nicht mehr unterscheiden. Nachdem die erste Leinwand abgehängt worden war, riss man sich die Bilder gegenseitig aus der Hand, und es war in dem Gewirr nicht zu erkennen, wer sie der Beschlagnahmung zuführen und wer sie den selbst ernannten Hütern von Sitte und Moral wieder entreißen und sich als Objekt der eigenen Begierde auf diesem Wege aneignen wollte. Drei oder vier der Besucher waren über Berthe, die versucht hatte, einige der Exponate in den hinteren Räumlichkeiten der Galerie in Sicherheit zu bringen, hergefallen und hatten sie zu Boden gerissen. Durch den Aufruhr in den Räumen angelockt, strömten Passanten von den umliegenden Straßen in diese dem Anschein nach sittenlose Stätte und malträtierten einige inzwischen auf dem Boden liegende, vermeintlich obszöne Werke mit den Füßen. Natürlich war es im Nachhinein betrachtet eine dumme Provokation gewesen, eines der Blätter in den Schaukasten neben der Tür zu hängen. Aber mit einer derartigen Erregung hatte doch niemand rechnen können.
Erst die schrille Pfeife des mit der Situation völlig überforderten Gendarmen hatte für Ruhe gesorgt. Unter dem Beifall der inzwischen mehrheitlich vertretenen Prüderie wurden schließlich die meisten Corpora delicti gemeinsam mit deren Schöpfer und seinen Helfern in die nahe Wache verfrachtet, und nur dem Umstand, dass sich Advokat Mercier unter den geladenen Gästen der Galerie befand und dieser noch in der gleichen Nacht bei der zuständigen Präfektur intervenierte, war es zu verdanken, dass der Künstler von einem längeren Arrest verschont blieb.
Das Tor der Gendarmerie an der Rue des Béotiens öffnete sich erst mit Anbruch des Tages wieder. Die Aufnahme der Personalien hatte man sich sparen können. Zusammen mit Chaim Soutine war er schon oft Gast in dieser Herberge gewesen – meist nur für eine Nacht und als Folge der ausschweifenden Zechgelage, an die er sich am Tage darauf nur mit Mühe erinnern konnte. In der Regel waren es seine Vertragspartner, die Kunsthändler Paul Guillaume und neuerdings eben Leopold Zborowski, die für Soutines offene Rechnungen aufkamen und ihn selbst auslösten; wiederholt legten aber auch seine Freunde unter den jungen Künstlern, Juan Gris, Pablo Picasso, André Salmon oder Cocteau, ein gutes Wort für ihn ein, zumal es meist nicht er war, der für die Schäden verantwortlich zeichnete, sondern Soutine. Schon wenige Gläser Absinthe konnten dessen gutmütiges Wesen außer Kraft setzen.
«Deine schmierigen putains behalten wir hier!» Der Gendarm grinste ihn böse an. «So eine dreckige Schweinerei. Ihr Malerpack suhlt euch im Morast, während unsere Soldaten in den Schützengräben sterben.»
Er antwortete nicht. Die Nacht in der kargen Zelle hatte ihm bereits genug zugesetzt. Jetzt noch ein sinnloser Streit mit einem Moral schwitzenden Sittenhüter in Uniform? Nein, das war zu viel. Leopold und Berthe würden sich um alles Weitere kümmern. Als er auf die Straße trat, stellte er sich vor, wie sich die neue Inquisition, die hier durch zwei kleine Gendarmen und deren Gehilfen repräsentiert wurde, an der gemalten Nacktheit des Fleisches ergötzte – wie sie schmutzige Witze rissen und mit gierigen Fingern über Brüste und Schamhaare fuhren, die allein von einer dünnen Schicht Firnis bedeckt waren.
Als sein Blick auf Sacré-Cœur de Montmartre fiel, deren frommes weißes Antlitz von den ersten Sonnenstrahlen des Tages erfasst wurde, erinnerte er sich einer spitzen Sottise Soutines und musste lachen. Wie hatte Chaim ihre Türme genannt? «Les Sceptres lubriques de Montmartre»! Recht hatte er. Ein so phallisches Bauwerk passte einfach zu diesem Viertel.
Seine Wohnung, die kaum mehr als ein großes Atelierzimmer war, lag keine fünf Minuten von hier entfernt. Wenn er auf einen Stuhl stieg, konnte er die Türme von Sacré-Cœur durch das Dachfenster sehen. Acht halbe Treppen und eine Stiege führten hinauf zu seinem Zimmer. Er schaute an sich herunter. Das abendliche Handgemenge hatte Spuren hinterlassen. Ein Ärmel war eingerissen, und auf der linken Seite klaffte ein großes Loch in seiner Jacke. Mechanisch griff er zum Türknauf, schob den Riegel beiseite und betrat sein Refugium. Eiseskälte schlug ihm entgegen.
«Bist du allein?», tönte es aus dem hinteren Winkel des Raumes.
«Ja. Warum hast du den Ofen nicht angefeuert?»
«Es waren nur noch so wenige Holzscheite da. Es tut mir so Leid, was passiert ist.»
«Ich hätte es mir denken können. Diese Banausen.» Zielstrebig ging er zu dem gusseisernen Ungetüm, das hinter der großen Staffelei in einer Nische des Raumes stand, und zog aus einer Kiste mehrere mit Zeitungspapier umwickelte Holzstücke hervor. Mit Hilfe eines Streichholzes entfachte er das Feuer. Für einen kurzen Moment betrachtete er die züngelnden Flammen, dann schloss er die Ofenklappe und wandte sich Jeanne zu, die, in mehrere Decken eingehüllt, auf dem roten Diwan ihr Lager aufgeschlagen hatte.
Er hatte nicht erwartet, sie hier anzutreffen. Natürlich, irgendwann hatte er ihr gesagt, sie sei jederzeit willkommen und seine Tür stünde ihr offen. Mehrmals schon hatte sie ihn hier im Atelier aufgesucht und ihm bei der Arbeit zugeschaut, seit sie sich Anfang des Jahres in der Académie Colarossi begegnet waren. Sie verstanden sich gut, ja, das war keine Frage. Aber warum kam sie gerade heute, nach dieser Niederlage? Stets hatte sie zu ihm aufgeschaut. Vom ersten Moment an war ihr Blick voller Bewunderung für ihn gewesen. Wie ein unschuldiger Fremdkörper war sie in der Académie aufgetaucht – jung, unerfahren und trotz ihrer anfänglich schüchternen Art mit dem brennenden Wunsch in den Augen, in die dionysische Welt des freien Kunstschaffens einzutauchen. Jetzt saß sie bis spät in die Nacht neben Malern und Schriftstellern, lauschte den Gesprächen zwischen Philosophen und Dummköpfen, Aufschneidern und Dilettanten, trank und rauchte mit ihnen und duldete als Preis die existenziellen Nöte, die dieses wundervolle Leben mit sich brachte.
Ja, er mochte Jeanne. Sie war besessen von purer Lebensfreude, mutig, kompromisslos und zugleich aufrichtig. Wenn sie bleiben wollte, sollte sie bleiben.
Nach wenigen Minuten hatte das Feuer des Ofens die kalte Luft aus dem Raum vertrieben, und wohlige Wärme breitete sich aus.
«Warum haben sie die Bilder mitgenommen?», fragte sie.
«Sie zeigen, was nicht gezeigt werden darf.»
«Das ist lächerlich!»
«Die Bilder gelten als obszön», sagte er und stellte ein großes Reißbrett auf die Staffelei. «Schamhaare dürfen nicht zu sehen sein, sagen sie!»
«Es war Anna Zborowska, die dir Modell gestanden hat, nicht wahr?»
«Ihr Körper! Nicht ihr Gesicht.» Er riss ein Blatt vom Zeichenblock ab und heftete es mit Nadeln an das Reißbrett. Dann entledigte er sich endlich seines zerrissenen Rockes, warf ihn über einen Stuhl vor dem Herd und streifte sich eine bequeme Strickjacke über.
«Ist sie Teil deines Vertrages mit Zborowski?»
«Nein», antwortete er. «Zieh dich aus!»
So nonchalant er diese ungeheuerliche Aufforderung auch über die Lippen brachte, in ihrem Gesicht zeigte sich nicht die geringste Spur von Empörung. Ganz im Gegenteil, als wenn sie auf diese Anweisung schon lange gewartet hätte, begann sie sich schweigend zu entkleiden. Er hatte sie zuvor weder nackt gesehen noch darum gebeten, dass sie ihm Modell saß.
«Weiß Zborowski, dass sie dein Modell war?»
«Wahrscheinlich. Aber er wird es dulden, solange es nicht publik wird. Er geht schließlich auch seiner Wege, und ich glaube, die sind mehr durch das Interesse an jungen Männern gekennzeichnet.»
«Liebst du sie?»
«Nein. Sie wollte gevögelt werden, und ich habe sie gemalt.» So grob sprach er sonst nicht über Frauen. Aber das Vokabular entsprach genau seinem momentanen Bedürfnis, dem Geschehen um ihn herum, ohne Rücksicht auf irgendeinen Kodex, einen Namen zu geben. Es war kein Zorn, der ihn trieb. Wenn sein Verhalten vielleicht anfänglich auch durch das Unverständnis über die Geschehnisse des letzten Abends geprägt war, so verspürte er jetzt mehr und mehr die Lust an der reinen Provokation. Wie weit würde Jeanne ihm folgen?
«Nicht gevögelt?»
«Auch.»
«Schläfst du mit allen deinen Modellen?»
Jeanne war jetzt völlig entkleidet. Sie hatte ihre Frisur gelöst, und das rotblonde Haar fiel auf ihre Schultern. Sein Blick folgte, einem Stift gleich, den Umrissen ihres Körpers. Ganz im Gegensatz zu Anna waren ihre Körperformen weich und zart proportioniert. Dafür besaß sie nicht Annas unsagbar feingliedrige Noblesse. Ihr Mund war klein und ohne die scharfen Konturen angemalter Lippen. Die rötliche Scham bildete auf der hellen Haut einen fast unnatürlich sanften Kontrast. Nur ihre Nase warf einen spitzen Schatten.
Während er sein Modell begutachtete, fixierte Jeanne ihn mit einem herausfordernden Blick.
«Nein, ich male alle, mit denen ich schlafe», antwortete er und griff zu einem Graphitstift.
«Willst du die Maja oder die Venus?» Er deutete auf das Kissen auf dem Diwan.
Aber anstatt sich niederzulegen, zog sie das Kissen energisch zu sich heran und hockte sich rittlings darauf. Ohne seinem Blick auszuweichen, legte sie die Hände auf ihre Schenkel und spreizte die Beine langsam so weit auseinander, dass ihr Geschlecht zum Zentrum jeglicher Aufmerksamkeit wurde. Als wenn diese Pose noch nicht eindeutig genug gewesen wäre, rückte sie auf dem Kissen nach vorne und schob ihre Hüften so weit vor, dass die Knie auf dem Diwan zur Ruhe kamen. Immer noch blickte sie ihm direkt in die Augen. Dann reckte sie ihren Oberkörper in die Höhe, streckte die Arme empor und verschränkte ihre Hände hinter dem Kopf. In dieser Position verharrte sie.
Ohne ein Wort zu sagen, setzte er den Stift auf das Papier.
«Willst du mich nicht?»
«Später!», antwortete er geistesabwesend. «Bleib so!»
«Liebst du Béatrice noch?»
«Im Moment nicht», antwortete er, ohne aufzublicken. Wie kam sie jetzt nur auf Béatrice? Bereits vor einem Jahr hatten sie sich getrennt, das war doch allgemein bekannt. Was Béatrice bewogen hatte, gestern überraschend in der Galerie aufzutauchen, wusste er auch nicht. Wahrscheinlich war es ihre Sucht nach Selbstdarstellung; sie nutzte jede Gelegenheit. Aber er wollte jetzt nicht an Béatrice denken. Ihr Verhältnis war ein endloser Akt der Selbstzerfleischung gewesen.
«Aber du tust es noch?», bohrte Jeanne weiter.
«Sie hätte alles darum gegeben, so gemalt zu werden wie du jetzt.» Er löste die Nadeln aus dem Reißbrett, riss einen neuen Bogen vom Block und begann erneut, der Lust seines Modells, die sich direkt vor seinen Augen öffnete, eine Form zu geben.
«Du weichst meiner Frage aus.»
«Tu ich nicht. Sie hätte es allerdings nur für sich selber getan. Mit der Absicht, die Betrachter der Bilder zu beobachten und sich mit Stolz als Modell zu offenbaren. Aber sie hätte es nicht für mich getan.»
«Woher weißt du, dass ich es nicht aus den gleichen Gründen mache?»
Zwei flüchtige Blicke voller Begehren trafen aufeinander und verweilten für einen kurzen Augenblick im Raum.
«In der Atmosphäre zwischen dir und diesem Blatt befindet sich alles, was zählt. Es kommt darauf an, die Distanz zu überwinden.»
«Wem willst du die Zeichnungen zeigen?»
«Niemandem. Es wird ein ganz privates Tagebuch.»
Hamburg Hauptbahnhof
Ein Blick in den Rückspiegel genügte, um ihm die Aussichtslosigkeit seines Vorhabens vor Augen zu führen. Vier Fahrzeuge blockierten den Rückweg. Zwei massive Poller aus poliertem Granit versperrten den seitlichen Fluchtweg, und vor der Kühlerhaube bewegte sich schon seit zwanzig Minuten überhaupt nichts mehr. Die Finger seiner linken Hand trommelten einen nervösen Rhythmus auf dem Lenkrad. «High Noon am Hauptbahnhof», murmelte er zu sich selbst und schüttelte ungläubig den Kopf. Warum um alles in der Welt hatte er diesen dämlichen Taxenstand angesteuert? Weit und breit war kein Fahrgast und, was noch viel schlimmer war, kein Schatten auszumachen. Die Sonne brannte so erbarmungslos, dass man nicht einmal das Schiebedach öffnen konnte. Von Zeit zu Zeit wedelte er sich mit der geöffneten Fahrertür ein wenig Luft zu. Sein Hemd klebte an der Rückenlehne. Es war eine von diesen unüberlegten Kurzschlusshandlungen gewesen – als Strafe schmorte er jetzt, eingekeilt zwischen einer Armada von Taxen, in der Mittagshitze und schwor sämtliche Eide, diesen Platz in Zukunft zu meiden. Er sehnte sich nach kühlendem Fahrtwind oder einem schattigen Plätzchen an der Alster. Stattdessen war er nun gezwungen, dem Fitnessprogramm schwergewichtiger Kollegen beizuwohnen. Um ihn herum war man einheitlich damit beschäftigt, klebrige Rußpartikel mit Hilfe von Haushaltstüchern gleichmäßig auf den Scheiben zu verteilen. Mit dieser Sisyphusarbeit nahm die Spezies gemeiner Kutscher den alltäglichen Kampf gegen die Langeweile am Arbeitsplatz auf. Er zählte neun Haushaltsrollen vor sich.
Entnervt schaltete er das Funkgerät aus und drehte die Rückenlehne herunter. Seine Blicke folgten dem Menschenstrom, der unaufhörlich aus der Wandelhalle des Bahnhofs quoll. In regelmäßigem Abstand stauten sich die Passanten vor der kleinen Ampel, welche zum Geschäfts- und Einkaufsviertel auf der gegenüberliegenden Straßenseite führte. Für einen kurzen Augenblick schien die Kolonne hier zu ruhen, und der Ameisenstrom verdichtete sich zu einem komplexen Gebilde. Zwei Gestalten lösten sich aus der Menge. Der zielstrebige Schritt, mit dem die beiden auf den Taxenstand zueilten, zeugte von geschäftlicher Dringlichkeit. Der Griff zum Zündschlüssel erfolgte automatisch. Aufrücken. Kurz darauf eine ältere Dame, mit dem rechten Arm einen Rollkoffer, mit dem linken einen widerspenstigen Foxterrier hinter sich herziehend. Kurz vor Erreichen des Ziels wurde sie von einem verliebt umschlungenen Pärchen überholt, welches sich nach einem innigen Kuss auf zwei Taxen verteilte. Es tat sich etwas. Noch fünf Haushaltsrollen.
Vor ihm machte man sich startklar: Nachdem die Thermoskannen verstaut waren, drückte man die Kofferraumdeckel lässig zu. Ein flüchtiger Blick zur Startlinie, dann auf das Schuhwerk. Wer sich jemals gefragt hatte, wer denn diese Sandaletten, die als Schnäppchen im Restpostenmarkt oder auf den letzten zwanzig Seiten des ADAC-Heftes angeboten wurden, überhaupt kaufte – hier bekam er die Antwort. Geschickt zog man die kleinformatige Tageszeitung aus der Sitzarretierung und vertraute sie dem letzten freien Winkel des städtischen Müllbehälters an. Ein kurzer und zurechtrückender Griff an den Bund der Hose, ein nochmals beiläufig prüfender Blick zum Bahnhof und dann, als Abschluss der Zeremonie, ein schnelles, aber dennoch bezeichnendes, knetendes Reiben der Handflächen. In aufrechter Haltung bezog man danach zwischen Wagen und geöffneter Fahrertür seinen Posten und hielt Ausschau. Den potenziellen Fahrgästen, die man am schweren Gepäck bereits auf fünfzig Meter Entfernung als solche ausgemacht hatte, stürzte man sich auf den letzten drei Metern hilfsbereit entgegen, man verstaute die Koffer und eilte dann mit hüpfendem Schritt um den Fahrgast herum, um ihm zuvorkommend die Tür seiner Wahl zu öffnen. Ein abschließender Blick auf die zurückbleibenden Kollegen, den Stolz auf eine lukrative Tour verkündend, sowie ein nochmaliges Reiben der Handflächen beendeten für gewöhnlich das Szenario.
Sooft er diese mechanischen Abläufe, die sich Tag für Tag an jedem beliebigen Taxenstand wiederholten, auch schon beobachtet hatte, die Uniformität der Gesten versetzte ihn jedes Mal erneut in Erstaunen.
Erstaunlich waren auch die Beine der jungen Frau, die sich mit einer kleinen Reisetasche und einer Handtasche auf den Taxenstand zubewegte. Nicht die Beine an sich, die, nebenbei bemerkt, sicherlich ausgesprochen schön geformt waren, erregten seine Aufmerksamkeit, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Frau trotz der hochsommerlichen Temperaturen eine Feinstrumpfhose trug. Er nahm sie deutlicher in Augenschein. Sie war noch weit von dem Alter entfernt, in dem Strumpfhosen als kosmetisch korrigierende Notwendigkeit getragen wurden. Vielleicht Mitte zwanzig? Seine Augen beobachteten sie wie durch den Sucher einer Kamera. Alles um sie herum verschwamm dabei in einer diffusen Unschärfe. Der Steckbrief der wahrgenommenen Einzelbilder setzte sich erst nach einem kurzen Augenblick zu einem körperhaften Ganzen zusammen. Eigentlich war sie eher unscheinbar: weder von besonderer Größe – so um die eins siebzig, schätzte er – noch von auffälliger Statur. Auch ihre dunkelblonden Haare, die etwas zerzaust bis über die Ohren reichten, hoben sie nicht unbedingt aus dem Meer der Passanten hervor. Sie trug das schlichte Kostüm einer jungen Geschäftsfrau. «London, siebzehn Grad, Regen», schoss es ihm in den Kopf. Der Rock endete eine Handbreit über dem Knie. Es gab eigentlich nichts, was seine besondere Aufmerksamkeit begründet hätte – nur die Strumpfhosen. Oder waren es Strümpfe?
Langsam schritt sie am Spalier der wartenden Taxen entlang und musterte die Fahrer. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke.
«Sind Sie frei?», fragte sie.
Ihre Stimme hatte er sich ganz anders vorgestellt. Eher mit dem zickigen Tonus einer aufstrebenden Jungmanagerin. Sie trug Schuhwerk, das sehr teuer aussah. «Ich bin nicht der erste Wagen», antwortete er und deutete auf die Fahrzeuge vor ihm.
«Ich möchte aber mit Ihnen fahren. Ich glaube, ich habe die freie Auswahl», entgegnete sie in höflichem Tonfall.
«Das kann aber vielleicht ein paar Minuten dauern», antwortete er und verwies auf seinen erbost blickenden Vordermann, der die schmale Gasse neben seinem Auto demonstrativ mit der geöffneten Beifahrertür versperrt hielt.
«Das macht gar nichts», sagte sie. «Ich habe es nicht besonders eilig.»
Wenn das keine Aufforderung war. Vielleicht half da ein Griff in die Trickkiste. Noch bevor sein Vordermann Gelegenheit hatte, ihm mit pöbelnder Stimme einen Vortrag über mangelnde Kollegialität und die ungeschriebenen Gesetze der Taxifahrerzunft zu halten, rief er ihm zu: «Kannst du mich bitte vorbeilassen? Die Dame möchte zur Bremer Reihe!» Angesichts dieser traurigen Heiermann-Tour klappte die Wagentür wie automatisch zu.
Sie öffnete die Tür hinter ihm, warf ihre Reisetasche auf die Rückbank und ging um das Taxi herum, um auf dem Beifahrersitz neben ihm Platz zu nehmen.
«Ziemlich schmutzig, der Bahnhof», bemerkte sie und wischte mit einem Finger über den Staub auf ihren Schuhen. «Nicht gerade eine Visitenkarte für die Stadt.»
«Sie sind sicherlich aus Münster?!»
«Wie kommen Sie darauf?», fragte sie erstaunt.
«Leute aus Münster beschweren sich immer über dreckige Bahnhöfe», sagte er und grinste sie an. Er hätte auch Bielefeld oder Erlangen sagen können. Aber tatsächlich, die kritischsten Worte über das Ambiente des Bahnhofs hatte er von Fahrgästen gehört, die sich sofort und voller Stolz mit einem Hinweis auf den sauberen heimatlichen Bahnhof – «picobello» – als aus Münster stammend geoutet hatten. Für gewöhnlich konterte er dann mit dem Witz mit den Kirchenglocken und dem Regen oder dem mit den Münsteranern und den Pferdeäpfeln, was ihm für den Rest der Fahrt das ersehnte eisige Schweigen bescherte.
«Nein, aus Schwäbisch Gmünd», entgegnete sie. «Wieso haben Sie das eben mit der Bremer Reihe gesagt?»
«Weil wir ansonsten hier gestanden hätten, bis sich die Schlange vor uns aufgelöst hat. Die Graupen stehen hier über eine Stunde und sind nicht begeistert, wenn ein Fahrgast in eine Taxe einsteigt, die sich gerade erst eingereiht hat. Aber noch weniger begeistert sind sie, wenn sie nach stundenlanger Warterei nur mal gerade um die Ecke fahren sollen.»
«Graupen?»
«Taxen ohne Funk.» Er schaltete das Funkgerät wieder ein und vernahm ein leises Knacken aus dem in der Kopfstütze versteckten Lautsprecher.
Sie klappte die Sonnenblende herunter und warf einen kontrollierenden Blick in den kleinen Spiegel. Ihr Gesichtsausdruck ließ erkennen, dass sie mit dem Zustand ihrer Frisur nicht zufrieden war. Mit skeptischem Blick pflügten ihre Finger durchs Haar. Sie hatte einen ziemlich breiten Mund und eine zierliche Nase. Augenfarbe Hellbraun. Die wenigen Sommersprossen konnte man zählen.
Der Hintermann hupte nervös und fuchtelte entnervt mit den Händen.
«Also, wo soll’s hingehen?», fragte er und ließ den Motor an.
«Moment, bitte.» Sie kramte hektisch in einer hoffnungslos überfüllten Handtasche. Endlich zog sie eine zerknickte Visitenkarte heraus. «Pension Wagner. Borsteler Chaussee.»
Der Daimler fädelte sich zügig in den um diese Tageszeit bereits zäh fließenden Verkehr ein.
«Pension Wagner», wiederholte er. «Kenn ich gar nicht.» Das Fahrziel passte überhaupt nicht zu ihrer Erscheinung. Ihrer geschäftsmäßigen Kleidung nach zu urteilen, hätte er eher ein Bürogebäude oder ein großes Hotel im Zentrum der Stadt als Ziel vermutet. Pension Wagner war vermutlich nicht mehr als ein oder zwei Gästezimmer in einem spießigen Einfamilienhaus mit Hollywoodschaukel. Er sah eine lebenslustige Witwe mit weiß gefärbter Duttfrisur und einem gleichfarbigen Pudel vor sich. Die Räume mit schwülstigen Leuchtern, Kamin, Häkeldecke und gesammelten Reiseandenken aus Capri und Ancona. Dazu eine Unmenge von unzerstörbarem Grünzeug: Gummibäume, Sukkulenten und hässliche Bürogewächse, die auf gekachelten Nierentischen vor einer gerafften Gardine ihr Dasein fristeten.
«Dauert die Fahrt länger?», unterbrach sie den Horrorfilm seiner Phantasie.
«So ungefähr zwanzig Minuten», antwortete er.
«Verdammt heiß hier», entgegnete sie und löste den Anschnallgurt, um sich ihr Jackett auszuziehen. Sie griff zwischen den Rückenlehnen hindurch nach ihrer Reisetasche und kramte umständlich darin herum. Schließlich zog sie einen Laptop hervor, legte ihn sich auf den Schoß und klappte ihn auf. Der Apple-Startton erklang. Nach einer Weile erschien die verkleinerte Fassung eines Gemäldes in Farbe auf dem Bildschirm.
«Ziemlich teures Modell», stellte er fest. In diesem Moment bemerkte er, dass ihr Rock durch die Bewegungen etwas hochgerutscht war und den Spitzensaum halterloser Strümpfe freigab.
«Verstehen Sie etwas davon?», fragte sie und schaute ihn an.
Sein Blick wanderte die wenigen Zentimeter zum Bildschirm empor und musterte das Gemälde. «Ich hab’s mal studiert», antwortete er beiläufig und widmete sich wieder dem Straßenverkehr. Natürlich hatte sie seinen Blick registriert, dessen war er sich sicher. Wenn eine Frau solche Strümpfe anzog, dann achtete sie auch darauf, ob man es bemerkte.
«Ach so», stellte sie lapidar fest. «Und selbst in der Computerbranche kriegt man heutzutage keinen Job mehr?»
«Ich hab Kunstgeschichte studiert», sagte er, ohne den Blick von der Straße zu wenden. «Ein schöner Modigliani.»
«Na, so was», antwortete sie und lächelte zum ersten Mal. «Ich bin auch Kunsthistorikerin.»
«Wo haben Sie studiert?»
«In Rom und Tübingen. Und Sie?»
«Hier.»
«Ah, ja», sagte sie.
Mit einem Studium in Rom war das natürlich nicht zu vergleichen. Wie sie aussah, hatte sie ein Graduiertenstipendium und mindestens ein «summa cum laude», vielleicht sogar einen Onkel im Vatikan vorzuweisen. Er selbst hatte die Kunstgeschichte nach Ende der Studienzeit an den Nagel gehängt. Sein Professor hatte ihm zwar die Promotion nahe gelegt, aber das hätte seinen Marktwert als Jobsuchender nur marginal gesteigert, wie ihm schnell deutlich geworden war, nachdem ihm viele seiner ehemaligen Kommilitonen von ihren Erfahrungen berichtet hatten. Stellen für Kunsthistoriker gab es eben wenige, und die wurden offenbar grundsätzlich mit Sachunkundigen besetzt.
Der Wagen hielt vor einem kleinen Einfamilienhaus mit liebevoll angelegtem Friedhofsgarten. Pension Wagner stand in schmiedeeisernen Lettern quer über die Hauswand geschrieben. «Macht sechsunddreißig vierzig. Brauchen Sie eine Quittung?»
«Ja bitte», antwortete sie und kramte erneut in ihrer Handtasche. «Ich habe morgen früh einen Termin. Würden Sie mich fahren?»
«Wohin geht die Fahrt?»
«Nach Wedel!»
«Und zu welcher Uhrzeit?», erkundigte er sich, während die Geldscheine in sein abgewetztes Portemonnaie glitten.
«Um zehn Uhr habe ich den Termin. Wie lange werden wir brauchen?»
«Sehr sympathisch», dachte er, denn bei dem Wort früh hätte er eher sechs Uhr morgens vermutet und die Tour von der Funkzentrale an einen weniger morgenmuffeligen Kollegen vermitteln lassen. Aber zehn Uhr war akzeptabel. «Ich stehe Viertel nach neun vor der Tür», antwortete er. Dann lud er die Reisetasche aus, wendete und fuhr in Richtung Alster.
Termin in Wedel
Zwei Minuten nach der verabredeten Zeit betätigte er kurz die Hupe, wie er es immer tat, damit die Fahrgäste nicht bereits vor Beginn der Fahrt den fortgeschrittenen Stand des Taxameters kommentierten. Bis auf die Bluse trug sie dieselbe Kleidung wie am Vortag. Große Variationsmöglichkeiten ließen ja schon die Maße ihrer Reisetasche nicht zu. Wahrscheinlich blieb sie nur für den einen Tag in der Stadt. Unter dem Arm trug sie eine schmale Aktentasche, die am Vortag offenbar auch in der Reisetasche Platz gefunden hatte. Die unförmige Handtasche hatte sie natürlich auch wieder dabei. Die Frisur wirkte heute ein wenig aufgeräumt.
«Guten Morgen. Warten Sie schon lange?» Ihre Stimme wirkte bereits vertraut.
«Wir fahren zwar gegen den Strom des Berufsverkehrs», antwortete er, «aber ich weiß nicht, wie pünktlich Sie sein müssen.» Er warf seine Lederjacke auf die Rückbank und ließ den Wagen an.
«Was ich gestern schon fragen wollte», hob sie an und stockte dann, als wenn ihr die Frage zu persönlich erschien.
«Ja?», ermutigte er sie.
«Warum fahren Sie Taxi? Sie sind doch gar nicht so der Typ Taxifahrer.» Erwartungsvoll blickte sie ihn an.
«Vielen Dank für das Kompliment, wenn es eins sein soll», entgegnete er. «Aber ich glaube, wenn es einen Berufsstand gibt, bei dem sich die unterschiedlichsten Charaktere zusammenfinden, dann ist es das Taxigewerbe. Vielleicht sind es die persönlichen Freiheiten, die relative Unabhängigkeit und die Tatsache, dass man die lieben Kollegen zwar ständig um sich weiß, sich aber nicht mit ihnen unterhalten muss.»
«Verdient man denn genug?»
Er lächelte. «Mehr, als die meisten denken. Aber das ist natürlich eine Frage der Ansprüche.»
«Ja, aber Sie sind doch kein Student mehr?»
«Eine Familie hab ich nicht zu ernähren, wenn Sie das meinen. Augenblicklich fühle ich mich ganz wohl in diesem Job.»
Sie wirkte nicht sehr überzeugt. Taxifahren war ja auch für ihn nicht mehr als eine bequeme Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne die persönlichen Freiheiten einbüßen zu müssen, die er von früher her gewohnt war. Aber im Moment konnte er in seinem eigentlichen Beruf nicht arbeiten. Was man von ihm verlangte und erwartete, war ihm schon seit geraumer Zeit nicht mehr möglich. Er wollte nicht mehr als Legionär der Informationsgesellschaft umherziehen. Wollte nicht mehr den gierigen Blick auf das Elend all derer ermöglichen, die ihr Leben nicht unter dem Schutzmantel existenzieller und wirtschaftlicher Sicherheiten führen konnten. Er war es leid, das Elend der Welt so aufzubereiten, dass es die Menschen in ihrem widerwärtigen Voyeurismus befriedigte. Seit zwei Jahren hatte er jeden Auftrag abgelehnt.
«Und Sie?», fragte er nicht ohne Neugier. «In welcher Branche sind Sie tätig? Kunsthandel? Versicherung?»
Sie hatte den Computer wieder auf dem Schoß aufgeklappt und verglich nun eine Fotografie, die sie aus einem Stapel von Geschäftspapieren hervorgezogen hatte, mit einer ähnlichen Abbildung auf dem Bildschirm. Die Zeichnung auf dem Foto zeigte skizzenhaft den nackten Oberkörper einer jungen Frau. Den Kopf hatte sie in den Nacken geworfen, und der Mund schien wie zum Schrei geöffnet. Der Hals war lang und kräftig. Mit den Händen umfasste sie kraftvoll ihre emporgestreckten Brüste.
«So ähnlich», antwortete sie, ohne den Blick von der Zeichnung zu wenden.
«Auch ein Modigliani?», fragte er.
Sie nickte.
Sicherlich war sie Sachverständige einer Kunstversicherung, und sie befanden sich gerade auf dem Weg zu jemandem, der diskret einen Modigliani versichern lassen wollte. Als er den Wagen nach einigen Minuten vor der angegebenen Adresse stoppte, revidierte er seine Vermutung. Das Haus war klein, unscheinbar und etwas heruntergekommen. Jemand, der einen Modigliani besaß, wohnte anders.
Sie schien ähnlich darüber zu denken. «Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind?», fragte sie und räumte ihre Unterlagen in die Mappe.
Er nickte, während er noch einmal Straße und Hausnummer verglich. Es war eines dieser schlichten Behelfsheime aus Kriegszeiten, von denen noch eine Reihe in den Hamburger Randzonen standen. Die meisten von ihnen hatten ihre ursprüngliche Gestalt durch zahlreiche Um- und Anbauten fast völlig verloren. Dieses dagegen schien seit Kriegsende unberührt, es wirkte zwischen den prachtvoll aufgemotzten Einfamilienhäusern in der Straße mehr als ärmlich. Der Garten war ungepflegt und verwildert. Auf dem hinteren Teil des Grundstücks, das mit grünem Maschendraht umzäunt war, stand ein alter Bauwagen.
Sie blickte ihn fragend an.
«Haben Sie sich irgendwie anders vorgestellt, oder?», entfuhr es ihm. Sie zögerte, auszusteigen, und er sagte: «Wenn Sie wollen, komme ich mit.»
«Das wäre schön.» Die Erleichterung über sein Angebot war ihr anzusehen.
Von weitem wirkte das Haus unbewohnt. Der Vorgarten roch in der Sonne intensiv nach Heu und Wiesenblumen. Eine Gruppe hellblauer Schmetterlinge schwebte tänzelnd durch das kniehohe Gras. Als sie dem Eingang näher kamen, wurde der Duft vom Teergeruch heißer Dachpappe überlagert. Hinter dem Klingelschild lugte ein abgerissenes Kabel hervor.
«Tomasz Wiegalt», entzifferte er den fast unleserlichen Schriftzug. «Ist der Name richtig?»
«Ja», antwortete sie einsilbig.
«Dann müssen wir uns wohl anders Gehör verschaffen», sagte er und klopfte gegen die Tür, die sich unter dem Druck seiner Faust mit leichtem Knarren öffnete.
Sie schauten sich ratlos an.
«Hallo!», rief er mit lauter Stimme. «Herr Wiegalt!?»
«Sieht nicht so aus, als wenn jemand da wäre», bemerkte sie kopfschüttelnd.
«Sie waren doch angekündigt?»
«Natürlich. Ein fester Termin», bestätigte sie. «Wir haben per E-Mail korrespondiert.»
«Per E-Mail?», fragte er entgeistert. «Die Bude hier wirkt eher so, als wenn der Kontakt zur Außenwelt noch per Mittelwelle hergestellt würde.» Beherzt drückte er die Tür ganz auf und trat ein.
«Dürfen wir das denn?» Sie folgte dicht hinter ihm.
«Ich weiß nicht», entgegnete er. Gemeinsam tauchten sie in das Dunkel des Hauses ein. Der süßlich brandige Geruch, der ihnen entgegenschlug, weckte unschöne Erinnerungen in ihm und ließ eine böse Ahnung aufsteigen. Sie betraten einen großen Raum, in dessen Mitte ein überdimensionierter Schreibtisch stand. Durch die kleinen verstaubten Fenster fiel ein zaghafter Schimmer morgendlicher Sonne, der sich mit dem Strahl der Schreibtischlampe zu einem seltsamen Zwielicht vermischte. Wer ließ denn an einem Sommertag die Schreibtischlampe an? Zwei Stühle, eine kleine Liege und mehrere Bücherregale vervollständigten die Einrichtung.
«Hallo», riefen beide wie aus einem Mund. «Ist hier jemand?» Auf dem Schreibtisch herrschte kreative Unordnung. Bücher stapelten sich übereinander.
«Wir scheinen aber richtig zu sein», sagte er und zog ein Buch aus dem Stapel. «Ein Bildband über Modigliani!»
«Ein Ausstellungskatalog», korrigierte sie. «Paris 1981. Hab ich auch.»
Er legte das Buch zurück auf den Stapel und griff nach der Kamera, die wie ein Briefbeschwerer auf einem Haufen unterschiedlicher Zettel und Formulare lag. «Ganz edles Modell», sagte er. «Eine Nikon. Allein das Objektiv ist ein kleines Vermögen wert.»
«So was lässt man doch nicht rumliegen, wenn die Tür offen steht», sagte sie, während er die Kamera behutsam auf den Tisch zurücklegte. «Wir sollten verschwinden.»
«Kein Computer weit und breit», stellte er fest. Sein Blick richtete sich auf die beiden Türen, die vom Raum abzweigten. «Mal sehen, was die bescheidene Hütte noch für Kostbarkeiten bietet. Vielleicht hängt ja doch noch irgendwo ein Modigliani herum.» Er öffnete die kleinere der beiden Türen, es war eine Abstellkammer. «Sehr übersichtlich», murmelte er und öffnete die andere Tür, ließ sie aber ebenso schnell wie die erste wieder ins Schloss fallen.
«Ach du Scheiße», sagte er und stand einen Moment lang mit offenem Mund da. Dann rannte er plötzlich wie von Furien getrieben hinaus in den Flur und drehte alle Sicherungen aus dem schwarzen Bakelitkasten neben der Eingangstür.
«Was ist los?», rief sie.
Seine Blicke suchten den Raum nach einem Telefon ab. «Sieht so aus, als wenn wir jetzt gehörig Ärger bekämen.» Er griff zum Hörer und wählte eine Nummer.
«Ich hab doch gesagt, wir können hier nicht einfach reingehen.» Mit diesen Worten öffnete sie die zweite Tür und blieb im gleichen Augenblick wie angewurzelt stehen. Ihr Unterkiefer senkte sich langsam. Zum Schrei kam es aber nicht mehr. Er hatte gerade noch genügend Zeit, sie aufzufangen.
«Hallo, hallo, so melden Sie sich doch», tönte es vom anderen Ende der Leitung. «Hier spricht die Polizei. Melden Sie sich bitte.» Er legte sie auf dem Sofa ab, schob ihr ein Kissen unter die Beine und griff zum Hörer des Telefons, der vom Schreibtisch baumelte. Die Adresse war ihm ja bekannt.
«Nein», antwortete er, nachdem er in knappen Worten die Situation geschildert hatte. «Ein Notarzt wird nicht mehr benötigt.»
Tomasz Wiegalt saß aufrecht in der Badewanne, das Gesicht der Tür zugewandt. Aus dem weit aufgerissenen Mund hing blau die Zunge. Die leblosen Hände hielten den Wannenrand fest umschlossen.
«Wohl mit ’nem Tauchsieder verwechselt», murmelte der Polizeibeamte, der den Föhn aus der Badewanne zog. Es war die Art von Humor, die den täglichen Umgang mit dem Tod erst erträglich machte.
Er hatte das Phänomen am eigenen Leibe erlebt. Schützend hielt er seinen Arm um sie gelegt und streichelte beruhigend ihre Hände. Sie zitterte noch immer am ganzen Körper, aber zumindest hatte sie wieder ein wenig Farbe bekommen.
«Nur ein kleiner Schock», erklärte er dem Polizisten auf die Frage, ob ein Arzt notwendig sei. Auch sie schüttelte verneinend den Kopf.
«Darf ich Sie dann um Ihre Personalien bitten?», begann der Beamte seine Routine.
«Grit Hoffmann.» Sie reichte ihm eine Visitenkarte.
«Ich bräuchte schon einen Ausweis», bat er freundlich.
«Bitte.» Sie nestelte das Dokument aus ihrer Handtasche.
«Margriet Hoffmann, wohnhaft in Schwäbisch Gmünd, Sartorigasse 2, geboren am 10. Juni 1968», las er laut vor und machte sich entsprechende Notizen. «Moment, das ist ja heute Ihr Einunddreißigster», entfuhr es ihm. «Herzlichen Glückwunsch», stammelte er nach einer Pause etwas verlegen.
«Ja, heute. Danke», antwortete sie und ließ den Personalausweis wieder in ihre Handtasche fallen.
«Und Sie?», fragte der Beamte zu ihm gewandt.
«Bin der Taxifahrer», antwortete er und reichte dem Polizisten automatisch seinen Ausweis. «Zart, Anselm Amedeus. Mit e, wie Modigliani.» Er war sich sicher, dass ihre Blicke ihn in diesem Moment ungläubig musterten.
«Wie, was bitte?», hakte der Beamte nach.
«Ach, schon gut», erwiderte er.
«Geboren am 11. September 1959?»
«Sieht ganz so aus, nicht?»
«Sind Sie mit dem Toten bekannt gewesen?», fragte der Beamte zu ihr gerichtet.
«Nein.» Sie schüttelte den Kopf.
«Was wollten Sie von Herrn Wiegalt?»
«Ich bin Mitarbeiterin der Firma ArtSave. Steht auf der Visitenkarte», entgegnete sie. «Herr Wiegalt hatte um einen Termin gebeten.»
«Bezüglich?», unterbrach der Polizist.
«Eines Versicherungsschadens», antwortete sie.
«Ah, Versicherungsvertreterin!» Das schien ihm etwas zu sagen. Zumindest nahm die Fragerei damit ein Ende.
«Bitte heute Nachmittag um vierzehn Uhr hier einfinden!», klang es in einem gemäßigten Befehlston. Der Polizist reichte ihnen eine Karte der zuständigen Polizeidienststelle und erhob sich. Nach einigen Schritten drehte er sich um und verharrte in einer Geste, die er sich offensichtlich von Inspector Columbo abgeschaut hatte. «Übrigens, was ich noch fragen wollte …» Tatsächlich senkte er den Kopf und stützte ihn auf den Zeigefinger der rechten Hand. «Wie sind Sie beide hier reingekommen?»
Sie schaute etwas betreten zur Seite, so, als hätte sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht.
«Die Tür war offen», half er ihr und ergriff das Wort. «Ich habe diesen komischen Geruch wahrgenommen und mir gedacht: Besser, wir schaun mal rein.»
«Ach so», antwortete der Polizeibeamte und machte zwei Feuerwehrleuten Platz, die einen großen Zinksarg durch die Haustür manövriert hatten.
«Sie haben sich Ihren Geburtstag sicherlich anders vorgestellt?», waren seine ersten Worte, nachdem sie einige Kilometer schweigend hinter sich gebracht hatten.