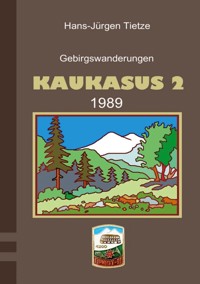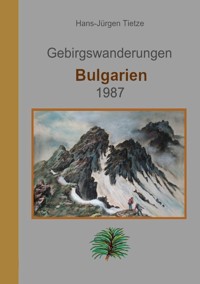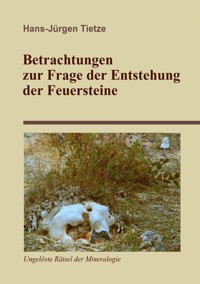Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wer sich bei Wanderungen aufmerksam durch das Gelände bewegt, trifft dann und wann auf "blaue Steine". Auffällig werden diese zuerst meist auf dem kiesigen Grund kleinerer Flüsse besonders in den Mittelgebirgen, dann aber auch auf dem Boden geschotterter Wege oder in überwachsenen Schutthalden hier und da in den Wäldern. Ursprung dieses eigentümlichen blauen Gesteins sind einstige Eisenhütten, bei denen in kleineren Hochöfen Eisen im Holzkohlenfeuer erschmolzen wurde, wo es als Schlacke anfiel. Von dort gelangten die Schlacken in den jeweils benachbarten Fluß oder See und wurden dort im Laufe der Jahrzehnte von Strömung oder Brandung gerundet ("abgerollt"). Dort können sie heute als "Sieberachat", "Bodeachat", "Marienstein", "Bergslagsten", "Leland Blue" etc. wieder gefunden und bestaunt werden. Im vorliegenden Büchlein wird versucht, hinter das Geheimnis der besonderen blauen Farbe dieser speziellen Schlacken zu kommen. Dabei stellte sich heraus, daß die Befassung mit dieser Färbung bereits eine lange Geschichte hat - ohne zu einer endgültigen Klärung zu führen. Lediglich in den als "Blue Slag" einst hergestellten und den blauen Schlacken nachempfundenen Glaswaren kennt man deren färbendes Prinzip: Kobaltblau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verlorenes liegt da in bunten Stücken und gleißend auf den Trümmern ohne Sinn. - Wie die Verheißung aus der Zeiten Anbeginn will es der Seher Blicke frisch entzücken. …
J.G.
Inhaltsverzeichnis:
Erste Begegnungen mit „den blauen Steinen“
Die Faszination der „blauen Steine“
Das historische Phänomen „Blue Slag“
Allgemeines über „die blauen Steine“, Fundstellen
Zur Natur der blauen Schlackenfarbe - erster Teil
Historische Betrachtungen und alte Eisenindustrie
Schlacke und Glas
Zur Natur der blauen Schlackenfarbe - zweiter Teil
Blaue Färbungen in Ziegelsteinen
Zur Natur der blauen Schlackenfarbe - dritter Teil
Die besondere rote Schlackenfarbe
Die Formen der blauen Schlackenstücke
Vorschläge zum Auffinden für die Ursachen der blauen Schlackenfarbe
Kleines Glossar
Stichwortverzeichnis
Bunte Schlacke mit blauen Schlieren
Erste Begegnungen mit „den blauen Steinen“
Es war bei einem erweiterten Schulausflug mit Lehrer Richter im Sommer des Jahres 1953 in Altenbrak im Harz. Wir befanden uns auf einer Wanderung. Der Tag war heiß. Während einer Rast stapften wir Schulkinder im kühlen Wasser der Bode umher, schauten uns um und betrachteten den Grund des Flüßchens - vielleicht um Fische oder Molche zu finden. Dabei stießen wir auf Kieselsteine, die eine auffällig blaue Farbe hatten, ja, die hier und da in einem richtigen „Himmelblau“ leuchteten. Das faszinierte uns, und wir begannen zu sammeln. Viele solche Steine fanden sich jedoch nicht, aber immerhin, ein paar waren es doch. Und sie blieben eine Besonderheit, denn anderswo hatten wir so etwas noch nie gefunden. Weiße, graue, gelbliche, braune, graue, schwarze „Kiesel“ waren uns bekannt. Blaue Steine (eine in der riesigen Gesteinswelt nicht sehr häufige Färbung) jedoch fielen sogleich auf und wurden gesammelt. Da störte es auch nicht, daß ein Wanderer vorbei kam und vor diesen Steinen warnte: Sie brächten Unglück, verkündete er bedrohlich.
Wir sammelten weiter. Aus dem Wasser an die Luft gebracht, verloren die blauen Steine allerdings etwas von ihrem leuchtenden Glanz und waren dann weniger faszinierend - blieben aber immer noch interessant. Die Frage aber, was das nun ist, dieses „Blau“, die konnte uns keiner beantworten - ein Rätsel.
Da wir zu dieser Zeit schon einiges über Goldsucher gelesen hatten, und wie die dann, wenn sie im Fluß ihre Körnchen gefunden hatten, auch deren Quelle zu finden trachteten - die dicke, „reiche“ Ader nämlich, wo gewissermaßen das pure Gold in mächtigen Massen „anstehen“ mußte, so vermuteten wir, daß es auch für die blauen Steine weiter oben im großen Harzgebirge „eine blaue Ader“ geben müßte, aus welcher ab und zu Stücke abbrachen und in den Fluß kullerten, wo sie dann rund geschliffen wurden und mit dem Wasser davon wanderten. Diese Sache wollten wir im Gedächtnis behalten, um bei späteren Gelegenheiten nach dieser blauen Ader zu suchen. Daß das nicht so ganz leicht war, das läßt sich gut vorstellen. Doch bei jedem Besuch im Harz wurde geschaut, ob sich wieder derartige Steine finden würden. Sie fanden sich tatsächlich - hier und da und immer wieder.
Und eines späteren Jahres wurde dann tatsächlich auch „die Ader“ entdeckt. Doch diese erwies sich nicht als diese erwartete blaue Gesteinsschicht, sondern vielmehr als eine gewissermaßen „kulturelle Ablagerung“ künstlicher Art. Darauf verwiesen auch weitere Funde, bei denen sich in solchen blauen Brocken deutliche Einschlüsse von Holzkohle und Eisenkügelchen beobachten ließen - neben allerlei anderen Einschließungen. (Abb.4, 5)
Als ein anderer Stein im Harz mit schöner Farbe erwies sich der leuchtend rote „Blutstein“ (bzw. „Blutjaspis“). Für diesen gibt es tatsächlich „Adern“ - nämlich in den Eisenerz-Pingen bei Elbingerode, wo einst zur Eisengewinnung der Hämatit gefördert wurde. Im Flußschotter scheint er eher selten zu finden sein.
Die „blauen Steine“ hingegen sind weit verbreitet - nicht nur in den Flüssen und Bächen im Harzgebirge. „Blaue Steine“ wurden hier und da auch in Wegeschottern entdeckt. Oder sie lagen als vergessene, überwucherte Haufen neben so manchem Waldweg. Wo der Regen etwas von der sie bedeckenden Erde abgewaschen hatte, wurden sie sogleich durch das bekannte blaue Leuchten auffällig. Damit war die Herkunft dieser eigentümlichen „blauen Steine“ entschlüsselt. Denn bei ihnen konnte es sich nur um Rückstände einstiger Eisenindustrien handeln. Sie waren in die Flüsse gerutscht, oder man hatte sie als Wegeschotter verwendet (Abb.3, 4)
Doch nie wurden vom Autor dieses Büchleins in der Nähe einstiger Eisenwerke („vor Ort“ also) solche blauen Schlacken „auf Halde“ gefunden. Diese Halden hatte man vermutlich alle längst abgetragen oder anderweitig verwendet. Die einzige Ausnahme hierbei bildete der Hüttenhof in der Stadt Peitz in der Lausitz, auf dem (im Jahre 1998) die blauen Steinchen rings um die alten Gießereigebäude noch reichlich zu finden waren.
Abb.1 Blaue Flußkiesel
Abb.2 Blaue Schlacken aus einem Wegeschotter
Abb.3 Blaue Schlacken im Anschnitt am Rand eines Waldweges.
Abb.4 blaue Schlacke mit Eisenkugel und Eiseneinschluß
Abb.5 Einschluß von Holzkohlestücken in blauer Schlacke
Die Faszination der „blauen Steine“
Im Übrigen war bald zu bemerken, daß diese „blauen Steine“ hier und da auch andere Leute interessierten. Wer sie erst einmal (oft unerwartet) entdeckt hat, ist fasziniert von ihren Farben. Er möchte mehr davon finden und schaut sich weiter danach um. Nur mit der Erklärung ihrer Natur und ihrer Herkunft haperte es meist.
Das Interesse an den blauen Steinen scheint einseitig zu sein: Jene, die sich dafür interessierten, konnten das Blau nicht erklären - und die, welche es vermutlich längst schon wußten und erklären konnten, interessieren sich nicht dafür.
In dem vorliegenden Büchlein soll versucht werden, ein wenig am „Geheimnis der blauen Steine“ zu kratzen. Dank Internet ist das unterdessen so sehr ein Geheimnis aber nicht mehr. Das Internet ist voll von Fundbeschreibungen verschiedenster Art - und repräsentiert damit die sympathischere Seite dieses modernen Mediums.
Während man z.B. im Jahre 1992 im Museum des einstigen Hüttenwerkes Thale/Harz noch keine Auskunft über die Natur solcher blauer Steine in der Bode geben konnte, ist unterdessen allgemein bekannt, daß es sich bei diesen auffälligen „Kieseln“ in so manchen Flußläufen und anderswo durchweg um Eisen-Schlacken handelt.
Im Harz wird heute Eisen nicht mehr produziert. Die Spuren davon aber werden in Form der „blauen Steine“ noch viele Jahrhunderte lang immer wieder Verwunderung auslösen - und vermutlich auch noch dann, wenn „das Anthropozän“ längst sein natürliches Ende gefunden hat.
Daß „die blauen Schlacken“ ein gewisses Alter haben müssen, bzw. daß sie aus einer zeitlich umgrenzten Phase der Eisengewinnung stammen, ist bekannt. Heutige Schlacken sind nicht mehr blau und werden auch nicht mehr in Flüsse geschüttet. Und bei den ganz alten Schlacken der Rennöfen kannte man auch noch keine blauen Farben. Doch nach wie vor werden blaue Schlacken gefunden.
Hervorzuheben ist dabei vor allem die Stabilität dieses „Kunstminerals“ gegenüber korrosiven Einflüssen. Irgendwo im Fluß oder vom Fluß oder sonstwo abgelagert und dann wieder aus der Erde gegraben, leuchten sie heute noch genauso wie vor hundert oder zweihundert Jahren (viel älter dürften diese besonderen Schlacken kaum sein). Und wo sie nicht vom Wasser abgeschliffen, abgerollt wurden, haben sie auch noch ganz ihre Form und ihren Glanz aus der Zeit ihrer unmittelbaren Entstehung behalten.
Solcherart könnte man diese „blauen Steine“ durchaus als „echt“ bezeichnen - auch, weil sie sich (original) offenbar nicht ganz einfach nachmachen lassen. Entsprechungen aus farbigem Glas sind als solche meist leicht zu erkennen.
An dem Streitpunkt, ob es sich bei diesen speziellen blauen Steinen nun um ein natürliches (also echtes) Mineral oder um ein künstliches Produkt handelt (was dann nicht in „die Mineralogie“ gehört), will sich der Verfasser nicht beteiligen. Die vielleicht doch noch kommenden Jahrtausende werden erweisen, ob spätere Finder auf derartige Systematisierungen Wert legen.
Ob man „den blauen Steinen“ eine besondere Heilwirkung zuschreiben kann, hängt vermutlich von einer entsprechenden Glaubensbereitschaft ab. Es kann angenommen werden, daß eine Be