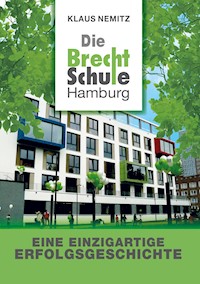
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Brecht-Schule in Hamburg hat eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie verläuft vom Nachhilfeunterricht von Heinz Brecht mit einzelnen Schüler*innen in seiner Küche in Eimsbüttel bis zu einer großen und attraktiven Schule mit Schülerspitzenleistungen, und das innerhalb von 75 Jahren, von 1946 bis 2021. Nun mag es andere Privatschulen geben, welche ebenso klein angefangen haben, als Initiative eines Einzelnen, der zu Hause Kinder unterrichtete. Von diesen ist aber keine bekannt geworden, welche so groß und erfolgreich wurde wie die Brecht-Schule Hamburg. Der Weg dorthin war keineswegs gradlinig, es gab immer wieder Situationen, in denen die Brecht-Schule vor dem Aus stand, Rückschläge mussten verkraftet werden und auch die Umsetzung guter Ideen gestaltete sich in den meisten Fällen zumindest zu Beginn durchaus widersprüchlich. Diese Stationen werden im vorliegenden Buch nachgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Grußwort der Brecht-Geschäftsführung
Erläuterung zur Gliederung und zum Konzept dieser Schrift
1. AUFBAU
Die Ära Heinz Brecht (1945-1966) Der Weg vom Nachhilfeunterricht zu einer richtigen Schule
2. AUF DER KIPPE
Die Ära Bruno Birnbaum (1969-2001) Die Brecht-Schule zwischen Stabilität und Stagnation
3. AUFBRUCH
Hochbegabtenförderung, Anerkennung und Expansion (2001-2011)
Phase 1 (2001-2007): Start der Hochbegabtenförderung, staatliche Anerkennung, Einzug in den Altbau Norderstraße und Gründung der Grundschule
Phase 2 (2007-2011): Erstes Leitbild, neue Anerkennungen, neue Geschäftsführung und Neubau
4. AUF ERFOLGSKURS
Die Brecht-Schule auf dem Weg an die Spitze der Hamburger Schulen (seit 2011)
Phase 1 (2011-2016): Hohe Schulqualität und neues Leitbild
Phase 2 (ab 2017): Die Brecht-Schule an der Spitze der Hamburger Schulen
Danksagung
ANHANG:
Grußwort der Brecht-Geschäftsführung
Im Jubiläumsjahr 2021 ist die Brecht-Schule Hamburg mit ihren fünf Schulzweigen – Abendgymnasium, Grundschule, Gymnasium, Höhere Handelsschule und Stadtteilschule – für etwa 180 Mitarbeiter*innen und rund 1300 Schüler*innen ein wichtiger Ort des Lernens, Arbeitens und der Begegnung. Im Herzen Hamburgs gelegen, mit ehrwürdigem Altbau und modernem Neubau in St. Georg gut sichtbar von der S-Bahn zwischen Berliner Tor und Hauptbahnhof, genießt die Brecht-Schule seit Jahren in der Öffentlichkeit einen exzellenten Ruf und ist die größte konfessionell und weltanschaulich unabhängige, gemeinnützige Privatschule Hamburgs. Wer hätte das vorauszusagen gewagt, als Heinz Brecht 1946 begann, in seiner Privatwohnung Nachhilfeunterricht zu geben? Oder auch noch in den 1990er Jahren, als eine überschaubare Zahl von Schüler*innen, die im herkömmlichen Schulsystem teils große Schwierigkeiten gehabt hatten, in wenigen kleinen Räumen am Holzdamm auf externe Abschlussprüfungen vorbereitet wurden?
Es ist tatsächlich eine »einzigartige Erfolgsgeschichte«, wie Klaus Nemitz treffend als Titel gewählt hat, auf die alle, die daran mitgewirkt haben beziehungsweise heute und in Zukunft mitwirken, stolz zurückblicken können. Im vorliegenden Buch wird diese außergewöhnliche, 75-jährige Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart erzählt.
Der Autor ist dafür ideal geeignet: Niemand ist mit der Geschichte der Brecht-Schule so gut vertraut wie Klaus Nemitz. Als pädagogischer Geschäftsführer und Schulleiter mehrerer Schulzweige hat er die Erfolgsgeschichte der Schule in den letzten Jahrzehnten (als »Zeitzeuge und Akteur«, wie er mit hanseatischem Understatement schreibt) maßgeblich geprägt und mitgestaltet. So ist es ein Glücksfall für uns, dass er im ersten Jahr nach seinem Rentenbeginn bereit war, sich auf Grundlage vielfältiger Notizen, Gespräche und Dokumente diesem Buchprojekt zu widmen. Während parallel auch im Rahmen einer Jubiläums-Festschrift eine kompakte Kurzfassung erscheint, finden sich in der hier vorliegenden, umfassenden Brecht-Historie auch viele Anekdoten und überraschende Details.
Die hier erzählte Geschichte bietet viele Orientierungspunkte, um immer wieder Kontinuität und Innovation gut auszubalancieren, und bedeutet zugleich eine Verpflichtung, angesichts aller gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen und nicht zuletzt auch in der aktuellen Corona-Pandemie: Gemeinsam mit all den Menschen, die sich an der Schule und für die Schule engagieren, wollen wir alles dafür tun, dass unsere Brecht-Schule weiterhin ein vielseitiger, dynamischer Ort ist und bleibt, an dem unterschiedlichste Menschen in einem Wohlfühlklima arbeiten, lernen und wachsen können.
Andreas Haase und Christoph Schneider
Erläuterung zur Gliederung und zum Konzept dieser Schrift
Als Zeitzeuge und Akteur der einzigartigen Entwicklung der Brecht-Schule Hamburg hatte ich schon lange das Vorhaben, nach meiner aktiven Zeit die Geschichte dieser besonderen Einrichtung aufzuschreiben. Ich habe mich dabei auf zahlreiche Gespräche mit Beteiligten, das Archiv der Brecht-Schule, Dokumente, Behördenkorrespondenz, Zeitungsartikel, auf Protokolle, Schulleiterberichte und zuletzt auf die wöchentlichen Freitagsmails der Geschäftsführung stützen können.
Im Nachhinein war es ein Glücksfall, dass ich teilweise schon vor mehr als 10 Jahren Aufzeichnungen von ausführlichen Gesprächen mit Verantwortlichen gemacht und aufbewahrt habe, welche die Frühzeit der Schule, insbesondere die Ära des Schulgründers Heinz Brecht, selbst miterlebt hatten. Dies waren wichtige Ergänzungen zu meinen eigenen Beobachtungen, welche erst 1988 einsetzten.
Das methodische Problem, eine Geschichte aufzuschreiben, welche ich in den letzten 30 Jahren wesentlich mitgestaltet habe, impliziert eine Ambivalenz. Einerseits bin ich über diese Zeit ungewöhnlich gut informiert, andererseits bleiben meine Ausführungen subjektiv, auch wenn ich mich stilistisch in die Er-Form setze. Und ich mache an einigen Stellen auch keinen Hehl aus meiner emotionalen Verbundenheit mit der Brecht-Schule, ein Phänomen, dem sich kaum jemand entziehen kann, der länger an dieser Einrichtung gearbeitet hat.
Die Darstellung ist natürlich der Wahrheit verpflichtet, die gute Lesbarkeit hat aber eindeutig Vorrang vor wissenschaftlicher Akribie. Es gibt daher in dem Sachtext auch immer wieder erzählerische Elemente, die Anekdoten oder Ungewöhnliches einbeziehen.
Ich habe die Geschichte der Brecht-Schule in vier Stationen gegliedert, die für mich eine logische Struktur ergaben.
Im ersten Kapitel »Aufbau« werden die Anfänge der Brecht-Schule dargestellt. Hier wird die außerordentliche Leistung des Schulgründers Heinz Brecht beschrieben, der aus einem Nachhilfeunterricht in seiner Küche in Eimsbüttel über drei Klassenräume in seiner größeren Borgfelder Wohnung in relativ kurzer Zeit die Brecht-Schule zu einer Einrichtung machte, welche einige Hundert Schüler*innen und drei Standorte mit staatlich genehmigten Schulzweigen umfasste. Dies ist umso höher einzuschätzen, als dies unter prekären finanziellen Verhältnissen, einem akuten Lehrer*innenmangel und äußerst schwierigen Bedingungen bei den Abschlussprüfungen gelang. Diese Phase endete 1966 mit dem Tod von Heinz Brecht bzw. 1969 mit dem Verkauf der Schule durch seine Witwe an eine von Mitarbeiter*innen neu gegründete GmbH.
Wenn man die Situation in dieser Zeit betrachtet, dann ist es kaum zu glauben, dass die heutige Brecht-Schule mit ihren großen Erfolgen und ihrem hohen Ansehen ein und dieselbe Schule sein soll wie die damalige Lehranstalt.
Dies gilt weitgehend auch für die im zweiten Kapitel »Auf der Kippe« beschriebenen folgenden Dekaden von den 1970er- bis zu den 1990er-Jahren. Diese zweite Phase beginnt mit der GmbH-Gründung 1969, welche die Schule auf mehrere Schultern stellte. Aber auch in dieser Zeit gab es eine dominierende Persönlichkeit, welche die Geschicke der Schule entscheidend geprägt hat: Bruno Birnbaum, welcher 36 Jahre lang als Geschäftsführer die Einrichtung leitete und über die Mehrheit in der Gesellschafterversammlung verfügte.
An der finanziell, personell und im Hinblick auf die Abschlüsse problematischen Situation änderte sich gegenüber der Ära von Heinz Brecht in dieser Zeit nur wenig. Birnbaum stand für eine Epoche der Stabilität, aber auch der Stagnation, in welcher das Schicksal der Schule immer wieder auf der Kippe stand. Mehrfach gelang es ihm, die Schule in schwierigen Situationen zu retten, sein größter Erfolg war der Sieg gegen das Hamburgische Privatschulgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht, welcher zu einer Verdreifachung der staatlichen Finanzhilfe führte.
Das dritte Kapitel »Aufbruch« beginnt mit dem für die Brecht-Schule historischen Jahr 2001, in welchem das Gymnasium staatlich anerkannt wurde und die Hochbegabtenförderung startete. Dies führte in der Folge zu einem kompletten Paradigmen- und Imagewechsel der Schule. Aus einer relativ kleinen Institution, welche Schüler*innen auffing, die woanders gescheitert waren, wurde eine höchst attraktive, große und erfolgreiche Schule in Hamburg. Die Brecht-Schule in ihrer heutigen Form entwickelte sich eigentlich erst während dieser Phase der Entwicklung in den Jahren 2001 bis 2011.
Bemerkenswert war dabei, dass etwas glückte, was eigentlich theoretisch kaum gelingen kann: eine gleichzeitige schnelle quantitative und qualitative Expansion. In diese Phase fallen zahlreiche pädagogische Initiativen und Projekte sowie der Einzug in den Altbau der Norderstraße. Ein Höhepunkt war auch die Gründung der eigenen Grundschule mit Maßnahmen zur Förderung besonders begabter Kinder. Die Aufbruchphase mündete schließlich in den Neubau in der Norderstraße, welcher die Schule in eine ganz neue räumliche Dimension brachte und ein weites Feld von zusätzlichen pädagogischen Möglichkeiten eröffnete.
Unter der Überschrift des vierten Kapitels »Auf Erfolgskurs« wird beschrieben, wie die Brecht-Schule in allen Bereichen dazu kam, Schülerleistungen hervorzubringen, welche die anderen Schulen in Hamburg in den Schatten stellten. Dies erscheint umso ungewöhnlicher, als die Brecht-Schule jahrzehntelang zu den Einrichtungen gehörte, welche zu eher schlechten bzw. gar keinen Abschlüssen führten, da die Absolvent*innen durch die externen Prüfungen fielen oder diese nur mit einem blauen Auge überstanden. In dieser Phase gelang es, die während des Aufbruchs erkämpften Qualitäten wie das Wohlfühlklima, gute Leistungen, schüleraktivierende Unterrichtsmethoden, eine hohe Beratungskompetenz, die Schwerpunkte Vielfalt und Nachhaltigkeit, eine Teamarbeit auf allen Ebenen sowie die systematische Schulentwicklungsarbeit auf lange Sicht zu stabilisieren.
Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als es für diese Privatschule nie kapitalkräftige Gönner gab, wie dies z. B. mit dem Pharmariesen Böhringer Ingelheim bei den Phorms-Schulen der Fall ist. Es kommt auch nicht der Staat für das Wohl und Wehe der Schule auf. Trägerin der Brecht-Schule ist vielmehr eine gemeinnützige GmbH und Gesellschafter*innen sind ausschließlich aktive Mitarbeiter*innen.
Ein kleines mitarbeitergeführtes Unternehmen hat es also aus eigener Kraft geschafft, groß und erfolgreich zu werden, bei den Schülerleistungen sogar Spitzenwerte zu erreichen. Man stelle sich vor, der FC St. Pauli wird deutscher Fußballmeister, mit großem Vorsprung vor dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Möglich und sicherlich eine sympathische Annahme. Aber sehr unwahrscheinlich. Und als Zielsetzung auch nicht fester Teil des Selbstverständnisses dieses alternativen Klubs (hier zählt eher ein Sieg im Derby gegen den HSV). Die Brecht-Schule Hamburg hat eine solche unwahrscheinliche Geschichte geschrieben.
Der Weg dorthin war keineswegs gradlinig, es gab immer wieder Situationen, in denen die Schule vor dem Aus stand, Rückschläge mussten verkraftet werden und auch die Umsetzung guter Ideen gestaltete sich in vielen Fällen zumindest zu Beginn durchaus widersprüchlich.
In der folgenden Schrift habe ich versucht, diesen einzigartigen Erfolgsweg der Brecht-Schule nachzuzeichnen und ihre Geschichte zu erzählen.
Klaus NemitzHamburg, im Dezember 2021
1. AUFBAU
Die Ära Heinz Brecht (1945-1966) Der Weg vom Nachhilfeunterricht zu einer richtigen Schule
Die Geschichte der Brecht-Schule, Hamburgs größter und erfolgreichster Privatschule, beginnt mit ihrem Gründer Heinrich (»Heinz«) Brecht, der seine Einrichtung nicht nach dem berühmten Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht benannte, sondern – nach dem Vorbild zahlreicher Firmengründer – schlicht nach sich selbst.
Heinz Brecht und das Institut Dr. Hartmann
Heinz Brecht, 1902 geboren als Sohn eines Schiffsingenieurs in St. Pauli, war Textilhändler, bevor er mit fast 40 Jahren während der Zeit des Nationalsozialismus auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur am Institut Dr. Hartmann, einer der führenden Privatschulen in Hamburg, in den Colonnaden nachholte. Wie viele andere Institutsabgänger wurde Brecht gleich nach dem Abitur – und ohne jegliche Lehrerausbildung – von Alfred Hartmann als Lehrkraft beschäftigt, wodurch er das begonnene Mathematikstudium finanzieren konnte. Dabei lernte er auch seine 20 Jahre jüngere Frau Gisela kennen, welche dort zum damaligen Zeitpunkt als Sekretärin arbeitete.
Anfang der 1940er-Jahre löste die Hamburgische Landesunterrichtsbehörde unter der Führung des Nationalsozialisten Wilhelm Schulz das Hartmann-Institut unter dem Vorwand auf, die Schule sei mehr und mehr zur Heimat einer »Jazz-Jugend« geworden, welche eine undeutsche Subkultur pflege. Alfred Hartmann wurde zusammen mit einigen seiner Lehrer, darunter auch Brecht, inhaftiert und wegen der »ideologischen Verführung« ihnen anvertrauter »Jungdeutscher« angeklagt. Das Nazi-Regime enteignete zugleich Hartmann, der damit die Rechte an seinem Institut verlor. Heinz Brecht wurde in der letzten Phase des Weltkriegs aus dem Gefängnis entlassen und zur Wehrmacht eingezogen.
Nachdem Hamburg am 2. Mai 1945 kampflos von britischen Truppen besetzt worden war, geriet Hartmann in englische Gefangenschaft, Brecht vorübergehend in Untersuchungshaft. Eher als Hartmann entlassen, begann Brecht damit, in seiner Wohnung in der Bundesstraße, mitten im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel, private Nachhilfe im Fach Mathematik zu geben. Dabei bezog er schon damals einzelne ehemalige Hartmann-Kolleg*innen ein, die andere Fächer übernahmen. Ehefrau Gisela achtete währenddessen in der überschaubaren Wohnung darauf, dass sich die im selben Jahr geborene Tochter Gitta nicht zu lautstark bemerkbar machte.
Heinz Brecht nutzte die Gunst der Stunde und gab seinem Unterricht den Namen »Institut Dr. Hartmann – Nachfolger«, ohne dass der Namensgeber davon Kenntnis hatte. Er versuchte damit offensichtlich, sich den Namen der ehemaligen großen Hamburger Privatschule zunutze zu machen. Brecht selbst war von den Briten bei der Entlassung als »weißer« Lehrer eingestuft worden, wurde also nicht verdächtigt, nationalsozialistische Ideologie verbreitet oder mit den Nazis kooperiert zu haben.
Als Alfred Hartmann 1946 aus der Gefangenschaft entlassen wurde, erhielt er, obwohl mittlerweile offiziell als Verfolgter des Naziregimes anerkannt, von den britischen Behörden keine Genehmigung zu einer Wiedereröffnung seiner Schule. Der Brechtsche Küchenunterricht war bislang weder den Briten noch dem Hamburger Schulsenator Landahl (SPD) aufgefallen und konnte sich daher zunächst unreglementiert von einer staatlichen Aufsicht entfalten.
Umzug zum Berliner Tor und erste Expansionsphase
Brechts Nachhilfeunterricht florierte. Zunächst wurden nur einzelne Zöglinge im Fach Mathematik unterwiesen, später erfolgte der Unterricht in Gruppen. Um der steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen, unterrichtete Heinz Brecht immer häufiger bis tief in die Nacht. Brecht muss in dieser Zeit klar geworden sein, dass für ihn und seine mittlerweile vierköpfige Familie die Nachhilfe mehr einbrachte als die frühere Arbeit im Textilhandel. Nebenbei gab er Stunden als Mathematiklehrer an der privaten Brechtefeldt-Schule im Holzdamm 36 (St. Georg) sowie an der privaten Handelsschule Weber.
Nachhilfeunterricht war in dieser Zeit stark nachgefragt. Die britische Besatzungsmacht hatte eine Stadt vorgefunden, deren Schulwesen materiell und geistig weitgehend am Boden lag. Von den ehemaligen Schulgebäuden Hamburgs waren 21 Prozent total zerstört und 26 Prozent so schwer beschädigt, dass sie kaum benutzt werden konnten. Hinzu kam, dass etliche Schulgebäude 1945 als Lazarette und Unterkünfte für Besatzungssoldaten oder Flüchtlinge genutzt wurden. Zugleich wuchs die Zahl der Schüler*innen in einem enormen Tempo, von 95.000 Ende 1945 auf 186.000 im Jahr 1947. Das zahlenmäßige Lehrer-Schüler-Verhältnis betrug in dieser Zeit 1:48. Es gab also einen riesigen Lehrer*innen- und Raummangel, so dass zeitweise Schichtunterricht eingeführt werden musste, ein Teil der Schülerschaft wurde morgens unterrichtet, ein anderer mittags und ein dritter Teil nachmittags oder abends.
Hinzu kam, dass etliche Lehrkräfte, welche noch wenige Monate zuvor den »Endsieg« der deutschen Wehrmacht propagiert hatten, die Schulen verlassen mussten und durch sogenannte »Neulehrer*innen« ersetzt wurden, welche in Kurzlehrgängen auf den schnellen Einsatz in den Schulen mit ihren sehr großen Klassen vorbereitet worden waren. Dabei zogen die Alliierten deutsche Bürger*innen mit akademischem Grad und möglichst ohne Verstrickung in das NS-Regime heran. Bei eher zweifelhafter politischer Vergangenheit konnte man durch »Entbräunungskurse« oder Entlastungsaussagen von NS-Opfern einen »Persilschein« erhalten, so dass man politisch quasi eine reine Weste hatte. Eine konsequente Entnazifizierung gelang in den Westzonen allerdings nur bedingt.
Wer im zerbombten Hamburg höhere berufliche Ambitionen hatte, tat fast alles, um zunächst seine Mittlere Reife (Realschulabschluss) oder sein Abitur zu machen. Heinz Brecht nutzte diese Gunst der Stunde.
Der Ursprung der Brecht-Schule lag also nicht primär in einer pädagogischen Idee begründet, sondern ihre Gründung diente einem Kaufmann in der Nachkriegszeit dazu, auf sinnvolle Weise Geld zu verdienen und ein ausreichendes Einkommen zu generieren. Und es sprach für Heinz Brecht, dass er dabei jungen Menschen zu guten Voraussetzungen für ihr späteres Berufsleben verhelfen wollte. Ein eigenes pädagogisches Konzept entstand erst mehr als 50 Jahre später, als die Brecht-Schule mit der Hochbegabtenförderung ein eigenes Profil entwickelte und damit auch Unterrichtsmethoden vorherrschten, welche über das »Pauken« für externe Prüfungen hinausgingen und moderne Lernformen beinhalteten.
Es zeigte sich in diesen frühen Jahren, dass Heinz Brecht ein erfolgreicher und beliebter Selfmade-Lehrer und zugleich vielleicht ein noch begabterer Kaufmann war. Schon die Bezeichnung seines Instituts nach dem Hartmann-Institut war ein Fingerzeig dafür gewesen, dass Brecht in größerem Maßstab dachte. Nun machte er Nägel mit Köpfen: Um noch mehr Schüler*innen unterrichten zu können, zog die Familie Brecht 1946 in eine deutlich größere Wohnung in der Borgfelder Straße 24, zwischen den U-Bahn-Stationen Berliner Tor und Burgstraße. Nach mehreren Umzügen sollte die Brecht-Schule mehr als 50 Jahre später, im Jahr 2003, nach St. Georg in die Nähe des Berliner Tors zurückkehren.
In dem vierstöckigen Wohnhaus, einem der wenigen vom Krieg unversehrten Gebäuden in dieser Gegend (und damit nicht zu übersehen), mietete Brecht im zweiten Stock eine Wohnung mit sechs Zimmern plus Küche und Gesindezimmer an. In den drei vorderen Zimmern, die zur lauten Borgfelder Straße hinausgingen, wurde unterrichtet, in den restlichen Räumen wohnte die vierköpfige Familie.
Die Nachfrage war beachtlich, bald erweiterte Brecht die Zahl der Fächer und stellte einzelne Lehrkräfte ein, meist Studierende oder Doktorand*innen, allerdings bei niedrigem Gehalt. Brechts Ehefrau Gisela hatte zwischendurch ein Anglistik-Studium angefangen und unterrichtete nun das Fach Englisch. Auch Alfred Hartmann erhielt von Brecht eine Anstellung, Arbeitgeber und Angestellter hatten die Rollen gewechselt. Brechts Schwiegermutter hielt die Räumlichkeiten sauber. Der Stundenlohn betrug damals 4,00 DM. Da einige Kolleg*innen 40 und mehr Wochenstunden gaben, kamen sie auf ein Monatsgehalt, welches für einen Studierenden viel Geld war.
Um die drei Klassenräume möglichst optimal zu nutzen, wurde das Lernen am Vormittag von Beginn an durch einen Abendunterricht ergänzt, so dass nun insgesamt sechs Klassen bzw. Lerngruppen Brechts Schule besuchten. Hier begann also schon die Tradition, Räume doppelt zu nutzen, wie sie heute mit der Tagesschule und dem Abendgymnasium im Altbau der Norderstraße weiterlebt.
Scheitern der alliierten Schulreformpläne in der Besatzungszeit
Währenddessen fielen in der Auseinandersetzung zwischen den Westalliierten und den neu entstehenden deutschen Landesregierungen und Kultusministerien grundlegende Entscheidungen über die Zukunft des Schulwesens in den Westzonen. In der Kontrollratsdirektive 54 einigten sich die Alliierten auf eine demokratische Reform des deutschen Bildungswesens. Im Bericht der Zook-Kommission (benannt nach ihrem US-amerikanischen Vorsitzenden) hieß es dazu, das klassische deutsche Drei-Säulen-Modell mit Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien hätte »bei einer kleinen Gruppe eine überlegene Haltung und bei der Mehrzahl der Deutschen ein Minderwertigkeitsgefühl entwickelt, das jene Unterwürfigkeit und jenen Mangel an Selbstbestimmung möglich machte, auf denen das autoritäre Führerprinzip gedieh« (vgl. Edelstein, Veith, Schulgeschichte nach 1945, bpb 2017). Die Zook-Kommission empfahl daher die Abschaffung des gegliederten Schulsystems und eine möglichst lange gemeinsame Beschulung aller Schüler*innen nach dem Vorbild der Highschools in den USA. Wäre es also nach den Alliierten gegangen, hätte Deutschland eine einheitliche Schulart erhalten, vergleichbar mit den späteren Gesamtschulen.
Diese Reformpläne setzten sich jedoch nicht durch, da die Alliierten zugleich den deutsche Kulturföderalismus wiederherstellten, also die Kultushoheit der neu entstehenden Bundesländer. Die letztgültige Entscheidung über die Struktur des Bildungswesens ging dadurch auf die neuen deutschen Behörden über. Zugleich formierte sich eine breite Widerstandsbewegung aus Kirchen, bildungsbürgerlichen Schichten und konservativen Parteien gegen die Gesamtschulbestrebungen. Dieser Koalition ging es vor allem darum, die höhere Bildung an den Gymnasien zu erhalten. In zugespitzter Form brachte dies 1947 der Bayrische Kultusminister Hundthammer in einer Stellungnahme an die Militärregierung mit der Formulierung zum Ausdruck, die »biologische Ungleichheit kann durch keine zivilisatorischen Maßnahmen beseitigt werden, auch nicht durch die Änderung unseres sogenannten zweispurigen Schulsystems zugunsten eines Einheitsschulsystems« (vgl. Edelstein, Veith).
Hatte die SPD zunächst noch Sympathien für eine gemeinsame Beschulung aller Schüler*innen geäußert, so geriet sie nach Wahlniederlagen in der Adenauer-Ära in die Defensive. Die Idee einer »Einheitsschule« wurde zudem zunehmend politisch belastet durch die Existenz einer solchen Schulart in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bzw. später der DDR in Form der Polytechnischen Oberschule (POS) während der Zeit des Kalten Krieges. 1955 wurde dann schließlich im Düsseldorfer Abkommen das dreigliedrige Schulsystem (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien) in der Bundesrepublik Deutschland als Standard beschlossen. Hieran hatte sich auch die Brecht-Schule zu orientieren.
Gründung der »Lehranstalt Brecht« 1946
Das rege Kommen und Gehen bei Brecht blieb mittlerweile auch der Schulbehörde nicht länger verborgen, die in der Besatzungszeit unter den Ersten Bürgermeistern Rudolf Petersen (1945-46, noch vom britischen Stadtkommandanten Armytage ernannt, parteilos) und Max Brauer (1946-1953 sowie 1957-1960, SPD) für den Wiederaufbau des Schulwesens zuständig war. Der zuständige Schulrat machte 1946 Heinz Brecht klar, dass das, was er in seiner Wohnung betrieb, kein privater Nachhilfeunterricht mehr sei, natürlich auch keine »richtige« Schule, sondern eine anzeigenpflichtige »Vorbereitungsanstalt«. Gemeint war damit eine Einrichtung, die selbst keine Abschlüsse erteilen durfte, aber unter der Aufsicht der Behörde Schüler*innen auf externe Prüfungen vorbereitete.
Heinz Brecht nahm dies zum Anlass, um seine neue Schule nun unter seinem eigenen Namen als »Lehranstalt Brecht« im Jahr 1946 offiziell der Behörde zu melden bzw. »anzuzeigen«. Dies war die Geburtsstunde der heutigen Brecht-Schule Hamburg. Es ist davon auszugehen, dass Heinz Brecht klar war, dass sein Nachname der Schule zugleich einen bildungsbürgerlichen Anstrich geben könnte, da die meisten Interessent*innen irrtümlich davon ausgehen würden, dass die Schule nach dem großen deutschen Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht benannt worden sei, also vergleichbar mit einem Goethe-Gymnasium oder einer Immanuel-Kant-Schule. Dies war aus unternehmerischer Sicht zweifellos eine clevere Marketingidee.
Bei der offiziellen Anzeige seiner Schule bei der Behörde meldete Heinz Brecht drei Realschulklassen an (M3, M2 und im dritten Vorbereitungshalbjahr M1, »M« für »Mittlere Reife«, heute Mittlerer Schulabschluss, MSA) sowie drei Oberstufenklassen (A3 bis A1, »A« für Abitur). Diejenigen Schüler*innen, welche diese Vorbereitung erfolgreich durchlaufen hatten, wurden von Brecht nach 18 Monaten zu den externen staatlichen Prüfungen angemeldet.
Externe Prüfungen und weiterer Ausbau der Schule
Während 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, in Bonn Konrad Adenauer (CDU) und in Hamburg Max Brauer (SPD) regierten, baute Heinz Brecht weiter seine Schule auf. Aufgrund der schwierigen Situation der staatlichen Schulen bot er für viele eine attraktive, persönliche Alternative (quasi mit Familienanschluss), aber er hatte von Anfang an mit den hohen Hürden der externen Prüfungen zu kämpfen, denen die meisten seiner Schüler*innen zum Opfer fielen.
Die Bestehensquoten bei den »Fremdenprüfungen« können im Nachhinein nur als miserabel bezeichnet werden. Dies lag zum einen daran, dass die Brecht-Schüler*innen (wie auch die der anderen nicht staatlich anerkannten Privatschulen) von externen staatlichen Lehrkräften geprüft wurden, deren Prüfungsthemen kaum vorhersehbar waren, zum anderen zählten alle Noten, welche die Schüler*innen an der Brecht-Schule erwarben, für den Abschluss nichts, nur die von staatlichen Lehrkräften durchgeführten externen Abschlussleistungen, Klausuren wie mündliche Prüfungen, bildeten die Basis für die Mittlere Reife oder für das Abitur. Hinzu kam, dass die Brecht-Schule in dieser Zeit über keine ausgebildeten Lehrkräfte verfügte. Lehramtsanwärter*innen, welche erfolgreich das Referendariat absolviert hatten, wurden ausnahmslos vom Staat übernommen. Da es am Ende nur auf den punktuellen Auftritt in der externen Prüfung ankam, waren kreative oder kooperative Unterrichtsmethoden weder bekannt noch angesagt, methodische Variationen gab es kaum, der Stoff wurde durchgehend frontal von der Lehrkraft vermittelt. Trotz der hohen Durchfallquoten scheint die Lehranstalt Brecht aber deutlich erfolgreicher gewesen zu sein als andere in Hamburg wirkende Vorbereitungsanstalten wie Brechtefeldt, Jessel oder Institut Dr. Ahrens, die nicht selten Durchfallquoten von 100 Prozent zu verzeichnen hatten.
Auch heute noch haben alle Schüler*innen in Hamburg, welche keine staatlichen oder staatlich anerkannten Schulen (wie jetzt die Brecht-Schule) besucht haben, die Möglichkeit, die Abschlüsse nachträglich durch eine »Externenprüfung« (so der aktuelle Sprachgebrauch) zu erwerben. Diese Hürde haben also immer noch die Absolvent*innen von Privatschulen zu überwinden, welche lediglich staatlich genehmigt oder nur bei der Behörde angezeigt sind.
Da Brechts Schule zu diesem Zeitpunkt keine Ersatzschule war (die man statt einer staatlichen Schule besuchen kann wie die Brecht-Schule heute), sondern eine Ergänzungsschule (die man nach dem Ende der Schullaufbahn wählen kann, um einen höheren Abschluss vorzubereiten als zuvor erreicht), also eine Form des zweiten Bildungsweges, bestand die Schülerschaft durchweg aus älteren Schüler*innen, die den Besuch einer Hauptschule oder einer Realschule bereits hinter sich hatten. Da bei Brecht häufig Studierende unterrichteten, war der Altersunterschied zwischen Schüler*innen und Lehrkräften oft nicht sehr hoch.
Es gab also eine Reihe von Gründen dafür, dass die Schulbehörde ein kritisches Auge auf die »Lehranstalt Brecht« warf und die externen Prüfungen relativ rigoros durchzog. In der Regel fielen von den wenigen Prüflingen, welche bei Brecht die Vorbereitungszeit erfolgreich absolviert hatten, mehr als die Hälfte durch die Abschlussprüfungen. Im Kollegium hieß es dazu immer wieder sarkastisch: »10 gehen rein in die Prüfung, 11 fallen durch!« An diesen schlechten Prüfungsergebnissen sollte sich bis in die 1990er-Jahre hinein wenig ändern.
Bezeichnend waren auch die offiziellen Begriffe für diese Prüfungen, die im Behördenjargon als »Externen-Prüfungen« oder »Fremden-Prüfungen« firmierten. Die von den Privatschulen gemeldeten Prüflinge waren »Externe« (also nicht wirklich zum Hamburger Schulwesen gehörend) oder auch laut Prüfungsordnung »Nichtschüler« (!), auf jeden Fall aber »fremd«. Dementsprechend wurden von den Behördenvertreter*innen auch die Lehrkräfte der Privatschulen angesehen. An eine Kooperation zwischen staatlichen Prüfer*innen und den Privatschullehrkräften, z. B. um von beiden Seiten die Prüfungsvorbereitungen sinnvoll miteinander abzustimmen, war nicht zu denken.
Umso beachtlicher ist es, dass die Lehranstalt trotz der schlechten Prüfungsaussichten in den Abschlussklassen weiter Zulauf hatte. Bildungsabschlüsse waren in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein hohes Gut und Heinz Brecht machte zudem Werbung für seine Lehranstalt in den Hamburger Zeitungen. Schon bald wurde auch im Wohnzimmer unterrichtet, die Familie zog sich in die restlichen Zimmer zurück. Da das Gebäude vom Abriss bedroht war (der dann aber erst in den 1980er-Jahren erfolgen sollte), fiel es Brecht leicht, leer werdende Räume im Haus dazuzumieten. Familie Brecht zog in den 3. Stock um, die sechs Zimmer im 2. Stock dienten nun nur noch als Unterrichtsräume.
Anfang der 1950er-Jahre mietete Brecht drei weitere Räume im 1. Stock an, um zusätzliche Vorbereitungsklassen einzurichten. Brechts Ziel war es, die Klassen »so voll wie möglich« zu machen. Die Klassenstärke betrug in der Regel 16 bis 18 Schüler*innen, damit wurde es in den kleinen Räumen schon recht eng. Brecht setzte zudem darauf, dass immer irgendwelche Schüler*innen fehlten (die Fehlquoten waren damals bei den überwiegend volljährigen Lernenden relativ hoch). Waren an einem Tag alle »an Bord«, musste der eine oder andere Schüler auch schon mal von der Fensterbank aus den Unterricht verfolgen.
Die Schule wuchs bald auf über 150 Schüler*innen an. Eine beachtliche Expansionsleistung unter schwierigen äußeren Bedingungen. Allerdings hatte Heinz Brecht noch Größeres im Sinn.
Genehmigung der Handelsschule Brecht (1954) und des Brecht-Gymnasiums (1956)
Heinz Brecht nutzte wieder einmal die Gunst der Stunde, als im Dezember 1953 nach der Bürgerschaftswahl ein vom CDU-Politiker Kurt Sieveking geführter neuer Senat seine Absicht bekundete, »die Errichtung von neuen Privatschulen in Hamburg zu fördern«. Die Anträge für weitere Schulzweige waren längst gestellt, jedoch vom SPD-geführten Senat unter Max Brauer wiederholt abgelehnt worden. Aus seiner Sicht gehörten die Schulen in staatliche Hände, die grundgesetzlich garantierten Privatschulen wurden eher widerwillig geduldet. Die SPD blieb hier einer Tradition verhaftet, welche Kritiker gerne als Staatsfixierung oder Etatismus bezeichnen.
Nun hatten die Schulen in freier Trägerschaft Rückenwind. Bereits 1954 erteilte der parteilose Schulsenator Hans Wenke Brecht die Genehmigung zur Errichtung einer »Privaten Handelsschule Brecht«, die dann noch im selben Jahr mit 18 Schüler*innen in einer HU-Klasse eröffnet wurde (im ersten Schuljahr hießen die Handelsschulklassen bei Brecht HU, im zweiten HO). Im März 1956 erfolgte dann die Genehmigung eines Gymnasiums, das den etwas sperrigen Namen »Privates Gymnasium Brecht, Wissenschaftliche Oberschule für Jungen und Mädchen (im Aufbau)« führen sollte. Mit diesem Schritt unterstrich der Sieveking-Senat seinen Anspruch, Vorkämpfer für Privatschulen zu sein. Durch die Genehmigung des Brecht-Gymnasiums sei jetzt »ein sichtbarer Schritt in diese Richtung getan worden«. Die Genehmigung eines privaten Gymnasiums in Hamburg, das war in den 1950er-Jahren ganz eindeutig ein aufsehenerregendes Politikum.
Für Heinz Brecht war dies zugleich eine Art Ritterschlag durch die Schulbehörde. Hatte er bislang nur ein anzeigenpflichtiges Institut als »Ergänzungsschule« geführt, so waren die neuen Schulzweige nun »staatlich genehmigte Ersatzschulen« und damit laut Hamburger Schulgesetz offizielle Bestandteile des Hamburger Schulwesens. Dies war verbunden mit behördlichen Vorgaben hinsichtlich der Bildungsziele der Schule, der Ausbildung und der wirtschaftlichen Stellung der Lehrkräfte sowie der persönlichen Eignung der Schulleitung (all dies sollte gleichwertig mit den staatlichen Schulen sein).
Die Schule erhielt für die genehmigten Schulzweige nun auch – nach jeweils dreijähriger Wartefrist – staatliche Finanzhilfe, welche auf dem Konkordat zwischen dem Hamburger Senat und der katholischen Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg basierte. Während die katholischen Schulen für ihre Schüler*innen allerdings 77 Prozent der Gelder erhielten, welche die staatlichen Schulen ein Schüler bzw. eine Schülerin kostete, waren es bei der Brecht-Schule und vergleichbaren Privatschulen ohne weltanschauliche Prägung nur 25 Prozent. Aber in der prekären finanziellen Situation der Schule waren dies wichtige Gelder, welche zunächst das Überleben sicherten.
Die staatliche Genehmigung war auf lange Sicht gesehen allerdings nur ein Schritt auf dem Weg zur staatlichen Anerkennung, mit der u. a. die Berechtigung verbunden ist, selbst die Abschlussprüfungen durchzuführen und Abschlüsse zu erteilen. Dieses Ziel sollte beim Gymnasium erst 2001, bei der Realschule und dem Abendgymnasium einige Jahre später erreicht werden. Nur die Handelsschule und Höhere Handelsschule von Brecht waren schon in den 1980er-Jahren anerkannt.
Für Brecht ergab sich durch die Genehmigung des Gymnasiums als privater Ersatzschule zum ersten Mal auch die Möglichkeit, Schüler*innen ab der 5. Klasse aufzunehmen. Dies blieb über viele Jahre allerdings eher eine theoretische Option, da es kaum Eltern gab, die ihre Kinder direkt nach der Grundschule an einer privaten Schule anmeldeten. Größere Klassen gab es bei Brecht in der Regel erst, wenn Lernschwierigkeiten unübersehbar wurden und der Schulabschluss an einer staatlichen Schule in Frage stand, also ab Klassenstufe 9. Hier war die Schule teilweise sogar dreizügig.
Die Brecht-Schule blieb damit im Vergleich zu weiterführenden staatlichen Schulen eine kleine Einrichtung und gehörte zu den wenigen Schulen in freier Trägerschaft, welche damals in Hamburg existierten. In der Hansestadt widerspiegelte sich damit – rein quantitativ gesehen – die Randexistenz, welche Privatschulen (bzw. Schulen in freier Trägerschaft) traditionell mit einer Quote von etwa 5 Prozent aller Schulen in Deutschland innehatten. Die Situation war damit signifikant anders als in Ländern wie Frankreich mit knapp 20, Spanien mit über 30 und vor allem den Niederlanden mit etwa 70 Prozent Anteil. Aber auch in Deutschland stieg der Anteil der Privatschulen im Laufe der Jahre bis heute auf etwa 11 Prozent. Laut Schulbehörde gab es 2020 in Hamburg 74 Schulen in freier Trägerschaft.
Zwei Standorte: Borgfelder Straße und Harvestehuder Weg
Einen Rückschlag gab es für Heinz Brecht, nachdem das neue Brecht-Gymnasium in einer 1956 von ihm angemieteten und zu einer Schule umgebauten Privatvilla im Winterhuder Kai 16 im gleichnamigen Stadtteil (direkt an der Alster neben der »Komödie Winterhuder Fährhaus«) gestartet war. Zunächst erklärte die Schulbehörde die Räumlichkeiten für zu klein, so dass weniger Kinder aufgenommen werden konnten als geplant. Dann wurde der Wohnbezirk unmittelbar am Alsterlauf zu einem besonders wohngeschützten Gebiet erklärt, in welchem für eine Schule kein Platz sei. Nun war wieder Brecht als Kaufmann gefragt. Mit Elternkrediten (die in den Folgejahren komplett zurückgezahlt wurden) mietete er noch im selben Jahr das Gebäude Harvestehuder Weg 22 direkt an der Außenalster (die heute so genannte »Joop-Villa« in der Nähe des »Cliff«) an und ließ es so umbauen, dass das Gymnasium zum 01.10.56 umziehen konnte.
Das neue Schulgebäude löste ein Problem nicht, das die Brecht-Schule bis zum Jahr 2003 verfolgen sollte: Der Unterricht fand auch hier in Räumen statt, welche ursprünglich für ein normales Wohnhaus vorgesehen und damit eigentlich zu klein für eine Schule waren. Dies sollte später auch für die Gebäude im Holzdamm gelten. Es war also ausgesprochen eng bei Brecht, mit entsprechenden Folgen für alle Beteiligten sowie für den Handlungsspielraum bei den Unterrichtsmethoden, von Fachräumen ganz zu schweigen.
Unter diesen Bedingungen bezog das Brecht-Gymnasium im Harvestehuder Weg 15 Räume, in denen insgesamt maximal, bei äußerster Enge, 240 Schüler*innen untergebracht werden konnten. Sehr klein und eng war auch der Schulhof, wenn der kleine Garten, in welchem sich die Schüler*innen in den Pausen aufhielten, überhaupt so genannt werden konnte. (Ähnlich sollte später die Situation im Holzdamm sein.)
Die Brecht-Schule hatte nun zwei Standorte, zum einen in der Borgfelder Straße, zum anderen im Harvestehuder Weg. Dies ermöglichte einerseits die weitere Expansion der Schule, war aber auch eine Belastung für die Lehrkräfte, die an beiden Standorten arbeiteten und pendeln mussten, eine Situation, die es später, von 2003 bis 2011, auch für die Standorte Holzdamm und Norderstraße gab.
Heinz Brecht delegiert die kaufmännische und pädagogische Leitung
Um die Führung der groß gewordenen Schule zu verstärken, übertrug Heinz Brecht zwei Studenten, die bei ihm unterrichteten, Leitungsaufgaben. 1955 wurde Paul Weidmann im Alter von 24 Jahren von Brecht zum kaufmännischen Leiter ernannt. Weidmann war seit 1953 bei Brecht und hatte gerade einen zweijährigen Kurzlehrgang für Bürowirtschaft absolviert. Er übernahm nun die Buchhaltung der Schule, einen Aufgabenbereich, der Heinz Brecht nicht zu liegen schien, so dass er sich nur selten einen Überblick über seine Einnahmen und Ausgaben verschaffte und kaum in der Lage war, seine Kasse abzurechnen. Er war eben eher ein unternehmerisches als ein buchhalterisches Talent.
Danach ernannte Brecht seinen noch im Studium befindlichen Lehrer Jörn Wittern zum pädagogischen Leiter. Dieser startete die ersten pädagogischen Initiativen, es fanden nun erstmals Lehrerkonferenzen statt, schulinterne Curricula für die einzelnen Fächer wurden ausgearbeitet. Wittern stellte auch das an der Brecht-Schule vorherrschende lehrerzentrierte Dozieren in Frage und setzte sich für offenen Unterricht und schüleraktivierende Methoden ein. Zudem warb er Studierende an, welche bereit waren, neben ihrem Studium Unterrichtsstunden bei Brecht zu geben.
1960 führte Wittern interne Vorprüfungen ein, welche alle Schüler*innen bestehen mussten, um danach zu den externen staatlichen Prüfungen angemeldet zu werden. Durch diese Generalprobe hatte die Schulleitung nun eine Handhabe, nur solche Schüler*innen zu den Fremdenprüfungen zuzulassen, die eine realistische Chance auf Erfolg hatten. Für die Brecht-AbiturientInnen bedeutete dies acht interne Prüfungen (vier schriftliche, vier mündliche) und acht externe Prüfungen, quasi ein Prüfungsmarathon. Dennoch fiel in der Regel weiterhin oft mehr als die Hälfte der Schüler*innen in der Fremdenprüfung durch. Um den besonders harten Hamburger Prüfungsbedingungen zu entgehen, meldete Wittern in dieser Zeit seine Schüler*innen immer wieder in anderen Städten wie Buxtehude oder Lübeck zur externen Prüfung an, wodurch die Bestehensquoten sich etwas besser gestalteten.
Letztlich konnte sich Witterns Idee einer offenen, schülerorientierten Unterrichtskonzeption in dieser Phase der Schulentwicklung nicht durchsetzen. Dabei spielte eine Rolle, dass die Brecht-Lehrkräfte in der Regel über keine abgeschlossene pädagogische Ausbildung verfügten und der Unterricht weitgehend darauf ausgerichtet war, die Schüler*innen auf punktuelle externe Prüfungen vorzubereiten und dafür den Stoff zu »pauken« (ein Begriff, der vom Einüben des Fechtens von schlagenden Studentenverbindungen stammt und später im übertragenen Sinne für mechanisches Lernen und Auswendiglernen vor Prüfungen steht). Der – neben der Reporterlegende Gerd Ruge – wohl berühmteste Absolvent der Brecht-Schule in dieser Frühzeit, der deutsch-britische Soziologe und Politiker Sir Ralf Dahrendorf, schrieb später in seinen Memoiren von einer »Presse«, in der er sich in Hamburg auf sein Abitur vorbereitet habe. (Er ließ dabei offen, ob ihm eher das Wissen von den Lehrkräften wie beim »Nürnberger Trichter« hineingepresst wurde oder ob er es bei den Abschlussprüfungen herauspressen musste. Vielleicht meinte er auch beides.)
Erfolgreicher war das Tandem Weidmann-Wittern beim Verbot des Rauchens im Unterricht. Gegen den Widerstand von studentischen Lehrkräften und erwachsenen Schüler*innen, die während des Unterrichts um die Wette zu rauchen schienen, so dass manche Hinterbänkler durch den Qualm ihre Sicht auf die Tafel beeinträchtigt sahen (Nichtraucher*innen begannen selten bei Brecht und hielten dort in der Regel nicht lange durch), setzten sie das Rauchverbot durch.
Die Grundkonstellation, dass die Brecht-Lehrkräfte ihre Schüler*innen auf die Abschlussprüfungen vorbereiteten, dann aber an diesen keinerlei Anteil hatten, sondern ihren Zöglingen nur noch die Daumen drücken konnten, führte insgesamt zu einer engen Verbundenheit von Schüler- und Lehrerschaft, da man quasi im selben Boot saß. Man freute sich gemeinsam über erfolgreiche Prüfungen und litt zusammen unter den vielen Durchfallern.
Da diese Situation in den allgemeinbildenden Bereichen der Brecht-Schule bis zur staatlichen Anerkennung des Brecht-Gymnasiums 2001, also über 50 Jahre lang, andauerte, ist die Hypothese vermutlich nicht vermessen, dass hier der Grundstein gelegt wurde für die ausgezeichnete Lehrer-Schüler-Beziehung, welche die Brecht-Schule heute noch – allerdings unter ganz anderen und für alle Beteiligten sehr viel besseren Bedingungen – prägt. Brecht-Lehrkräfte hatten es von Beginn an mit besonderen Schüler*innen zu tun und entwickelten immer einen besonderen Blick für jeden einzelnen von ihnen. Es war eine Zusammenarbeit fast auf Augenhöhe, schon von Beginn an im Sinne von Jesper Juuls späterem Begriff der »Gleichwürdigkeit« von Lehrkräften und Schüler*innen.
Umzug in den Holzdamm (1959)
Das nächste große Projekt von Heinz Brecht war der Umzug der Lehranstalt Brecht von den zu klein gewordenen Wohnungen in der Borgfelder Straße in den zentral gelegenen Holzdamm 36, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof (nach einer Verlängerung der Gleise waren später bei offenem Fenster während des Unterrichts die Durchsagen über die einfahrenden Züge zu hören). Am Ende der Straße befanden sich das bekannte Hotel Atlantic und die Außenalster.
Das Gebäude schien wegen seiner zentralen Lage für Heinz Brecht schon seit Längerem attraktiv zu sein. Im Weg stand ihm allerdings die private Brechtefeldt-Schule (deren Namensgeber zwei Jahre zuvor gestorben war), die dort untergebracht war (und in der Brecht nebenher Stunden gegeben hatte). Heinz Brecht gelang es durch die Bereitschaft zu einer höheren Miete und die Übernahme der Renovierungskosten, den Vermieter dazu zu bewegen, den Mietvertrag der Brechtefeldt-Schule auslaufen zu lassen, so dass die Brecht-Schüler*innen Einzug halten konnten. Die Brechtefeldt-Schule erhielt – nicht zuletzt aufgrund guter Beziehungen des Schulleiters Dr. Grapengeter zur Behörde – stattdessen von der Stadt das Haus des CVJM, welcher im Nachbargebäude Holzdamm 38 untergebracht war. Brecht und Brechtefeldt befanden sich nun als unmittelbare Konkurrenten quasi wörtlich auf Augenhöhe.
Die Brechtefeldt-Schule konnte als Privatschule auf eine deutlich längere Tradition zurückgreifen als die Brecht-Schule. Die Einrichtung von Dr. Waldemar Brechtefeldt (1879-1957) war aus dem »Institut Dr. Gustav Goldmann« hervorgegangen, dessen Namensgeber 1870 eine Lehranstalt zur Vorbereitung auf die mittlere Reife am Neuen Wall in Hamburg gegründet hatte.
Einer der bekanntesten Schüler des Goldmann-Instituts war der spätere pazifistische Herausgeber der »Weltbühne«, KZ-Häftling und Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky (Jahrgang 1889), der aber wegen seiner Schwächen in Mathematik noch vor dem Ersten Weltkrieg zweimal bei dem Versuch scheiterte, die staatliche externe Prüfung zur mittleren Reife (Realschulabschluss) zu bestehen. Ein weiterer bekannter Absolvent war zuvor der Reeder Albert Ballin gewesen, der später die HAPAG zur größten Schifffahrtslinie der Welt entwickelte. Er machte 1874 mit 17 Jahren beim Goldmann-Institut seinen Schulabschluss.
Die Brechtefeldt-Schule blieb zunächst (bis 1977) im Nebenhaus, während der Holzdamm 36 in den Jahren 1959 und 1960 komplett entkernt und nach den Vorstellungen von Brecht hergerichtet wurde. Immer wenn eine Etage fertig war, wurden die Schüler*innen – angefangen mit der Handelsschule – schrittweise von der Borgfelder Straße in den Holzdamm überführt. In der Borgfelder Straße wurde in den kommenden Jahren eine Wohnung nach der anderen aufgegeben, so dass hier das Geld gespart wurde, das Brecht für den Holzdamm benötigte. Am Ende blieb die Wohnung der Familie Brecht im 3. Stock.
Die Vorteile des Holzdamms lagen auf der Hand: mehr Klassenräume und die zentrale Lage. Allerdings galt auch hier, dass es sich – wie bei den vorhergehenden Standorten – um Gebäude handelte, welche als Wohnungen gebaut worden waren. Die Raumgröße unterschied sich jeweils danach, ob hier eine Küche, ein Schlafzimmer oder – im besten Fall – ein Wohnzimmer gewesen war. Bei sehr enger Aufstellung von Schultischen und -stühlen konnten in der Regel zwischen 16 und maximal 24 Schüler*innen (später im Holzdamm 38 auch bis zu 28 Schüler*innen) untergebracht werden (in der Krisenzeit unter Gisela Brecht Ende der 1960er-Jahre wurde teilweise auf Tische verzichtet, um Klassen zusammenlegen zu können).
Die Lehrkräfte standen im Unterricht daher in etlichen Räumen im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Rücken an der Wand bzw. an der Tafel. Es benötigte manchmal etwas Kreativität, um den Lehrerstuhl so vor das Pult zu stellen, dass die Unterrichtenden sich hier setzen konnten, ohne Atembeklemmungen zu bekommen. Das Gehen zwischen den Tischreihen war aufgrund der Enge häufig beschwerlich. Auch dies förderte den lehrerzentrierten, dozierenden Unterrichtsstil.
Krisenzeit: Das Ende der Ära Heinz Brecht
Heinz Brecht gab dem Team Weidmann-Wittern immer mehr freie Hand und zog sich aus gesundheitlichen Gründen schrittweise aus dem Tagesgeschäft zurück. Er litt unter schwerem Asthma und starb an dessen Folgen 1966 im Alter von 64 Jahren.
Da es sich bei der Brecht-Schule um keine GmbH oder Kapitalgesellschaft, sondern um ein Einzelunternehmen handelte, das allein im Privatbesitz von Heinz Brecht gewesen war, wurde jetzt seine Ehefrau Gisela Brecht die Alleinerbin. Sie war Außenhandelskauffrau, hatte beim Institut Dr. Hartmann Abitur gemacht und danach ihr Englisch-Studium nicht beendet.
Jörn Wittern verließ noch im selben Jahr die Brecht-Schule und wurde später Professor für Pädagogik an der Universität Hamburg.
Paul Weidmann wechselte ein Jahr danach als Lehrer an eine staatliche Handelsschule und machte später seinen Abschluss als Diplom-Pädagoge. Nachfolger von Wittern wurde zunächst Thomas Zilling, der aber auch bald in den Staatsdienst wechselte, und danach Dr. Georg Kriszat.
Durch das Ausscheiden der drei prägenden Persönlichkeiten – Heinz Brecht, Jörn Wittern und Paul Weidmann – geriet die Schule nun in eine krisenhafte Lage. Gisela Brecht versuchte durch rigide Sparmaßnahmen, die schwierige Situation zu bewältigen. Klassen wurden bis zu einer Größe von 36 Schüler*innen zusammengelegt, die Zahl der Wochenstunden für einzelne Fächer gekürzt, die Bürokräfte wurden entlassen und durch die beiden Brecht-Töchter Gitta und Edda ersetzt, welche für diese Aufgabe allerdings über eine eher überschaubare Qualifikation verfügten. Die Räume waren renovierungsbedürftig, viele Schulmöbel beschädigt. Der Schule ging es zunehmend schlechter, auch weil nach Einschätzung von Weidmann »am falschen Ende gespart« wurde.
Die Sparmaßnahmen verschlechterten die Stimmung an der Schule merklich. Die Schülerzahl ging zurück. 1968 wurde den Lehrkräften kein regelmäßiges Gehalt mehr ausgezahlt. Die meisten Kolleg*innen waren Honorarkräfte, um eine Festanstellung konnte nur jemand »nachsuchen«, der sich verpflichtete, mindestens ein weiteres Jahr an der Schule zu bleiben und nicht – wie so viele – zu einer staatlichen Schule abzuwandern.
Eine zusätzliche Belastung war, dass die Schule bei rückläufigen Schülerzahlen immer noch drei Standorte hatte und finanzieren musste, die Gebäude im Holzdamm, im Harvestehuder Weg sowie in der Borgfelder Straße.
Die Schule stand unmittelbar vor dem Konkurs. Gisela Brecht schloss vorübergehend die unrentable Handelsschule und das zusammengeschrumpfte Gymnasium zog (aus dem Harvestehuder Weg) zusammen mit der Lehranstalt Brecht (die noch einige wenige Räume in der Borgfelder Straße belegt hatte) komplett in den Holzdamm 36. Einen Anstoß dafür gaben vermutlich auch die letzten externen Prüfungen, bei denen von 20 angetretenen Brecht-Handelsschüler*innen nur einer bestanden hatte. Die Anmeldungen gingen merklich zurück, Werbemaßnahmen brachten keinen Erfolg. Im August 1967 waren morgens noch 75 und abends 90 SchülerInnen geblieben.
Dazu schien es kaum zu passen, dass die Behörde 1967 (Herbert Weichmann, SPD, hatte 1965 mittlerweile Paul Nevermann als Ersten Bürgermeister abgelöst) die noch von Heinz Brecht beantragte Private Realschule genehmigte. Es gab nun zahlreiche Schulzweige, aber kaum noch Schüler*innen.
Unzufriedene Brecht-Lehrkräfte trafen sich nun regelmäßig beim Chinesen um die Ecke in der Ernst-Merck-Straße und berieten, welcher Weg aus der Krise führen könnte und wie die Ablösung der Schulleitung zu organisieren wäre.
Zunächst wurde 1968 ein Betriebsrat gegründet, um die Interessen des Kollegiums gegenüber der Schuleigentümerin Gisela Brecht formulieren und durchsetzen zu können. Bis dahin hatte es in dem so lange patriarchalisch geführten Unternehmen keinerlei Mitbestimmungsgremien gegeben. Die Wahl einer Interessenvertretung fiel in die Zeit der Studentenbewegung und der außerparlamentarischen Opposition (APO). Nach dem Attentat auf Studentenführer Rudi Dutschke kam es auch in Hamburg in der Nacht zum Karfreitag 1968 zu Belagerungen, Demonstrationen und Versuchen, die Auslieferung der BILD-Zeitung mit Blockaden zu verhindern.
So weit ging es an der Brecht-Schule nicht, aber das Kollegium war – entsprechend dem Zeitgeist – nicht länger bereit, die Macht der Eigentümerin Gisela Brecht einfach hinzunehmen. Der neue Betriebsrat forderte die Schulbesitzerin nun auf, die Schule an eine Gruppe von Lehrer*innen zu übergeben, welche sich in der Krise formiert hatte.
Zum Betriebsratsvorsitzenden wurde der Geografie-Lehrer Bruno Birnbaum gewählt, der neben seiner Arbeit bei Brecht an der Universität Hamburg die Fächer Englisch und Geografie auf Lehramt studiert hatte, aber im 1. Staatsexamen durchgefallen war.
Birnbaum selbst schrieb später über seine Tätigkeit bei Brecht in dieser Zeit: »Ich war damals der einzige Geographielehrer der Schule. Bald wurde ich zum ›Wanderer‹ zwischen den drei Schulstandorten. Mein Stundendeputat betrug 30 Std./Woche vormittags und 12 Std./Woche abends. Die Besoldung betrug DM 5,- (spitze Abrechnung!) pro Stunde. Herr Prof. Wittern notierte auf der Bewerbungsnotiz: ›wie üblich‹.«
Er hatte den Betriebsratsvorsitz bis zum »Sturz« der Brecht-Dynastie 1969 inne und entwickelte sich in der Folgezeit zur Schlüsselfigur der Schule.
Der Betriebsrat war danach bis heute – vergleichbar mit dem Personalrat staatlicher Schulen – als Interessenvertretung der Brecht-Mitarbeiterschaft eine selbstverständliche Einrichtung, und auf Bruno Birnbaum folgten noch viele weitere Betriebsratsvorsitzende bis zur heutigen Amtsinhaberin Christina Ralf.
2. AUF DER KIPPE
Die Ära Bruno Birnbaum (1969-2001) Die Brecht-Schule zwischen Stabilität und Stagnation
Während in der Bundeshauptstadt Bonn der neue Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) eine zwanzigjährige CDU-Regentschaft beendete, musste Gisela Brecht, inzwischen mit dem Rücken zur Wand, gegenüber den »aufständischen« Lehrkräften schließlich kapitulieren. Die Lehrer*innen verzichteten auf einen Teil ihres Gehalts, übernahmen das gesamte Mobiliar der Schule und durften die Rechte des Firmennamens (die Marke »Brecht« war zu diesem Zeitpunkt in Hamburg schon eine bekannte Größe) übernehmen. Gisela Brecht erhielt eine Anstellung als Bürokraft an der Brecht-Schule.





























