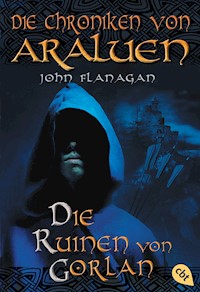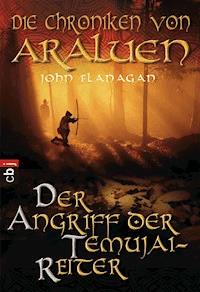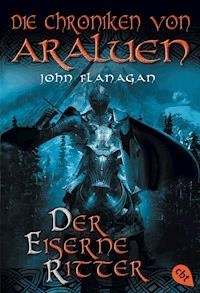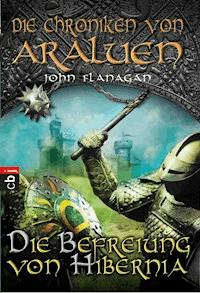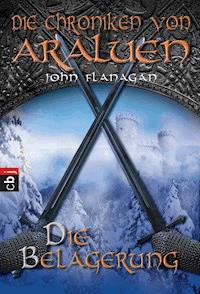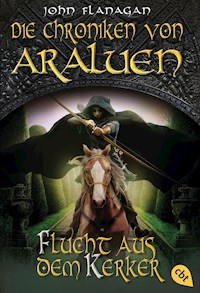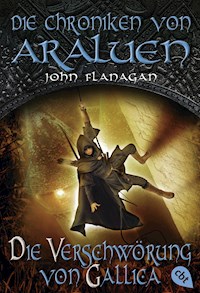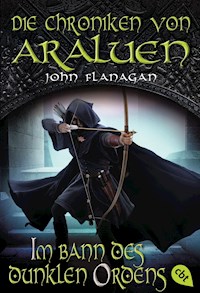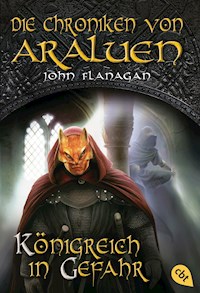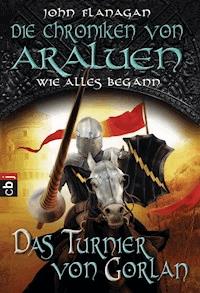7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Chroniken von Araluen
- Sprache: Deutsch
Ein mitterlalterliches Königreich, bedroht von bösen Kräften und ungeheuerlichen Kreaturen, verteidigt von einem jungen Waldläufer und seinen Freunden - willkommen in Araluen!
Der Waffenstillstand Araluens mit den Skandianern ist noch frisch, als König Duncan die Nachricht erreicht, dass Erak, der Anführer Skandias vom Wüstenvolk der Arridi gefangen genommen wurde. Kurz entschlossen brechen der Waldläufer Will und seine Freunde Walt, Gilan, Evanlyn und Horace auf, um den Skandianer zu befreien. Doch Sandstürme, unbarmherzige Hitze und feindselige Nachbarvölker machen die Mission zu einem Wettlauf gegen die Zeit ...
Spannende und actionreiche Abenteuer in einem fantastisch-mittlalterlichen Setting – tauche ein in »Die Chroniken von Araluen«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DER AUTOR
John Flanagan arbeitete als Werbetexter und Drehbuchautor, bevor er das Bücherschreiben zu seinem Hauptberuf machte. Den ersten Band von »Die Chroniken von Araluen« schrieb er, um seinen 12-jährigen Sohn zum Lesen zu animieren. Die Reihe eroberte in Australien in kürzester Zeit die Bestsellerlisten.
Inhaltsverzeichnis
Für Rachel Skinner(Ich hoffe, du sitzt gerade, wenn du das liest.)
Vorbemerkung: Die Handlung von »Der Gefangene des Wüstenvolks« ist zeitlich zwischen Band 4 und 5 angesiedelt
Der Wachposten sah die dunkel gekleidete Gestalt, die in tiefster Nacht auf Schloss Araluen zuschlich, nicht kommen.
Der Eindringling bewegte sich im Spiel von Licht und Schatten und schien mit dem nächtlichen Schwarz zu verschmelzen, so geschickt passte er sich dem Wiegen der Bäume im Wind und den Schatten der Wolken über dem Halbmond an.
Er befand sich in der Nähe des südöstlichen Turms, im äußeren Sperrgürtel außerhalb der massiven Schlossmauer. Das Wasser im Burggraben hinter ihm kräuselte sich im Wind, sodass sich die Sterne im dunklen Wasser als Tausende unruhige Lichtpunkte spiegelten. Vor dem Posten erstreckte sich der riesige Park mit Obst- und Ziergehölzen, der das herrschaftliche Anwesen umgab und dessen Rasen stets sorgfältig gepflegt wurde.
Die Gartenanlage um das Schloss herum war leicht abschüssig, Baumgruppen bildeten kleine schattige Nischen zum Hinsetzen und Entspannen oder gar für ein trautes Stelldichein zu zweit, geschützt vor der heißen Mittagssonne. Dazwischen befand sich jedoch offenes Gelände, sodass keine größeren Angriffe im Schutz von Bäumen möglich waren. In Zeiten, in denen man stets mit einem Angriff rechnen musste, stellte diese Anlage einen wohlüberlegten Kompromiss dar zwischen der Möglichkeit, sich frei zu bewegen und dem Bedürfnis nach Sicherheit.
Etwa achtzig Fuß links von der Wache befand sich ein Picknicktisch, den man aus einem alten Wagenrad gezimmert und auf einem Baumstumpf festgemacht hatte. Um den Tisch standen rustikale Bänke und daneben war ein kleiner Baum, der zur Mittagszeit Schatten spendete. Dieser beliebte Ruheplatz für die Ritter und ihre Damen bot einen schönen Ausblick über den Park, der in einiger Entfernung sanft in ein Waldstück überging.
Auf eben diesen Tisch steuerte der Eindringling nun zu.
Die dunkle Gestalt schlüpfte in den Schatten einer schmalen Gehölzgruppe, vielleicht sechzig Fuß von der Bank entfernt, dann ließ sie sich bäuchlings auf den Boden fallen. Nach einem letzten Blick in die Runde kroch sie geduckt auf den Tisch zu.
Die Person ließ sich dabei sehr viel Zeit. Sie war offensichtlich geübt und wusste, dass jede schnelle Bewegung auffallen würde. Als die Schatten der Wolken über den Park hinwegzogen, bewegte sich die Gestalt mit ihnen, ja sie schien lediglich ein weiterer Schatten zu sein. Die dunkelgrüne Kleidung diente der Tarnung. Schwarz wäre zu dunkel gewesen und hätte womöglich selbst einen Schatten verursacht. Dunkelgrün hingegen verschmolz mit dem Farbton des Grases.
Es dauerte an die zehn Minuten, um die Entfernung zum Tisch zurückzulegen. Ein paar Schritte vor dem Ziel verharrte die Gestalt, da der Wachposten sich plötzlich kerzengerade hinstellte, als hätte irgendein Geräusch oder eine Bewegung ihn alarmiert – vielleicht war es auch nur ein Instinkt, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Mann drehte sich um und spähte in die richtige Richtung, ohne jedoch die dunklen Umrisse in der Nähe des Tisches wahrzunehmen.
Schließlich schien der Wachmann überzeugt, dass keine Gefahr drohte, schüttelte den Kopf, stampfte mit den Füßen auf, marschierte ein paar Schritte nach rechts und wieder zurück nach links, wechselte seinen Speer von der rechten in die linke Hand und rieb sich die müden Augen. Er langweilte sich und war erschöpft, was, wie er wusste, meist der Auslöser dafür war, sich Dinge einzubilden.
Er gähnte, dann verlagerte er das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Er schniefte schuldbewusst. Untertags käme er mit einer solchen Haltung niemals davon. Doch jetzt war es nach Mitternacht und sein Vorgesetzter würde wohl kaum in der nächsten Stunde vorbeikommen, um ihn zu kontrollieren.
Als der Wachposten sich wieder entspannte, glitt die dunkle Gestalt weiter das letzte Stück bis zu dem großen Tisch. Dort ging sie langsam in die Hocke und sondierte die Lage. Der Wachposten würde leicht zu überwältigen sein.
An der Taille des Eindringlings hing ein Lederband. Bei genauerem Hinsehen konnte man es nun, da es gelöst wurde, als eine Schlinge mit einem weichen Ledersäckchen in der Mitte erkennen. Ein glatter Stein wurde in den Beutel geschoben, die Gestalt erhob sich ein wenig und begann, die schlichte Waffe langsam im Kreis zu schleudern.
Der Wachmann nahm ein merkwürdiges Geräusch wahr. Es begann als ein tiefes, fast unhörbares Brummen, das langsam höher wurde, fast wie das Summen eines Insekts, vielleicht einer riesigen Biene. Es war schwierig, die Richtung auszumachen, aus der das Geräusch kam. Da fiel dem Wachmann ein, dass ein anderer Wachposten vor ein paar Tagen ein solches Geräusch erwähnt hatte. Er hatte erzählt, es sei …
Klong! Der Posten wurde in seinen Überlegungen abrupt unterbrochen. Etwas knallte gegen seinen Speerkopf. Die Wucht des Geschosses riss dem Mann die Waffe aus dem lockeren Griff und schleuderte sie zu Boden. Instinktiv zog der Wachposten sein Schwert, als eine schlanke Gestalt sich hinter dem Tisch erhob.
Der Alarmschrei des Wachmanns blieb aus, denn der Eindringling schlug die dunkle Kapuze zurück und langes blondes Haar kam zum Vorschein. Das Vergnügen bei den Worten: »Keine Sorge, ich bin’s nur«, war unüberhörbar.
Selbst in der Dunkelheit und bei einer Entfernung von achtzig Fuß waren die lachende Stimme und das blonde Haar von Cassandra, Kronprinzessin von Araluen unverkennbar.
Das muss aufhören, Cassandra«, sagte Duncan. Er war wütend, daran bestand kein Zweifel. Wenn es nicht so offensichtlich gewesen wäre, weil er aufgebracht in seinem Arbeitszimmer hinter dem Schreibtisch auf und ab marschierte, hätte sie es daran gemerkt, dass er sie Cassandra nannte. Sein Kosename für sie war Cass oder Cassie. Nur wenn er wirklich böse auf sie war, sprach er ihren vollen Namen aus.
Und heute war er böse. Er hatte einen arbeitsreichen Vormittag vor sich. Auf dem Schreibtisch stapelten sich Petitionen und Urteile, eine Handelsdelegation aus Teutlandt forderte seine Aufmerksamkeit, und trotz alledem musste er sich mit einer Beschwerde über das Benehmen seiner Tochter beschäftigen.
Sie hob die Hände zu einer besänftigenden Geste. »Papa, ich wollte nur …«
»Du hast dich nach Mitternacht draußen herumgetrieben, einem unschuldigen Wachmann aufgelauert und ihm dann mit deiner verdammten Schlinge eine Heidenangst eingejagt! Was, wenn du ihn getroffen hättest und nicht seinen Speer?«
»Hab ich aber nicht«, antwortete sie schlicht. »Ich treffe mein Ziel. Und ich habe auf die Speerspitze gezielt.«
Er sah sie aufgebracht an und streckte die Hand aus.
»Her damit«, befahl er. Als sie fragend den Kopf zur Seite legte, fügte er hinzu: »Die Schlinge. Her damit.«
Entschlossen schob sie das Kinn vor. »Nein.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Du widersetzt dich mir, dem König?«
»Ich widersetze mich nicht. Ich gebe dir nur nicht meine selbst gemachte Schlinge. Eine Woche habe ich gebraucht, um sie richtig hinzubekommen. Seit Monaten übe ich nun damit, weil ich mein Ziel sicher treffen will. Ich werde sie dir nicht geben, nur damit du sie zerstörst. Tut mir leid.« Die Entschuldigung fügte sie nach einer winzigen Pause hinzu.
»Ich bin außerdem dein Vater«, erinnerte er sie.
Sie nickte. »Das respektiere ich auch. Aber im Augenblick bist du wütend. Und wenn ich dir jetzt meine Schlinge gäbe, dann würdest du sie sofort und ohne zu zögern zerstören, ist es nicht so?«
Er schüttelte aufgebracht den Kopf und drehte sich zum Fenster. Sie befanden sich in seinem Arbeitszimmer, einem großen, luftigen und hellen Raum, von dem aus man auf den Park blicken konnte.
»Ich kann nicht zulassen, dass du nachts draußen herumschleichst und die Wachposten überraschst«, sagte er. Er hatte gemerkt, dass er bezüglich der Schlinge nicht weiterkam, und hielt es für das Beste, seine Taktik zu ändern. Er wusste genau, wie stur seine Tochter sein konnte.
»Es ist nicht anständig den Männern gegenüber«, fuhr er fort. »Dies ist nun schon zum dritten Mal passiert, und sie haben deine albernen Spiele langsam satt. Der Oberste Wachhabende hat mich um ein Gespräch gebeten, und ich weiß genau, worum es gehen wird.« Er drehte sich zu ihr. »Du hast mich in eine sehr schwierige Lage gebracht. Ich werde mich bei ihm entschuldigen müssen. Ist dir klar, wie peinlich das ist?«
Er sah, wie der Ärger aus ihrem Gesicht wich. »Das tut mir leid, Vater«, antwortete sie steif, denn für gewöhnlich nannte sie ihn Papa. Heute jedoch waren sie Cassandra und Vater. »Aber es ist kein albernes Spiel, glaub mir. Es ist etwas, was ich tun muss.«
»Warum?«, fragte er, immer noch aufgebracht. »Du bist die Kronprinzessin, nicht irgendein Dorfmädchen! Du lebst in einem Schloss mit Hunderten von Soldaten, die dich beschützen! Warum um alles in der Welt musst du lernen, wie man in der Dunkelheit umherschleicht und obendrein noch die Waffe eines Wilderers benutzt?«
»Papa!«, sagte sie und vergaß alle Formalitäten: »Denk doch an meine bisherigen Erfahrungen. Ich wurde in Celtica von den Wargals verfolgt. Meine Begleitgarde wurde getötet und ich bin gerade so mit dem Leben davongekommen. Dann wurde ich von Morgaraths Armee gefangen genommen. Ich wurde nach Skandia verschleppt, wo ich allein in den Bergen überleben musste. Ich hätte dort sterben können. Danach war ich in eine entsetzliche Schlacht verwickelt. Deine vielen Wachen haben mich davor nicht schützen können, oder?«
Duncan winkte irritiert ab. »Nun ja, vielleicht nicht. Aber…«
»Sehen wir doch einmal den Tatsachen ins Auge«, fuhr Cassandra fort, »es ist eine gefährliche Welt, und als Kronprinzessin bin ich ein Ziel für unsere Feinde. Ich möchte in der Lage sein, mich selbst zu schützen. Ich möchte mich nicht auf andere Leute verlassen müssen. Außerdem …« Sie zögerte.
»Außerdem?«, fragte er nach. Cassandra schien zu überlegen, ob sie den nächsten Satz tatsächlich aussprechen sollte. Dann holte sie tief Luft und sprach weiter.
»Als deine Tochter sollte ich dir irgendwann helfen können und einen Teil deiner Pflichten auf mich nehmen.«
»Aber das tust du doch bereits! Das Bankett letzte Woche war ein voller Erfolg …«
Sie winkte ab. »Ich meine damit nicht Bankette und Staatsempfänge oder ein Picknick im Park. Ich meine die wichtigen Dinge: in deinem Namen auf diplomatische Mission zu gehen, als deine Stellvertreterin zu handeln, wenn Streitigkeiten beigelegt werden müssen. Die Art von Dingen, die du auch von einem Sohn erwarten würdest.«
»Aber du bist nicht mein Sohn«, sagte Duncan.
Cassandra lächelte traurig. Sie wusste, ihr Vater liebte sie. Doch sie wusste auch, dass ein König, jeder König, sich einen Sohn wünschte, der sein Werk fortführte.
»Papa, eines Tages werde ich Königin sein. Nicht zu bald, hoffe ich«, fügte sie hastig hinzu und Duncan nickte lächelnd. »Aber wenn ich es einmal sein werde, dann werde ich diese Dinge tun müssen und vielleicht ist es zu jenem Zeitpunkt etwas spät, mit dem Lernen anzufangen.«
Duncan musterte sie nachdenklich. Cassandra hatte einen starken Willen, das wusste er. Sie war tapfer, tüchtig und intelligent. Sie würde sich auf keinen Fall damit begnügen, als Herrscherin nur ein Schmuckstück zu sein, während andere die wichtigen Entscheidungen treffen.
»Damit hast du möglicherweise recht«, sagte er schließlich. »Du sollst ja auch lernen, dich selbst verteidigen zu können. Aber Sir Richard hat dir beigebracht, wie man den Säbel führt. Warum gibst du dich mit der Schlinge ab … und warum willst du lernen, unbemerkt umherzuschleichen?«
Es war nicht ungewöhnlich für hochwohlgeborene junge Damen, die Schwertkunst zu erlernen. Cassandra nahm schon seit einigen Monaten Unterricht bei dem stellvertretenden Heeresmeister und benutzte dabei einen leichten Säbel, der speziell für sie hergestellt worden war. Sie sah ihren Vater jetzt entschuldigend an.
»Ich komme damit zurecht«, gab sie zu. »Aber ich werde niemals eine richtige Schwertkünstlerin sein. Und genau das müsste ich werden, wenn ich mich gegen einen Mann mit einer schweren Waffe ernsthaft verteidigen will. Das Gleiche gilt für den Bogen. Es ist jahrelange Übung nötig, um ihn wirklich gut einsetzen zu können, und dafür habe ich nicht die Zeit.
Die Schlinge ist eine Waffe, die ich bereits gut kenne. Ich habe schon als Kind gelernt, damit umzugehen. Sie hat mich in Skandia am Leben erhalten. Ich habe beschlossen, dass sie die Waffe meiner Wahl ist und ich meine diesbezüglichen Fähigkeiten vervollkommnen will.«
»Das könntest du auch auf einem Übungsgelände tun. Dazu brauchst du nicht meine Wachen in Angst und Schrecken zu versetzen«, sagte Duncan.
Sie lächelte entschuldigend. »Ich gebe zu, das war ihnen gegenüber nicht anständig. Aber Geldon sagte, die beste Übung sei es, wenn man die Situation so echt wie möglich macht.«
»Geldon?« Duncan zog die Augenbrauen zusammen. Geldon war ein Waldläufer im Ruhestand, der eine kleine Unterkunft auf Schloss Araluen hatte. Gelegentlich diente er Crowley, dem Obersten Waldläufer, als Ratgeber. Cassandra wurde rot, als ihr klar wurde, dass sie mehr verraten hatte, als sie wollte.
»Ich habe ihn lediglich um ein paar Ratschläge gebeten, wie man sich am besten ungesehen bewegt«, gestand sie und fügte dann eilig hinzu: »Aber er wusste nichts von der Schlinge, ehrlich.«
»Mit ihm werde ich später reden«, sagte Duncan, obwohl er keine Zweifel an ihrer Aussage hatte. Geldon würde sie gewiss nicht zu so unverantwortlichem Handeln ermuntern.
Er setzte sich und atmete einige Male tief durch, um seinen Ärger abklingen zu lassen. Dann sagte er in ruhigerem Ton: »Cass, denk doch einmal nach. Deine Eskapaden könnten dich oder auch das Schloss in ernste Gefahr bringen.«
Sie neigte den Kopf und sah ihren Vater verständnislos an.
»Jetzt, wo die Wachen wissen, was du treibst, könnten sie vielleicht manchmal ein Geräusch oder eine Bewegung im Dunkeln missachten. Wenn sie eine dunkle Gestalt durch die Büsche kriechen sehen, werden sie annehmen, du wärst es. Aber sie könnten sich täuschen. Was, wenn ein Feind versucht, ins Schloss einzudringen? Das könnte den Tod eines Wachpostens zur Folge haben. Möchtest du das wirklich verantworten?«
Niedergeschlagen ließ Cassandra den Kopf hängen, als ihr klar wurde, dass er recht hatte. »Nein«, antwortete sie leise.
»Natürlich könnte auch das Gegenteil passieren. Eines Nachts könnte ein Wachposten jemand sehen, der sich anschleicht und nicht wissen, dass es die Kronprinzessin ist. Du selbst könntest getötet werden.«
Sie öffnete den Mund, um etwas einzuwenden, doch er hob nur die Hand.
»Ich weiß, du denkst, du bist zu geübt dafür. Aber überlege doch mal. Was würde mit dem Mann geschehen, der dich getötet hat? Möchtest du, dass er das auf dem Gewissen hat?«
»Natürlich nicht«, sagte sie düster. Ihr Vater nickte, zufrieden, dass sie diese Lektion gelernt hatte.
»Deshalb möchte ich, dass du mit diesen gefährlichen Spielchen aufhörst.« Wieder wollte sie etwas einwenden, doch er sprach weiter. »Wenn du üben willst, dann lass Geldon einen ordentlichen Plan für dich ausarbeiten. Ich bin sicher, er würde gern helfen, und es könnte sich für dich als schwieriger herausstellen, ihn zu überrumpeln als nur ein paar schläfrige Wachen.«
Cassandra schmunzelte, als ihr klar wurde, dass ihr Vater, anstatt die Schlinge zu konfiszieren, ihr sogar die Erlaubnis gegeben hatte, ihre Übungen fortzusetzen.
»Danke, Papa«, sagte sie und der Eifer in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »Ich fange heute noch an.«
Duncan schüttelte den Kopf.
»Das muss warten. Heute brauche ich deine Hilfe bei der Planung einer Reise – einer offiziellen Reise. Ich möchte, dass du entscheidest, wer uns begleiten soll. Und du wirst vielleicht auch noch ein paar neue Kleidungsstücke benötigen – ordentliche Reisekleidung und ein elegantes Abendkleid, nicht diese Tunika und die Beinkleider, die du trägst. Du hast gesagt, du willst helfen, hier hast du die Gelegenheit.«
Sie nickte und runzelte leicht die Stirn, als sie über die Vorbereitungen nachdachte, die sie würde treffen müssen, all die Dinge, um die sie sich kümmern müsste. Eine offizielle königliche Reise bedurfte umfangreicher Planung und schloss eine Menge Leute ein. Sie hatte ein paar geschäftige Wochen vor sich. Aber sie war froh, dass seine Aufmerksamkeit jetzt endgültig von der Sache mit der Schlinge abgelenkt worden war.
»Wohin reisen wir denn?«, fragte sie, »und wann genau?« Schließlich musste sie die Übernachtungen auf dem Weg dorthin planen.
»In drei Wochen«, antwortete der König. »Wir sind am Vierzehnten des nächsten Monats zur Hochzeit auf Burg Redmont eingeladen.«
»Redmont?«, wiederholte sie interessiert. »Wer heiratet denn auf Redmont?«
Walt fuhr sich mit der Hand durchs Haar, während er die Namensliste überflog.
»Bei Gorlogs Bart!«, rief er aus, ein Fluch der Nordländer, den er sich inzwischen angewöhnt hatte. »Wie viele Leute stehen denn auf dieser Liste?«
Lady Pauline betrachtete ihn gelassen. »Zweihundertunddrei«, antwortete sie ruhig.
»Zweihundertdrei?«, wiederholte er entsetzt, und sie nickte. Er schüttelte den Kopf und legte die Pergamentrolle auf den Schreibtisch. »Tja, dann müssen wir eben irgendwo kürzen.«
Pauline runzelte nachdenklich die Stirn. »Wir könnten vielleicht die drei Überzähligen loswerden«, sagte sie. »Eigentlich möchte ich den iberischen Botschafter und seine zwei dummen Töchter bei meiner Hochzeit gar nicht dabeihaben.«
Sie strich die letzten Namen auf der Liste. »Na bitte. Schon passiert. War doch ganz einfach.«
Walt wiegte den Kopf und nahm die Liste wieder in die Hand. »Aber … zweihundert Leute? Sind wirklich zweihundert Leute für unsere Hochzeit nötig?«
»Nötig sind sie vielleicht nicht, mein Lieber. Aber eingeladen werden sie trotzdem«, antwortete sie und ging absichtlich nicht weiter auf seinen Einwand ein. Er zog düster die Augenbrauen zusammen. Normalerweise war Walts Stirnrunzeln etwas, was den meisten Leuten Angst machte. Doch bei Lady Pauline war das anders. Sie hob selbst eine Augenbraue und hielt seinem Blick stand. Walt wurde klar, dass sein Stirnrunzeln bei ihr zwecklos war, also ließ er es bleiben. Er deutete auf den Anfang der Liste.
»Mal sehn … na gut, der König muss wohl dabei sein«, begann er.
»Natürlich muss er das. Du bist einer seiner ältesten Ratgeber«, stimmte Lady Pauline zu.
»Und Evanlyn – ich meine, Cassandra. Sie ist eine Freundin. Aber wer sind all diese anderen? Das sind ja fünfzehn Leute in der königlichen Gästeschar!«
»Siebzehn«, verbesserte ihn Lady Pauline. »Der König kann ja wohl schlecht ohne sein Gefolge reisen. Er und Cassandra können nicht einfach auf ihre Pferde steigen und dann bei uns vor der Tür stehen und sagen: ›Wir sind jetzt da. Die Hochzeit kann losgehen. Wo sitzen wir?‹ Es gilt ein gewisses Protokoll einzuhalten.«
»Protokoll!« Walt schnaubte abfällig. »Was für ein unsinniger Aufwand!«
»Walt«, sagte die elegante Diplomatin, »als du um meine Hand angehalten hast, dachtest du da ernsthaft, wir könnten uns mit ein paar engen Freunden zu einer Wald- und Wiesenhochzeit davonmachen?«
Walt zögerte. »Na ja … nein, natürlich nicht.«
Aber um genau zu sein, war es genau das, was er gedacht hatte. Eine einfache Zeremonie, ein paar Freunde, gutes Essen und Getränke, und dann wären Pauline und er ein Ehepaar. Aber er hielt es nicht für ratsam, das jetzt zuzugeben.
Die Verlobung des grauhaarigen Waldläufers und der schönen Lady Pauline war nun schon seit einigen Wochen Hauptgesprächsstoff im Lehen Redmont.
Die Leute waren verblüfft und zugleich begeistert, dass dieses anscheinend so verschiedene, aber wohlgelittene Paar Mann und Frau würden. Das war etwas, worüber man sich wunderte und worüber man klatschte. Seit Wochen war im Speisesaal von Redmont über kaum etwas anderes gesprochen worden.
Es gab jene, die vorgaben, nicht überrascht zu sein. Baron Arald von Redmont gehörte dazu.
»Ich habe es schon immer gewusst!«, sagte er zu jedem, der es hören wollte. »Habe schon immer gewusst, dass da etwas zwischen den beiden vorging! Sah das schon seit Jahren kommen! Wusste es wahrscheinlich sogar schon, bevor sie selbst es wussten.«
Tatsächlich hatte es über die Jahre hinweg immer mal wieder Gerüchte gegeben, dass Walt und Pauline in der Vergangenheit mehr als nur Freunde gewesen waren. Doch der Großteil der Leute hatte dieses Gerede abgetan. Und weder Walt noch Pauline äußerten sich jemals dazu. Wenn es um Geheimnisse ging, gab es wohl kaum jemand, der verschwiegener war als Waldläufer und Mitglieder des Diplomatischen Dienstes.
Aber es kam ein Tag, an dem Walt erkannte, dass die Zeit immer schneller verging. Will, sein Lehrling, war im letzten Jahr seiner Ausbildung. In wenigen Monaten würde er seine Abschlussprüfungen ablegen und das silberne Eichenblatt erhalten – das Rangabzeichen eines voll ausgebildeten Waldläufers. Und das bedeutete, dass Will von Redmont wegziehen würde. Er würde ein eigenes Lehen zugeteilt bekommen, und Walt spürte, dass sein Alltag, der mit Will so ausgefüllt und voller Ablenkungen war, erschreckend langweilig werden würde. Je mehr ihm diese Tatsache bewusst wurde, desto öfter suchte er unbewusst die Gesellschaft von Lady Pauline.
Umgekehrt hatte sie sein wachsendes Bedürfnis nach Gesellschaft und Zuneigung erkannt. Das Leben eines Waldläufers war meist ein einsames – und eines, über das er nur mit wenigen Leuten reden konnte. Als Kurier, der Zugang zu den vielen Geheimnissen des Lehens und des Königreiches hatte, dem sie beide dienten, gehörte Lady Pauline zu diesem eingeschränkten Personenkreis. Walt konnte sich in ihrer Gegenwart entspannen. Sie konnten sich über ihre jeweiligen Aufgaben unterhalten und sich gegenseitig Ratschläge erteilen. Und da war tatsächlich auch noch eine gewisse gemeinsame Vergangenheit zwischen den beiden – ein gegenseitiges Verständnis, könnte man es vielleicht nennen –, was zurückging auf eine Zeit, in der sie beide noch sehr jung gewesen waren.
Um es genau zu sagen, Lady Pauline liebte Walt schon seit vielen Jahren. Still und geduldig hatte sie gewartet, im Vertrauen darauf, dass er ihr eines Tages einen Antrag machen würde.
Sie hatte auch gewusst, dass dieser unglaublich scheue und zurückgezogen lebende Mann dann von der Aussicht auf eine öffentliche Hochzeit entsetzt wäre.
»Wer ist das?«, sagte er, als er auf einen Namen stieß, den er nicht kannte. »Lady Georgina von Sandalhurst? Warum laden wir sie ein? Ich kenne sie nicht einmal. Warum laden wir Leute ein, die wir nicht kennen?«
»Ich kenne sie«, antwortete Pauline. In ihrer Stimme lag eine gewisse Schärfe. »Sie ist meine Tante. Eigentlich eine ziemliche Schreckschraube, aber ich muss sie einladen.«
»Du hast sie noch nie vorher erwähnt«, entgegnete Walt fragend.
»Stimmt. Ich mag sie nicht sehr. Wie ich schon sagte, sie ist eine Schreckschraube.«
»Warum laden wir sie dann ein?«
Lady Pauline seufzte. »Weil Tante Georgina die letzten zwanzig Jahre damit verbracht hat, die Tatsache zu bejammern, dass ich unverheiratet bin. ›Arme Pauline!‹, erzählte sie jedem, der ihr zuhörte. ›Sie wird als eine einsame alte Jungfer enden! Sie ist mit dem Diplomatischen Dienst verheiratet! Sie wird nie einen Mann finden, der für sie sorgt!‹«
Walt runzelte die Stirn. Wenn jemand die Frau kritisierte, die er liebte, bekam der es mit ihm zu tun.
»Einverstanden«, brummte er. »Wir setzen sie zu den langweiligsten Leuten auf der Hochzeit.«
»Gute Idee«, sagte Lady Pauline und machte eine Notiz. »Sie wird die erste Person am Langweiler-Tisch.«
»Langweiler-Tisch?«, wiederholte Walt. »Ich glaube nicht, dass ich den Ausdruck schon einmal gehört habe.«
»Bei jeder Hochzeit muss es einen Langweiler-Tisch geben«, erklärte seine Verlobte geduldig. »Man setzt alle langweiligen, nervtötenden und angeberischen Leute zusammen. So langweilen sie sich gegenseitig und nicht die netten Menschen, die man eingeladen hat.«
»Wäre es nicht einfacher, von vorneherein nur die Leute einzuladen, die man mag?«, fragte Walt. »Außer Tante Georgina natürlich, für ihre Einladung gibt es einen guten Grund. Aber warum andere Langweiler einladen?«
»So ist das in Familien nun mal«, sagte Lady Pauline und fügte gleich einen zweiten und dritten Namen für den Langweiler-Tisch hinzu. »Man muss die Familie einladen, und jede Familie hat ihre Zahl an Langweilern. Das gehört eben zu einer Hochzeit dazu.«
Walt ließ sich seitlich in einen Lehnstuhl fallen, sodass ein Bein lässig über der Armlehne hing. »Und ich dachte, Hochzeiten seien fröhliche Feste«, murrte er.
»Sind sie auch. Solange man einen Langweiler-Tisch hat.« Lady Pauline wollte schon hinzufügen, dass er Glück hatte, keine Familie einladen zu müssen, überlegte es sich dann jedoch rechtzeitig anders. Walt hatte seit zwanzig Jahren niemanden von seiner Familie mehr gesehen, und sie spürte, dass ihn das tief im Inneren traurig machte.
»Die Sache ist die«, fuhr sie fort und versuchte, das Thema Familie zu umgehen, »da der König anwesend sein wird, sind gewisse Formalitäten unausweichlich. Es gibt Leute, die eingeladen werden müssen – Adlige, Ritter und deren Damen, örtliche Honoratioren und so weiter. Sie würden es uns nie verzeihen, wenn wir sie der Gelegenheit beraubten, sich in der Nähe des Königs aufzuhalten.«
»Es interessiert mich keinen Deut, ob sie mir das verzeihen«, sagte Walt. »Jahrelang haben die meisten sich große Mühe gegeben, mir aus dem Weg zu gehen.«
Lady Pauline lehnte sich vor und legte ihre Hand auf seinen Arm.
»Walt, für manche von ihnen wird es der Höhepunkt ihres Lebens sein. Möchtest du ihnen wirklich ein wenig Glanz und Farbe in ihrem eintönigen Einerlei verweigern? Ich möchte das jedenfalls nicht.«
Er seufzte, denn sie hatte ja recht. Er merkte, dass er vielleicht etwas zu heftig protestiert hatte. Langsam dämmerte ihm, dass die Aussicht auf eine große formelle Hochzeit für Pauline nicht so verabscheuenswürdig war wie für ihn selbst. Auch wenn er selbst es nicht nachvollziehen konnte, wenn es das war, was sie wollte, dann würde er es ihr nicht verwehren.
»Nein. Du hast natürlich recht.«
»Schön.« Sie merkte, dass er kapituliert hatte und war ihm dafür dankbar. »Hast du dir überlegt, wer dein Trauzeuge sein soll?«
»Will natürlich«, antwortete er prompt.
»Nicht Crowley? Er ist dein ältester Freund.«
Walt runzelte die Stirn. »Stimmt. Aber Will ist etwas Besonderes. Er ist schließlich fast wie ein Sohn für mich.«
»Natürlich. Trotzdem müssen wir auch für Crowley eine Rolle finden.«
»Er könnte die Braut führen«, schlug Walt vor. Pauline überlegte und fuhr sich mit dem Federkiel übers Kinn.
»Ich nehme an, Baron Arald geht davon aus, dass er diese Aufgabe übernehmen wird. Hm. Schwierig.« Sie überlegte einen Augenblick, dann kam sie zu einer Entscheidung. »Crowley kann mich führen und Arald kann die Eheschließung vornehmen. Problem gelöst!« Sie machte zwei weitere Notizen auf ihrer Liste.
In Araluen waren Eheschließungen nicht religiöser Natur. Es war normal, dass ein hochrangiger Staatsrepräsentant die Zeremonie durchführte. Walt räusperte sich und bemühte sich, keine Miene zu verziehen.
»Verlangt das Protokoll denn nicht«, sagte er mit gespielter Besorgnis, »dass der König das tut?«
Paulines feine Gesichtszüge überschatteten sich. Natürlich hatte Walt recht, andererseits wirkte er für ihren Geschmack viel zu selbstzufrieden. Der betont unschuldige Blick unterstrich das noch.
»Verdammt!«, sagte sie. Das schien ihr nicht kräftig genug, also borgte sie sich seinen Fluch aus: »Bei Gorlogs Zähnen!« Verärgert trommelte sie mit den Fingern auf den Schreibtisch.
»Gorlogs Bart, meinst du wohl«, warf Walt ein.
»Das geht wohl beides, habe ich gehört«, sagte Lady Pauline. Dann hatte sie einen Geistesblitz. »Ich weiß, was wir tun. König Duncan wird der offizielle Hochzeitspate sein. Das befreit uns aus der Zwickmühle.«
»Was macht ein solcher Hochzeitspate denn?«, fragte Walt.
Sie tat die Frage mit einer Handbewegung ab.
»Weiß ich noch nicht, ich habe diese Rolle soeben erfunden. Aber das weiß Duncan nicht. Er hat beinahe ebenso wenig Ahnung von den Feinheiten des Protokolls wie du. Er wird eine Art königlicher Zeremonienmeister sein. Das wird unserer Hochzeit ein gewisses … Gütesiegel verleihen. Hm, das ist ziemlich gut«, meinte sie nachdenklich, »das muss ich mir sofort aufschreiben.«
Das tat sie dann auch und notierte sich, ihren alten Freund Lord Anthony, den königlichen Kämmerer, von der Rolle des offiziellen Hochzeitspaten baldmöglichst zu unterrichten.
»Nun, wen haben wir denn noch? Haben wir jemand vergessen?«
»Was ist mit Horace?«, fragte Walt.
Lady Pauline nickte. »Er wird der Anweiser sein und alle begrüßen«, sagte sie und schrieb bereits weiter.
»Hast du das auch gerade eben erfunden?«, fragte er.
Sie sah entrüstet auf. »Natürlich nicht. Das ist ein höchst offizieller Part. Er begrüßt die Gäste und weist allen Leuten die richtigen Plätze zu. Freund der Braut? Freund des Bräutigams? Sitzt links. Sitzt rechts. Das ist Aufgabe des Anweisers.«
Walt runzelte die Stirn. »Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir jemanden vergessen haben …«
Pauline schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Gilan!«, sagte sie. »Er wäre bestimmt furchtbar beleidigt, wenn wir ihm keine offizielle Aufgabe übertrügen.«
Walt seufzte. Pauline hatte wieder einmal recht. Sie mussten etwas für den stets fröhlichen, treuen Gilan – Walts einstigen Lehrling – finden.
»Kann ich nicht zwei Trauzeugen haben?«, fragte er.
»Hm. Ausnahmsweise. Das heißt, ich muss noch eine zusätzliche Brautjungfer finden. Ich hatte ursprünglich nur an Alyss gedacht.«
»Nun«, sagte Walt, erfreut, dass er sich langsam in das komplizierte Thema einfand, »dafür eignet sich Cassandra.«
Verwundert bemerkte er einen Anflug von Besorgnis bei Pauline. Diese hatte insgeheim das Gefühl, dass Alyss, ihre Gehilfin und Schutzbefohlene, nicht gerade begeistert wäre, Prinzessin Cassandra neben sich und Will am Hochzeitstisch zu haben. »Nein«, antwortete sie prompt. »Das geht überhaupt nicht. Als Kronprinzessin würde sie die Aufmerksamkeit der Gäste von der Braut auf sich ziehen.«
»Nein, das geht natürlich überhaupt nicht«, stimmte Walt zu.
»Dann nehmen wir vielleicht die kleine Jenny, wenn Chubb sie entbehren kann. Immerhin sind sie, Alyss und Will zusammen aufgewachsen.«
Lady Pauline machte eine weitere Notiz auf einem frischen Blatt. Die Liste wurde länger und länger. So vieles war zu bedenken. Da schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Ohne aufzublicken sagte sie: »Du wirst dir doch sicher vorher noch die Haare schneiden lassen, oder?«
Walt fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Es wurde tatsächlich etwas zu lang.
»Ich werde es schneiden«, sagte er und legte die Hand unwillkürlich auf den Knauf seines Sachsmessers.
Diesmal sah Pauline vom Schreiben auf. »Du wirst es schneiden lassen«, sagte sie knapp.
Ihre Reaktion machte Walt deutlich, dass es gewisse Freiheiten, die er über die Jahre für selbstverständlich gehalten hatte, vielleicht nicht mehr lange geben würde.
»Ich werde mir die Haare schneiden lassen«, versprach er.
Segel einholen«, rief Erak, Oberjarl von Skandia und derzeitiger Kapitän des Schiffes Wolfswind.
Svengal und ein paar Matrosen standen neben dem Mast bereit. Auf den Befehl hin lösten sie das Gaffelfall. Die Gaffel hielt die Rah in Position, während sie langsam zum Deck niedergelassen wurde. Als das große viereckige Segel dann nicht länger die Küstenbrise einfing und zusammenfiel, legten drei Männer es schnell ordentlich zusammen, damit es verstaut werden konnte.
Die Rah selbst war nicht mehr mit dem Mast verbunden und wurde von weiteren Matrosen festgehalten, damit sie keinen unnötigen Lärm machte, wenn sie irgendwo gegenschlug. Normalerweise achteten die Nordländer nicht so sehr darauf, keinen unnötigen Lärm zu machen. Doch jetzt waren sie nicht einfach nur unterwegs, sondern auf Beutezug.
Erak lenkte das Schiff parallel zur noch etwa zweihundert Fuß entfernten Küste von Arrida.
»Ruder heraus«, sagte er gedämpft und fügte dann hinzu: »Und seid leise, um Thuraks willen.«
In der nordländischen Religion gab es zum Glück genügend Götter, Halbgötter oder Dämonen, durch deren Nennung man einem Befehl Nachdruck verleihen konnte. Mit fast übertriebener Sorgfalt holten die Männer die Ruder hervor und schoben sie durch die Ruderlöcher zu beiden Seiten des Schiffs. Das geschah mit wenigen dumpfen Stößen, doch selbst dabei biss Erak die Zähne zusammen. Auch wenn die Küste menschenleer zu sein schien, gab es doch immer die Möglichkeit, dass ein einsamer Schäfer oder Reiter in Hörweite war und Alarm schlug, wenn ein Schiff der Nordländer sich im Schutz der nahenden Dunkelheit der Stadt Al Shabah näherte.
Es war riskant, so weit an die Küste heranzukommen, das wusste Erak. Doch es war das kleinere von zwei Übeln. Sie hatten einen steten Südostkurs eingeschlagen und sich von der unablässigen Brise aus Norden forttragen lassen, die um diese Zeit des Jahres Richtung Küste wehte. So war Erak in eine breite Bucht gesegelt, die aussah, als hätte jemand einen riesigen Bissen aus der Küstenlinie genommen. Am östlichen Ende der Bucht, auf einem hohen Felsvorsprung an der Steilküste, lag die Stadt Al Shabah. Indem Erak sein Schiff in der Bucht unterhalb der Stadt ankerte, hatte er dafür gesorgt, dass es sogar bei Sonnenaufgang immer noch im Schatten lag, während der Hügel und die Stadt erhellt wären.
Er hätte auch bereits vom Meer aus geradewegs auf Al Shabah zuhalten können, um so das Risiko zu vermeiden, von der Küste aus gesehen zu werden. Aber dann wären sie vielleicht direkt von der Stadt aus bemerkt worden. Bei Nacht war die Wolfswind nicht viel mehr als ein dunkler Schatten im stahlgrauen Meer. Und je näher sie der Stadt kamen, desto größer war die Gefahr, entdeckt zu werden.
Nein, so war es sicherer: das Segel einzuholen und sich an der Küste entlang ins Land zu schleichen, verdeckt von der dunklen Landmasse hinter ihnen.
Er schüttelte die besorgten Gedanken ab. Er war offensichtlich außer Übung, wenn er zu einem solchen Zeitpunkt noch Bedenken zuließ.
»Bereit zum Rudern«, flüsterte er. Der Befehl wurde entlang der Ruderbänke weitergegeben. Die Ruderer in den Doppelreihen hatten ihre Blicke fest auf den Kapitän gerichtet. Er hob die Hand und machte ein Zeichen, woraufhin die Ruder ins Wasser getaucht wurden, um die Wolfswind zu ihrem Ziel zu bringen.
Es ist gut, wieder mal auf Raubzug zu gehen, dachte Erak zufrieden.
Das Leben als Oberjarl hatte seine guten Seiten, das stand außer Frage. Und es war angenehm, einen zwanzigprozentigen Anteil von allen Raubzügen zu erhalten, die nach Hallasholm gebracht wurden. Doch Erak war zum Seewolf geboren, nicht zum Steuereintreiber und Verwalter. Einige Jahre in der Großen Halle in Hallasholm herumzusitzen, sich Berichte und Schätzungen von seinem Hilfsmann Borsa anzuhören, hatten ihn gelangweilt und ein Verlangen nach Abwechslung aufkommen lassen. Während sein Vorgänger Ragnak beim Anblick der satten Steueraufkommen unverhohlene Genugtuung empfunden hatte, fühlte Erak sich fast unwohl bei all den Kostbarkeiten, die sich in seinen Kammern häuften. Als Kapitän eines Wolfsschiffs hatte seine Sympathie immer eher jenen gegolten, die versuchten, die Steuern zu drücken, als dem Oberjarl und dem Adlerauge von Hilfsmann, der sie eintrieb.
Schließlich hatte er einen riesigen Stoß von Pergamentrollen, Schätzungen und Abrechnungen der Beute seiner Jarls in Borsas Schoß fallen lassen und verkündet, dass er noch einmal auf Raubzug fahren würde.
»Nur ein allerletztes Mal«, hatte er dem entrüsteten Hilfsmann erklärt. »Ich werde verrückt, wenn ich noch länger hinter diesem Schreibtisch sitze. Ich muss wieder zur See fahren.«
Zögernd hatte Borsa das eingesehen. Er selbst war nie Seemann gewesen. Er war ein Verwalter und machte seine Arbeit gut. Er hatte nie verstanden, warum die mächtigen Kapitäne, die irgendwann zum Oberjarl gewählt wurden, nicht lernten, seine Leidenschaft für Zahlen und das Aufspüren von unversteuerten Einkünften zu teilen. Selbst Ragnak war in der ersten Zeit seiner Herrschaft immer noch gelegentlich auf Raubzüge gefahren. Erst später, als er faul und ein wenig gierig geworden war, fand er Vergnügen daran, in Hallasholm zu bleiben und seine Reichtümer zu zählen.
Erak hatte dann jedenfalls nach Svengal geschickt, seinem früheren zweiten Mann an Bord, der das Kommando über die Wolfswind übernommen hatte, und ihn davon in Kenntnis gesetzt, dass er für einen Beutezug noch einmal das Kommando übernähme.
Manche Männer wären vielleicht von der Aussicht, zum Stellvertreter zurückgestuft zu werden, enttäuscht gewesen. Doch Svengal war begeistert, Erak wieder am Steuer zu sehen. Die beiden Männer waren gute Freunde, und Svengal war der Meinung, dass Erak sowieso der bessere Kapitän war.
Also waren sie nach Arrida gesegelt und hatten sich dem kleinen Handelsstädtchen Al Shabah genähert.
Al Shabah gehörte zu den Städten, welche die Schiffe, die übers Ewige Meer segelten, mit Vorräten und sonstiger Ausstattung wie Holz und Seilen versorgte. Es war ein unauffälliger Ort auf einer Landspitze über einem kleinen Strand, dessen im Norden liegender Hafen von der Stadt aus durch Treppen zu erreichen war. Zu dieser Jahreszeit machten sich immer mehr Schiffe der Handelsflotten auf die Reise über das Ewige Meer und durch den Endlosen Ozean.
Meist legten sie in Al Shabah oder einer ähnlichen Hafenstadt an, um Wasservorräte aufzufüllen, Essen und Feuerholz aufzunehmen und etwaige von Stürmen verursachte Schäden zu beheben.
Wenn sie den Hafen verließen, blieben stets etliche Goldmünzen oder Silberbarren, mit denen sie ihre Rechnungen bezahlt hatten, in der Stadt. Ab und zu kam dann aufgrund einer geheimen Nachricht eine bewaffnete Karawane aus der Hauptstadt, um die Schätze aus den Handelsstädten in die Schatzkammer des Emrikirs zu holen.
Die erste Karawane des Jahres war in etwa zwei Wochen fällig, das wusste Erak. Der Zeitplan war verständlicherweise streng geheim. Wenn mögliche Angreifer nicht mit Sicherheit sagen konnten, ob die Schätze schon abgeholt worden waren oder nicht, verringerte das die Gefahr eines Angriffs. Kein Pirat, der seine Sinne beisammenhatte, würde in der bloßen Hoffnung auf irgendwelche Schätze sein Leben riskieren. Geheimhaltung war Al Shabahs beste Verteidigung.
Aber Geheimnisse können auch verraten werden, und vor etwa einer Woche hatte Erak achtzig Meilen weiter unten an der Küste einem Spitzel vierzig Silberstücke bezahlt, um eine Abschrift des neuesten Plans zu bekommen. Dadurch hatte er erfahren, dass die Schatztruhe von Al Shabah im Gegensatz zu der anderer Städte immer noch verführerisch voll war und es auch noch einige Tage bleiben würde.
In der Stadt war eine Wachmannschaft stationiert, nicht mehr als vierzig Männer. Vierzig schläfrige, übergewichtige, bequeme Stadtbewohner, die schon seit vielen Jahren keinen richtigen Kampf mehr ausgetragen hatten, würden kein echtes Hindernis für dreißig blutrünstige, gierige Nordländer darstellen, die gleich Höllenhunden die Stadt stürmten.
Erak spähte durch die Dunkelheit zu den weißen Häusern der Stadt, die langsam sichtbar wurden. Es waren keinerlei Lichter zu sehen, nicht einmal Fackeln, um die Wege zu erleuchten. Er zuckte mit den Schultern. Eine Fackel würde die Nachtsicht eines Wächters nur stören, denn es wäre ihm nicht möglich, über die erleuchtete Stelle hinaus irgendetwas zu erkennen.
Ja, es war die richtige Entscheidung gewesen, sich der Stadt von dieser Seite her zu nähern. Er lenkte das Schiff an die Küste, hob seine freie Hand zum verabredeten Zeichen, und sechzehn Ruder hoben sich tropfend aus dem Wasser. Nur hie und da war ein gedämpftes Grunzen zu hören, als die Männer ihre Ruder senkrecht stellten und sie dann vorsichtig senkten, um sie unter den Ruderbänken zu verstauen. Ein oder zwei klapperten etwas lauter, und das Geräusch schien durch die Stille um sie herum noch verstärkt zu werden. Erak warf den Matrosen einen bösen Blick zu. Später würde er sich die achtlosen Burschen vorknöpfen.
Ein Zittern durchlief das Schiff, als der Kiel in den Sand stieß. Vier Männer machten sich bereit, um ins flache Wasser zu springen und das Schiff zu sichern.
»Leise vor Anker, Matrosen!«, raunte Svengal.
Die Männer, die sich normalerweise laut ins knietiefe Wasser hätten fallen lassen, glitten daraufhin vorsichtig nach unten. Mit zwei Seilen eilten sie den Strand hinauf und zogen das Schiff noch ein Stück weiter aus dem Wasser, dann sicherten sie es mit den Enterhaken.
Erak spähte wieder hoch zu den Häusern. Noch immer war kein Anzeichen von Leben zu bemerken, weit und breit keine Wachen zu sehen. Die weißen Gebäude sahen im Licht der nahenden Morgendämmerung fast gespenstisch aus.
Weitere Männer kletterten jetzt über den Bug. Einige andere holten die Schilde und Streitäxte unter den Ruderbänken hervor und reichten sie weiter. Die Schilde, die entlang des äußeren Dollbords angebracht gewesen waren, hatte man zur Tarnung mit dunklem Tuch überzogen. Das rissen die Männer jetzt ab, verteilten die jeweiligen Waffen und warteten dann auf den Befehl ihres Kapitäns.
Erak reichte seinen Schild und seine Streitaxt einem der Wartenden, dann kletterte er selbst über Bord. Er nahm Schild und Axt wieder entgegen und ging zu seinen Männern. Die vier Nordländer, die das Schiff geankert hatten, würden an Bord Wache halten.
Erak musste unwillkürlich lächeln, als er Vorfreude und Anspannung verspürte. Es war gut, wieder zurück im alten abenteuerlichen Leben zu sein.
»Denkt daran«, erinnerte er seine Männer, »so leise wie möglich! Passt auf, wo ihr hintretet. Ich möchte nicht, dass einer von euch die Felsen runterkugelt. Wir wollen möglichst nahe rankommen, bevor sie uns entdecken. Wenn wir Glück haben, sind wir in der Stadt, ehe jemand Alarm schlägt.«
Er machte eine Pause und sah in die bärtigen Gesichter. Als einige der Männer nickten, fuhr er fort.
»Wenn wir allerdings entdeckt werden, kommt’s darauf nicht mehr an. Dann heißt es: Auf sie mit Geschrei! Sie sollen glauben, sie hätten es mit einer ganzen Armee zu tun.«
Oft, das wusste Erak aus Erfahrung, verharrten schlaftrunkene Wachleute allein wegen des Lärms der Angreifer vor Schreck wie gelähmt. Manchmal rannten die Wachen sogar einfach los und flohen.
Er sah sich um. Eine breite Treppe am Fuß der Klippen führte nach oben in den Ort. Er deutete mit seiner Axt nach links, auf einen schmalen, kaum sichtbaren Pfad ein Stück weiter weg.
Der Pfad war in keiner Weise befestigt und der Aufstieg steil. Aber die Nordländer waren trotz ihrer kräftigen Statur in ausgezeichneter körperlicher Verfassung und folgten ihrem Anführer mit flottem Schritt. Gelegentlich rollte ein loser Stein unter ihren Füßen weg und fiel über die Klippen ins Meer.
Doch im Großen und Ganzen verursachten die dreißig Nordländer nur wenig Lärm. Ihre Stiefel aus Robbenfell kamen weich auf dem Fußweg aus Fels und Sand auf.
Einmal gab es eine Schrecksekunde, als einer der Männer unmittelbar hinter Erak stolperte und es nur mit rudernden Armbewegungen schaffte, nicht den steilen Abhang ins Meer hinabzustürzen. Glücklicherweise steckte seine Axt in seinem Gürtel, sonst hätte er bei der wilden Fuchtelei wahrscheinlich noch einigen Freunden versehentlich die Köpfe abgetrennt.
Er stieß unwillkürlich einen kleinen Schrei aus und seine scharrenden Füße traten viele kleine Felsstücke und Steine los, die knirschend den Hügel hinunterrollten. Bevor er ebenfalls hinunterkullerte, wurde er mit eisernem Griff an seiner Schaffellweste gepackt und von Erak auf sicheren Grund gezerrt.
»Bei allen Göttern! Danke, Oberjarl …«, fing er an. Eine riesige Hand legte sich über seinen Mund und schnitt ihm das Wort ab. Erak starrte den Pechvogel zornig an und schüttelte ihn ziemlich unsanft.
»Halt die Klappe, Axel!«, flüsterte er wütend. »Wenn du dir den Hals brechen willst, dann tu es leise, oder ich erledige das anschließend für dich.«
Axel war ein großer, stämmiger Mann, einer von den Ruderern. Die galten nicht gerade als die Gescheitesten, und in der Tat wollte Axel Erak gerade erklären, dass es keinen Sinn hätte zu drohen, ihm den Hals ein zweites Mal zu brechen. Das war unvernünftig.
Doch dann überlegte er es sich noch einmal. Der Oberjarl, das wusste er, dachte nicht immer vernünftig, wenn er wütend war. Er war jedoch andererseits immer bereit, seine Fäuste einzusetzen, um eine Auseinandersetzung zu beenden. Und so groß und breit Axel auch war, er hatte nicht den Wunsch, sich mit Erak anzulegen.
»Tut mir leid, Oberjarl. Ich wollte doch nur …«, fing er an, aber Erak schüttelte ihn durch.
»Klappe!«, zischte er. Dann ließ er ihn los und blickte besorgt nach oben, um zu sehen, ob man sie dort gehört hatte.
Die Männer warteten schweigend einige Minuten lang, doch als kein Alarm ausgelöst wurde, legte sich die Anspannung.
Erak winkte sie weiter und ging mit schnellem Schritt voran. Noch bevor sie ihr Ziel erreicht hatten, gab er den Männern das Zeichen, stehen zu bleiben. Dann bedeutete er Svengal, ihn zu begleiten, und die beiden legten die verbleibende Strecke geduckt zurück. Seite an Seite knieten die beiden Nordländer vor der letzten Anhöhe und sondierten die Lage.
Al Shabah befand sich vielleicht einhundertfünfzig Fuß entfernt, inmitten kargen Ödlands. Die Stadt war umgeben von einer niedrigen Mauer, weniger als acht Fuß hoch. Selbst wenn dahinter Wachposten ihre Runde drehten, böte das Ganze kein echtes Hindernis für die Nordländer. Eine solche Mauer überwanden sie im Handumdrehen. Zwei Männer würden sich an die Mauer stellen und als Leiter für die Kameraden dienen. Wenn dann einer nach dem anderen die Mauer überwand, bekäme jeder von der »menschlichen Leiter« noch einen zusätzlichen Schwung verpasst. Dieses Kunststück übten alle Nordländer schon von klein auf.
Doch heute war kein Bedarf dafür, denn nirgendwo waren Wachen zu entdecken. Auf der rechten Seite stand ein überdachtes Tor weit offen und am Eingang war kein Mensch zu sehen.
»Das ist ja fast schon zu leicht«, grinste Svengal.
Erak runzelte die Stirn. »Das dachte ich auch gerade«, sagte er. »Wo sind die Wachen? Weshalb ist niemand auf dem Posten?«
Svengal zuckte mit den Schultern. Auch wenn keine Wachen zu sehen waren, sprachen die beiden Männer lediglich im Flüsterton.
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage Deutsche Erstausgabe Februar 2012 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2009 John Flanagan
Die englische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Ranger’s Apprentice. Eraks’s Ransom« bei Random House Australia Pty Limited, Sydney, Australia. This edition published by arrangement with Random House Australia. © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe cbj Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Übersetzung: Angelika Eisold Viebig Lektorat: Petra Koob-Pawis Vignetten: Mathematics Umschlagbild: John Blackford Reproduced by arrangement with Philomel Books, a division of Penguin Young Readers Group, a member of Penguin Group (USA) Inc. All rights reserved.