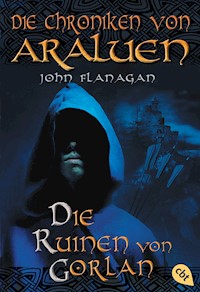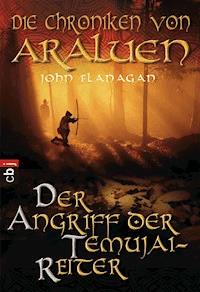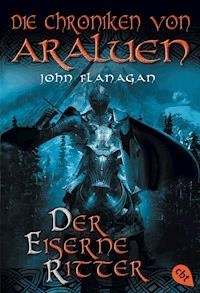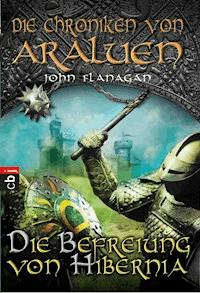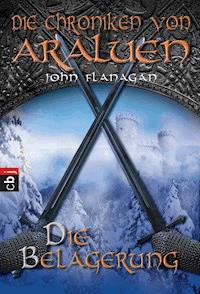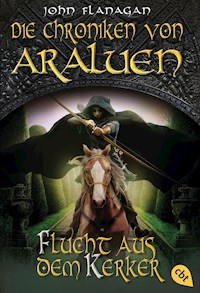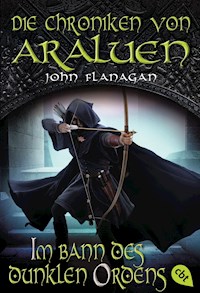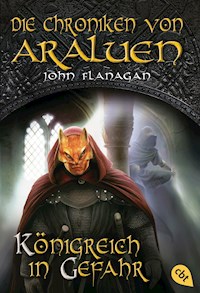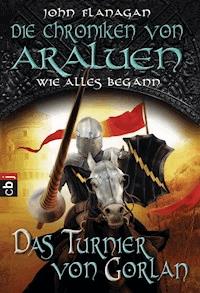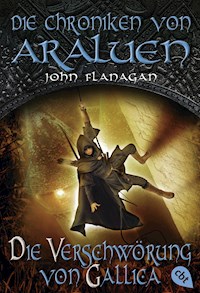
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Chroniken von Araluen
- Sprache: Deutsch
Ein mitterlalterliches Königreich, bedroht von bösen Kräften und ungeheuerlichen Kreaturen, verteidigt von einem jungen Waldläufer und seinen Freunden - willkommen in Araluen!
König Duncan von Araluen erreicht ein verzweifelter Hilferuf aus dem befreundeten Königreich Gallica: Der junge Thronfolger wird von Verschwörern gefangen gehalten. Für seinen Vater, König Philipp, sind Araluens Waldläufer die einzige Hoffnung, den Prinzen lebend wiederzusehen. Der Plan: Will und Lynnie sollen sich, getarnt als Gaukler, in das Schloss des verräterischen Barons einschleichen und den Königssohn befreien. Will und Lynnie verschaffen sich tatsächlich Zugang zu der Burg und können zu dem Gefangenen Kontakt aufnehmen. Doch dann werden die beiden enttarnt und die Verräter drohen, den Königssohn zu ermorden. Wer hat die Waldläufer verraten? Wird es Will und Lynnie trotz allem gelingen, das Leben des Prinzen zu retten – und ihr eigenes?
Spannende und actionreiche Abenteuer in einem fantastisch-mittlalterlichen Setting – tauche ein in »Die Chroniken von Araluen«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
© Cameron Barrie
DER AUTOR
John Flanagan arbeitete als Werbetexter und Drehbuchautor, bevor er das Bücherschreiben zu seinem Hauptberuf machte. Den ersten Band von »Die Chroniken von Araluen« schrieb er, um seinen 12-jährigen Sohn zum Lesen zu animieren. Die Reihe eroberte in Australien in kürzester Zeit die Bestsellerlisten und ist weltweit unvermindert erfolgreich, ebenso wie die Spin-off-Reihe »Brotherband«.
Von John Flanagan ist beim cbj Verlag erschienen:
DIE CHRONIKEN VON ARALUEN
Die Ruinen von Gorlan (27072)
Die brennende Brücke (27073)
Der eiserne Ritter (21855)
Der Angriff der Temujai-Reiter (21065)
Die Krieger der Nacht (22066)
Die Belagerung (22222)
Der Gefangene des Wüstenvolks (22229)
Die Befreiung von Hibernia (22342)
Der große Heiler (22343)
Die Schwertkämpfer von Nihon-Ja (22375)
Die Legenden des Königreichs (22486)
Das Vermächtnis des Waldläufers (22508)
Königreich in Gefahr (31255)
Im Bann des dunklen Ordens (31269)
Die Verschwörung von Gallica (31389)
DIE CHRONIKEN VON ARALUEN – WIE ALLES BEGANN
Das Turnier von Gorlan (22625)
Die Schlacht von Hackham Heath (22631)
BROTHERBAND
Die Bruderschaft von Skandia (22381)
Der Kampf um die Smaragdmine (22382)
Die Schlacht um das Wolfsschiff (22383)
Die Sklaven von Socorro (22505)
Der Klan der Skorpione (22506)
John Flanagan
DIE CHRONIKEN VON ARALUEN
Die Verschwörung von Gallica
Aus dem Englischen von Angelika Eisold Viebig
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Feburar 2021
© John Flanagan 2020
© 2021 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Zuerst erschienen 2020 unter dem Titel «Ranger’s Apprentice - The Royal Ranger The Missing Prince« bei Penguin Random House Australia, Sydney, Australia
Übersetzung: Angelika Eisold Viebig
Lektorat: Andreas Rode
Umschlagillustration: © Jeremy Reston
Umschlaggestaltung: init Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen
CK · Herstellung: AS
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26923-4V001www.cbj-verlag.de
Zum Gedenken an meinen Bruder, Peter Flanagan, 1940–2019
Eins
Die Mondsichel war eben am westlichen Horizont untergegangen, als eine Gruppe von zehn Reitern aus dem Waldstück hervorkam. Sie ritten noch ein kleines Stück weiter, bis sie die Hügelkuppe erreicht hatten, von der aus man Schloss Araluen sehen konnte. Der Reiter in der Mitte hob eine Hand, um anhalten zu lassen, und die anderen Reiter zogen die Zügel an. Die Pferde schnaubten ungeduldig. Sie spürten, dass dieses große Gebäude Unterkunft, Wasser und Futter bedeutete. Und diese drei Dinge wollten sie so bald wie möglich.
Der Reiter rechts von dem Mann, der das Zeichen gegeben hatte, beugte sich erwartungsvoll im Sattel nach vorn und studierte das offene Gelände vor ihnen. Es fiel von der Hügelkuppe sanft nach unten ab und begann dann in Richtung des Schlosses wieder anzusteigen, hier und da gab es kleine Baumgruppen und schattige Haine. Doch zum größten Teil war das Gelände frei, sodass ein Reiter sofort bemerkt werden würde, wenn jemand Ausschau hielt.
Und es war nur allzu wahrscheinlich, dass immer jemand Ausschau hielt. Im Augenblick war die offene Parklandschaft verlassen. Wenn jemand das Gelände beobachtete, musste er sich im Schloss selbst befinden.
Die meisten Fenster des Schlosses lagen in Dunkelheit – wie es um diese späte Stunde nicht anders zu erwarten war. Entlang der Mauern brannten jedoch in regelmäßigen Abständen Leuchtfeuer und zu beiden Seiten des Tors flackerten Fackeln. Das Tor selbst war jetzt geschlossen, um etwaige Eindringlinge abzuhalten.
»Sieht alles normal aus«, sagte der Anführer der Gruppe.
Der Mann neben ihm nickte. »Das habe ich auch erwartet. Und selbst wenn es vielleicht nicht so wäre …«
Beide Männer sprachen gallisch. Während sie noch zögerten, leuchtete auf den Mauern oberhalb des riesigen Tors und der Zugbrücke eine gelbe Laterne auf, deren Schein bis zu den Granitmauern neben dem Eingang reichte.
»Und da ist auch schon das Signal«, sagte der Anführer. Er drehte sich zu einem Reiter auf der anderen Seite. »Jules, gib die Antwort.«
Der Mann, den er angesprochen hatte, hielt Feuerstein und Zunder bereit, und an seinem Sattelknauf hing eine Laterne. Er brauchte nur wenige Momente, um eine kleine Flamme zu entfachen und gegen den Docht der Laterne zu halten. Sobald der Docht entzündet war, schloss er die aus blauem Glas bestehende Vorderseite der Laterne. Er hielt das Licht hoch, damit der blaue Schein auf die kleine Gruppe fiel.
Sekunden später wurde das Licht auf den Schlossmauern langsam von links nach rechts und wieder zurück bewegt. Das Ganze wurde drei Mal wiederholt.
»Das heißt, es ist alles in Ordnung«, sagte der Anführer, gab seinem Pferd die Sporen und ritt los, neben ihm der Mann, der eben gesprochen hatte. Die anderen Reiter folgten in zwei Reihen.
In langsamem Trab näherten sie sich dem Schloss, die Hufe ihrer Pferde waren auf dem weichen Boden kaum zu hören. Als sie das Ende des Abhangs erreicht hatten und aus der Senke heraus wieder hangaufwärts auf das Schloss zuritten, wurden die Pferde natürlich etwas langsamer, und die Reiter trieben sie zu größerer Geschwindigkeit an. Das Rasseln eines gewaltigen Räderwerks war zu hören, und oben an der Zugbrücke zeigte sich ein Lichtschlitz, der im Laufe des Herablassens immer breiter wurde.
Als die Reiter schließlich nur noch etwa dreißig Meter entfernt waren, war die riesige Brücke ganz unten. Die Reiter konnten sehen, dass das Fallgatter immer noch gesenkt war und den Zugang zum Schlosshof versperrte. Die beiden Anführer ritten zum Anfang der Zugbrücke und hielten dort an.
Ein mit einem Kettenhemd geschützter Mann trat durch ein kleines Tor seitlich des Fallgatters und kam über die Zugbrücke auf sie zu. Er war mit einer Hellebarde bewaffnet und in seinem Gürtel steckte ein langes Schwert. Sein Kettenhemd blitzte im Licht der Fackeln auf.
Der Anführer der Gruppe musterte die massiven dunklen Mauern, die vor ihnen aufragten. Zweifelsohne bekam der Mann mit dem Kettenhemd von mehreren Bogenschützen Deckung. Die Araluaner waren bekanntermaßen mit Langbogen ausgestattet, nicht mit Armbrüsten, und sie waren alle ausgezeichnete Schützen.
Der Wachposten hielt ein paar Meter vor ihnen an.
»Wie lautet das Passwort?«, fragte er leise.
Der Anführer beugte sich leicht im Sattel nach vorn. »Pax inter reges«, sagte er in der alten Sprache. Das bedeutete: »Frieden zwischen Königen.«
Der Wachmann nickte, drehte sich zurück zum Schloss und hob den Arm, um den Männern oberhalb des Fallgatters ein Zeichen zu geben. Langsam und begleitet von hörbarem Rasseln aus dem Torhaus begann sich das massive Gatter zu heben. Sobald das Gatter oben war, winkte der Wachposten die Besucher nach vorn.
»Ihr könnt passieren«, sagte er.
Die Pferdehufe klapperten über die Hartholzbretter der Zugbrücke, während die Reiter in Zweierreihen passierten. Im gepflasterten Hof änderte sich das Geräusch der Hufe. Auf jeder Seite des Tores standen bewaffnete Fußsoldaten, die sie beobachteten. Einer, der die Abzeichen eines Feldwebels trug, deutete auf den Bergfried, den massiven steinernen Turm in der Mitte des Schlosshofs. Jetzt wurde dort im Erdgeschoss eine Tür geöffnet und gelblicher Fackelschein erleuchtete das Pflaster.
Die Neuankömmlinge ritten auf den Turm zu und stiegen ab. Wartende Knechte übernahmen ihre Pferde und führten sie weg, um sie zu füttern und trocken zu reiben. Der Anführer der Besucher drückte sich eine Faust in den Rücken. Er war es nicht mehr gewohnt, lange Strecken zu reiten, und sie waren stundenlang hierher unterwegs gewesen.
Der Mann, der aus der Tür getreten war, stieg die drei Stufen zum Hof herab und verbeugte sich leicht. Er hatte graue Haare und ein vornehmes Aussehen und trug teuer wirkende Kleidung.
»Willkommen auf Schloss Araluen. Ich bin Lord Anthony, der Kämmerer des Königs«, sagte er. Sein Ton war neutral, weder hieß er die Gäste sonderlich herzlich willkommen, noch war er ablehnend. Der Besucher nickte, erwiderte jedoch nichts. Anthony trat einen Schritt zur Seite und bedeutete den Ankömmlingen, die Treppe nach oben zu nehmen. »Bitte hier entlang.«
Der Anführer ging voraus und Anthony begleitete ihn leicht seitlich versetzt hinter ihm. Der Rest der Gruppe folgte.
Als sie in die hell erleuchtete große Halle des Bergfrieds kamen, musterte Anthony den Anführer der Gruppe. Er war relativ klein, mindestens fünf Zentimeter kleiner als Anthony selbst, und schmal gebaut. Seine elegant geschnittene Weste in laubgrünem Leder konnte seine unsportliche Gestalt nicht verbergen. Seine Schultern waren schmal und er hatte den Ansatz eines Bauches. Er bewegte sich mit eingesunkenen Schultern und zeigte insgesamt eine schlechte Haltung. An der linken Hüfte trug er ein kunstvoll verziertes Schwert und rechts zum Ausgleich einen juwelenbesetzten Dolch.
Trotz der Waffen ist dies kein Krieger, dachte Anthony. Doch natürlich hatte man ihm das schon gesagt, als man ihm diesen Besuch angekündigt hatte.
Er warf einen kurzen Blick auf die Begleiter des Mannes. Bis auf einen waren sie alle größer als der Anführer, muskulös und athletisch gebaut. Das sind die Krieger, erkannte Anthony. Die eine Ausnahme hatte die gleiche Größe und Gestalt wie der Anführer und sah ihm auch sonst sehr ähnlich. Anthony merkte jetzt, dass der Anführer zögerte, und deutete rasch auf die breite Treppe, die zu den oberen Stockwerken des Bergfrieds führte.
»König Duncans Räume befinden sich im ersten Stock«, sagte er, woraufhin der Anführer der Truppe erneut voranging.
»Der König bittet um Entschuldigung, dass er Euch nicht selbst hier unten begrüßen kann, Sir«, sagte Anthony. »Sein Knie bereitet noch Probleme, gerade auf Treppen.«
Der Besucher verzog herablassend das Gesicht. »Er ist also immer noch ein Krüppel, ja?«
Lord Anthony hob die Augenbrauen angesichts dieser beleidigenden Überheblichkeit. Steifes Knie hin oder her – Duncan war immer noch ein Krieger. Er könnte dich ungespitzt in den Boden rammen, dachte Anthony.
»Er kann bereits wieder reiten und geht jeden Tag mit seinen Hunden«, erwiderte er und bemühte sich, seine Verärgerung nicht in der Stimme mitklingen zu lassen.
»Aber offensichtlich kann er nicht die Treppe herunterkommen«, entgegnete der andere Mann.
Diesmal gestattete Anthony sich, seine Verärgerung zu zeigen. Er hielt an und sah dem Besucher direkt ins Gesicht. »Nein. Doch wenn Euch das stört, Sir, können wir dieses Treffen selbstverständlich auch absagen.« Er begegnete dem hochmütigen Blick des Mannes, ohne zu blinzeln. Du aufgeblasener Trottel, dachte er, du kommst hierher und willst um einen Gefallen bitten, also kannst du auch gleich von deinem hohen Ross herabsteigen.
Sie sahen einander einen Moment lang an, dann schaute der Besucher mit einem herablassenden Schulterzucken weg.
So sind diese Leute eben, dachte Anthony.
»Egal«, sagte der Besucher. »Wir können ja Treppen steigen.«
Er ging weiter nach oben. Anthony, der innerlich triumphierte, dass der Mann einen Rückzieher gemacht hatte, folgte dicht hinter ihm. Als sie oben auf dem ersten Absatz der breiten Steintreppe angelangt waren, deutete er nach links.
»Hier entlang bitte, Sir.«
Sie standen vor einer zweiflügeligen Tür aus massivem Holz. Der Eingang wurde von zwei kräftigen Soldaten bewacht, die genauso wehrhaft wirkten wie die Tür. Beim Anblick der bewaffneten Männer versperrten sie sofort die Tür mit ihren langen Hellebarden.
»Ich fürchte, Eure Männer werden hier warten müssen, Sir«, sagte Anthony.
Der Besucher nickte. Damit hatte er bereits gerechnet.
»Einer Eurer Begleiter kann mit Euch eintreten«, fügte der Kämmerer hinzu.
Der Anführer deutete auf den Mann, der ihm ähnlich sah.
»Mein Bruder Louis wird mit mir kommen«, erklärte er. Er blickte zu den restlichen Männern. »Ihr anderen werdet hier warten.«
»Das ist nicht nötig, Sir«, erklärte Anthony ihm. »Wir haben Erfrischungen für alle in einem Nebenraum.« Er hob die Stimme und rief: »Thomas!«
Ein Stück weiter im Flur wurde eine Tür geöffnet, und ein Dienstbote in Livree trat heraus, verbeugte sich und bedeutete der Truppe, mit ihm in den hell erleuchteten Raum hinter sich zu kommen.
Der Anführer nickte, und die acht Krieger marschierten los, zu den auf sie wartenden Speisen und Getränken. Anthony ging voraus zu den riesigen Holztüren. Die dortigen Wachposten traten zur Seite und gingen in Habachtstellung. Anthony klopfte an.
»Herein«, ertönte es von drinnen.
Anthony öffnete die Doppeltür und führte die beiden Besucher in das Arbeitszimmer des Königs.
Duncan saß hinter einem großen Schreibtisch.
»Euer Majestät«, sagte Anthony, »darf ich vorstellen? König Philippe von Gallica und sein Bruder, Prinz Louis.«
Duncan, der König von Araluen, erhob sich von seinem Platz und ging um den Tisch herum, um seine Besucher zu begrüßen.
»Willkommen in Araluen«, sagte Duncan und streckte seine Hand aus.
Philippe ergriff sie und sie schüttelten sich die Hände. »Danke, dass Ihr uns empfangt«, sagte Philippe.
Duncan machte eine großzügige Handbewegung. »Wir sind stets bereit, unseren Freunden zu helfen.« Er nickte dem zweiten Mann grüßend zu. »Prinz Louis«, sagte er.
Der Bruder des Königs verbeugte sich elegant. »Euer Majestät«, sagte Louis und richtete sich dann auf.
Duncan musterte die beiden Männer. Sie wirkten von der Reise ermüdet.
»Es ist spät, und Ihr seid weit gereist«, sagte er. »Ihr müsst müde und hungrig sein.«
Philippe verzog zustimmend den Mund. »Es war ein harter Tag«, pflichtete er ihm bei.
»Eure Räume sind bereit. Ich werde Essen und Getränke nach oben schicken und Euch auch ein heißes Bad richten lassen, sofern Ihr das wünscht. Schlaft erst einmal aus und wir reden dann morgen früh.«
Zum ersten Mal lächelte Philippe. »Das wäre äußerst willkommen. Und wir haben tatsächlich viel zu bereden.«
Duncan neigte den Kopf. »Dessen bin ich sicher«, sagte er.
Zwei
Der alte Bauernkarren war abgenutzt und benötigte dringend einen frischen Anstrich. Die hölzerne Achse des rechten Rades war trocken. Das Schmierfett war längst aufgebraucht, und so quietschte das Rad in regelmäßigem Rhythmus – ein irritierendes Geräusch, das jedem, der es hörte, durch Mark und Bein ging. Den alten Bauern, der den Karren lenkte, schien es jedoch nicht zu stören. Vornübergebeugt saß er auf dem Kutschbock da und trieb das Maultier an der Deichsel mit einer Reihe von Zungenschnalzern an.
Das Maultier musste aber auch angetrieben werden. Es war stur und übellaunig wie die meisten seiner Art, und der Karren war schwer und voll beladen mit geernteter Ware. Garben von Weizen und Gerste, Dutzende von Kartoffelsäcken, an Schnüren aufgereihten Zwiebeln und acht oder neun große Kürbisse füllten die Ladefläche. Neun leblose fette Gänse hingen über der Heckklappe, die Köpfe nach unten, wackelten sie mit jeder Bewegung des Karrens, während die harten Räder über die Furchen im Weg holperten. Die Gänse wurden nicht nur als Braten verkauft, auch ihre Federn waren zum Herstellen von Kissen begehrt. Deshalb durfte sich der Bauer erhoffen, auf dem Markt einen guten Preis zu erzielen.
Hinter dem Karren, an die Hinterachse gebunden, trotteten zwei halb ausgewachsene Schafe – eines davon war ein junger Bock. Die Schafe würden heute wahrscheinlich die einträglichsten Verkäufe des Bauern darstellen. Der Bock würde für die Zucht benutzt werden, und das andere Schaf zeigte bereits ein dichtes Fell, das reichlich Wolle liefern würde. Und zwar jedes Jahr.
Der Bauer war ein schmächtiger Mann. So vornübergebeugt, wie er dasaß, schien er aufgrund seines Alters und eines harten Arbeitslebens geschrumpft zu sein. Doch nach der Qualität und der Menge der Waren zu urteilen, die er zum Markt brachte, hatte sich die harte Arbeit gelohnt. Er trug einen alten geflickten Kittel und einen formlosen Strohhut. Seine Hose war aus rauer, hausgesponnener Wolle und seine Stiefel aus Leder – alt, aber gut erhalten. Zu einer Zeit, in der sich die meisten Bauersleute nicht mehr leisten konnten als Holzpantoffeln, ausgestopft mit Stroh, waren sie Zeugnis seines lebenslänglichen Fleißes wie auch der Qualität seiner Erzeugnisse.
Der Weg führte einen kleinen Hügel hinauf und die gepflügten Äcker zu beiden Seiten wichen nach und nach dichtem Wald. Wenn jemand die Straße beobachten sollte, würde man ihn im dunklen Schatten der Bäume kaum bemerken können.
Doch genau an dieser Stelle hielten sich Späher verborgen. Es waren vier Männer, die beobachteten, wie der Karren langsam zwischen den Bäumen hindurchholperte. Das Land war zu beiden Seiten des Weges ein paar Meter gerodet, dann begann der Wald. Der Bauer blickte schläfrig in die dunklen Schatten rechts und links, dann lehnte er sich auf seinem Kutschbock zurück und rutschte noch ein paar Mal hin und her, um eine bequeme Sitzposition zu finden. Er ließ sich nicht anmerken, dass er die stillen Beobachter im Wald bemerkt hatte.
Der Anführer dieser Gruppe war ein untersetzter, bärtiger Mann von etwa dreißig Jahren. Er war in eine schlichte Weste und eine Hose gekleidet und trug einen Umhang aus Bärenfell. Der Kopf des Bären und sein Oberkiefer dienten ihm als Mütze. Auf den ersten Blick sah das beeindruckend und gefährlich aus – eine zähnefletschende Fratze, die auf dem bärtigen, schmutzigen Gesicht des Mannes thronte. Doch wenn man genauer hinsah, wurde deutlich, dass der Bär bei seinem Tod nicht in bester Verfassung gewesen war. Einer der Fangzähne war in der Mitte abgebrochen und es gab einige kahle, abgewetzte Stellen im Fell. Die traurige Erscheinung seines Umhangs und seiner Kappe störten den Mann nicht. Er nannte sich Barton Bärentöter und hatte sich einen gewissen Ruf in der Gegend verschafft – als Anführer einer Räuberbande, die es auf die einfachen Leute abgesehen hatte, auf Bauern und Bewohner kleiner Dörfer.
Barton saß auf dem untersten Ast eines Baumes und beobachtete den Karren, der quietschend vorbeirollte. Jetzt blickte er verärgert nach unten, da einer seiner Männer den Arm ausgestreckt und an seinem Bein gezupft hatte.
»Was?«, fragte er in einem verärgerten Flüstern. Der Mann, der gezupft hatte, hieß Donald. Mit einem albernen Grinsen deutete er auf den Karren.
»Gute Sachen im Karren«, sagte er. Und als der selbst ernannte Bärentöter nicht antwortete, fuhr er fort: »Mir sollten los und die uns hol’.«
»Warum das denn?«, wollte Barton wissen.
Donald zuckte aufgeregt mit den Schultern und rollte mit den Augen. »Weizen, Erdäpfel, Kürbissen, Gäns und Schaf«, zählte er auf, als ob Barton das nicht selbst hätte sehen können. »Mir könn’ das gut verkauf’«, erklärte er.
Barton schüttelte höhnisch den Kopf. »Warum sollten wir uns die ganze Arbeit machen?« Er deutete mit dem Kopf auf die zusammengesunkene Gestalt des Bauern. »Lassen wir ihn das doch für uns machen.«
Donald folgte der angezeigten Richtung, nickte und runzelte dann die Stirn. »Aber dann«, sagte er, »kömmer das nimmer hol, oder? Wenn er’s alles verkauft hat, hat er’s nimmer.«
»Nein«, sagte Baron nachdrücklich. »Er hat dann das ganze Geld vom Verkauf. Schönes Geld, das macht kling, kling, kling.«
Langsam dämmerte Verständnis auf Donalds dreckverschmiertem, unrasiertem Gesicht. »Und wir nehm’ ihm das Kling-kling weg.«
Barton nickte übertrieben. »Genau. Wir nehmen es ihm weg.«
Donald grinste, dann schwand das Lächeln, als er ein weiteres Problem erkannte. »Aber wann?«, fragte er. »Wann denn?«
»Heute Nachmittag, wenn er vom Markt nach Hause fährt«, erklärte Barton ihm.
Donald grinste, als er die Raffinesse hinter Bartons Plan erkannte. »Er fährt mit’m Geld heim …«
»Und wir nehmen es ihm ab«, bestätigte Barton.
Donalds Grinsen wurde breiter, als er sich vorstellte, wie das später ablaufen würde. »Das wird ihm gar nich’ gefall’, ganz bestimmt nich’«, sagte er und kicherte heiser.
Barton nickte und die Bärenfellmütze nickte dabei mit. »Nein, das wird ihm bestimmt nicht gefallen«, bestätigte er. »Aber stört uns das?«
Donald machte zwei oder drei Freudenschritte. »Nein, das stört uns nich’.«
Er blickte dem Karren hinterher, der eben hinter einer Kurve verschwand. Schwach war noch das Quietschen des Rades zu hören, das auch bald verklang.
Barton schätzte den Stand der Sonne ab. »Wir können es jetzt erst mal langsam angehen lassen«, sagte er. »Wird bestimmt paar Stunden dauern, bis der zurückkommt.«
Er stieg von seinem Ast und suchte sich einen Fleck mit hohem, weichem Gras auf der anderen Seite des Baums. Dort legte er sich auf den Boden und streckte sich aus, zog die Bärenmaske über die Augen, um die Augen gegen die Sonne abzuschirmen. Die beiden anderen Mitglieder der Bande – der einäugige Jem und Richard Narbengesicht – taten es ihm nach. Donald musterte alle einen Moment und überlegte noch, ob er es ihnen nachmachen sollte. Doch Bartons Stimme hielt ihn auf.
»Du hältst Wache«, befahl er mürrisch. »Könnte ja sein, dass noch’n Bauer den Weg entlangkommt.«
Donald nickte, leicht enttäuscht. Das dichte Gras dort drüben sah kühl und einladend aus.
»Na gut«, sagte er, »ich halt’ Wache.«
Es war Spätnachmittag, als das quietschende Rad die Rückkehr des Bauernkarrens ankündigte. Der Rhythmus des Quietschens war jetzt schneller, da der leere Karren sich schneller bewegte als vorher. Das Maultier schwang zufrieden den Schweif, während es dahintrottete. Es war viel angenehmer, den leeren Karren zu ziehen als – wie am Morgen – den voll beladenen. Darüber hinaus durfte es jetzt in den Schutz der Scheune und zu einem vollen Futtersack zurückkehren. Der Bauer saß wieder auf dem Kutschbock vor der Ladefläche, die bis auf drei Leinensäcke und einen Beutel leer zu sein schien.
Der Karren verschwand außer Sicht, als er in eine kleine Vertiefung in der Straße fuhr, und Barton gab Jem und Richard eilig seine Befehle.
»Auf die andere Seite«, zischte er. »Donald und ich warten hier. Bleibt in Deckung, bis wir ihn angehalten haben.«
Seine zwei Handlanger wiesen ihn nicht darauf hin, dass sie etwas Derartiges in den letzten Wochen schon Dutzende Male durchgeführt hatten und keine Anweisungen brauchten. Das war bei Barton sinnlos und er war leicht reizbar. Gebückt, obwohl der Karren immer noch außer Sicht war, überquerten sie eilig den schmalen Weg und versteckten sich dann zwischen den Bäumen. Sie waren beide bewaffnet – Jem mit einem selbst gemachten Speer und Richard mit einer schweren, mit Nägeln versehenen Keule.
Barton holte seine eigene Keule hinter dem Baum hervor, unter dem er geschlafen hatte, und bedeutete Donald, zurück in den Wald zu treten.
»Versteck dich«, befahl er. »Warte, bis ich dich rufe.«
Donald nickte einige Male und lief gebückt in den Wald. Die Sonne stand jetzt niedrig am Himmel und warf tiefere Schatten. Barton sah Donald nach, dann nickte er zufrieden. Wenn man nicht bewusst nach Donald suchte, würde man ihn nicht entdecken.
Das Quietschen wurde jetzt lauter. Vorsichtig spähte Barton um den Baumstamm. Der Karren tauchte aus der Senke auf und war nur noch etwa dreißig Meter entfernt. Der Bauer schien keine Ahnung von der drohenden Gefahr durch die Räuber zu haben. Barton grinste boshaft.
»Pech für ihn«, murmelte er.
Er war fast überrascht, dass ein so erfolgreicher Bauer diese Straße alleine entlangfuhr. Barton und seine Männer hatten während der letzten drei Wochen immer wieder den Bauern auf dem Weg zum und vom Markt aufgelauert. Inzwischen hatten die meisten von ihnen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Entweder reisten sie in Gruppen oder sie heuerten bewaffnete Wachen an, die sie begleiteten. In diesen Fällen ließen Barton und seine Männer die Bauern ungehindert passieren. Barton mochte sich selbst als furchtlosen Bärentöter ausgeben, doch er hatte keine Lust, seinen eigenen Hals in einer Auseinandersetzung mit bewaffneten Wachen zu riskieren. Nicht, wenn es immer noch Narren wie diesen gab, die alleine reisten.
Obwohl, ging es ihm durch den Kopf, Alleinreisende wurden inzwischen immer seltener. Er und seine Männer mussten sich wohl bald einen neuen Ort suchen. Aber diese fette Beute würde er noch mitnehmen.
Der Karren war etwa zehn Meter entfernt, als Barton hinter dem Baum hervorkam und auf die Straße trat. Er schwang mehrmals die Keule und die große Waffe machte ein bösartig zischendes Geräusch.
»Anhalten!«, brüllte Barton und hob seine freie Hand in unmissverständlicher Geste.
Der Bauer zog die Zügel an und das Maultier hielt an, schwang den Schweif und stampfte mit einem Fuß. Es schien, als gäbe es eine Verzögerung auf dem Weg zum Futtersack. Das reichte aus, um die schlechte Laune des Maultiers anzustacheln.
Was nicht schwer war.
»Gute Güte. Was haben wir denn hier?«, sagte der Bauer gelassen.
Seine Wortwahl und sein Akzent klangen nicht nach der rauen Sprache des Landvolks, die man von einem einfachen Bauern erwarten durfte. Und das hätte die Alarmglocken bei Barton klingeln lassen sollen. Doch er war zu selbstzufrieden, um Vorsicht walten zu lassen. Der Anblick eines gut gefüllten Beutels zwischen den leeren Säcken auf der Ladefläche des Karrens, zweifellos voller Münzen, war mehr als ausreichend, um ihn sorglos werden zu lassen.
»Ich bin Barton, der Bärentöter!«, röhrte er und deutete auf seine Bärenkappe. Das war normalerweise genug, um seinen Opfern Furcht einzujagen. Dieses Mal jedoch war das Resultat nicht ganz das, was er erwartet hatte.
Der Bauer beugte sich auf seinem Kutschbock nach vorn und spähte interessiert auf die Bärenmaske auf Bartons Kopf. »Willst du mir etwa sagen, dass du diesen Bären getötet hast?«, fragte er erstaunt.
Barton zögerte einen Moment, verblüfft über die mangelnde Furcht bei seinem Opfer. Dann erholte er sich jedoch, hob seine Waffe und schwang sie über seinem Kopf.
»Das stimmt! Ich habe ihn mit einem Schlag dieser Keule getötet!«, zischte er.
Der Bauer nahm den Bärenschädel genauer in Augenschein, kratzte sich am Kopf und fragte dann: »Bist du sicher?«
Nun war Barton wirklich verblüfft. So hatte er sich den Verlauf dieser Unterhaltung nicht vorgestellt. »Was?«, stieß er ungläubig hervor.
Der Bauer deutete auf das Bärenfell. »Bist du sicher, dass er nicht schon tot war, als du ihn gefunden hast?«, fragte er. »Ich meine, schau ihn dir nur mal an. Er ist schwerlich in bester Verfassung, oder? Wenn er nicht schon tot war, dann muss er auf jeden Fall schon todkrank gewesen sein. Du hast ihn einfach erlöst, was eine Gnade war.«
»Es war … es … ich …«, stammelte Barton und suchte nach einer passenden Antwort. Tatsächlich war der Bär schon tot gewesen, als er ihn gefunden hatte. Er hatte ein schönes Leben gehabt und war an Altersschwäche gestorben. Aber noch nie zuvor hatte jemand seine Behauptung, den Bären getötet zu haben, infrage gestellt.
»Natürlich habe ich ihn getötet!«, behauptete er wütend. »Er hat mich angegriffen und ich habe ihn getötet. Deshalb bin ich auch bekannt als Barton, der Bärentöter.«
Der Bauer blieb unbeeindruckt. »Hm«, sagte er nachdenklich. »Bist du sicher, dass du nicht bekannt bist als Barton, der Popo des toten Bären? Schließlich hast du den Kopf des toten Bären auf und du bist sozusagen der Popo darunter. Das klingt für mich sehr viel sinnvoller.«
Das war zu viel für den verwirrten Räuber. Niemand hatte sich ihm bisher widersetzt. Niemand hatte sich bisher über ihn lustig gemacht. Das war zu viel. Er machte einen Schritt auf den Karren zu und hob dabei drohend die Keule.
»Runter vom Karren!«, befahl er. »Wirf den Beutel her und komm runter, oder ich gebe dir eine auf die Nuss!«
Der Bauer musterte ihn zweifelnd, den Kopf zur Seite gelegt. »Nein. Ich glaube nicht«, sagte er.
Barton stieß einen Wutschrei aus und machte noch einen Schritt auf den Karren zu, um diesen frechen Bauern von seinem Kutschbock zu fegen. Doch noch bevor er das tun konnte, hob der Bauer seine Hand in die Luft und machte eine rasche Handbewegung.
Etwa eine Sekunde später verspürte Barton ein heftiges Reißen am Kopf, gleichzeitig wurde ihm die Bärenmaske vom Kopf gerissen und am Baum hinter ihm durch einen noch wippenden Pfeil festgenagelt.
Drei
Nun, König Philippe, sagt uns, wie wir Euch helfen können?«
Es war der Morgen nach der mitternächtlichen Ankunft auf Schloss Araluen, und Philippe und sein Bruder befanden sich in Duncans Arbeitszimmer. Anwesend waren außerdem noch Lord Anthony, der Kämmerer, und ein hochgewachsener, breitschultriger Krieger, der als Sir Horace vorgestellt wurde. Er war Duncans Schwiegersohn und Kommandant der Streitkräfte von Araluen. Sie saßen um Duncans großen Tisch. Ein sechster Mann, gekleidet in einen grün und grau gesprenkelten Umhang, saß auf der Seite, als versuche er im Hintergrund zu bleiben. Philippe musste den Kopf wenden, um ihn anzusehen. Er war als Gilan, der Oberste Waldläufer Araluens, vorgestellt worden. Soweit es Philippe betraf, war dieser Mann der Hauptgrund für seinen Aufenthalt hier, und er drehte sich immer wieder zu ihm, um den schweigenden Mann zu mustern.
»Es geht um meinen Sohn, Giles«, sagte Philippe und kam geradewegs zur Sache. »Er wird von einem meiner Barone gefangen gehalten.«
Duncan neigte nachdenklich den Kopf. Das waren ernste Nachrichten, die nichts Gutes für Gallica bedeuteten, ein Land mit einer bekanntermaßen instabilen politischen Geschichte. Revolten und Streitigkeiten unter seiner regierenden Klasse waren an der Tagesordnung. Philippe war selbst durch einen Aufstand auf den Thron gekommen und hatte während der vergangenen neun Jahre in einer Zeit der Unruhe regiert.
Andererseits waren das nicht völlig schlechte Neuigkeiten für Araluen. Solange Gallica mit inneren Querelen beschäftigt war, stellte es eine geringere Bedrohung für andere Länder dar. Vor vielen Jahren war die große und mächtige Nation ein aggressiver und unberechenbarer Staat gewesen, hatte den Frieden seiner Nachbarn bedroht und versucht, neue Territorien zu erobern. Doch nun waren die Gallier bereits seit einiger Zeit zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, um begehrlich über ihre eigenen Grenzen hinaus nach anderen Ländern zu schielen.
»Wie ist das denn passiert?«, fragte Duncan. »Und wer ist der fragliche Baron?«
»Sein Name ist Lassigny, Baron Joubert de Lassigny. Seine Burg ist das Chateau des Falaises. Es ist eine mächtige Burg«, erklärte Philippe.
Duncan warf Anthony einen kurzen Blick zu. Der Kämmerer nickte diskret. Er hatte von Joubert de Lassigny gehört, denn es gehörte zu seinen Aufgaben, Informationen über ehrgeizige Adlige in Araluen und den angrenzenden Ländern zu sammeln, die vielleicht eine Bedrohung des gegenwärtigen Friedens darstellten.
»Und Ihr sagt, dieser Mann hat Euren Sohn entführt?«, fuhr Duncan fort.
»Nicht so direkt«, sagte Philippe. »Es war eher so, dass er eine sich bietende Gelegenheit nutzte. Mein Sohn war in Lassignys Provinz zur Jagd, als ein heftiger Sturm aufkam. Er und seine Begleiter suchten Schutz im Chateau des Falaises. Leider hat Giles aufgrund seiner Jugend nicht erkannt, dass Lassigny nach mehr Macht strebt. Indem er sich selbst in Lassignys Hände begab, hat er ihm eine enorme Möglichkeit verschafft, seine Position zu verbessern und seine Macht auszuweiten.«
Anthony beugte sich nach vorn. »Hat Lassigny irgendwelche direkten Drohungen gegen Euren Sohn ausgesprochen?«
Philippe schüttelte mit einem bitteren Lächeln den Kopf. »Dafür ist er zu schlau. Er weiß, dass ich bei einer direkten Drohung Unterstützung der anderen Barone einfordern und ihn zwingen könnte, Giles freizulassen. Er behauptet jedoch, Giles hätte aus freien Stücken beschlossen, auf unbestimmte Zeit auf Chateau des Falaises zu bleiben. Die anderen Barone akzeptieren diese Erklärung und halten sich heraus. Keiner von ihnen ist besonders loyal der Krone gegenüber«, sagte er verächtlich. »Das Chateau des Falaises ist eine mächtige Burg, und meine eigenen Kräfte reichen nicht aus, um sie zu belagern und zu erobern. Ich bräuchte vier Mal so viele Männer. Und wenn ich Lassigny angreife, könnte ich eine Revolte bei anderen auslösen. Ich weiß, dass einige geradezu nach einem Vorwand suchen, um sich gegen mich zu erheben.«
»Hat Lassigny irgendwelche direkten Forderungen an Euch gestellt?«, warf Horace ein. »Hat er einen Preis für die Freilassung Eures Sohnes festgelegt?«
Wieder schüttelte der König von Gallica den Kopf. »Nicht direkt. Er versucht bereits seit einigen Jahren die Kontrolle über die an sein Gebiet angrenzende Provinz zu bekommen. Der dortige Baron ist vor einigen Jahren gestorben und Lassigny hat seitdem ein Auge darauf geworfen.«
Er hielt inne und sein Bruder führte die Erklärung fort. »Der tote Baron hatte keinen Erben und Nachfolger, und Lassigny hat das Land offiziell beansprucht«, erläuterte Louis. »Es ist eine reiche Provinz, und wenn er sie unter seiner Herrschaft hätte, würde er über noch größere Macht verfügen.«
»Aber sicher kann der König ernennen, wen er als Baron dieser Provinz auswählen will?«, fragte Horace nach. Dies war jedenfalls in Araluen der Fall. Doch anscheinend nicht in Gallica.
»Ich wünschte, so wäre es«, erwiderte Philippe. »Aber Lassigny hat einen gewissen Anspruch auf die Position, wenn auch einen sehr geringen. Vor hundert Jahren bildeten die beiden Provinzen eine Baronie. Diese wurde von einem meiner Vorfahren geteilt – wahrscheinlich, weil sie eine zu mächtige Basis bildete, um seine Position zu bedrohen. Es gibt Mitglieder im Konzil der Barone, die Lassignys Anspruch unterstützen. Zweifellos erwarten sie eine Belohnung, sollte sein Anspruch anerkannt werden.«
»Und ganz zufällig hat er seinen Anspruch genau zu der Zeit wieder erhoben, als Euer Sohn in seine Hände fiel?«, sagte Duncan.
Philippe sah zu ihm. »Genau. Die Botschaft ist unausgesprochen, aber dennoch deutlich. Gebt mir das Anrecht auf die anschließende Provinz und Giles wird heimkehren dürfen.«
»Ich sehe Euer Problem«, sagte Duncan nachdenklich. »Aber mir ist nicht klar, welche Hilfe wir leisten könnten. Wir können wohl kaum Truppen nach Gallica entsenden, um Eure Autorität gegenüber Lassigny zu stützen. Das wäre eine zu große Provokation für die anderen Barone. Ihr sagtet bereits, dass viele von ihnen ihn stillschweigend unterstützen.«
»Das ist richtig.«
»Dann könnte die Entsendung unserer Truppe zu Eurer Unterstützung eine Revolte unter ihnen auslösen, und möglicherweise sogar einen Krieg zwischen unseren beiden Ländern. Ich fürchte, dieses Risiko kann ich nicht eingehen für etwas, das grundsätzlich eine innere Angelegenheit von Gallica ist.« Er runzelte die Stirn und fuhr fort. »Ich möchte nicht teilnahmslos gegenüber Euren Problemen klingen, doch ich weiß, wie unsere Barone reagieren würden, sollte umgekehrt ich um Unterstützung von gallischen Truppen bitten.« Er blickte in den Raum zu seinen Beratern, die daraufhin nickten.
»Ich bitte nicht um Truppen«, antwortete Philippe. »Ich bitte Euch nicht, meine Schlacht für mich zu schlagen. Dies ist keine Situation, die durch eine Streitkraft gelöst werden kann. Hier sind List und Intelligenz gefragt. Wahrscheinlich kann ein einziger Mann helfen.«
»Ein einziger Mann?«, warf Horace ein. »Wer sollte das sein?«
Philippe hob in einer fragenden Geste die Hände. »Ich habe keinen bestimmten Mann im Sinn«, antwortete er. »Das müsstet Ihr entscheiden und empfehlen.«
»Ich kann Euch nicht folgen«, sagte Duncan. »Ihr meint, ein einziger Mann könne Euer Problem lösen, aber Ihr wisst nicht, wer er ist. Ihr sprecht in Rätseln, Philippe.« In seiner Stimme schwang ein Hauch Ärger mit. Die Gallier schienen ein abartiges Vergnügen dabei zu empfinden, schwer verständlich zu sein.
Philippe bemerkte das und machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Ich wollte keine Verwirrung stiften«, sagte er. »Es geht mehr um den Typ von Mann, an den ich denke.« Er drehte sich im Stuhl, um Gilan direkt anzusehen. »Einer Eurer Waldläufer wäre vielleicht der Richtige.«
Gilan zeigte keinerlei Regung. Sein Gesicht blieb ausdruckslos. »Was wisst Ihr über unsere Waldläufer?«, fragte er.
Philippe zuckte mit den Schultern. »Sie haben einen gewissen Ruf«, sagte er. »Einen Ruf dafür, Dinge zu erledigen, ohne zu Gewalt greifen zu müssen. Es heißt, sie können das Unmögliche erreichen.«
»Es heißt auch, wir seien Zauberer, welche die dunklen Künste beherrschen«, sagte Gilan. »Aber keine der Aussagen ist wahr. Tatsache ist schlicht und einfach, dass meine Männer sorgfältig ausgewählt, hochintelligent und gut ausgebildet sind. Sie können kämpfen, wenn notwendig, aber zuallererst benutzen sie ihren Verstand, um Kämpfe zu vermeiden.«
»Und das ist genau die Art von Mann, die in dieser Situation gebraucht wird«, sagte Philippe. »Falaise ist eine mächtige Burg. Sie könnte einer Belagerung jahrelang standhalten, selbst wenn ich die Männer und die Unterstützung für eine solche Belagerung hätte. Aber ein Mann, der klug und listig ist, könnte in der Lage sein, in die Burg einzudringen und Giles herauszuholen.«
Duncan räusperte sich. Er war sich nicht sicher, ob er die Richtung mochte, in die diese Unterhaltung ging. Die Waldläufer waren eine ganz besondere Einheit. Der Bund der Waldläufer war gegründet worden, um den Frieden in Araluen zu bewahren und den Königen von Araluen zu dienen. Sie waren nicht dazu bestimmt, an andere Länder ausgeliehen zu werden.
»Etwas möchte ich gern hervorheben«, sagte er. »Die Waldläufer haben die Aufgabe, dem König zu dienen. Sie sind auch bekannt als die Waldläufer des Königs.«
Louis lächelte salbungsvoll. »Und mein Bruder ist ein König.«
Duncan runzelte die Stirn. Manchmal können die Gallier wirklich aalglatt sein, dachte er. »Er ist nicht der König unserer Waldläufer«, sagte er geradeheraus.«
Philippe reagierte darauf mit dem typischen Schulterzucken der Gallier. »Das ist natürlich richtig. Aber es gibt doch gewiss eine Bruderschaft unter Königen, nicht wahr? Und schließlich ist eine Drohung gegenüber einer königlichen Familie eine Drohung gegen alle. Wenn dies in Gallica ungesühnt passieren kann, könnte es andere hier genauso ermutigen.«
Es lag eine gewisse Wahrheit in dem, was er sagte, doch Duncan war dennoch nicht überzeugt. Vorfälle in Gallica hatten keine wirkliche Auswirkung auf die Lage in Araluen. Trotzdem war Duncan Realist genug, um zu wissen, dass es immer unentdeckte Strömungen von Ablehnung und Intrigen in jedem Königreich gab, auch wenn sein Königreich im Augenblick relativ stabil und friedlich war.
»Vielleicht«, gestand er widerwillig ein. Er ließ den Blick durch den Raum schweifen, um die Reaktion von Anthony und den anderen zu erfahren. Deren Gesichter wirkten unentschlossen. »Ich muss mich mit meinen Beratern besprechen«, antwortete Duncan dem König von Gallica. »Ich werde Euch meine Entscheidung heute Abend mitteilen.«
Philippe verbeugte sich gekonnt im Sitzen.
»Das ist alles, worum ich bitten kann«, sagte er glatt.
Nachdem Philippe und sein Bruder in ihre Quartiere zurückgekehrt waren, sah Duncan seine drei Berater an.
»Nun, was meint Ihr?«, fragte er. Sie tauschten Blicke aus. Keiner schien als Erster sprechen zu wollen. Also sprach er seinen Schwiegersohn direkt an. »Horace?«
Der hochgewachsene Krieger rutschte auf seinem Stuhl hin und her, als fühle er sich äußerst unwohl. »Ich weiß nicht, ob uns das wirklich etwas angeht«, sagte er schließlich. »Sosehr ich etwas wie eine Entführung und unausgesprochene Forderungen für die Freilassung ablehne, scheint mir, es ist eine Angelegenheit der Gallier, ein Problem, das sie selbst lösen müssen. Moralisch verurteile ich Lassignys Handlungen. Aber ich bin nicht sicher, ob wir uns da einmischen sollten. Und es ist ja auch nicht so, als schuldeten wir Philippe irgendeinen Gefallen.«
»Sehr richtig«, stimmte Duncan zu. »Und Philippe war nie ein besonders freundlicher Nachbar, oder? Diese Situation könnte größtenteils seine eigene Schuld sein.«
»Wieso meint Ihr das, Euer Majestät?«, fragte Gilan.
Der König zuckte mit den Schultern und blickte zu seinem Kämmerer. »Sagt Ihr es ihnen, Anthony.«
Lord Anthony räusperte sich und überlegte einen Augenblick. Während der Bund der Waldläufer verantwortlich dafür war, den König über mögliche Gefahren oder Probleme innerhalb von Araluen zu informieren, unterhielt Anthony ein Netzwerk von Personen in geheimer Mission auf dem Festland – hauptsächlich in Gallica, Teutlandt und Iberion. Sie berichteten ihm regelmäßig über Ereignisse und politische Angelegenheiten, die Auswirkung auf Araluen haben konnten.
»Philippe ist ein schwacher König«, sagte er schließlich. »Er besitzt keine echte Autorität gegenüber seinen Baronen. Er regiert, indem er sie gegeneinander aufhetzt, und ist dafür bekannt, sich bestechen zu lassen. Entsprechend ist Gallica seit Jahren ein instabiles Königreich, das von Krisen und Korruption geschüttelt wird. Die gegenwärtige Situation ist wahrscheinlich größtenteils auf seine eigene Schwäche und Unentschlossenheit zurückzuführen. Lassigny hat eine Gelegenheit erkannt und ergriffen.«
»Was wissen wir über Lassigny?«, wollte Horace wissen.
»Er könnte ein Problem werden«, erklärte Anthony. »Er ist aggressiv und ehrgeizig und offensichtlich nicht zimperlich in der Wahl der Mittel, um seine Ziele zu erreichen. Er verfügt über eine starke Garnison in Falaise und hat darüber hinaus Zugriff auf eine große Miliz, wenn es darauf ankommt. Und wie König Philippe uns sagte, hat er die Unterstützung von einigen der anderen Barone.«
»Wie ehrgeizig ist er Eurer Meinung nach?«, fragte Duncan.
Anthony antwortete nicht sofort, sondern überlegte offensichtlich genau. »Ich würde sagen, er möchte mehr als die Kontrolle über die beiden Provinzen. Nach dem, was ich über ihn gehört habe, vermute ich, dass er ein ganz bestimmtes Ziel hat.«
»Welches Ziel?«, fragte Duncan, auch wenn er das Gefühl hatte, er kenne die Antwort bereits.
»Meiner Meinung nach möchte er den Thron übernehmen. Er hat die Macht und die Unterstützung der anderen Barone, zweifellos gekauft mit Versprechen von Belohnung im Falle des Erfolgs. Er geht ein großes Risiko ein, indem er den Sohn des Königs gefangen hält. Er muss nach mehr streben als nur nach der Kontrolle über eine andere Provinz.«
»Wie steht es um Philippes Behauptung, dass ein Angriff auf eine königliche Familie ein Angriff auf alle ist?«, fragte Horace.
Anthony schüttelte den Kopf und breitete die Hände in einer ablehnenden Geste aus. »Das mag er vielleicht so sehen«, antwortete er. »Er meint, dass er König aus einer Art göttlichem Recht ist. Ihr dagegen, Euer Majestät«, sagte er und nickte in Duncans Richtung, »genießt Ansehen auch aufgrund Eurer eigenen Verdienste. Das Volk ist Euch gegenüber loyal, weil es Euch respektiert.«
Duncan gestattete sich ein schwaches Lächeln. »Ein Großteil davon vielleicht«, sagte er. »Aber ich schließe mich im Grundsatz an. Eine Rebellion in Gallica wird nicht notwendigerweise dazu führen, dass hier das Gleiche passiert.« Er drehte sich zu Gilan. »Was hältst du davon, einen Waldläufer zur Unterstützung zu schicken?«
Der Oberste Waldläufer verzog ablehnend das Gesicht. »Gar nichts«, sagte er. »Der Bund wurde gegründet, um vor allem innerhalb von Araluen tätig zu werden und Euch zu dienen, Majestät«, sagte er. »Ich mag den Gedanken nicht, dass Außenstehende immer mehr über uns erfahren. Wir haben über die Jahre hinweg stets versucht, im Hintergrund zu bleiben, und das möchte ich beibehalten.«
Duncan nickte. »Ich bin deiner Meinung. Ich mag den Gedanken nicht, einen Waldläufer loszuschicken, um Philippe zu helfen. Das käme mir fast so vor, als wären die Männer aus dem Bund Söldner, die man anheuern kann.«
»Wir haben die Waldläufer in der Vergangenheit auch losgeschickt, um den Nordländern zu helfen … und den Arridanern«, warf Anthony ein.
»Das sind Freunde und Verbündete«, erwiderte Duncan sofort. »Wir haben Bündnisse mit ihnen geschlossen und sie geben uns auch etwas zurück. Philippe hingegen ist uns im Großen und Ganzen stets mit Geringschätzung begegnet. Zumindest bis jetzt, da er unsere Hilfe braucht.«
»Es gibt allerdings noch etwas zu berücksichtigen«, sagte Anthony. »Es könnte in unserem Interesse sein, dafür zu sorgen, dass Philippe auf dem Thron bleibt.« Er machte eine Pause und Duncan bedeutete ihm mit einer Handbewegung fortzufahren. »Philippe ist ein schwacher König und Gallica ist zersplittert und uneinig. Lassigny andererseits wäre ein starker König. Er könnte die Barone vereinen und dadurch für Stabilität in Gallica sorgen.«
»Aber das ist doch gewiss eine gute Sache?«, meinte Horace.
Doch Anthony schüttelte den Kopf. »Er ist aber auch ehrgeizig und skrupellos«, sagte er. »Wenn er an die Macht käme, könnte er danach trachten, die Landesgrenzen zu verschieben. Möglicherweise müsste er das sogar, weil er die anderen Barone, die ihn bei der Thronübernahme unterstützten, belohnen müsste.«
»Ihr wollt damit sagen, dass er eine Bedrohung für Araluen sein könnte?«, hakte Duncan nach.
Anthony nickte langsam. »Sicher würde er eine größere Bedrohung darstellen als Philippe.«
Ein unangenehmes Schweigen breitete sich im Raum aus. Schließlich brach Duncan es.
»Dann könnte es also in unserem Interesse sein, Philippes Bitte zu entsprechen.«
Vier
Barton drehte sich entsetzt um und starrte auf seine Bärenfellmütze, die jetzt am Stamm des Baumes festhing, hinter dem er sich versteckt hatte. Er blickte zurück zu dem Bauern, der seinen Blick völlig gelassen und überhaupt nicht ängstlich erwiderte. Diese Art von Verhalten bei einem mutmaßlichen Opfer war Barton absolut neu, und sein Verstand, der noch nie der hellste gewesen war, kämpfte darum, all das zu verstehen.
»Oh, was für ein Jammer«, sagte der Bauer mitfühlend. »Deine nette Mütze hat ein neues Loch.«