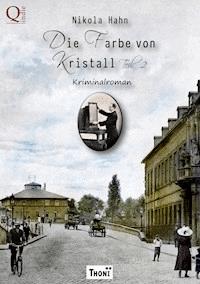4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thoni-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Krimis zur Kriminalistik
- Sprache: Deutsch
Frankfurt am Main, 1882: "Glashaus" nennen die Kinder die Orangerie, die Dr. Könitz seiner Frau vor vielen Jahren als Hochzeitsgeschenk erbauen ließ. Dass das imposante Gebäude nicht nur der Lieblingsplatz von Sophia Könitz ist, sondern ein schreckliches Geheimnis birgt, ahnt niemand, als nach einem fröhlichen Volksfest die 15jährige Dienstmagd Emilie verschwindet. Während der preußische Kriminalkommissar Richard Biddling von einem Vermisstenfall ausgeht, ist Victoria, die Nichte von Dr. Könitz, die zum Entsetzen ihrer Mutter lieber Mordgeschichten von Edgar Allan Poe und Abhandlungen über Leichenerscheinungen liest, statt sich Klavierspiel und Stickarbeiten zu widmen, davon überzeugt, dass Emilie eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Als unter mysteriösen Umständen eine Frauenleiche aus dem Main geländet wird, führen die Spuren plötzlich in die Vergangenheit: Gibt es eine Verbindung zwischen der unbekannten Toten, dem verschwundenen Dienstmädchen und den grausamen Taten des "Stadtwaldwürgers", der vor zehn Jahren in Frankfurt sein Unwesen trieb und nie gefasst werden konnte? Warum weigern sich Dr. Könitz und seine Frau, über einen Unfall zu sprechen, den Victorias Schwester im Glashaus hatte? Und was sind das für geheimnisvolle Stimmen, die nachts im Garten zu hören sind? Ein blutiger Fingerabdruck scheint auf die richtige Fährte zu führen, aber niemand außer Victoria erkennt, welche entsetzliche Geschichte diese Spur erzählt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nikola Hahn
Die Detektivin
Kriminalroman
»Krimis zur Kriminalistik« Band 1
Vers. 5, 8/2016
vollständig überarb. Ausgabe im eBook 2013
Erstausgabe Marion von Schröder 1998; unveränderte Neuauflage im Ullstein Taschenbuch 2011; vollständig überarb. Neuausgabe im Paperback und Hardcover-Großformat Thoni Verlag 2016
© Thoni Verlag 2013–2016
www.thoni-verlag.com
Covergestaltung: N. Hahn, unter Verwendung von Fotografien von C. F. Mylius, Bilder aus dem alten Frankfurt am Main u. Hamburger Polizeibehörde, Photographische Anstalt
Satz u. Layout: N. Hahn
ISBN 978-3-944177-22-9
Ein Qindie-Buch im Thoni Verlag
Das Qindie-Siegel steht für Qualität & Unabhängigkeit.
Weitere Informationen im Internet: qindie.de
Informationen
zur Autorin – zum Buch – zur Reihe »Krimis zur Kriminalistik«
Die moderne Kriminalistik ist ein Kind des mit dem 19. Jahrhundert heraufziehenden Zeitalters der Gesellschafts- und Naturwissenschaften. Dieses Jahrhundert gab dem uralten Kampf der menschlichen Gesellschaft gegen das störende und zerstörende, in jeder Gesellschaftsform lebende, mit jeder neuen Form neu wachsende kriminelle Element ein völlig neuartiges Gesicht. Im Laufe von hundert Jahren lieferten die Naturwissenschaften den Schöpfern der Kriminalistik die Bausteine für das große Fundament, auf dem sich heute das weltumspannende Ringen mit dem Verbrechertum aller Grade und Formen vollzieht. Für mich bildet die Geschichte dieser hundert Jahre eines der bewegtesten Dramen, das die menschliche Gesellschaft kennt.
William Hewitt, in: Jürgen Thorwald, »Das Jahrhundert der Detektive«, Zürich, 1964
Junge Mädchen brauchen – außer etwas Geographie, Geschichte und Naturlehre – kein Bücherwissen zu erlernen, sondern müssen vor allem Menschenkenntnis und hauswirtschaftliche Kenntnisse erlangen. Am wichtigsten ist die Bildung des Charakters: Herzensreinheit, Frömmigkeit, Keuschheit, Bescheidenheit, Sanftmut, Ordnungsliebe.
Frei nach: Campe, »Väterlicher Rat für meine Tochter«, 1789
Eins
Häufig bedienen sich die Verbrecher der Schiebekarren zum Transport ihrer Beute, oder sie erscheinen gar mit Wagen und Pferden auf dem Schauplatz der That.
(W. Stieber: Practisches Lehrbuch der Criminal-Polizei, 1860)
Frankfurt am Main, den 30. Mai 1882
Liebster Ernst!
Ich wünschte mir, Du könntest sehen, was für einen herrlichen Wäldchestag wir dieses Jahr haben! Die Sonne scheint von einem strahlend blauen Himmel, wie er in Indien bestimmt nicht schöner ist, und der Duft der Rosen in Sophias Garten erinnert mich daran, wie sehr Du mir fehlst.
»Was tust du da!«
Erschrocken ließ Victoria die Schreibfeder fallen und fuhr herum. In der Tür zu ihrem Zimmer stand ihre Mutter, und ihr ärgerlicher Gesichtsausdruck bildete einen seltsamen Kontrast zu ihrer festlichen Aufmachung. »Beeile dich gefälligst. In einer halben Stunde fährt der Wagen vor!« Wenn Henriette Könitz wütend war, klang ihre Stimme noch greller als gewöhnlich.
Victoria ließ den angefangenen Brief unauffällig in ihrem Schreibtisch verschwinden und stand auf. »Bitte entschuldige, Mama, aber ich habe nicht auf die Uhr gesehen«, sagte sie demütig. Sie wusste, dass ihre Mutter mit Verboten schnell bei der Hand war, und es wäre eine schlimme Strafe, ausgerechnet am Wäldchestag, dem höchsten weltlichen Feiertag in Frankfurt, zu Hause bleiben zu müssen.
Victoria liebte es, sich unter die fröhlichen, feiernden Menschen zu mischen, um hier und dort ein paar Neuigkeiten aufzuschnappen, die nicht für ihre Ohren bestimmt waren, oder im Wald heimlich ihre unbequemen Stiefel auszuziehen und barfuß über das weiche Moos zu laufen.
Kopfschüttelnd betrachtete Henriette Könitz die unordentliche Frisur ihrer Tochter und ihr vom Sitzen zerdrücktes Kleid. »Eine Dame wirst du nie!«, tadelte sie und verließ das Zimmer.
Victoria schaute in den mannshohen, gefassten Spiegel, der in der Ecke neben ihrem Bett stand, und lächelte. »Ich habe auch nicht vor, jemals eine zu werden, Mama!«
Kurz darauf kam Victorias Kammerzofe Louise Kübler herein, eine verhärmt wirkende Frau Anfang Dreißig. Als sie Victoria vor dem Spiegel stehen sah, fragte sie: »Soll ich Ihnen zuerst das Haar machen, gnädiges Fräulein?«
»Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du mich duzen sollst, es redet sich dann besser!«, entgegnete Victoria beleidigt.
Louise Kübler zupfte an ihrer weißen Schürze. »Aber die gnädige Frau möchte das nicht.«
»Mama ist nicht hier, oder?« Victoria zwinkerte ihr zu. »Du hast genau dreißig Minuten Zeit, um mich in eine ansehnliche höhere Bürgertochter zu verwandeln, mit der man sich am noblen Oberforsthaus nicht blamiert.«
Die Zofe ging zum Bett, auf dem Victorias Sonntagskleid lag, und strich über die weiche, gelbe Seide. »Ich wünschte, ich dürfte nur einmal so etwas Schönes tragen.«
Victoria machte eine abfällige Handbewegung. »Meinetwegen könntest du das Ding gerne haben. Leider hat Mama etwas dagegen. Und wenn wir jetzt nicht bald mit der Staffage anfangen, muss ich am Ende hierbleiben und den Seelentröster für meine liebe kleine Schwester Maria spielen!« Sie streifte ihr zerknittertes Kleid ab und ließ es achtlos zu Boden fallen. »Sich wegen eines dummen Mannsbildes die Augen auszuweinen und aufs Wäldche zu verzichten – das würde mir im Traum nicht einfallen!«
Louise reichte Victoria den mit Volants verzierten Plisseerock und half ihr beim Schnüren des hochgeschlossenen Oberteiles. Danach bürstete sie ihr das Haar. »Stecke ja meinen blöden Zopf gut fest, nicht dass es einen Eklat gibt!«, sagte Victoria.
»Aber sicher, gnädiges Fräulein.« Zum ersten Mal, seit Louise ins Zimmer gekommen war, lächelte sie.
Victoria zog ihre Handschuhe an, und Louise setzte ihr einen mit künstlichen Blumen verzierten Stadthut auf. Dann suchte sie einen farblich auf die Garderobe abgestimmten Sonnenschirm heraus; ein Accessoire, das Victoria verabscheute, obwohl es für ein vornehmes Fräulein unverzichtbar war. Sie drehte sich vor dem Spiegel und verzog das Gesicht. »Wie ich diese Turnüre hasse! Als ob ich einen Gänsehintern hätte!« Feixend streckte sie ihrem Spiegelbild die Zunge heraus.
Victorias sechzehnjähriger Bruder David steckte seinen Kopf zur Tür herein. Er grinste, als er ihre missmutige Miene sah. »Würden Gnädigste geruhen, ihre Toilette demnächst zu beenden? Der Wagen wartet!« Als Victoria Anstalten machte, nach dem Tintenfass zu greifen, zog er sich schleunigst zurück. Ein Glas mit Tinte wäre nicht der erste Gegenstand, den seine Schwester ihm hinterhergeworfen hätte.
David und Victoria waren wie Hund und Katze, und der ungelenke Junge genoss es, sie bei jeder Gelegenheit spüren zu lassen, dass Frauen Menschen zweiter Klasse waren.
Vor dem Anwesen der Familie Könitz stand ein Vierspänner, und Henriette Könitz hatte gerade Louise und David standesgemäß platziert, als Victoria herbeieilte, so schnell es ihr enger Rock zuließ.
»Das nächste Mal bitte ich mir Pünktlichkeit aus!«, mahnte ihr Vater Rudolf Könitz, der ungeduldig vor dem Wagen wartete.
»Ja, Papa«, sagte Victoria und warf ihrem Bruder einen bösen Blick zu, der aus der Kutsche heraus Grimassen schnitt. Als die Geschwister wenig später nebeneinander im Blickfeld ihres Vaters saßen, benahmen sie sich tadellos, denn beide wussten, dass ein falsches Wort genügen konnte, um sie von dem ersehnten Ausflug ins Wäldche auszuschließen.
Die Fahrt führte vom Untermainquai über die vor einigen Jahren errichtete neue Brücke nach Sachsenhausen. Wohin man auch sah, überall waren Menschen unterwegs, zu Fuß, zu Pferd, in Droschken, Equipagen und unzähligen Nachen, in denen Färcher das Fußvolk gegen Entgelt zum jenseitigen Ufer brachten. Arm und Reich, Jung und Alt strömten dem Frankfurter Stadtwald zu, um den dritten Pfingsttag zu feiern.
Der Kutscher lenkte den Wagen durch verwinkelte Gässchen und dann über eine staubige Landstraße an prunkvollen Häusern, Obst- und Gemüsegärten vorbei. Hier und da winkten ihm vergnügte Menschen hinterher. Eine dicke Sachsenhäuserin, die eine Gitarre quer auf dem Rücken trug, schimpfte mit ihrem kleinen Sohn, der herumtrödelte. Ein alter Mann schleppte einen Leierkasten mit sich und sang, und über dem Dach aus zahllosen Hüten und Sonnenschirmen schwebte eine Traube aus bunten Luftballons. Wie gerne hätte sich Victoria einem der vielen Grüppchen angeschlossen, die so voller Lebensfreude ins Wäldche pilgerten! Stattdessen saß sie, die Hände brav im Schoß gefaltet, schweigend in der Kutsche, denn das Gesicht ihrer Mutter verriet ihr allzu deutlich, dass sie immer noch verärgert war. Erst als sie vor dem Oberforsthaus aus dem Wagen stieg, lockerte sich Henriettes Miene auf. Sie zupfte ihr Kleid in Form, spannte ihren Sonnenschirm auf und sah sich neugierig um.
Auch hier wimmelte es von Menschen, die in der Mehrzahl zum gehobenen Bürgertum gehörten. Während sich das einfache Volk an zahlreichen Tischen im Wald vergnügte, bevorzugten die wohlhabenden Bürger das feudale Ambiente des Oberforsthauses, um die neue Garderobe auszuführen.
Rudolf Könitz begrüßte seinen älteren Bruder Dr. Konrad Könitz und dessen Frau Sophia, die auch gerade angekommen waren. »Ich habe zwei Tische besetzen lassen«, sagte er. »Selbstverständlich an exponierter Stelle.« Weil die Plätze am Forsthaus nicht für alle Besucher ausreichten, hatten es sich viele vornehme Familien zur Gewohnheit gemacht, an Feiertagen wie dem Wäldchestag die schönsten Sitzgelegenheiten in den schattigen Lauben und Gängen schon vor Tagesanbruch von Angestellten in Beschlag nehmen zu lassen.
»Na dann! Worauf warten wir noch?«, fragte Konrad Könitz. »Ich bekomme langsam Durst.«
Rudolf lachte. »Ich auch.«
Victoria beneidete die Männer, die sich jetzt zurückziehen konnten, um mit ihresgleichen politische Diskussionen zu führen, während von ihr erwartet wurde, mit ihrer Mutter zu parlieren oder wohlanständig dem tanzenden Volk zuzuschauen. Da sie weder zu dem einen noch zu dem anderen besondere Lust hatte, schlug sie vor, einen Spaziergang zu machen.
»Ich denke nicht daran, über schmutzigen Waldboden zu laufen und mein Kleid zu ruinieren!«, sagte ihre Mutter empört.
Sophia Könitz sah sie lächelnd an. »Wenn du erlaubst, werde ich Victoria begleiten.«
»Tu, was du magst, Schwägerin«, erwiderte Henriette verächtlich und drehte sich zu Louise Kübler um, die unschlüssig neben der Kutsche stand. »Sie kommen mit mir!«
Victoria sah die stumme Bitte in Louises Augen und fragte ihre Mutter, ob sie ihre Zofe nicht mitnehmen dürfe. »Sie könnte das Körbchen mit den Getränken tragen, Mama.«
Henriette musterte ihre Tochter mit einem kühlen Blick. »Wenn du es für erforderlich hältst.« Ohne ein weiteres Wort ging sie davon.
Victoria und Sophia folgten einem schmalen Spazierweg, der durch eine Hecke von der Fahrstraße abgetrennt war und von alten Buchen gesäumt wurde. Mit einem Seitenblick auf das blasse Gesicht ihrer Tante bemerkte Victoria: »Du siehst müde aus. Geht es dir nicht gut?«
Sophia zuckte mit den Achseln. »Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen.«
Victoria schaute über die Schulter nach Louise, die sich etwas abseits hielt, wie es sich für Dienstboten geziemte, und fragte: »Wo hast du denn Emilie gelassen, Tante Sophia?«
»Ich habe ihr freigegeben, aber sie wollte unbedingt noch ein bisschen im Glashaus arbeiten.« Sophia lächelte. »Sie ist ein fleißiges Mädchen, und was noch wichtiger ist: Sie hat ein Gefühl für Pflanzen. Ich bin dir dankbar, dass du sie mir empfohlen hast.« Trotz ihres Lächelns wirkte Sophia traurig.
»Dir fehlt tatsächlich nichts?«, erkundigte Victoria sich nochmals.
Sophia seufzte. »Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich schon seit einer Woche nicht richtig wohl. Es ist so eine Unruhe in mir.«
»Wie meinst du das?«
»Ich weiß es ja selbst nicht! Vielleicht ist es der fehlende Schlaf, der mir dieses Gefühl vorgaukelt.«
»Welches Gefühl denn?«
»Wenn ich es nur erklären könnte!« Sophia stockte und sah ihre Nichte an. »Es könnte sein, dass irgendetwas uns bedroht.«
Victoria blieb stehen. »Was sollte uns an einem so schönen Tag bedrohen, Tantchen? Die Sonne scheint, und wir feiern Wäldchestag!«
»Vielleicht sind meine Nerven überreizt.«
»Das wird es sein. Und deshalb werden wir jetzt einen gemütlichen Spaziergang machen, weit weg von dem Geschwätz der feinen Leute. Das ist nämlich wirklich manchmal bedrohlich – bedrohlich dumm!«
»Deine spitze Zunge wird dich noch ins Unglück stürzen! Mit dreiundzwanzig solltest du ...«
»... einen Ehemann und mindestens zwei Kinder haben.«
Sophia lächelte nachsichtig. »Das Leben einer Frau ist nun einmal gesellschaftlich vorbestimmt, und es tut nicht gut, dagegen aufzubegehren, Kind.«
»Bitte lass uns nicht wieder davon anfangen!«
»Aber ich habe deiner Mutter versprochen ...«
»... mich von den Vorzügen einer Ehefrau und Mutter zu überzeugen, ja, ja. Und ich habe dir versprochen, mich zu bemühen. Wie sehr ich mich bemühe!«
»Und herrschet weise/Im häuslichen Kreise, und reget ohn’ Ende/Die fleißigen Hände«, zitierte Sophia.
Victoria verdrehte die Augen. Eigentlich fand sie Schillers Werke insgesamt nicht übel, und seine Gedanken über das Verbrechen im Allgemeinen und dessen Beschreibung in der Literatur im Besonderen waren sehr interessant, aber für das bei jeder Gelegenheit hervorgekehrte Lied von der Glocke hätte sie ihm am liebsten post mortem noch den Hals herumgedreht. Aber das behielt sie besser für sich.
»Gnädiges Fräulein, dürfte ich etwas fragen?« Louise hatte sich unbemerkt genähert und schaute Victoria erwartungsvoll an.
»Bitte entschuldige mich einen Moment, Tante Sophia.« Victoria ging mit ihrer Zofe einige Schritte beiseite. »Ich glaube, ich kann den Korb genauso gut selbst tragen. Ich gebe dir drei Stunden frei; wir treffen uns danach vor dem Forsthaus.« Flüsternd fügte sie hinzu: »Sie ist nicht hier.« In Louises hagerem Gesicht machte sich Enttäuschung breit, und Victoria zischte: »Reiß dich zusammen!«
»Ich hatte so sehr gehofft, dass sie mitkommt.«
»Deine Stellung hängt davon ab, dass du dich unauffällig benimmst.«
»Und die Ihre ebenso, gnädiges Fräulein«, sagte Louise leise, und diesmal war die förmliche Anrede mit Absicht gewählt.
»Ich wollte dir helfen!«, versetzte Victoria gekränkt.
»Wir wissen doch beide, dass Sie zuvörderst sich selbst helfen wollen, gnädiges Fräulein.«
»Lass bitte diesen Ton! Ich kann nichts dafür, dass deine geliebte Emilie es vorzieht, in der Erde zu graben!«
»Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen.« Louise übergab den Korb und wandte sich ab. Victoria kehrte zu Sophia zurück.
»Was hat Louise denn? Sie wirkt bekümmert«, sagte Sophia, als sie weitergingen.
»Ich glaube, sie braucht mal ein bisschen Abwechslung in ihrer Arbeit. Kammerzofe bei Victoria Könitz zu sein ist sehr anstrengend«, entgegnete Victoria.
»Du bist unmöglich, Kind«, wies Sophia sie lächelnd zurecht.
Victoria deutete auf eine moosbewachsene Steinbank, die neben dem Weg unter zwei knorrigen Eichen stand. »Wollen wir uns ein wenig ausruhen?« Sophia nickte, und Victoria stellte den Korb ins Gras. Sie setzten sich. »Louise hat bestimmt auch ein geschicktes Händchen mit Pflanzen. Vielleicht bringe ich sie mit, wenn ich dich das nächste Mal besuche, Tantchen. Was meinst du?«
»Meinetwegen. Wenn deine Mutter nichts dagegen hat.«
»Was sollte sie dagegen haben? Eine Zofe selbst bei kurzen Verwandtenbesuchen unentbehrlich zu finden, ist dem Ansehen einer Tochter aus gutem Hause durchaus förderlich!«
Sophia hielt sich dezent ihre Hand vor den Mund und lachte. Victoria freute sich, dass die Schatten von ihrem Gesicht verschwunden waren, aber noch mehr freute sie sich, dass sie es wieder einmal geschafft hatte, unbemerkt ihr Ziel zu erreichen. Zufrieden schaute sie in das hellgrüne Blätterdach der Eichen hinauf, in dem irgendwo eine Amsel sang. »Ist es nicht herrlich, dass in Frankfurt selbst die Vögel Wäldchestag feiern?«, fragte sie und zwinkerte ihrer Tante spitzbübisch zu.
»Sollst sehe, Edgar, des is’ die best’ Idee, die mer je gehabt hawwe!« Oskar Straube wuchtete ein Fässchen Sachsenhäuser Apfelwein auf eine betagte hölzerne Schiebekarre und setzte sich damit in Bewegung.
»Des werd awwer net selbst gesoffe!«, rief Oskars Frau ihnen hinterher, und Edgar schrie zurück: »Do kannste gewiss sei, Lotti: Heut’ tun mer uff’m Wäldchestag net saufe, sondern verkaufe, gell, Oskar?«
»Wer’s glaabt«, murmelte die Frau. Sie kannte den ungezügelten Durst ihres Gatten nur zu gut, und sein Freund stand ihm in nichts nach.
Der Tag war heiß, und die Sonne brannte den beiden Mainfischern ordentlich auf den Kopf. Am Affentor hielten sie an.
»Ei! Ich hab noch’e besser Idee!«, sagte Oskar. Er strich sich den Schweiß von der Stirn, kramte in seiner Hosentasche und förderte einen alten Groschen zutage, den er seinem Freund hinhielt: »Damit des Geschäft net ruiniert werd, bezahle mer die Schoppe!« Edgar kratzte sich am Kinn, dann grinste er.
Als die beiden endlich im Stadtwald ankamen, war das Geldstück unzählige Male von einer schmutzigen Hosentasche in die andere gewandert und das Apfelweinfässchen bis auf den letzten Tropfen leer. Vergnügt winkten sie den vorbeifahrenden Wagen hinterher und intonierten dabei in ohrenbetäubender Stimmlage ein Frankfurter Wäldchestaggedicht von 1802: »Den ersten Pfingsttag begehet man hehr, am zweiten, da sucht man zu glä-hänzen. Am dritten, da macht man die Gläser brav leer, am Mittwoch, da eilt man zu Tä-hänzen ...«
Schließlich stellten sie die Handkarre am Wegrand ab und ließen sich in der bunten Gesellschaft aus trink- und essfreudigen Frankfurtern nieder, die durcheinandergewürfelt im schattigen Wald saßen und abwechselnd redeten, stritten, lachten und die gefüllten Körbe und Flaschen leerten. Es duftete nach Schinken und Würstchen, nach Braten und Geflügel, Kuchen und Pastetchen, und in Römern und Bechern schimmerte grüner Rießler aus den Weingärten Sachsenhausens und der Sekt des dritten Standes, der allseits beliebte Apfelwein. Es dauerte nicht lange, bis auch Oskar und Edgar wieder gefüllte Gläser in den Händen hielten, und lachend prosteten sie ihren freundlichen Spendern zu.
Es war schon spät, als sie sich auf den Rückweg machten, und kurz vor dem Affentor verloren sie sich aus den Augen. Nur wenig später sah Oskar das Mädchen.
»Du hast recht gehabt, Victoria. Die Waldluft hat mir gutgetan«, sagte Sophia, als sie auf den Pfad einbogen, der zurück zum Forsthaus führte. »Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht, und es war an der Zeit, mich zu erinnern, wie undankbar ich bin, an so einem schönen Tag betrübt zu sein.«
»Das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, Tante Sophia. Du brauchst bloß ab und zu ein bisschen Aufmunterung. Und dafür werde ich sorgen«, entgegnete Victoria vergnügt.
Sophia lächelte. »Ach, ich kann mich ja selbst nicht mehr verstehen. Es war diese dumme Angst!«
Victoria sah ihre Tante erschrocken an. »Es ist doch nicht etwa wieder die Krankheit?« Vor zehn Jahren waren bei Sophia Symptome aufgetreten, die befürchten ließen, dass sie vom Wahn befallen sein könnte. Aber nach einigen Wochen war sie von selbst genesen, und nicht einmal ihr Mann, der zu den angesehensten Ärzten in Frankfurt gehörte, hatte die Ursache für ihr Leiden herausfinden können.
»Mach dir bitte keine Sorgen, Kind. Mir fehlt nichts.« Sophia lächelte immer noch, aber ihre Augen straften ihre Worte Lügen. »Wenn man nachts, statt zu schlafen, im Garten umherschleicht, nimmt es nicht wunder, wenn die überreizten Sinne verrücktspielen und man Stimmen hört, wo nur der Wind in den Blättern rauscht.«
»Sagt Dr. Konrad Könitz, um seine angeblich nervöse Gattin ruhigzustellen«, bemerkte Victoria süffisant. »Was sind das für Stimmen?«
»Ich sagte doch: Der Wind narrte mich.«
»Wo hast du sie gehört? Wann? Wie oft?«
Sophia schlug sich in gespieltem Entsetzen vor die Stirn. »Wie konnte es mir einfallen, ausgerechnet dir davon zu erzählen! Wenn Konrad jemals erfährt, dass ich dir den Schlüssel zur Bibliothek überlassen habe, wird er mich vierteilen.«
»Er wird Papa raten, mich unverzüglich in ein Kloster einzusperren, und dir zur Ablenkung ein halbes Dutzend Palmen schenken. Also: Was waren das für Stimmen?«
Sophia schüttelte sich. »Sie klangen so unheimlich! Ein Flüstern und Wispern, irgendwo im Glashaus. Wahrscheinlich war es tatsächlich nur der Wind.«
»Wie oft hast du es gehört?«
»In der vergangenen Woche zweimal, jeweils kurz nach Mitternacht.«
»Und dieses Geflüster ist die Ursache für deine Angst?«
»Nein«, sagte Sophia. »Ich war unruhig und konnte nicht schlafen. Als ich in den Garten hinausging, hörte ich die Stimmen.«
»Hast du versucht herauszufinden, aus welchem Teil des Glashauses sie kamen? Aus der Orangerie, oder vielleicht aus dem Erdhaus?«
»Wo denkst du hin! Ich bin natürlich sofort ins Haus zurückgelaufen und habe Konrad geweckt. Er hat im Garten nachgesehen und gemeint, ich müsse mich getäuscht haben. Zwei Tage später habe ich es wieder gehört, ihm aber nichts davon gesagt. Jetzt traue ich mich nicht mehr nach draußen, sobald es dunkel wird.«
»Hat Onkel Konrad auch im Glashaus nachgesehen?«
»Ja.«
»Bist du sicher?«
»Ja! Er hat beteuert, dass dort nichts ist.«
»Was hältst du davon, wenn wir uns heute Nacht zusammen auf die Lauer legen?«
»Was hast du für sonderbare Ideen, Kind?« Sophia schüttelte den Kopf. »Deine Mutter würde es nie erlauben.«
»Irgendwas wird mir schon einfallen, das ich ihr erzähle.«
Sophia sah ihre Nichte streng an. »Du wirst sie doch nicht etwa anlügen wollen?«
»Selbstverständlich nicht!«, sagte Victoria. »Ich glaube, es ist ohnehin besser, wenn ich dich erst morgen früh besuche. Bei Tag sieht man mehr als in der Nacht. Ich bringe Louise mit. Sie kann mit Emilie im Glashaus arbeiten, während wir uns im Garten umschauen. Wenn sich wirklich jemand da herumgetrieben hat, muss er irgendwelche Spuren hinterlassen haben.« Sie lachte. »Es sei denn, es war eins von Großmamas Kellergespenstern.«
Inzwischen waren sie am Oberforsthaus angekommen. Victoria hielt nach Louise Ausschau; sie war jedoch nirgends zu sehen. In den Bäumen hingen Schaukeln, und die beiden Frauen schauten den Kindern zu, die sich mit Gejohle zu den Kronen hinaufschwangen.
»Ich möchte wissen, wo sie bleibt!«, sagte Victoria ärgerlich, als Louise nach einer Viertelstunde immer noch nicht da war.
»Wo wollte sie denn überhaupt hin?«, fragte Sophia.
Victoria zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ein bisschen feiern vielleicht.«
»Und was sagt deine Mutter dazu, dass du eurem Personal eigenmächtig Freistunden gibst?«
»Sie ist immerhin meine Zofe, und wenn ich ...« Victoria brach ab, als Louise, außer Atem und eine Entschuldigung stammelnd, angerannt kam. Victoria drückte ihr wortlos den Korb in die Hand, und sie machten sich auf die Suche nach ihrer Familie. Sophia entdeckte sie zuerst und steuerte auf einen gut besetzten Tisch zu, an dem Henriette Könitz sich mit zwei anderen Frauen angeregt unterhielt. Als sie ihre Tochter und ihre Schwägerin bemerkte, verdüsterte sich ihre Miene.
»Sophia, Victoria! Wo wart ihr so lange?« Verächtlich musterte sie Sophias Kleid. »Du solltest lieber kein Blau tragen, das macht blass und ausdruckslos.«
»Danke für die Anregung, Henriette«, entgegnete Sophia freundlich. »Wie du weißt, tue ich mich in Fragen der Mode etwas schwer. Meinst du, ein dunkles Grün würde mich besser kleiden?«
»Wir könnten in der kommenden Woche zusammen Stoffe anschauen«, schlug Henriette in versöhnlichem Ton vor und begann, Sophia in aller Ausführlichkeit mit den Geheimnissen der Damenmode vertraut zu machen.
Victoria fand das Gerede über Kleider, Hüte und Toiletteregeln langweilig. Außerdem ärgerte sie es, dass Sophia sich wieder einmal ohne jede Gegenwehr von ihrer Mutter hatte bloßstellen lassen. Dabei sah sie in ihrem schlichten blauen Kleid wesentlich besser aus als Henriette, die, wie jedes Mal, wenn sie ausging, Stunden damit verbracht hatte, sich herauszuputzen. Henriette Könitz hatte durchaus Sinn für modische Eleganz, aber sie war keine Schönheit, und daran konnte auch der teuerste Schneider nichts ändern. Sehnsüchtig schaute Victoria zu dem Tisch hinüber, an dem ihr Vater und ihr Onkel saßen.
Rudolf Könitz gab gerade die neuesten Auswüchse der Frankfurter Politik zum Besten. »Rate mal, was unser Sparbrötchen von Oberbürgermeister sich für dieses Jahr hat einfallen lassen!«
»Na, was?«, fragte Konrad.
»Seine Politik des Atemschöpfens von Protz und Verschwendung hat ein neues Kind geboren: Ab Mitternacht werden die Gaslaternen heruntergedreht.«
»Und damit fängt er ausgerechnet am Wäldchestag an?«
»Eigentlich sollte die Anordnung ab dem Sommer gelten, aber wenn man schon zu Pfingsten beginnt, kann man noch mehr sparen.« Rudolf Könitz lachte zynisch. »Das zwielichtige Gesindel in der Stadt wird ihm zu höchstem Dank verpflichtet sein.«
Kindergeschrei übertönte das Gespräch, und Victoria hing ihren Gedanken nach. Was mochte die Ursache für die seltsamen Geräusche sein, die Sophia gehört hatte? Im Gegensatz zu ihrem Onkel glaubte sie nicht an eine Sinnestäuschung. Offenbar gab es im Glashaus ein Geheimnis, und sie war entschlossen, es zu lüften.
Es dämmerte schon, als sich die vornehme Gesellschaft am Oberforsthaus auf den Heimweg machte. Ein Konvoi aus Droschken, luftigen Phaetons und eleganten Equipagen, in denen gediegene Damen und Herren saßen, bewegte sich langsam in Richtung Stadt, und alle waren sich einig, dass der Wäldchestag in diesem Jahr besonders schön gewesen war.
Auch Dr. Könitz hatte ein zufriedenes Lächeln im Gesicht, als er seine Frau fragte: »Geht es dir besser, meine Liebe?«
Sophia nickte. »Der Spaziergang mit Victoria hat mir gutgetan. Morgen kommt sie uns übrigens besuchen.«
»Uns?«, sagte Konrad amüsiert. »Ich glaube kaum, dass meine vorlaute Nichte besonderen Wert auf meine Gesellschaft legt.«
Sophia lachte. »Auf meine schon. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie jeden Tag käme.«
Die Kutsche rumpelte über die Alte Brücke zurück nach Frankfurt und folgte eine Weile dem Mainufer, ehe sie in die Neue Mainzer Straße einbog. Als sie sich ihrem Stadtpalais näherten, bemerkte Sophia einen Mann, der vor dem Eingang auf und ab lief. Die Pferde waren kaum zum Stehen gekommen, als er den Schlag aufriss.
»Entschuldigen Sie bitte vielmals, Dr. Könitz!«, rief er nervös. »Sie müssen sofort mit mir zu Elisabeth fahren, ich glaube, es ist soweit!«
»Das Kind sollte doch erst in zehn Tagen kommen!« Konrad stieg eilig aus. »Helfen Sie meiner Frau«, forderte er den Kutscher auf und rannte ins Haus. Kurz darauf kam er mit seiner Arzttasche zurück.
»Es ist eine Katastrophe: ausgerechnet am Wäldchestag, wenn alle unterwegs sind«, jammerte der Mann. »Ich war schon vor einer Stunde hier, und als niemand öffnete, habe ich es woanders versucht. Aber nirgends ist heute ein Arzt aufzutreiben!«
»Hat Ihnen Emilie nicht gesagt, wann wir zurückkommen?«, fragte Sophia erstaunt.
Der Mann sah sie ebenso erstaunt an. »Emilie?«
»Eines unserer Hausmädchen. Sie blieb hier.«
»Nein, da war niemand. Ich habe mehrfach geschellt«, behauptete der Mann und stieg zu Dr. Könitz in den Wagen.
Emilie war nicht im Haus, und sie war auch nicht im Garten. Sie war weg. Wie vom Erdboden verschluckt.
Zwei
Eine planmäßig überlegte Tödtung einer Person lediglich in der Absicht, dieselbe zu bestehlen, gehört in neuester Zeit zu den unerhörten Seltenheiten.
Mit einem Stöhnen fasste sich Oskar an den Kopf und betastete die dicke Beule auf seiner Stirn. Mühsam stand er auf und schaute sich um: Warum lag er mitten in der Nacht unter der Alten Brücke, noch dazu auf der falschen Seite des Mains? Wo war Edgar, wo seine Schiebekarre mit dem Apfelwein? Plötzlich fiel ihm das Mädchen ein. Er war ihm gefolgt und hatte gehört, wie etwas ins Wasser klatschte; später war er auf dem Boden herumgekrochen, hatte die Silhouette des Brickegickel gesehen und das Amulett gefunden. Dann folgte Nebel, durch den keine Erinnerung drang. Oskar griff in seine Hosentasche und umfasste das Schmuckstück. Es fühlte sich kühl an. Nein, er hatte nicht geträumt! Aber wie, um Himmels willen, war er hierher geraten? Er schlurfte zum Mainquai hinauf und überquerte die Brücke zum anderen Flussufer. Er hatte Mühe, den Weg zu finden, denn die Stadt lag im Dunkeln. Alle Straßenlaternen waren aus, und der Mond hatte sich hinter Wolken verzogen.
Dribb de Bach, wenige Meter hinter der Brücke auf Sachsenhäuser Boden, wäre er beinahe über seine Schiebekarre gefallen, die am Straßenrand stand, als hätte sie auf ihren Besitzer gewartet. Oskar starrte das hölzerne Gefährt an und versuchte noch einmal, sich zu erinnern, aber ihm war so schlecht und schwindlig, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte. Den Wagen schwerfällig vor sich herschiebend, bog er von der Brückenstraße nach Westen ins Fischer- und Schifferviertel ab und verschwand in einem Gässchen, das von aneinandergebauten, windschiefen Häusern gesäumt wurde.
Laut holperten die Speichenräder in der nächtlichen Stille über das grobe Pflaster, und als Oskar auf dem kleinen Platz vor seinem Haus ankam, ließ er die Karre einfach stehen und wankte zu dem steinernen Brunnen in der Platzmitte. Er drückte die verrostete Schwengelpumpe, hielt seinen Kopf darunter und ließ sich den kalten Wasserstrahl übers Gesicht laufen. Sofort fühlte er sich besser.
Durch eine schmale Einfahrt gelangte er in einen verwinkelten Innenhof, schlich die ausgetretenen Stufen zum Hintereingang seines Hauses hinauf und öffnete vorsichtig die knarrende Holztür, die ins Innere führte.
Am folgenden Tag, kurz vor der Mittagsstunde, erschien Victoria zusammen mit ihrer Zofe im Haus ihres Onkels. Sophia sah noch müder aus als am Vortag. Als sie durch die Eingangshalle gingen, sagte sie leise: »Emilie ist verschwunden.«
Victoria warf der schreckensbleichen Louise einen strengen Blick zu und folgte ihrer Tante in den holzgetäfelten Salon. Sie ließ sich auf Sophias Lieblingsmöbel nieder, ein Sofa aus Bugholz mit Kugelfüßen und voluminösen, zylindrischen Armlehnen.
»Was heißt verschwunden? Hat sie etwa eine bessere Anstellung gefunden?«
Sophia zuckte mit den Schultern und forderte Louise auf, in einem der Plüschsessel neben dem Sofa Platz zu nehmen. Louise tat wie ihr befohlen, ängstlich darauf bedacht, nicht an eins der Beistelltischchen zu stoßen, auf denen Buketts aus getrockneten Blumen und eine marmorne Büste standen. Sophia schellte nach ihrer Zofe Elsa und wies sie an, einen Kaffee zu kochen. Danach erzählte sie, was am vergangenen Abend geschehen war.
Victoria verzog das Gesicht. »Und dieser Binding ...«
»Biddling«, warf Sophia ein. »Der Kommissar heißt Biddling.«
»Meinetwegen. Dieser Herr Kriminalkommissar behauptet also allen Ernstes, dass Emilie ohne jeden Grund einfach weggelaufen ist?«
Sophia sah ihre Nichte lächelnd an. »Es kann doch sein, dass sie gegangen ist.«
Victoria stellte die zierliche Kaffeetasse auf den Unterteller, dass es schepperte. »Und wohin, bitte? Ohne ihre Sachen mitzunehmen? Ohne ein Wort zu verlieren?«
»Sie würde das nicht tun«, sagte Louise, die nur mit Mühe die Tränen zurückhalten konnte.
»Woher willst du das wissen, du kanntest sie nicht!«, fuhr Victoria sie an. Louise senkte schuldbewusst ihren Kopf. »Wann war die Polizei da?«, wandte Victoria sich wieder an ihre Tante.
»Heute früh«, sagte Sophia. »Wir haben die Nacht noch abgewartet, weil wir hofften, dass sie auf dem Wäldchestag war.«
Victoria runzelte die Stirn. »Gestern sagtest du doch, dass sie nicht mal freihaben wollte.«
»Vielleicht hatte sie Angst, weil sie meinen Orangenbaum umgeworfen hat.«
»Behauptet das etwa auch der Kommissar?«
»Er meinte, das könnte eine mögliche Erklärung für ihr Verschwinden sein, und es sei nicht unwahrscheinlich, dass sie von selbst zurückkomme.«
»Man ergreift nicht wegen eines umgefallenen Pflanztopfes kopflos die Flucht!«
»Emilie wusste, wie wertvoll der Orangenbaum ist. Es sind mehrere Äste abgebrochen.«
»Ich würde gern ins Glashaus gehen und es mir ansehen.«
»Aber der Herr Kommissar war doch schon dort.«
»Der Herr Kommissar scheint mir die Sache nicht ernst zu nehmen«, sagte Victoria hochmütig. »Am besten ...«
»... würdest du dich aus Dingen heraushalten, die Frauen nichts angehen«, tadelte Konrad Könitz, der unbemerkt hereingekommen war.
Victoria stand auf und warf trotzig den Kopf in den Nacken. »Warum sollte es mich nichts angehen, wenn plötzlich jemand ohne Grund verschwindet?«
»Weil es nicht deine Angelegenheit ist und weil ich es nicht dulde, dass du Sophia unnötig Angst machst!« Konrad warf seiner Frau einen besorgten Blick zu. »Nach der ganzen Aufregung brauchst du dringend Ruhe.«
»Ein wenig Gesellschaft wird mir guttun«, sagte Sophia leise.
Victoria wusste, dass Konrad seiner Frau kaum einen Wunsch abschlagen konnte, und lächelte ihrer Tante dankbar zu. Dann trug sie Louise auf, zu Hause Bescheid zu geben, dass sie erst gegen Abend zurückkomme, wartete, bis ihre Zofe das Zimmer verlassen hatte, und trat an die von Brokatvorhängen eingerahmte Terrassentür. »Wollen wir ein wenig in den Garten gehen, Tante Sophia?«
Sophia stand auf. »Gern, Kind.«
Dr. Könitz sah ihnen mit gemischten Gefühlen hinterher. Er war davon überzeugt, dass es für Emilies Verschwinden eine harmlose Erklärung gab, und es gefiel ihm nicht, dass seine Nichte Sophia mit hanebüchenen Mutmaßungen verschreckte. Er sah, dass die beiden Frauen den verschlungenen Pfad zum Glashaus einschlugen, und wandte sich vom Fenster ab. Sein Blick fiel auf das goldgerahmte Ölgemälde, das über dem Sofa hing und ihn und Sophia an ihrem Hochzeitstag zeigte. Wie zerbrechlich sie wirkte!
»Es wird Zeit, dass Victoria verheiratet wird, damit sie endlich die Pflichten einer Frau begreift«, hatte Rudolf Könitz gestern gesagt, und obwohl Konrad selten mit seinem Bruder einer Meinung war, stimmte er ihm ausnahmsweise zu.
Sophia und Victoria hatten die Orangerie erreicht, ein Koloss aus Stein, der von einem gläsernen Kuppelbau gekrönt wurde; daran angeschlossen waren ein Gewächshaus und ein unscheinbarer, in die Erde eingelassener Raum, der nach oben mit einem schlichten Glasdach abschloss und als Überwinterungsstätte für frostempfindliche Pflanzen diente.
Der Orangenbaum stand im Mittelteil der Orangerie. Er war in einen neuen, zu engen Kübel gesetzt worden, so dass ein Teil des Wurzelwerkes überhing. Die weißen Blüten, die das Bäumchen neben unreifen und einigen orange leuchtenden Früchten zierten, verströmten einen erfrischend süßen Duft. Als Victoria näher heranging, um die abgeknickten Zweige zu betrachten, rümpfte sie die Nase. »Ich weiß nicht, warum, aber ich kann diesen Geruch nicht ausstehen!«
Sophia setzte sich auf die schmiedeeiserne Bank, die Konrad neben ihrem Lieblingsbaum hatte aufstellen lassen, und ihr Blick schweifte über den Urwald aus Bananenstauden, kleinen und großen Palmen, Baumfarnen und unzähligen anderen exotischen Gewächsen, von denen einige mehr als dreißig Jahre alt waren. Hier und da wucherte das üppige Grün bis zur Glaskuppel hinauf.
»Befand sich der Baum vorher an der gleichen Stelle wie jetzt?«, fragte Victoria.
»Ja.« Zärtlich strich Sophia über ihre ramponierte Lieblingspflanze. »Ich konnte es nicht fassen, als ich gestern Abend das Malheur bemerkte.«
»Nur mal so eben umgefallen ist der Baum jedenfalls nicht!«, stellte Victoria fest. Als sie Sophias verständnisloses Gesicht sah, fügte sie hinzu: »Die Äste sind rundherum abgebrochen.«
»Heißt das etwa, sie hat es mit Absicht getan?«, fragte Sophia empört.
Victoria lachte. »So zerzaust, wie dein Orangenbaum aussieht, müsste die gute Emilie ihn mindestens dreimal hintereinander umgeworfen haben, Tantchen!« Sie wurde ernst. »Diese Stimmen, die du gehört hast – meinst du, die kamen von hier?«
Sophia wurde blass. »Ich hoffe, es war tatsächlich nur der Wind.«
Victoria verschwand hinter einem ostindischen Riesenbambus. »Wenn es nicht der Wind war, werde ich es herausfinden! Kommst du mit? Ich gehe ins Erdhaus!«
Leichtfüßig sprang Victoria die Stufen hinab, die zum Eingang des Überwinterungsraumes führten. Als sie die Tür öffnete, schlug ihr ein Schwall feuchter Luft entgegen. Der quadratische Raum war vollgestellt mit Kübelpflanzen aller Formen und Größen. Über blühenden Fuchsien breiteten sich die steifen Wedel einer alten Phönixpalme aus. Vom Glasdach tropfte Kondenswasser herab, und der Boden glänzte vor Feuchtigkeit.
Victoria drehte sich zu ihrer Tante um, die ihr gefolgt war. »Wann warst du zuletzt hier?«
»Ich glaube, am Samstag. Warum?«
»Schau auf den Boden!«
Jetzt sah es auch Sophia: Auf den feuchten Platten zeichneten sich Abdrücke von großen Schuhsohlen ab.
»War außer dir und Emilie während der vergangenen Tage noch jemand hier drin?«
»Der Gärtner hat in der vorigen Woche eine der Palmen umgesetzt. Sie sollten eigentlich längst wieder in den Garten ausgeräumt sein. So spät wie dieses Jahr waren wir noch nie damit.«
»Wenn es der Gärtner gewesen wäre, müssten die Spuren auch bei den Töpfen zu finden sein, aber dort ist der Boden sauber«, wandte Victoria ein und bückte sich, um die Abdrücke genauer anzusehen.
»Du meinst, es war jemand im Gang? Lieber Gott! Lass uns Konrad holen!«
»Damit er mir wieder Vorhaltungen machen kann? Nein, danke.« Victoria durchquerte den Raum und blieb vor einer holzverkleideten Wand stehen.
»Ich habe Angst«, flüsterte Sophia.
»Keine Sorge, ich bin ja bei dir«, entgegnete Victoria lächelnd. Auch ihr schlug das Herz bis zum Hals, aber ihre Neugier war stärker als ihre Furcht. »Wir brauchen eine Lampe. Oben in der Orangerie habe ich eine gesehen. Holst du sie?«
Sophia verschwand. Victoria atmete durch und öffnete die Tür, die fast unsichtbar in das Holz eingelassen war. Sie blickte in ein schwarzes Loch und spürte einen feinen Lufthauch in ihrem Gesicht. Plötzlich waren sie wieder da, die unheimlichen Gestalten aus ihrer Kinderzeit, wilde Räuber und grausame Ritter, die einst mordend und brandschatzend durch diesen dunklen Gang in die Stadt gekommen waren.
»Alles Quatsch!«
»Hast du was gefunden?«, fragte Sophia, die mit der Lampe zurückkam.
»Nein. Ich habe mich nur an Großmamas Gruselgeschichten erinnert, mit denen sie mich als Kind erschreckte, damit ich nicht in den Tunnel gehe.« Victoria drehte die Lampe heller und betrat den niedrigen Keller, der vor dem eigentlichen Tunnel lag. Sophia blieb abwartend im Türrahmen stehen. Im Lichtschein sah Victoria Spinnweben von der Decke hängen. Früher hatte man in dem Raum Obst gelagert, aber das war viele Jahre her. Der Keller war leer bis auf Holzbretter, die in einer Ecke gestapelt waren. Nicht weit davon entfernt befand sich eine zweite Tür, durch die man in den Tunnel gelangte. Sie bestand aus Latten und war mehr schlecht als recht mit einem Riegel verschlossen. Victoria ging den Keller ab und leuchtete in sämtliche Ecken und Winkel. Weder auf dem Boden noch an den Wänden war etwas Ungewöhnliches zu entdecken. »Es muss aber jemand dagewesen sein«, sagte sie. »Die Spuren führen direkt hier herein.«
»Ich frage nachher den Gärtner«, meinte Sophia. Ihre Stimme zitterte.
»Vielleicht sollten wir im Tunnel nachschauen«, schlug Victoria vor.
»Nein! Es ist zu gefährlich!«
Victoria war hin- und hergerissen zwischen Entdeckerdrang und der Angst, dass sie in dem stockdunklen, kaum mannshohen Tunnelsystem, das in den weitläufigen Kellergewölben unter der Könitzschen Villa endete, tatsächlich Schreckliches finden könnte. Jemand mit ziemlich großen Füßen in staubigen Schuhen war jedenfalls in diesen Raum hinein- und wieder herausgegangen. Emilie war ein zierliches Mädchen. Sie konnte es nicht gewesen sein. Oder hatte sie etwas entdeckt, das sie nicht entdecken sollte, und diesen Jemand überrascht, der sich am Wäldchestag ungestört glaubte? Aber was konnte es im Glashaus zu verbergen geben? Je mehr Victoria versuchte, eine logische Erklärung für Emilies Verschwinden zu finden, desto mehr Fragen drängten sich ihr auf.
Sophia schaute sie bittend an. »Lass uns ins Haus zurückgehen.«
Victoria blies die Lampe aus. »Wenn du erlaubst, würde ich gerne noch ein wenig promenieren, Tante Sophia.«
Sophia nickte, obwohl sie wusste, dass ein Spaziergang durch den frühsommerlichen Garten das Letzte war, was ihre Nichte jetzt interessierte. Sie schalt sich eine Närrin, dass sie ihr immer wieder nachgab. Gemeinsam gingen sie die Treppe zur Orangerie hinauf und in den Garten hinaus.
Victoria sah ihrer Tante hinterher, bis sie durch die Terrassentür im Salon verschwunden war. Es lag ein würziger Duft nach Kräutern in der Luft, und sie verwünschte einmal mehr das unbequeme Korsett, das es ihr nicht erlaubte, tief durchzuatmen. Am liebsten hätte sie es sich vom Leib gerissen, Schuhe und Strümpfe abgestreift und wäre barfuß durch den Garten gelaufen. Ein einziges Mal hatte sie es gewagt, und ihre ansonsten sanftmütige Tante war ziemlich böse geworden. Man durfte Dekolleté zeigen, aber doch keine nackten Füße!
Victoria überlegte, ob sie ins Erdhaus zurückgehen sollte, verwarf den Gedanken aber. Inzwischen hatte Sophia ihrem Mann bestimmt gebeichtet, wo sie gewesen waren, und sie musste damit rechnen, dass er nachschauen kam. Davon abgesehen, wäre auch Sophias Toleranz schlagartig erschöpft, wenn sie wüsste, dass sich ihre geliebte Nichte keineswegs damit zufriedengab, ab und zu ein verbotenes Buch aus Konrads Bibliothek zu stibitzen. Victoria schlug den Weg zu dem kleinen Pavillon ein, der sich im hinteren Teil des Gartens befand, direkt an der Mauer, die das Könitzsche Anwesen zu den Anlagen hin begrenzte.
Aus den Erzählungen ihrer Großmutter wusste sie, dass die feudalen Villengärten, schattigen Baumgänge und gepflegten Parkanlagen, die die Stadt in ein grünes Band fassten, zu Anfang des Jahrhunderts ein Panzer aus Wällen, Bastionen, Mauern und Türmen gewesen waren. Es fiel ihr schwer, sich das vorzustellen.
Lächelnd ließ Victoria sich auf der Holzbank nieder, die in dem rosenberankten Pavillon stand, solange sie denken konnte. Hier hatte sie schon als Kind gesessen und herrlich ungestört vor sich hin geträumt oder irgendwelche neckischen Spielchen ausgeheckt. Oder über die Lösung von Problemen nachgedacht. Angenommen, ein Fremder wäre im Glashaus gewesen: durch den Haupteingang war er wohl kaum spaziert. Er musste durch das Pförtchen gekommen sein! Victoria sprang auf. Warum hatte sie nicht gleich daran gedacht?
Sie lief an der efeubewachsenen Steinmauer entlang. Die alte Pforte lag versteckt hinter einer Hecke aus wilden Rosen. Der Durchgang an der Mauer war schmal, und Victoria zerkratzte sich ihre Arme, als sie sich hindurchzwängte. Doch das war vergessen, als sie vor sich niedergetretenes Gras und abgeknickte Zweige entdeckte.
Das angerostete Tor hing schief in den Angeln und quietschte, als Victoria es aufschob. Sie schlüpfte hindurch. Auch auf der anderen Seite der Mauer wucherte Gestrüpp. Victoria folgte der Mauer und stieß auf ein Beet mit blühenden Studentenblumen. Zum Glück waren keine Spaziergänger unterwegs, so dass sie in Ruhe die Schuheindrücke betrachten konnte, die kreuz und quer durch die Pflanzung führten. Wer auch immer die verborgene Pforte benutzt haben mochte: Ein Blumenliebhaber war es nicht gewesen, denn viele der gelben und orangefarbenen Blütenköpfe waren rücksichtslos niedergetreten worden.
Als Victoria sich bückte und die Spuren genauer ansah, erkannte sie, dass sie unterschiedlich groß waren. Verblüfft richtete sie sich auf. Hatte sie es etwa mit mehreren Eindringlingen zu tun?
Auf dem Weg zurück blieb sie auf der Gartenseite mit ihren Haaren in den Rosen hängen, und bei dem Versuch, sich zu befreien, fiel ihr Blick auf ein winziges Stückchen braunen Mantelstoff, das sich in den dornigen Zweigen verfangen hatte. Vorsichtig löste sie es heraus und nahm es mit.
»Wo hast du dich herumgetrieben?«, fragte Konrad Könitz, als Victoria in den Salon zurückkam. Vorwurfsvoll deutete er auf ihre zerkratzten Arme und die ruinierte Frisur.
»Ich habe mich an den Rosen am Pavillon gestochen«, sagte sie und zupfte an ihrem zerzausten, glücklicherweise nicht aufgelösten Haar.
»Gestochen? Ich vermute eher, dass du mitten hineingesprungen bist, so wie du aussiehst!«
Victoria schwieg betreten, aber ihr Onkel war mit seiner Standpauke noch nicht am Ende. »Sophia hat mir erzählt, dass ihr im Tunnel wart, obwohl du genau weißt, dass ich das nicht will!« Er sah sie drohend an. »Wenn du nicht damit aufhörst, deine Nase in Angelegenheiten zu stecken, von denen du nichts verstehst, werde ich ein ernstes Gespräch mit deinem Vater führen müssen.«
»Ja«, sagte Victoria leise. Ihr Vater würde ihr bis auf Weiteres sämtliche Verwandtenbesuche streichen und womöglich eine Hausdame verpflichten, um seiner Tochter Benimm beizubringen. Im Gegensatz zu seinem Bruder Konrad machte Rudolf Könitz nicht viele Worte, wenn es darum ging, seine Kinder zu manierlichen Menschen zu erziehen.
»Ich danke dir, dass du mir trotz meines ungebührlichen Benehmens Gelegenheit gibst, mich zu bessern«, sagte Victoria und hasste sich dafür. Aber es gab keine andere Möglichkeit, um heil davonzukommen. Konrad musterte sie mit einem Blick, dem man ansah, dass er ihre Reueschwüre in Zweifel zog, und verließ das Zimmer.
»Er meint es nur gut«, sagte Sophia, die das Gespräch schweigend verfolgt hatte. »Der Tunnel ist einsturzgefährdet.«
»Das ist nicht der Grund!«, sagte Victoria aufgebracht, aber sofort beruhigte sie sich wieder. Es hatte keinen Sinn, ihre Tante merken zu lassen, wie sehr sie sich über ihren Mann geärgert hatte. »Selbstverständlich hat Onkel Konrad recht. Wahrscheinlich steht Emilie morgen früh wohlbehalten vor der Tür, und alles ist gut.« Sie glaubte keine Sekunde daran, aber Sophia nickte erleichtert.
Als Victoria später nach Hause ging, hörte sie, wie der alte Hausknecht ihrem Onkel erzählte, dass aus dem Weinkeller ein leeres Fass verschwunden sei.
Drei
Es giebt Personen, welche ganz unbescholten sind und welche sich rein aus persönlicher Neigung für das Polizeifach zu Vigilanten-Diensten benutzen lassen. Diese Personen dürfen nicht mit den Verbrechern verwechselt werden, welche sich für schnödes Geld dem Verrath ihrer Genossen hergeben.
Auf dem Leichnam und der Kleidung befanden sich folgende Spuren eines Kampfes: 1. Nägeleindrücke am Halse und hinter den Ohren, 2. Blutergüsse an beiden Oberarmen, 3. blutig ausgerissene Haarsträhnen, 4. und letztens der zerrissene rechte Ärmel des Kleides. Am Halse zeigten sich die bei einer Erwürgung oftmals vorhandenen verdächtigen blauen Flecke neben der Strangulationsmarke. Schließlich wurde durch die gerichtliche Sektion die vollständig sichere Überzeugung gewonnen, dass es sich um Mord handelte.
»Darf ich Ihnen Hannes vorstellen?«
Richard Biddling schlug die angestaubte Akte zu, in der er gelesen hatte, und blickte zu Kriminalschutzmann Heiner Braun hoch, der einen dicklichen, etwa achtzehnjährigen Jungen mit wilden braunen Locken ins Büro bugsierte.
»Guten Tag, Herr Kommissar«, sagte der Junge mit näselnder Stimme und fixierte ihn misstrauisch über den Rand seiner Augengläser hinweg. Richard lehnte sich zurück und schwieg.
Heiner schubste den Jungen zum Schreibtisch. »Na, nun berichte dem Herrn Kommissar, was du mir erzählt hast!«
»Ich wollte das aber nur Ihnen sagen.«
»Ich habe dir erklärt, dass nicht ich diesen Fall bearbeite, sondern der Herr Kommissar.« Heiner Braun sah seinen Vorgesetzten entschuldigend an. Er wusste noch nicht so recht, wie er den jungen Kommissar einschätzen sollte, der vor zwei Wochen vom Polizeipräsidium Berlin nach Frankfurt gekommen und ihm vor die Nase gesetzt worden war. »Hannes ist einer unserer Vigilanten, und er leistet mir ab und zu recht gute Dienste.«
»Ein Vigilant bist du also.« Richards Stimme klang abweisend. Er hielt nicht viel von diesen durchtriebenen Polizeispitzeln, die vorgaben, sich in den Dienst von Recht und Gesetz zu stellen, obwohl sie in Wahrheit nur auf ihren Vorteil bedacht waren. Während seiner Dienstzeit bei der Berliner Kriminalpolizei hatte er des Öfteren üble Erfahrungen mit diesem Gesindel machen müssen, das selbst die eigene Großmutter ans Messer lieferte, wenn ein ordentliches Entgelt dafür in Aussicht gestellt wurde.
»Ich komme wegen Emilie Hehl«, sagte der Junge und schaute hilfesuchend zu Heiner.
»Hannes meint, dass das Dienstmädchen vermutlich nicht die Einzige war, die am Wäldchestag zu Hause blieb«, erklärte der Kriminalschutzmann und wandte sich zum Gehen. »Es tut mir leid, Hannes, aber die weitere Unterhaltung musst du mit dem Kommissar alleine bestreiten. Ich habe noch zu arbeiten.« Er nickte dem Jungen aufmunternd zu und verließ das Büro.
»Nun lass dir nicht alles einzeln aus der Nase ziehen«, sagte Richard. »Du darfst dich auch setzen. Ich beiße nicht.«
Hannes ließ sich auf einem wackligen Stuhl neben dem Schreibtisch nieder und berichtete, anfangs stockend, dann zunehmend freimütiger, dass er von einem Gespräch zwischen Sophia und Konrad Könitz erfahren habe, in dem es um mysteriöse Stimmen im Glashaus und einen geheimen unterirdischen Tunnel ging, der in der vergangenen Nacht offenbar von einem Unbekannten benutzt worden war, um aus dem Keller ein Weinfass zu stehlen.
Richard sah den Jungen streng an. »Woher weißt du das alles?«
Hannes senkte den Blick. »Es wurde mir zugetragen, Herr Kommissar.«
»Von wem?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Kennst du Herrn und Frau Könitz?«
»Sie meinen den Doktor und seine Gattin?«
»Wen sonst?«
»Es gibt noch eine Familie Könitz. Den Bruder vom Doktor, Rudolf Könitz. Er ist ein ziemlich wohlhabender Kaufmann und wohnt am Untermainquai.«
»Na, arm scheint mir der Doktor auch nicht gerade zu sein, wenn ich mir sein Haus und die Orangerie so anschaue.« Richard lachte verächtlich. »Das Ding Glashaus zu nennen ist ja eine gelinde Untertreibung.«
»Den Namen haben sich die Könitzschen Kinder ausgedacht, und der Reichtum der Familie ist größtenteils ererbt, obwohl Dr. Könitz als Arzt einen hervorragenden Ruf genießt und demzufolge über ein gutes Einkommen verfügt«, erklärte Hannes.
Richard schaute ihn überrascht an. »Woher weißt du so gut über die Familie Bescheid, Junge?«
»Ich lebe lange genug in Frankfurt.«
»Kennst du Dr. Könitz und seine Frau persönlich?«
»Dazu möchte ich nichts sagen!«, beharrte Hannes, und seine Stimme klang auf einmal gar nicht mehr schüchtern, als er hinzufügte: »Wollen Sie mich nun verhören oder das Verschwinden von Emilie Hehl aufklären?«
»Ich verbitte mir diesen Ton!«
Hannes zuckte mit den Schultern und stand auf.
»Halt! Bleib hier.«
Der Junge setzte sich wieder und sah den Kommissar abwartend an. Richard räusperte sich. »Also gut. Ich frage dich nicht nach der Quelle deiner Erkenntnisse, und du verrätst mir, was du sonst noch über die Familie Könitz und das verschwundene Dienstmädchen weißt.«
Zwei Stunden später packte Richard die Akten über den Stadtwaldwürgerzusammen und verstaute sie sorgfältig in seinem Schreibtisch. Er verließ sein Büro und ging über den dunklen, mit altertümlichen Pfeilern und Sturzgesimsen ausgestatteten Flur zum Treppenturm. Direkt daneben befand sich das Dienstzimmer von Heiner Braun. Es war verschlossen. Als Richard aus dem Treppenhaus in den Innenhof hinaustrat, sah er Heiner Braun und den Leiter der Kriminalpolizei, Polizeirat Dr. Rumpff, im Schatten eines Kastanienbaums stehen.
Dr. Rumpff war wütend. »Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie Anordnungen exakt so auszuführen haben, wie es Ihnen befohlen wurde, Braun!«, schnauzte er den Kriminalschutzmann an, dass es über den ganzen Hof schallte. »Wenn Sie nicht so gute Arbeit leisten würden, hätte ich Sie schon längst in den letzten Herrgottswinkel versetzen lassen, das können Sie mir glauben!«
»Jawohl, Herr Doktor Polizeirat«, entgegnete Braun.
Seine Stimme war ruhig, aber ohne jede Ehrfurcht, und Richard erinnerte sich an die Worte, mit denen Dr. Rumpff ihn an seinem ersten Diensttag auf seinen zukünftigen Mitarbeiter vorbereitet hatte: »Kriminalschutzmann Braun ist ein fähiger Beamter, aber es mangelt ihm absolut an Disziplin und Gehorsam. Im Übrigen neigt er dazu, sich mit dem Pöbel auf eine Stufe zu stellen.«
Darüber hinaus hatte der Polizeirat ihm den guten Rat erteilt, sich durch Brauns harmloses Aussehen und sein scheinbar besonnenes Wesen nicht täuschen zu lassen. »Allein im vergangenen Jahr sind gegen ihn zwei Disziplinarmaßnahmen wegen Beleidigung von Vorgesetzten verhängt worden, und ausschließlich seines ungebührlichen Benehmens wegen ist er trotz fast dreißigjähriger Dienstzeit und beachtenswerter Erfolge noch immer nicht zum Wachtmeister befördert worden.«
Richard ging auf die beiden Männer zu und grüßte. Polizeirat Rumpff schaute ihn erwartungsvoll an. „Und, Biddling? Was gibt es Neues im Fall Emilie Hehl?«
»Ich habe vorhin von einem Vigilanten interessante Informationen erhalten, die ich gerade überprüfen will.«
»Soso. Und was sind das für Informationen?«
Heiner Braun blinzelte ihm zu, aber Richard verstand nicht, was das bedeuten sollte. »Dr. Könitz scheint anzunehmen, dass er es sich erlauben kann, der Polizei gewisse Dinge vorzuenthalten.«
»Um eines unmissverständlich klarzustellen, Biddling: Dr. Konrad Könitz ist ein achtbarer Arzt und eine integre Persönlichkeit. Also mäßigen Sie sich in Ihren Äußerungen, solange Ihre Annahmen auf dem Geschwätz irgendwelcher Gauner basieren. Guten Tag, die Herren!« Ohne eine Erwiderung abzuwarten, hinkte Dr. Rumpff davon.
»Falls ich darauf hinweisen dürfte: Sie haben sich soeben in den größten Fettnapf gesetzt, der herumstand«, sagte Heiner Braun, als Rumpff außer Hörweite war. Er sah Biddlings Miene versteinern und setzte lächelnd hinzu: »Nun, zwei Wochen hier im Clesernhof dürften kaum genügt haben, sich über die Feinheiten im Beziehungsgeflecht der Frankfurter Bürgerschaft ausreichend zu informieren: Dr. Rumpff geht im Hause Könitz ein und aus. Dr. Könitz und er sind seit vielen Jahren befreundet.«
»Dann habe ich mir ja Sympathie fürs Leben erworben.« Richard beschloss, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Er wusste tatsächlich zu wenig, um irgendwem trauen zu können.
»Machen Sie sich keine großen Gedanken. Rumpff wird zwar manchmal laut, aber er ist nicht nachtragend. Vor allem nicht, wenn er sieht, dass Sie Ihre Arbeit gut machen«, versuchte Heiner seinen Vorgesetzten aufzumuntern.
»Sie sollten sich besser um Ihre eigenen Probleme kümmern, Braun!«
»Wenn Sie meinen, Herr Kommissar, werde ich das tun«, sagte Heiner freundlich. »Leider werde ich meine Probleme nicht lösen können, solange es als Vergehen gegen die Dienstvorschriften angesehen wird, wenn sich ein untergeordneter Beamter den Luxus einer eigenen Meinung erlaubt. Obwohl ich es wirklich auf Notfälle beschränke.«
»Werden Sie nicht unverschämt!« Richards Stimme klang nicht so streng, wie er beabsichtigt hatte. Insgeheim sah er es als Glücksfall an, dass Braun im Präsidium nicht besonders gelitten war. Umso leichter würde er ihn für seine Zwecke einsetzen können, ohne Gefahr zu laufen, dass gleich der ganze Clesernhof darüber redete. »Hatte Dr. Rumpff einen Unfall, oder warum hinkt er?«
Heiner Braun nickte. »Er war früher Offizier beim Frankfurter Linienbataillon, doch mit einem Sturz vom Pferd endete seine militärische Laufbahn. Danach begann seine Karriere bei der Polizei. Sein Steckenpferd ist übrigens die Bekämpfung der Anarchisten, und er kann diesbezüglich beachtliche Erfolge aufweisen.« Heiner grinste. »Die Verfolgung der gewöhnlichen Kriminellen rangiert für ihn an zweiter Stelle, was allerdings nicht heißt, dass er schlampige Ermittlungen durchgehen lässt. Aber das werden Sie noch früh genug erleben.«
»Wie lange arbeitet dieser Hannes eigentlich schon für die Polizei?«
»Ich habe ihn vor vier Jahren von meinem Vorgänger übernommen.«
»Vor vier Jahren? Da war er ja noch ein Kind!«
Heiner zuckte mit den Schultern. »Er behauptete damals, achtzehn Jahre alt zu sein. Ich hab’s halt geglaubt. Jedenfalls dauerte es einige Zeit, bis er Vertrauen zu mir gefasst hatte. Er arbeitet nicht gerne mit anderen Beamten zusammen; darum war er vorhin auch so verstockt. Aber das gibt sich, wenn Sie ihn nett behandeln.«
»Haben Sie eine Ahnung, woher der Junge seine Informationen hat?«
»Nein. Ich kann nur sagen, dass bis jetzt immer alles gestimmt hat, was er uns zutrug. Anfangs gab er meistens Hinweise auf Laden- oder Marktdiebe, aber im vergangenen Jahr haben wir mit seiner Hilfe einen großangelegten betrügerischen Konkurs aufklären können, indem er uns verriet, wann und über welches Speditionsbüro die unterschlagenen Waren beiseite geschafft werden sollten. Er hat uns sogar genau aufgeschlüsselt, inwieweit die Verdächtigen ihre Bücher gefälscht und fingierte Forderungen auf Ehefrauen und Verwandte ausgestellt hatten.«
»Aber dazu braucht man umfangreiche interne Kenntnisse!«
Heiner nickte. »Ich vermute, dass unser Hannes ein Familienmitglied eines Unternehmers oder sonstigen Geschäftsmannes ist, obwohl er das mit seiner abgetragenen Kleidung zu kaschieren versucht.«
»Den Eindruck habe ich allerdings auch«, stimmte Richard zu. »Ein Arbeiter oder Handwerksbursche ist er jedenfalls nicht. Nicht nur seine gepflegten Hände und seine gewählte Ausdrucksweise sprechen dagegen, sondern auch sein gutgenährtes Aussehen. Nur wohlhabende Bürger sind in der Lage, ihrem Nachwuchs einen solchen Hängebauch anzumästen.«
»Was gegen Ihre Annahme spricht, ist seine Frisur«, wandte Heiner ein. »Kein Mensch, der in Frankfurt etwas auf sich hält, würde sein Kind derart verlottert herumlaufen lassen.«
»Und wenn er gar nicht aus Frankfurt stammt?«
»Hm, ja. Das könnte auch sein.« Heiner lächelte. »Aber ist das nicht egal, solange er uns mit guten Informationen versorgt?«
»Nein! Ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe.«
»Nicht bei Vigilanten.«
»Gerade bei Vigilanten. Und Hannes wäre der erste, bei dem ich es nicht herausfinden würde!«
Heiner Braun verzog das Gesicht. »Was haben Sie davon, wenn Sie das Geheimnis seiner Identität lüften und dadurch einen guten Informanten verlieren?«
»Gewissheit.«
»Gewissheit worüber?«
»Welches Spiel gespielt wird.«
»Was für ein Spiel sollte der harmlose Hannes denn spielen?«
Richard runzelte die Stirn. »Irgendwas stört mich an dem Kerl. Aber beenden wir das Thema. Ich möchte mit Ihnen lieber über die Familie Könitz sprechen. Kennen Sie Dr. Könitz?«
»Flüchtig, ja. Er ist ein erfolgreicher Arzt, ziemlich reich, seit fünfunddreißig Jahren verheiratet und Vater von fünf Töchtern und einem Sohn. Die Töchter sind inzwischen ebenfalls verheiratet und aus Frankfurt weggezogen. Der Sohn lebt im Ausland.«
»Seit wann?«
»Schon ziemlich lange. Wieso interessiert Sie das?«
»Ich bin auf dem Weg, um Hannes’ Hinweise zu überprüfen. Am besten kommen Sie gleich mit.«
Heiner nickte. »Was halten Sie davon, wenn wir bei der Gelegenheit einen kleinen Stadtrundgang machen? Ich nehme an, Sie haben noch nicht viel von Frankfurt gesehen, seit Sie hier sind?«
»Ich hatte keine Zeit dazu.«
»Was studieren Sie auch Tag und Nacht abgelegte Akten.« Richard sah den Kriminalschutzmann misstrauisch an. Heiner lächelte. »Es ist mir nicht entgangen, dass Sie sich aus dem Archiv die Unterlagen über den Stadtwaldwürger, sagen wir mal, entliehen haben.«
»Und was geht Sie das an?«
Heiner Braun zuckte mit den Achseln. »Jeder Beamte im Polizeipräsidium weiß, dass diese Sache wie ein Menetekel auf der Seele unseres auf Korrektheit achtenden Dr. Rumpff lastet. Falls Sie vorhaben, sich gleich im nächsten Fettnapf zu wälzen, brauchen Sie ihm gegenüber nur anzudeuten, dass Sie gedenken, die Stadtwaldwürgerfälle wieder aufzurollen.«
»Nachdem ich jetzt über seine engen Bindungen zur Familie Könitz informiert bin, werde ich das schön bleibenlassen.« Richard bedachte seinen Untergebenen mit einem verächtlichen Blick. »Einen Bericht über Ihr ungehöriges Benehmen mir gegenüber würde Dr. Rumpff bestimmt nicht unkommentiert zur Seite legen.«
»Darf ich trotzdem erfahren, warum Sie sich für diese alte Sache interessieren?«
»Nein!«
Schweigend verließen die Männer den Clesernhof in Richtung Kornmarkt.
»Emilie ist leider nicht zurückgekommen«, sagte Dr. Könitz, als er Kommissar Biddling und Heiner Braun ins Haus ließ.
»Ich weiß«, entgegnete Richard. »Ich habe noch einige Fragen an Sie und Ihre Frau.«
»Könnten Sie Sophia nicht davon verschonen? Die Sache hat sie sehr mitgenommen. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit.«
»Es tut mir leid, aber es muss sein«, sagte Richard.
Dr. Könitz führte die Beamten in den Salon, wo Sophia Könitz mit einer blonden jungen Frau in ein angeregtes Gespräch vertieft war. Beide standen auf, als die Männer hereinkamen.
»Sophia, Liebste, Herr Kommissar Biddling hat noch einige Fragen wegen Emilie«, sagte Dr. Könitz und wandte sich an ihre Gesprächspartnerin. »Würdest du uns bitte entschuldigen, Victoria?«
Richard sah sie interessiert an. »Sie können gerne bleiben, Fräulein ...?«
»Könitz«, vervollständigte Victoria. Sie nahm ihren Fächer, der auf einem Tischchen neben dem Sofa lag, und wedelte damit vor ihrem Gesicht herum. »Du hast recht, Onkel. Es ist besser, wenn ich euch allein lasse.« Ihre Stimme klang herablassend, aber Richard hatte das Gefühl, dass sie damit ihre Unsicherheit zu überspielen versuchte. »Ich besuche dich morgen wieder, Tante.« Mit erhobenem Kopf und ohne die Beamten eines Blickes zu würdigen, ging sie zur Tür.
Richard schaute ihr unauffällig hinterher. Sie sah sehr jung aus. Und ziemlich hübsch. »Ihre Nichte?«, fragte er.
Dr. Könitz nickte.
Richard wandte sich an Sophia. »Ich habe gehört, dass es in Ihrer Orangerie spuken soll, gnädige Frau.« Sophia wurde blass.
»Humbug!«, sagte Dr. Könitz.
»Ich habe Ihre Frau gefragt, Doktor.«
Sophia atmete durch. »Ich habe in der vergangenen Woche einige Male schlecht geschlafen und bin in den Garten hinausgegangen. Ich glaubte, ein Flüstern aus dem Glashaus zu hören. Ich habe sofort meinen Mann geholt, und er hat überall nachgesehen. Es muss Einbildung gewesen sein.«
Ihre Worte klangen zu wohlüberlegt, um Richard zu überzeugen. »Mit wem außer mit Ihrem Mann haben Sie noch darüber gesprochen?«
Sie überlegte einen Moment. »Mit niemandem. Es kann aber sein, dass jemand vom Personal unser Gespräch zufällig mitgehört hat.«
»Und warum haben Sie mir das gestern verschwiegen?«
»Ich wusste doch nicht, dass das wichtig ist!«
»Die Information, dass es zu Ihrem Garten einen zweiten Zugang über die Anlagen gibt, hielten Sie ebenfalls nicht für erwähnenswert.«
»Ob Sie es glauben oder nicht«, schaltete sich Dr. Könitz verärgert ein, »wir gehen nach wie vor davon aus, dass Emilie weggelaufen ist. Und ich wüsste nicht, was die alte Pforte damit zu tun haben sollte. Sie wird seit Jahren nicht mehr benutzt.«
Richard beschloss, die weiteren Informationen von Hannes vorerst für sich zu behalten. »Verzeihen Sie bitte, dass ich Sie mit meinen Fragen in unnötige Aufregung versetzt habe, gnädige Frau.« Er sah Dr. Könitz an. »Ich möchte mir gern selbst ein Bild machen.«
Dr. Könitz ging zur Terrassentür und öffnete sie. »Bitte sehr – hier entlang! Sie dürfen sich gerne davon überzeugen, dass ich nichts zu verbergen habe.«
Richard fluchte unterdrückt, als er sich in dem Gestrüpp vor der Gartenmauer trotz aller Vorsicht die Hände zerkratzte. Vor der Pforte blieb er stehen, um abgebrochene Zweige in Augenschein zu nehmen. Überrascht entdeckte er in den Dornen einige blonde Haare. Vorsichtig löste er sie heraus und verließ den Garten.
Es dauerte eine geraume Weile, bis er zu Dr. Könitz und Kriminalschutzmann Braun zurückkam. »Entgegen Ihrer Behauptung scheint es gleich mehrere Personen zu geben, die diesen unbequemen Weg benutzen, um in Ihren Garten zu gelangen, Herr Könitz. Und eine dieser Personen ist blond«, stellte er fest.
»Habe ich es mir doch gedacht, dass sich dieses Gör nicht einfach so an einem Rosenstock gestochen hat!«
Richard und Heiner wechselten einen verständnislosen Blick. Konrad Könitz verzog das Gesicht. »Meine Nichte hat gestern versucht, Detektiv zu spielen.« Er berichtete von seiner Auseinandersetzung mit Victoria.
Richard stellte sich dumm. »Und was ist das für ein Gang, in den sie nicht gehen soll?«
»Als vor vielen Jahren unser Haus gebaut wurde, stieß man beim Ausschachten auf ein Höhlenlabyrinth. Vermutlich handelt es sich um die Überbleibsel einer alten unterirdischen Verteidigungsanlage. Genau weiß ich es aber nicht. Einer der Gänge führt von unserem Weinkeller durch den Garten zur Orangerie.«
»Und was ist mit den anderen?«, wollte Heiner wissen.
»Die meisten sind verschüttet«, sagte Dr. Könitz. »Mein Vater ging damals zusammen mit mehreren Männern alles ab. Sie brauchten Tage, um sich zurechtzufinden. Weitere Ausgänge entdeckten sie jedoch nicht.«
»Aber es könnte auch heute noch jemand von der Orangerie aus durch diesen Gang in Ihren Keller gelangen?«, fragte Heiner.
Dr. Könitz nickte. »Wenn er lebensmüde ist, ja.«
»Zeigen Sie mir den Eingang«, forderte Richard ihn auf. Kopfschüttelnd schlug Dr. Könitz den Weg zur Orangerie ein; Richard und Heiner folgten.
»Und wenn er recht hat mit seiner Warnung?«, flüsterte Braun.
»Ich vertraue nur dem, was ich selbst sehe«, entgegnete Richard.
Die Männer durchquerten die Orangerie und stiegen ins Erdhaus hinab. Als Richard die penibel geschrubbten Fliesen sah, fragte er gereizt: »Wie oft wird hier drin saubergemacht?«
»Alle zwei bis drei Tage«, antwortete Dr. Könitz. »Warum?«
»Hier sollen gestern noch Fußabdrücke gewesen sein!«
»Woher wissen Sie das nun schon wieder?«
»Ich habe meine Informanten, Herr Könitz.«
»Warum fragen Sie mich dann überhaupt?«
»Weil ich herausfinden möchte, ob Sie mir die Wahrheit sagen.«
»Verdächtigen Sie mich etwa, das Dienstmädchen meiner Frau umgebracht zu haben?«, fragte Dr. Könitz konsterniert.
Richard lächelte dünn. »Erstens: Solange ich nicht weiß, wo das Mädchen ist, müssen wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Zweitens: Nicht ich, sondern Sie haben von Mord gesprochen. Drittens: Verdächtig ist zunächst jeder, der keinen Nachweis für seine Unschuld erbringen kann.«
»Ich war mit meiner Frau auf dem Wäldchestag. Als wir wegfuhren, war Emilie noch da, als wir wiederkamen, war sie nicht mehr da. Reicht Ihnen das?«