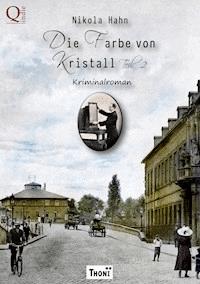4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thoni-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Krimis zur Kriminalistik
- Sprache: Deutsch
Ein Kriminalroman aus der Reihe "Krimis zur Kriminalistik" / Vollständig überarbeitete Neuausgabe im eBook (Teil 1: Kap. 1-21) KRIMIS ZUR KRIMINALISTIK Die "Krimis zur Kriminalistik" der Ersten Kriminalhauptkommissarin und Autorin Nikola Hahn verbinden eine spannende Krimihandlung mit akribisch recherchierter Gesellschaftsgeschichte und lassen die Anfänge und Entwicklung der Kriminalistik in Deutschland lebendig werden. • Band 1: Die Detektivin • Band 2: Die Farbe von Kristall (als eBook in zwei Teilen: Teil 1: Kap. 1-20; Teil 2: Kap. 21-31 plus Anhänge) Zum Buch: Frankfurt am Main, 1904: Der Klavierhändler Hermann Lichtenstein wird in seinem Geschäft mitten in der belebten Innenstadt Frankfurts von Unbekannten beraubt und erschlagen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Stadt und verhindert das Antrittsgespräch der Polizeiassistentin Laura Rothe, die sich als erste Frau im Präsidium um verwahrloste Kinder und Jugendliche kümmern soll. Ein blutiger Fingerabdruck am Kragen des Ermordeten und die Spur eines Damenschuhs lassen den Verdacht aufkommen, dass eine Frau in die brutale Tat verwickelt ist. Außerdem gibt es Hinweise, dass der Mord an dem Klavierhändler mit mysteriösen Drohbriefen zusammenhängt, die der ermittelnde Kommissar Richard Biddling seit Jahren bekommt. Laura Rothes Recherche ist es schließlich zu verdanken, dass der Kommissar einen entscheidenden Schritt weiterkommt. Doch die Spuren führen nicht nur in Biddlings Familie, sondern auch zu einem Kriminalrätsel des Meisterdetektivs Sherlock Holmes, in dem offenbar der Schlüssel zu einem alten und lebensgefährlichen Geheimnis verborgen liegt. -- BAND 1, Kap. 1-20 --
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Nikola Hahn
Die Farbe von Kristall
Kriminalroman
Teil 1
Kap. 1 – 20
»Krimis zur Kriminalistik« Band 2 – Teil 1
Vers. 2, 8/2016
neu bearb. Ausgabe im eBook 2014
Erstausgabe 2002 Marion von Schröder; 8. unveränderte Aufl. 2016 Ullstein Taschenbuch; vollständig überarb. Neuausgabe im Paperback und Hardcover-Großformat Thoni Verlag 2016
© Thoni Verlag 2014–2016
www.thoni-verlag.com
Covergestaltung: N. Hahn, unter Verwendung von Fotografien von C. F. Mylius, Bilder aus dem alten Frankfurt am Main u. Hamburger Polizeibehörde, Photographische Anstalt
Satz u. Layout: N. Hahn
ISBN 978-3-944177-29-8
Ein Qindie-Buch im Thoni Verlag
Das Qindie-Siegel steht für Qualität & Unabhängigkeit.
Weitere Informationen im Internet: qindie.de
Informationen
zur Autorin – zum Buch
Vorbemerkung
Bei den im Roman verwendeten Zeitungszitaten handelt es sich (mit Ausnahme der Notiz über Pokorny & Wittekind in Kapitel 9) um authentische Ausschnitte aus der Frankfurter Zeitung und Handelsblatt aus dem Jahr 1904, die an den jeweils angegebenen Tagen erschienen sind. Auch die aufgeführten Anzeigentexte stammen aus der genannten Zeitung, Jahrgang 1904.
Prolog
Der Wind hatte nachgelassen, aber es regnete noch. Auf dem Weg zwischen den Gräbern lag nasses Laub. Es roch nach Vergänglichkeit. Victoria hatte gewusst, dass er da sein würde. Sie blieb neben ihm stehen. Er hielt den Kopf gesenkt; von seinem Hut tropfte der Regen. Der Grabstein glänzte im Licht einer Laterne. Die Rosen hatte der Sturm zerstört.
»Ich werde Frankfurt verlassen«, sagte sie.
»Wann?«, fragte er leise.
Sie kämpfte gegen die Tränen. »Sobald das Urteil gesprochen ist.«
Er sah sie an. »Sie sind stark, und Sie werden darüber hinwegkommen, Victoria. Über das – und alles andere.«
»Das haben Sie schon einmal zu mir gesagt, Herr Braun.«
»Und hatte ich denn nicht recht?«, entgegnete er lächelnd.
Zweites Morgenblatt, Freitag, 26. Februar 1904
Dem Petit Parisien wird von seinem Berliner Korrespondenten der Inhalt einer Unterredung mitgeteilt, die der deutsche Reichskanzler Graf Bülow dieser Tage mit einem französischen Besucher gehabt hat. Nachdem der Reichskanzler bestritten hatte, daß Deutschland irgendwelche schwarzen Pläne in China oder im nahen Orient habe, gab er einen kleinen Exkurs über Weltpolitik. Deutschland ist friedlich und wünscht wesentlich seinen friedlichen Einfluß in der Welt auszuüben. Nicht als Eroberer, sondern als Kaufleute erscheinen wir bei den nächsten wie bei den entferntesten Nationen.
Die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit dieser Äußerungen hat der Petit Parisien zu tragen. Unbülowisch klingen sie übrigens nicht.
Eins
Hermann Lichtenstein legte die Zeitung beiseite und sah aus dem Fenster: ein trister, verregneter Wintertag, aber auf der Straße herrschte reges Treiben. Das Rattern der Droschken und Fuhrwerke und das Geschrei der Zeitungsjungen drangen bis in den ersten Stock hinauf. Lichtenstein schaute zur Hauptwache hinüber, an deren verlassenen Anblick er sich noch immer nicht gewöhnt hatte. Das Klingeln des Telefons riss ihn aus seinen Gedanken. Er nahm den Fernsprecher vom Haken.
»Hier Pianofortefabrik Lichtenstein & Co – Wer dort? Ah, Herr Consolo! Herzlich willkommen in Frankfurt! Ihr Konzert heute Abend? Selbstverständlich werde ich Sie beehren, mein Lieber! Zusammen mit meiner Gattin und meiner ältesten Tochter. Bitte? Sie suchen etwas Besonderes? Ich glaube, ich kann Ihnen helfen ... einen Bechstein, wunderbar im Klang, erlesen in der Verarbeitung. Vergangene Woche ausgeliefert. Ja, ich habe Zeit. Ich erwarte Sie in meinem Kontor. Ende.«
Ein älterer Mann kam herein. »Ich wollte fragen, ob ich zu Tisch gehen kann, Herr Lichtenstein? Frischer Kaffee steht nebenan auf dem Ofen.«
»Danke, Anton. Ich habe gerade mit Herrn Consolo telefoniert. Er logiert im Frankfurter Hof und möchte sich den Bechsteinflügel ansehen.«
Der Auslaufer strich sich über sein schütteres Haar. »Dann werde ich so lange warten.«
Lichtenstein schüttelte den Kopf. »Soll ich dir jeden Tag das gleiche Lied singen, mein Lieber?«
»Sie sollten nicht so oft allein hier sein, Herr Lichtenstein.«
»Deine Sorge um mein Wohlergehen ehrt mich, aber wie du weißt, befinden sich in meinem Kassenschrank in der Hauptsache alte Bücher. Im Übrigen pflegen Diebe nicht zu Zeiten zu erscheinen, in denen draußen die halbe Stadt vorbeipromeniert.«
Der alte Auslaufer musterte seinen Chef mit zusammengekniffenen Augen. »Statt den ganzen Tag in diesem zugigen Büro zu verbringen, sollten Sie lieber das Bett hüten, Herr Lichtenstein.«
»Ach was«, murmelte der Klavierhändler. »Das bisschen Schnupfen vergeht von allein.«
»Wenn Sie bitte erlauben: Sie sehen aus, als plagte Sie ein wenig mehr als bloß Schnupfen.«
»Dummes Zeug!«
Achselzuckend wandte sich der Auslaufer ab und ging hinaus. Hermann Lichtenstein sah ihm mit gemischten Gefühlen hinterher. Anton Schick stand seit dreiundzwanzig Jahren in den Diensten der Familie Lichtenstein; er war eine treue Seele und neigte zu übertriebener Vorsicht. Und manchmal hatte er diese Art, einen anzusehen, als könnte er Gedanken lesen! Der Klavierhändler schaute in den Spiegel, der zwischen zwei Fenstern hing. Die Nase war rot, das Gesicht blass, die Augen wirkten glasig, aber das konnte man auf die Erkältung schieben. Er zündete eine Lampe an und ging über den Flur ins Lager; vier düstere Räume, in denen sich mehr als einhundert Klaviere, Harmonien und Flügel aneinanderreihten.
Der Bechsteinflügel stand vor einem ungenutzten Kamin im hintersten Zimmer. Das polierte Holz glänzte im Lampenschein. Es zu berühren war ein sinnlicher Genuss. Consolo würde begeistert sein. Hermann Lichtenstein freute sich auf den Besuch des italienischen Pianisten, der nicht nur eine Passion für edle Musikinstrumente hatte, sondern auch kurzweilig zu plaudern verstand. Er setzte sich, und die quälenden Gedanken an Fräulein Zilly verschwanden. Sanft strichen seine Finger über die Tasten aus Elfenbein; die ersten Akkorde von Beethovens viertem Klavierkonzert erklangen. Irgendwo im Haus flog eine Tür ins Schloss. Abrupt beendete Lichtenstein sein Spiel. Ihr Haar hatte geglänzt wie Gold. Und dann hörte die Erinnerung auf. Er schloss den Flügel, dass es an den Wänden widerhallte. Karl Hopf gehörte gevierteilt! Ihn in diese Pfefferhütte zu schleppen! Die Türglocke läutete. Lichtenstein zog seine Taschenuhr hervor. Kurz vor halb eins. Ernesto Consolo war früh dran.
Doch es war nicht der italienische Pianist, der Einlass begehrte.
»Du?«, fragte Lichtenstein erstaunt.
»Ich habe Ihnen gesagt, dass ich wiederkomme«, entgegnete der Besucher lächelnd. »Wie versprochen, habe ich einen Interessenten mitgebracht.«
Die zweite Person war groß und schlank und stand seitlich im dunklen Flur. »Es tut mir leid«, sagte Lichtenstein. »Im Moment passt es schlecht, ich habe gleich einen Termin. Wenn du ... Wenn Sie vielleicht heute Nachmittag noch einmal kommen könnten?«
»Es dauert nicht lange. Wir möchten uns nur rasch das Piano ansehen, Herr Lichtenstein.«
»Ja. Aber ich habe wirklich nicht viel Zeit.«
»Wir auch nicht«, sagte der Besucher freundlich.
Es war absurd, und es gab nicht den geringsten Grund dafür. Doch Hermann Lichtenstein bekam plötzlich Angst.
»Das habe ich gern«, schimpfte Richard Biddling. »Sie packen in aller Seelenruhe Ihren Kram zusammen, und ich kann sehen, wo ich bleibe!«
Kriminalwachtmeister Heiner Braun grinste. »Ich habe keine Sorge, dass Sie die Frankfurter Räuber und Mörder in Zukunft auch ohne mich überführen werden, Herr Kommissar.« Er riss eine Seite aus einem Exemplar der Frankfurter Zeitung und wickelte zwei mit Gold bemalte Kaffeetassen darin ein.
»Wahrscheinlich die neueste Ausgabe«, brummte Richard. »Die ich selbstverständlich noch nicht gelesen habe!«
Heiner nahm die Zeitungsreste. »Hm ja, fast. Siebzehnter Januar 1904, Viertes Morgenblatt. Literarisches. Das Mineralreich von Dr. Reinhard Brauns, ordentlicher Professor der Universität Gießen. Der Verfasser der chemischen Mineralogie und der kleinen Mineralogie hat uns ein Werk vorgelegt, das im Vergleich zu den üblichen Handbüchern einen ganz eigenartigen Charakter trägt.«
»Es reicht.«
»Von chromolithographisch erzeugten Krystallbildern kann man billigerweise nicht überall Vollkommenes erwarten.«
Richard nahm seinem Untergebenen die Zeitung weg. »Wollen Sie mir an Ihrem letzten Tag unbedingt den allerletzten Nerv rauben?«
Heiner sah ihn erstaunt an. »Ich hätte nicht gedacht, dass Sie nach fast zweiundzwanzig Jahren Zusammenarbeit noch einen übrig haben.«
»Es wird Zeit, dass Sie mir aus den Augen kommen, Braun!«
Heiner schloss seine abgewetzte Ledertasche. Er sah an Richard vorbei zum Fenster. »Ich hätte einen Antrag auf Verlängerung gestellt. Aber Helena ...«
»Schon gut«, fiel ihm Richard harsch ins Wort. Er hasste Verabschiedungen, vor allem, wenn sie endgültig waren.
»Was die Sache bei Pokorny & Wittekind angeht, bin ich allerdings wie Sie der Meinung, dass da einer tüchtig nachgeholfen hat, um das Ganze wie einen Unfall aussehen zu lassen, Herr Kommissar.«
»Das kann Ihnen jetzt gleich sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute.«
»Wenn Sie Zeit haben – Helena würde sich über einen Besuch freuen.«
»Mhm«, sagte Richard und blätterte in einer Akte. Sentimentalitäten hasste er noch mehr als Verabschiedungen.
»Ich war gestern Abend noch mal in Bockenheim und habe mir diese Maschine erklären lassen. Der Dampf kann unmöglich von selbst ausgetreten sein.«
»Braun! Haben Sie die feierlichen Worte unseres Herrn Polizeirats schon vergessen? Sie sind seit einer Stunde im Ruhestand. Grüßen Sie Ihre Frau von mir.«
»Ja.« Heiner nahm seine Tasche und ging zur Tür. Sein von unzähligen Fältchen durchzogenes Gesicht wirkte müde, und Richard wurde klar, dass seinem Untergebenen der Abschied mindestens so schwer fiel wie ihm selbst.
»Glauben Sie ja nicht, dass ich Sie aus der Pflicht nehme! Sollte ich in dieser verflixten Sache Ihren Rat brauchen, werde ich ihn suchen.«
»Danke.«
Richard schlug die Akte zu. »Herrje! Verschwinden Sie endlich!«
Heiner salutierte. »Zu Befehl, Herr Kommissar!«
Richard lachte. Vom Flur drangen Stimmen herein. Ein junger Polizist stürzte ins Büro. Sein Gesicht war rot vor Aufregung. »Bitte entschuldigen Sie die Störung! Herr Polizeirat Franck lässt unverzüglich alle im Haus befindlichen Männer zu sich befehlen. Soeben ist ein Mord auf der Zeil gemeldet worden!«
Laura Rothe nahm ihren Koffer und schaute sich suchend um. Der Centralbahnhof war viel größer, als sie ihn sich vorgestellt hatte; vielleicht weil die von grauen und dunkelblauen Eisenträgern gestützten Perronhallen durch offengehaltene Wände als Ganzes wirkten. Die Fenster in den seitlichen Umfassungsmauern gaben wirkungsvolles Seitenlicht. Die Gussteile, die die Granitsockel mit den schmiedeeisernen Bögen verbanden, waren mit palmblattähnlichen Ornamenten versehen, die Blechflächen der hohen Bogendächer mit Zierstreifen geschmückt. Es waren die Details, die dem Bauwerk die Bedrohlichkeit nahmen.
Überall eilten Menschen hin und her, und im Gegensatz zu Laura schien jeder genau zu wissen, wohin er wollte. Die Bremsen eines einfahrenden Zuges kreischten. Ein Schaffner stieg aus und rief einem Kollegen etwas zu, aber seine Worte gingen im Getöse eines abfahrenden Zuges unter.
»Wo finde ich bitte die Gepäckaufbewahrung?«, fragte Laura einen Jungen in schmuddeligen Hosen, der auf dem Perron saß und sie interessiert musterte.
»Ei, do driwwe.«
»Wie bitte?«
Der Junge stand auf und deutete grinsend zum anderen Ende der Halle. »Dort drüben, gnädigstes Fräulein! Wenn ich bitte Ihne Ihrn Koffer tragen dürfte?«
»Das ist sehr nett, danke. Aber ich trage ihn lieber selbst.«
Der Junge sah sie derart verblüfft an, dass sie lachen musste. Eine junge Dame, die ohne Begleitung aus einem Zweite-Klasse-Abteil stieg und auf die Dienste eines Gepäckträgers verzichtete, kam sicher nicht alle Tage vor. Laura zeigte zum gegenüberliegenden Bahnsteig, auf dem eine ältere und zwei jüngere Frauen zwischen Koffern und Körben standen. »Ich glaube, die Herrschaften brauchen deine Hilfe nötiger als ich.«
Auf dem Kopfperron und im Vestibül wiesen Schilder den Weg, und zehn Minuten später hatte Laura ihren Koffer aufgegeben. Kurz darauf trat sie auf den Bahnhofsvorplatz hinaus. Nieselregen wehte ihr ins Gesicht. Sie schlug den Kragen ihres Mantels hoch und spannte ihren Regenschirm auf.
»Halt!«
Erschrocken fuhr sie zusammen, als plötzlich zwei mit Säbeln bewaffnete Schutzmänner vortraten, die offenbar rechts und links des Eingangs gestanden hatten. Grimmig musterten sie einen schmächtigen jungen Mann, der in den Bahnhof hineingehen wollte.
»Wer sind Sie? Wohin wollen Sie?«, fragte einer der Beamten in scharfem Ton. Er hatte einen martialischen schwarzen Bart und trug ein goldenes Portepee. Der Mann stotterte etwas Unverständliches.
Laura sah, dass auch die anderen Eingänge von Schutzleuten bewacht wurden, die ohne Ausnahme jeden, der in den Bahnhof hineinwollte, kontrollierten. Was hatte das zu bedeuten? Sie spürte die Blicke des bärtigen Polizisten und ging rasch weiter. Das fehlte noch, dass man sie festhielt oder sogar mit zur Wache nahm. Sie überquerte den Platz und stieß fast mit einem Fahrradfahrer zusammen, der ihr wütend etwas hinterherrief, das sie nicht verstand. Vielleicht wäre es besser, mit der Trambahn zu fahren? Andererseits hatte sie genügend Zeit, und ihr Geld würde sie für wichtigere Dinge brauchen. Außerdem bot der Gang zu Fuß eine erste Möglichkeit, sich in der Stadt zu orientieren. Während der vergangenen Wochen hatte sie alles gelesen, was sie an Informationen über Frankfurt am Main hatte auftreiben können, und sie war gespannt, ob die Bilder in ihrem Kopf mit der Wirklichkeit übereinstimmten. Die in einem Reiseführer als Prachtboulevard gerühmte Kaiserstraße sah im Regen jedenfalls reichlich trist aus.
Das Trottoir war voller Menschen, die in Gruppen zusammenstanden und durcheinanderredeten. Und dazwischen immer wieder Polizei. Irgendetwas stimmte nicht! Laura wich auf die Fahrbahn aus, um schneller voranzukommen. Als sie den Rossmarkt erreichte, hörte es auf zu regnen. Sie überlegte, ob noch Zeit wäre, sich das Gutenberg-Denkmal anzuschauen, als ein Automobil an ihr vorbeiknatterte und sie von oben bis unten nass spritzte. Konnte dieser dumme Mensch nicht aufpassen, wohin er fuhr? Vergeblich versuchte sie, mit einem Taschentuch die Flecken aus ihrem Wollmantel herauszureiben. Ein Antrittsbesuch in schmutziger Garderobe! Ihre Mutter würde in Ohnmacht fallen, wenn sie es sähe.
Der Gedanke an zu Hause schmerzte. Es gab Dinge, die für eine junge Dame viel verderblicher waren als ohne Begleitung zu reisen und das Gepäck selbst zu tragen: einen Beruf zu erlernen, dem jüdischen Glauben abzuschwören und mit achtundzwanzig ledig zu sein. Laura steckte das Taschentuch weg und ging weiter. Sie hatte sich all das bestimmt nicht erkämpft, um vor ein paar Wasserflecken zu kapitulieren! Rechts vor ihr tauchte der Turm der Katharinenkirche auf. Als sie näher kam, sah sie vor dem Portal und dem Eingang des danebenliegenden Hauses eine Menschenmenge. Mehrere Schutzleute bemühten sich, sie auseinanderzutreiben.
»Machen Sie Platz!«, rief einer von ihnen, als sich zwei Männer in Zivil näherten. Sie trugen dunkelgraue Tuchmäntel und schwarze Hüte. Der jüngere, ein grobschlächtig wirkender Mensch, stieß die Leute fluchend beiseite, um sich einen Weg zum Eingang zu bahnen, der ältere, der ihn fast um Haupteslänge überragte, folgte wortlos. Keine Frage: In diesem Haus musste etwas Schlimmes geschehen sein. Ob das der Grund war, den Bahnhof unter Bewachung zu stellen? Die Uhr an der Katharinenkirche schlug zur vollen Stunde und erinnerte Laura daran, dass Polizeirat Franck sie erwartete.
Sie erreichte die Neue Zeil 60 zehn Minuten vor der Zeit. Das Polizeipräsidium der Stadt Frankfurt war ein dreistöckiger Bau im Stil der deutschen Renaissance und, wie Laura wusste, erst achtzehn Jahre alt. So imponierend das Gebäude von außen wirkte, so zweckmäßig bot es sich dem Besucher von innen dar: die Flure mit schlichten Deckenwölbungen versehen, die Treppen aus Eisen gefertigt. In der Polizeiwache im Erdgeschoss fragte sie nach dem Büro von Herrn Polizeirat Franck.
Die beiden Beamten musterten sie ungeniert. Was sie sahen, schien ihnen nicht zu gefallen. »Herr Polizeirat Franck empfängt in seinem Büro keinen Damenbesuch«, sagte der ältere. »Und schon gar nicht ohne vorherige Anmeldung!«
Laura erwiderte seinen Blick ohne Scheu. »Woher, bitte, wollen Sie wissen, dass ich nicht angemeldet bin?« Sie zog ein Schriftstück aus ihrem Mantel und gab es ihm.
Er las sorgfältig. »Oh. Ich bitte höflichst um Verzeihung, Fräulein Rothe.«
»Dürfte ich nun endlich erfahren, wo ich das Büro von Herrn Franck finde?«, wiederholte Laura schärfer als beabsichtigt.
»Erster Stock, rechts. Es steht angeschrieben. Aber Sie werden kein Glück haben. Er ...«
»Danke!«, schnitt ihm Laura das Wort ab.
Sie war kaum aus der Tür, als der jüngere Beamte losplatzte: »Ist sie das?«
»Sieht so aus.«
»Na, das wird lustig werden.«
Der ältere Beamte zuckte mit den Schultern. »Was interessiert’s mich? Solange sie uns nicht in die Parade fährt, ist es mir herzlich egal, ob sie Haare auf den Zähnen hat oder nicht.«
»Die wär’ das erste Weibsbild, mit dem der Heynel nicht fertig wird«, sagte der jüngere Beamte grinsend.
Es gab keinen Grund, anzunehmen, dass Kommissar Biddling bald ins Präsidium zurückkehrte. Dennoch wartete Heiner Braun bis kurz nach drei Uhr, bevor er sich entschloss, zu gehen. Ein letztes Mal betrachtete er das nüchtern eingerichtete Büro: Biddlings Schreibtisch mit Federkasten, Tintenfässchen, Stempeln und Akten darauf, sein eigenes leergeräumtes Stehpult am Fenster, den alten Aktenschrank, den Tisch mit der neuen Schreibmaschine. Eine Underwood mit Radschaltung, sichtbarer Schrift und Tabulator, wie der Kommissar Besuchern gern erläuterte.
Heiner erinnerte sich an seinen ersten Tag als blutjunger Polizeidiener im Polizeicorps der damals noch Freien Stadt Frankfurt und daran, wie stolz er nach der Ernennung zum Kriminalschutzmann auf sein erstes Büro gewesen war, eine zugige Kammer im ehemaligen Präsidium Clesernhof, das längst der Spitzhacke zum Opfer gefallen war. Er hatte seinen Beruf geliebt, und schon drei Stunden nach seiner Pensionierung ließ nichts mehr erahnen, dass er fast achtzehn Jahre in diesem Raum gearbeitet hatte. Er schloss die Tür und ging durch den verwaisten Flur zur Treppe. Es fiel ihm schwer zu akzeptieren, dass er nicht mehr gebraucht wurde. Er dachte an Helena, und sein Gesicht hellte sich auf. Sie brauchte ihn.
»Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wann Herr Polizeirat Franck zurückkehrt?«
Heiner fuhr zusammen. »Bitte?«
Eine junge Frau erhob sich von der Holzbank, die in einer Nische neben der Treppe stand. »Sehe ich so schlimm aus, dass Sie sich vor mir erschrecken?« Sie hatte eine melodische Stimme, ein nicht übermäßig schönes, aber sympathisches Gesicht und trug ein Tuchkleid im Stil der Reformbewegung. Ihr Haar war entgegen der herrschenden Mode zu einem schlichten Knoten geschlungen. Mantel und Hut hatte sie neben sich auf die Bank gelegt.
»Verzeihen Sie, ich war ein wenig in Gedanken«, sagte Heiner.
»Dann bin ich ja beruhigt, Herr ...?«
»Kriminalwachtmeister Braun.«
»Laura Rothe«, stellte sie sich vor. »Ich warte auf Herrn Franck. Er hatte mich um halb drei in sein Büro bestellt.«
»Sind Sie die Polizeiassistentin aus Berlin?«
Sie nickte.
»Es tut mir leid, aber Polizeirat Franck ist mit allen verfügbaren Kriminalbeamten zu einem Mordfall unterwegs.«
»Ich vermute, in dem Haus neben der Katharinenkirche? Jedenfalls lässt der Menschenauflauf, den ich auf dem Herweg sah, diesen Schluss zu.« Sie sah ihn neugierig an. »Und warum sind Sie noch hier?«
Die Frage war ein wenig direkt, aber Heiner nahm es ihr nicht übel. Er holte seine Taschenuhr hervor. »Weil ich seit drei Stunden und sieben Minuten pensioniert bin.«
»So alt sehen Sie gar nicht aus!« Betreten hielt sie sich die Hand vor den Mund und murmelte eine Entschuldigung.
Heiner Braun lachte. »Wenn ich Ihnen als altgedienter Beamter dieses Hauses einen Rat geben darf? Polizeirat Franck schätzt vorlaute Mitarbeiter nicht besonders. Möchten Sie einen Kaffee?«
»Ich dachte, Sie sind pensioniert?«
»Einen Kaffee kochen werde ich schon noch können.«
Zehn Minuten später saßen sie in Richard Biddlings Büro vor zwei dampfenden Tassen. »Ich hatte mir meinen Antrittsbesuch anders vorgestellt«, sagte Laura. »Abgesehen davon, wüsste ich gern, welche Aufgaben mich erwarten.«
»Soweit ich gehört habe, sollen Sie in der Fürsorge eingesetzt und Kriminaloberwachtmeister Heynel zugeteilt werden, Fräulein Rothe.«
»Ich hoffe doch sehr, über die Fürsorge hinaus auch die anderen Tätigkeitsfelder der Kriminalpolizei kennenzulernen. Erzählen Sie mir von ihm.«
»Bitte?«
»Oberwachtmeister Heynel – was ist er für ein Mensch?«
Heiner lächelte. »Warum interessiert Sie das?«
»Ich weiß gern, mit wem ich es zu tun habe.«
»Er neigt zu, nun ja, wie soll ich sagen? Er hat zuweilen eine etwas einnehmende Art.«
»Sie mögen ihn nicht«, stellte Laura fest.
»Ich kenne ihn kaum. Darf ich fragen, warum Sie ausgerechnet diesen ungewöhnlichen Beruf gewählt haben?«
»Die Aussicht, mein Leben in den philiströsen Verhältnissen von Kontor und Küche zuzubringen, gefiel mir nicht.« Als sie Heiners verständnislosen Blick sah, fügte sie hinzu: »Ich habe drei Jahre als Korrespondentin und Buchhalterin in der Firma meines Vaters gearbeitet.«
»Ihr Herr Vater war sicher nicht angetan von Ihrem Berufswechsel.«
»Mein Vater glaubt, ich bin in Berlin.« Sie sagte es in einem Ton, der jede weitere Frage verbat. Sie trank ihren Kaffee aus. Heiner ging hinaus, um die Tassen zu spülen. Als er zurückkam, saß sie an Biddlings Schreibtisch und blätterte in der Akte Pokorny & Wittekind.
»Kommissar Biddling wird nicht erfreut sein, wenn Sie ungefragt in seinen Akten lesen!«
Sie stand sofort auf. »Entschuldigen Sie. Ich habe nicht nachgedacht.«
Heiner wickelte die Tassen wieder in Zeitungspapier ein.
»Die hat eine Frau ausgesucht«, stellte Laura fest.
»Bitte?«
»Ihre Kaffeetassen! Die haben Sie von einer Frau bekommen, oder?«
»Mhm. Es dürfte wenig Sinn haben, weiter auf Polizeirat Franck zu warten. Am besten hinterlegen Sie auf der Wache Ihre Adresse und bitten um Nachricht, wann er Sie empfangen kann.«
»Leider habe ich noch keine Adresse. Und außerdem nicht das geringste Verlangen, mich ein weiteres Mal mit diesen beiden unhöflichen Beamten dort unten abzugeben!«
Heiner Braun musste lachen. »Sie erinnern mich an eine junge Dame, mit der ich vor vielen Jahren zusammengearbeitet habe.«
Sie sah ihn verblüfft an. »Man sagte mir, dass ich die erste Frau bin, die in Frankfurt in den Polizeidienst eintritt.«
»Die junge Dame, von der ich spreche, war genötigt, sich in einen jungen Mann zu verwandeln. Und es hat vier Jahre gedauert, bis ich es gemerkt habe.«
»Sie haben sie dafür bewundert.«
»Ja.«
»Lassen Sie mich raten: Die Kaffeetassen sind von ihr.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Sie gehen so sorgsam damit um, als ob sie eine besondere Bedeutung für Sie hätten. Was ist aus Ihrer heimlichen Mitarbeiterin geworden?«
Heiner Braun lächelte. »Kommissar Biddlings Gattin.«
»So etwas Dummes passiert mir nicht!«
»Was, bitte, ist daran dumm, wenn zwei Menschen heiraten?«
»Nichts!« Laura nahm ihren Mantel und ihren Hut. Heiner schloss die Tür ab und legte den Schlüssel auf den Rahmen. Laura folgte dem Kriminalwachtmeister bis zur Treppe und setzte sich wieder auf die Bank.
»Sie werden vergebens warten«, sagte Heiner freundlich.
»Lassen Sie das bitte meine Sorge sein.«
»Es gibt eine Art von Mut, die der Starrköpfigkeit recht nahe kommt, gnädiges Fräulein. Ich wünsche Ihnen viel Glück.«
Sie schluckte. »Könnten Sie mir vielleicht ein gutes Zimmer empfehlen? Allerdings dürfte es nicht allzu teuer sein. Meine Mittel sind begrenzt.«
»Wenn Sie keine besonderen Ansprüche an den Komfort stellen, fragen Sie im Rapunzelgässchen 5.«
»Ich lege Wert auf ein untadeliges Haus.«
»Für den Leumund der Wirtin verbürge ich mich.«
»Ach ja?«
»Sie ist meine Frau.«
Bevor Laura etwas erwidern konnte, war er gegangen.
Abendblatt, Freitag, 26. Februar 1904
Raubmord auf der Zeil. Eine allgemein bekannte und beliebte Persönlichkeit, der Inhaber der Pianofortefabrik Lichtenstein, Hermann Richard Lichtenstein, wurde heute Mittag zwischen 12 und 1 Uhr in seinem Bureau, Zeil 69, ermordet aufgefunden. Es liegt nach den bisherigen Anzeichen ohne Zweifel ein Raubmord vor, der mit frechster Verwegenheit im belebtesten Teil der Stadt zur Zeit des stärksten Verkehrs verübt worden ist.
Beobachtungen des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
26. Febr., 7 Uhr Mrgs.
Barometer (mm): 756,7
Thermometer (in Cels.): -3,3
Grad d. Bewölkung (0-10): 5
do., 2 Uhr Nachm.
Barometer (mm): 755,4
Thermometer (in Cels.): -1,4
Grad d. Bewölkung (0-10): 10
Zwei
Victoria Biddling drehte sich vor dem Spiegel, prüfte den Sitz ihres Hutes und zupfte sich eine Locke in die Stirn. Ihre Zofe Louise half ihr beim Anziehen des pelzbesetzten Mantels. »Welchen Schirm soll ich Ihnen bringen?«
»Den dunkelbraunen.«
Die Tür flog auf, und ein junges Mädchen stürmte herein. »Kommst du, Mama? Der Kutscher wartet schon!«
Victoria bemühte sich um einen strengen Gesichtsausdruck. »Sei nicht so ungeduldig!«
Flora Henriette Biddling stellte sich neben ihre Mutter und lachte ihr Spiegelbild an. »Ich bin ja so gespannt, was Papa heute Abend sagt, wenn er mein Hündchen sieht!«
»Dein Hut sitzt schief!«, tadelte Victoria.
»Das ist mir gleich!« Flora raffte ihren Rock hoch und drehte sich im Kreis herum, dass ihre blonden Locken tanzten. »Ich bekomme ein Hündchen, ein klitzekleines Hündchen, ganz für mich allein!«
Victoria verzog das Gesicht. Die Idee ihrer Schwester Maria, Flora zum Geburtstag einen Hund zu schenken, fand sie genauso unpassend wie ihr Getue um diesen Hundezüchter. Wenn du ihn erst kennengelernt hast, wirst du mir zustimmen, liebste Schwester: Karl Hopf ist ein faszinierender Mensch – und Mann. Dabei lächelte sie in einer Art, die Victoria nicht ausstehen konnte. Aber weil sie ihrer Tochter die Freude nicht verderben wollte, enthielt sie sich jeden Kommentars. Louise reichte ihr den Regenschirm und einen zur Farbe des Kleides passenden Beutel. Flora lief zur Tür und stieß beinahe mit ihrer Schwester Victoria Therese zusammen.
»Langsam, Florchen«, sagte sie lächelnd. »Du kommst schon noch früh genug nach Niederhöchstadt.«
Flora küsste sie auf die Wange. »Ich freu’ mich ja so, Vicki! Schade, dass Papa nicht mitfahren kann.«
»Bist du fertig?«, fragte Victoria.
Die Zweiundzwanzigjährige nickte. Sie trug ein enggeschnürtes rotes Schneiderkostüm, einen bestickten Tuchmantel und einen Hut aus grünem Velours, der gut zu ihrem schwarzen Haar passte.
»Sie sehen wunderschön aus«, sagte Louise.
»Ach was«, entgegnete Vicki verlegen.
Victoria lachte. »Die liebe Louise will nur kundtun, dass sie es bedauert, mich beim Ankleiden nicht mehr quälen zu dürfen.«
»Wenn Sie bitte erlauben: Ich finde diese neumodischen Kleidersäcke nicht besonders kleidsam.«
»Aber es zwickt nichts, und man fällt beim Fahrradfahren nicht so schnell in Ohnmacht«, sagte Flora.
»Lieber Himmel!«, rief Louise. »Diese schrecklichen Geräte sind doch nichts für sittsame, junge Mädchen!«
»Mama hat versprochen, dass ich eins bekomme, wenn ich fleißig Französisch lerne.«
Louise wandte sich kopfschüttelnd ab und legte Victorias Garderobe zusammen.
»Bitte kümmere dich darum, dass David und Vater zur gewohnten Zeit den Nachmittagskaffee erhalten«, sagte Victoria.
»Ja, gnädige Frau.«
»Lass dich von Großvater nicht ärgern«, flüsterte Vicki ihr zu, und über das Gesicht der alten Zofe huschte ein Lächeln.
Als Victoria mit ihren Töchtern und einem Dienstmädchen in den vor dem Haus stehenden Landauer stieg, war es kurz vor ein Uhr. Ein kalter Wind blähte ihre Kleider, und es nieselte. Victoria seufzte. Statt in einer zugigen Kutsche kilometerweit durch die Gegend zu fahren, würde sie lieber am Kamin in ihrer Bibliothek sitzen und die Bücher anschauen, die gestern geliefert worden waren. Flora kümmerte das schlechte Wetter nicht. Sie plapperte unaufhörlich, während ihre Schwester Vicki gedankenverloren in den Regen hinaussah.
»Tessa! Was meinst du, wie mein Hündchen heißen soll?«
»Struppi«, schlug das Dienstmädchen vor.
»So ein dummer Name!«
»Was fragst du dann überhaupt?«
»Es ist langweilig hier drin. Wir hätten mit der Eisenbahn fahren sollen.«
»Dich Zappelphilipp hätte der Schaffner spätestens am Bockenheimer Bahnhof an die Luft gesetzt«, neckte Vicki.
Flora streckte ihr die Zunge heraus.
»Wenn du nicht sofort Ruhe gibst, kehren wir um!«, sagte Victoria.
Flora lag eine Erwiderung auf der Zunge, aber der Gesichtsausdruck ihrer Mutter ließ keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Drohung. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schmollte.
Der Wagen bog in die Rödelheimer Landstraße ein und fuhr an Feldern und Wiesen vorbei, über denen grauer Dunst lag. Ab und zu sahen sie einen Reiter oder ein Fuhrwerk, ansonsten war die Straße leer. Das gleichmäßige Rumpeln der Räder machte müde. Victoria schloss die Augen. Sie hatte gehofft, Richard am Morgen sprechen zu können, aber als sie aufgewacht war, war er schon fort gewesen. Auch ihr Vater hatte es vorgezogen, ihr aus dem Weg zu gehen und sich Frühstück und Mittagessen aufs Zimmer bringen lassen. Und er tat gut daran. Er hatte kein Recht gehabt, seinen Schwiegersohn wie einen dummen Jungen zu disziplinieren, nur weil er nicht rechtzeitig zu Floras Geburtstagsessen heimgekommen war. Andererseits hatte Rudolf Könitz erkennbar einige Gläser Rießler zu viel genossen, und es wäre für Richard ein Leichtes gewesen, die Situation durch eine humorvolle Bemerkung zu entschärfen. Stattdessen hatte er Öl ins Feuer gegossen.
»Wenn ich Dieben künftig den Weg zu deiner wohlgehüteten Geldschatulle weise, statt sie zu verhaften, werde ich meinen Dienst sicherlich zeitiger beenden können, verehrtester Schwiegervater.«
»Das würde ich mir überlegen, mein Lieber«, entgegnete Rudolf Könitz lächelnd. »Denn ohne meine wohlgehütete Schatulle müsstest du mit deiner Familie ziemlich bald ins Ostend ziehen.«
Die Gespräche am Tisch verstummten. Richard stand auf und ging.
»Bleib sitzen!«, sagte Victoria, als Flora ihrem Vater folgen wollte. »Tessa! Bitte tragen Sie das Dessert auf.«
»Jawohl, gnädige Frau.«
Victoria tupfte sich mit der Serviette den Mund ab. »Ihr entschuldigt mich für einen Moment?«
Sie fand Richard in seinem Schlafzimmer. Er sah auf die Straße und den nächtlichen Main hinaus. Victoria ging zu ihm. »Vater ist betrunken. Er weiß nicht, was er sagt.«
»Er weiß es nur zu gut.«
»Flora wartet seit Stunden auf dich.«
Richard drehte sich zu ihr um. Sein Gesicht war angespannt und blass. »Ich lasse mich vor Gästen nicht derart beleidigen!«
Sie berührte seinen Arm. »Es ist doch nur die Familie da.«
»Du meinst, das macht es besser?«
»Vater ist ein alter Mann.«
»Das ist keine Entschuldigung.«
»Warum kommst du auch so spät?«
»Das Gesindel in dieser Stadt kümmert es herzlich wenig, ob meine Tochter heute Geburtstag hat!«
»Du tust, als wärst du der einzige Polizeibeamte in ganz Frankfurt!«, erwiderte Victoria verärgert.
Er ging an ihr vorbei und läutete nach einem Dienstmädchen. Louise kam herein.
»Bringen Sie mir bitte meinen Mantel.«
Louise nickte.
»Was hast du vor?«, fragte Victoria.
»Ich gehe aus.«
»Am Geburtstag deiner Tochter? Das ist nicht dein Ernst.«
»Ich hatte dich gebeten, im kleinen Kreis zu feiern.«
»Marias Familie, David und Vater – noch kleiner geht es ja wohl kaum! Nicht mal Floras Freundinnen sind eingeladen.«
»Wenn du Bankette liebst, hättest du keinen Beamten heiraten dürfen.«
Victoria schossen Tränen in die Augen. »Du bist gemein – und ungerecht dazu!«
Louise kam mit dem Mantel. Richard nahm ihn ihr aus der Hand. »Der größte Fehler, den ich in meinem Leben begangen habe, war, in dieses Haus zu ziehen«, sagte er und ging.
»Wollen Sie sich ein wenig frisch machen?«, fragte Louise.
Victoria wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Ich glaube, es könnte nichts schaden, oder?«
Als sie in den Salon zurückkam, war auch ihr Vater verschwunden. Sie wusste nicht, auf welchen der beiden Männer sie wütender sein sollte. »Richard lässt sich entschuldigen. Er fühlt sich nicht wohl«, sagte sie lächelnd und setzte sich.
Die Enttäuschung in Floras Gesicht tat weh. »Morgen Abend hat er bestimmt Zeit für dich, Liebes.«
»Tja, diese Preußen«, bemerkte Victorias Schwager. »Ein falsches Wort, und schon fühlen sie sich in ihrer Ehre gekränkt.«
»Du hast kein Recht, so über Papa zu reden, Onkel Theodor!«, sagte Flora empört.
Theodor Hortacker grinste. »Das war ein Scherz, du Dummerchen.«
»Ich bin kein Dummerchen!«
Die jüngere der beiden Hortacker-Töchter kicherte.
»Adina!«, sagte Maria. Die pummelige Vierzehnjährige wurde rot und starrte auf ihren Dessertteller.
Maria Hortacker zupfte am Ärmel ihres aufwendig gearbeiteten Kleides, das sich über ihrer drallen Figur spannte, und führte mit gezierter Geste ein Löffelchen Schokoladenmousse zum Mund. »Deine Nachspeise ist exzellent, Schwester. Schade nur, dass deinem Mann diese Köstlichkeit entgeht.« Der dezente Hinweis auf Richards Etikettebruch machte Victoria noch zorniger als sie ohnehin schon war.
»Keine Sorge, meine Liebe«, sagte sie. »Ich habe ein Schälchen zurückstellen lassen. Du kannst also ohne Bedenken eine weitere Portion essen.«
Beleidigt schob Maria den halbvollen Teller von sich.
»Hast du dir denn schon einen Namen für deinen Hund überlegt?«, fragte David Könitz seine Nichte.
Flora schüttelte den Kopf. »Weißt du nicht einen?«
Er sah zu dem Klavier, das neben dem Durchgang zum Herrenzimmer stand. »Mit etwas Musik würden mir bestimmt ein halbes Dutzend einfallen.«
Flora sprang auf. »O fein! Ich spiele dir etwas auf meinem neuen Piano vor! Was möchtest du hören, Onkel David? Schubert? Beethoven?«
»Ich lasse mich überraschen.«
Victoria nickte ihrem Bruder dankbar zu. Flora stimmte eine Sonate an.
»Mama, aufwachen! Wir sind da!«
Victoria schrak zusammen. Ihr Rücken schmerzte, und ihre Finger waren trotz der gefütterten Handschuhe eiskalt. Der Wagen fuhr durch einen Torbogen in eine gekieste Einfahrt und hielt vor einem Gehöft, das aus einem Wohnhaus und mehreren Nebengebäuden bestand. Der Kutscher öffnete den Schlag. Neben ihm stand ein Mann mit Schnauzbart und einer Fellmütze auf dem Kopf. Er hatte einen geflickten Reitdress an, der vor Nässe triefte.
»Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise?«, sagte er und half Victoria aus dem Wagen.
»Wenn ich ehrlich bin: Es ist zu kalt zum Ausfahren«, entgegnete sie.
Flora sprang aus der Kutsche. »Sterbenslangweilig war’s. Wo sind die Hündchen?«
»Flora, bitte!«, mahnte Victoria.
Der Mann lachte. »Was hältst du davon, wenn wir vorher deine Mitreisenden aussteigen lassen, kleines Fräulein?«
»Ich bin schon zwölf!«, sagte Flora empört.
Er nahm ihre Hand und deutete einen Kuss an. »Wenn Sie bitte vielmals entschuldigen, Gnädigste? Ich bin schon vierzig.«
Flora kicherte. »Ich heiße Flora Henriette Biddling, und du darfst ruhig du zu mir sagen.«
»Gestatten: Karl Emanuel Hopf«, sagte der Mann.
Victoria war so überrascht, dass sie sogar vergaß, ihre Tochter wegen der unangemessenen Anrede zu disziplinieren. Dieser nachlässig gekleidete, nach Pferdestall riechende Mensch konnte doch unmöglich der Hundezüchter sein, von dem Maria in den höchsten Tönen geschwärmt hatte? Er reichte Vicki, dann Tessa die Hand, um ihnen beim Aussteigen behilflich zu sein. Victoria entging weder der bewundernde Blick, mit dem er ihre Älteste bedachte, noch die distanzierte Miene ihrer Tochter, die sie immer dann aufsetzte, wenn ihr etwas gründlich missfiel.
Karl Hopf deutete eine Verbeugung an. »Nach den Berichten Ihrer Tante freue ich mich sehr, Sie persönlich kennenzulernen, Fräulein Biddling.«
»Vielen Dank für die Einladung«, sagte Vicki steif.
»Warum bist du so nass?«, wollte Flora wissen.
Karl Hopf sah Victoria an. »Ich bitte, meinen unpassenden Aufzug zu entschuldigen. Ich hatte Sie erst in einer Stunde erwartet.«
»Meine Schwester hat mir ausdrücklich zugesagt, unsere Ankunftszeit zu telegrafieren!«, sagte Victoria ärgerlich.
Hopf lächelte. »Die gute Maria scheint vergesslich zu werden.«
Er wies dem Kutscher den Weg und bat seine Besucher, ihm ins Haus zu folgen. »Ich wette, mit einer Tasse heißer Schokolade im Bauch wird dir Malvida umso besser gefallen«, sagte er zu Flora, die sehnsüchtig zu den Ställen sah.
»Wer ist denn Malvida?«
Er zog seine Mütze vom Kopf und tat, als suchte er etwas darin. »Geläng’ es mir, des Weltalls Grund,/Somit auch meinen, auszusagen,/So könnt’ ich auch zur selben Stund/Mich selbst auf meinen Armen tragen.«
Flora zog einen Schmollmund. »Das ist doch keine Antwort auf meine Frage.«
Victoria sah ihn verblüfft an. »Sie kennen Grillparzer?«
»Sieh an. Sie kennen ihn auch«, gab er schmunzelnd zurück.
»Trauen Sie Frauen etwa keine literarische Lektüre zu?«
»Hätten Sie Ihre Eingangsfrage auch gestellt, wenn ich einen Cutaway trüge?«
»Mir ist kalt«, nörgelte Flora.
»Oh, Verzeihung! Wie unhöflich von mir.« Hopf klopfte gegen die Tür. Ein blasses Mädchen öffnete. »Bitte führe die Damen in den Salon, Briddy. Ich komme gleich nach.«
Das Mädchen nahm Hüte, Schals und Mäntel entgegen. Der Salon lag am jenseitigen Ende der düsteren Diele und war im Vergleich zu den Räumlichkeiten im Könitzschen Stadtpalais bescheiden, sowohl was seine Größe, als auch, was die Möblierung anging: ein Tisch, ein grünes Sofa mit passenden Polsterstühlen, ein einfach gearbeitetes Buffet und zwei Korbsessel vor einem aus Backstein gemauerten Kamin. Es gab keine Büsten, keine Nippfiguren, keinen Blumenschmuck, nicht einmal Bilder an den Wänden. Die vier gerahmten Fotografien auf dem Kaminsims fielen daher um so mehr ins Auge.
Vicki und Flora setzten sich, Tessa blieb stehen. Victoria hielt ihre Hände über das Feuer. Verstohlen betrachtete sie die Fotos: das Portrait eines älteren Mannes, das Bildnis einer jungen Frau, ein Säugling im Taufkleid und schließlich, ein wenig abgerückt von den anderen, eine etwa vierzigjährige Frau, die neben einem blumengeschmückten Tischchen stand. Der Haartracht und dem altmodischen Kleid nach zu urteilen, handelte es sich um eine Aufnahme aus den siebziger oder achtziger Jahren.
Briddy brachte die Schokolade. »Möchten Sie auch eine Tasse, gnädige Frau?«
Victoria schüttelte den Kopf. Die Frau auf dem Foto sah noch sehr kindlich aus. Ob der Säugling zu ihr gehörte?
»Meine Familie«, sagte Karl Hopf von der Tür her. Victoria hatte Mühe, ihre Überraschung zu verbergen: Statt der Stallkleidung trug er einen dunkelblauen Tagesanzug, eine farblich passende Weste und ein Hemd mit Langbinder. Es war, als stünde ein anderer Mensch vor ihr.
»Ich vermute, jetzt nehmen Sie mir auch Grillparzer ab?«, sagte er lächelnd.
Flora stand auf. »Kann ich bitte endlich die Hündchen sehen?«
»Aber sicher. Malvida wartet schon.« Er klingelte, und kurz darauf kam ein Junge mit einer Holzkiste herein. Vorsichtig stellte er sie auf den Boden.
»Du darfst den Deckel abnehmen, aber vorsichtig. Sonst erschreckt sie sich.«
»Mama! Schau doch, wie niedlich!«
Victoria sah neugierig in die mit Stroh ausgelegte Kiste. Der kleine Hund hatte ein honigfarbenes Gesicht, Hängeohren und ein seidiges Fell. Als Flora ihn anfassen wollte, verkroch er sich in eine Ecke.
»Malvida wird ein Weilchen brauchen, bis sie sich an dich gewöhnt hat«, sagte Karl Hopf. »Aber ich bin sicher, sie wird ihrer Namensvetterin recht bald alle Ehre machen.«
»Und wer ist ihre Namensvetterin?«
Hopf sah Victoria an. »Malvida Freiin von Meysenbug, eine aufmüpfige, schriftstellernde Dame, die es verdient, nicht vergessen zu werden. Sie starb im vergangenen Jahr.«
Victoria lachte. »Und da lassen Sie sie ausgerechnet in einem Hund weiterleben?«
»Nicht der Körper, die Seele ist es, was zählt«, sagte er ernst und legte den Deckel wieder auf die Kiste.
»Ich hätte sie so gern gestreichelt«, klagte Flora.
Hopf zeigte auf den Jungen. »Weißt du was? Benno stellt dir Malvidas Familie vor. Möchtest du?«
»O ja! Kommst du mit, Vicki?«
Sie nickte, aber Victoria sah ihr an, dass sie alles andere lieber tun würde, als mit ihrem maßgeschneiderten Kleid in einem Hundestall herumzulaufen. Als sie gegangen waren, kam Briddy herein. Sie wirkte noch blasser. Tessa erbot sich, ihr mit dem Geschirr zu helfen.
Karl Hopf trug die Kiste in die Nähe des Kamins, nahm den Deckel ab, streichelte den Welpen und sprach beruhigend auf ihn ein.
»Welche Rassen züchten Sie?«, fragte Victoria.
»St.-Bernhardhunde in der Hauptsache, Seiden- und Wachtelhunde in der Nebensache. Die Frankfurter Damenwelt ist ganz verrückt nach meinen Chins.«
»Meine Schwester aber sicherlich nicht.«
»Nein. Die gute Maria mag keine Hunde.« Er schloss die Kiste. »Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch.« Er sagte es ohne jeden Hintersinn, und Victoria fragte sich, was ein Hundezüchter an einer Frau fand, die keine Hunde mochte, alles andere als Liebreiz ausstrahlte und noch dazu ständig über Mode und übers Essen redete.
»Ich lernte Ihre Schwester übrigens im Haus Ihrer Schwägerin, Gräfin von Tennitz, kennen.«
»Ah«, sagte Victoria.
»Sie haben nicht das beste Verhältnis zu ihr, oder?«
»Zu wem? Maria oder Cornelia?«
»Sowohl als auch.«
Victoria errötete. »Nun, wir verstehen uns recht gut.«
Er lachte. Es war ein herzliches, warmes Lachen. »Ich nehme an, Sie haben Ihre Schwester zum Teufel gewünscht, als Sie von ihrem Geschenk erfuhren.«
»Nein, wirklich nicht. Malvida ist sehr hübsch.«
Er blieb vor ihr stehen. »Sie sind Maria kein bisschen ähnlich.« Er strich über den Pelzbesatz ihres Kleides. »Oder doch?«
Victoria fehlten die Worte. Seine Augen waren von einem Grün, wie sie es noch nie gesehen hatte. Er berührte ihr Haar. »Sie sehen nicht glücklich aus.«
Victoria zeigte auf die Fotografien. »Ihre Frau ist sehr jung. Oder ist es eine Verwandte?«
Sein Lächeln erstarb. »Mein Vater, mein Sohn, meine Frau«, zählte er mit tonloser Stimme auf. »Und meine Mutter. Als sie so alt war wie ich. Sie lebt in Offenbach.«
»Und die anderen?«
Er sah sie an. »Memento mori. Neunzehnter April 1895, erster April 1896, achtundzwanzigster November 1902.«
»Wollen Sie damit sagen, sie sind alle tot?« Er nickte. Victoria konnte seinem Blick nicht standhalten. »Bitte verzeihen Sie.« Sie wünschte, ihre Töchter kämen zurück. Oder Tessa. Oder die bleichgesichtige Briddy.
»Wollen Sie wissen, woran sie gestorben sind? Mein Vater an Influenza, mein Sohn an Kiefervereiterung. Und Josefa ...« Er nahm die Fotografie und strich mit den Fingerspitzen darüber. Die zärtliche Geste stand in auffallendem Missverhältnis zu seinem feindseligen Gesichtsausdruck. »Man sagt, ich hätte sie umgebracht.«
Victoria wagte nicht zu fragen, wer das behauptete, und warum.
Er stellte das Foto zurück. »Warum fragen Sie nicht, ob ich es getan habe?«
Sie versuchte ein Lächeln. »Nun – haben Sie?«
»Was wäre, wenn ich Ja sagte?«
»Ich würde es nicht glauben.«
»Warum?«
»Sie sehen nicht wie ein Mörder aus.«
Sein Gesicht entspannte sich. »Wie müsste ich denn aussehen, dass Sie mir eine solche Tat zutrauten?«
»Woran ist sie gestorben?«
Er legte ein Scheit Holz ins Feuer. »Die Sektion ergab, dass sie an einem Geschwür am Zwölffingerdarm litt.«
Victoria lächelte. »Ich hatte also recht.«
»Womit?«
»Dass Sie nicht wie ein Mörder aussehen.«
»Und deshalb keiner sein kann? Für diese Deduktion bekämen Sie in der Baker Street aber ein entschiedenes Kontra, gnädige Frau.«
»Bitte?«, fragte sie verblüfft.
»Es läuft der scharlachrote Faden des Mordes durch das farblose Gewebe des Lebens, und es ist unsere Pflicht, ihn herauszulösen und zu isolieren und jedes Stückchen bloßzulegen. Maria hat mir verraten, dass Sie ein Bewunderer von Sherlock Holmes sind.«
Sie sah ihn wütend an. »Gibt es etwas, das meine geschwätzige Schwester nicht ausgeplaudert hat?«
»Sie tun ihr unrecht. Maria ist diskret, was familiäre Angelegenheiten angeht. Aber als ich ihr erzählte, dass ich so neugierig auf Holmes’ Wiederauferstehung war, dass ich mir sogar die Collier’s Weekly aus England habe schicken lassen, hat sie gesagt, dass Sie den guten Dr. Doyle wegen Holmes’ unrühmlichem Ende am liebsten höchstselbst die Reichenbachfälle hinabgejagt hätten.«
»Das ist Jahre her.«
»Soll das heißen, es interessiert Sie nicht, was aus dem großen Detektiv geworden ist?«
»Richtig.«
»Wenn Sie mögen, leihe ich Ihnen The Adventure of the Empty House zur Lektüre aus. Wenn Sie mir bitte in die Bibliothek folgen wollen?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, ging er zur Tür.
Victoria blieb am Kamin stehen. »Ich schätze es nicht, wenn man über mich verfügt!«
Er sah sie mit einem zerknirschten Gesichtsausdruck an. »Ich bitte höflichst um Verzeihung für meine Konduite, gnädige Frau. Wir haben selten Gäste in diesem Haus, deshalb bin ich in Dingen der Etikette ein wenig ungeübt.« Er zog einen Stuhl zurück und verneigte sich. »Sicherlich sind Sie nach der anstrengenden Reise müde. Darf ich Ihnen einen Platz anbieten? Ich lasse sofort eine Erfrischung bringen.«
Victoria schmunzelte. »Sie sind ein lausiger Schauspieler, Herr Hopf. Und jetzt zeigen Sie mir Ihre Büchersammlung!«
Sie gingen in den ersten Stock hinauf. Das Treppenhaus war noch schummriger als die Diele und eiskalt. Ausgestopfte Vögel starrten sie aus dem Halbdunkel an wie Räuber bei einem Überfall.
Die Bibliothek lag über dem Salon. Hopf ließ Victoria vorausgehen. Überrascht sah sie sich um: Der Raum war hell und anheimelnd und passte überhaupt nicht in dieses düstere Haus. In einem Kamin flackerte ein Feuer, davor gruppierten sich Sessel und ein Tisch, auf dem Bücher und Zeitungen lagen. Der Boden war mit bunten Teppichen belegt, an den Wänden standen Bücherschränke. In einem zweiteiligen Ahornholzmöbel, dessen Oberteil von vier Kugeln getragen wurde, waren exotisch anmutende Masken ausgestellt. Daneben befand sich, teils durch einen Paravent verdeckt, ein holzvertäfelter Durchgang.
»Die Bibliothek ist mein Lieblingszimmer«, sagte Hopf. »Ich könnte ganze Tage zwischen Büchern verbringen.«
»Ich auch«, sagte Victoria.
Während er die Zeitungen durchsah, studierte sie den Inhalt der Bücherschränke: Die Hundezucht im Lichte der Darwinschen Theorie, Katechismus der Hunderassen, Damen- und kleine Luxushunde; Lexika, Werke von Goethe und Schiller, eine Gesamtausgabe von Grillparzers Dramen, Lutz’ Kriminal- und Detektivromane Band eins bis zwölf, dazwischen die zweibändige englischsprachige Ausgabe der Leipziger Tauchnitz Edition The Memoirs of Sherlock Holmes. Victoria widerstand dem Verlangen, einen Band herauszunehmen, und ging zum nächsten Schrank. »Studieren Sie nebenbei Medizin?«, fragte sie.
Er legte die Zeitungen beiseite und kam zu ihr. »Nein. Warum?«
»Geschichte der Heilkunde, Handbuch der gerichtlichen Medizin, Lehrbuch der praktischen Toxikologie, Dictionnaire de médecine – ein ungewöhnlicher Lesestoff für einen Hundezüchter, oder?«
»Ich bin ausgebildeter Drogist.«
»Oh.«
»Ist das so ein außergewöhnlicher Beruf?«, fragte er amüsiert.
Victoria ärgerte sich, dass es ihm schon wieder gelungen war, sie verlegen zu machen. Sie zeigte auf die beiden Bände Handbuch der gerichtlichen Medizin. »Früher gehörten Caspers Ausführungen über Leichenerscheinungen zu meiner bevorzugten, allerdings heimlich genossenen Lektüre.«
»Ach ja?«
»Das ist mehr als zwanzig Jahre her. Mein Onkel war Arzt und besaß eine gut sortierte Bibliothek.«
Hopf lachte. »Ich nehme an, Ihre Eltern hatten es nicht leicht mit Ihnen.«
Sie sah zum Kamin. »Sie wollten mir die neueste Geschichte von Sherlock Holmes zeigen.«
Flora stürmte herein. »Malvida hat noch drei Schwestern!«
»Flora, bitte! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du anklopfen sollst, bevor du ein fremdes Zimmer betrittst«, sagte Victoria.
»Oh. Entschuldigung.«
»Schon gut«, beschwichtigte Karl Hopf.
»Wo ist denn Vicki?«, fragte Victoria.
»Ihr Dienstmädchen und Ihre Tochter warten im Salon«, sagte Briddy, die Flora gefolgt war.
Flora strahlte Karl Hopf an. »Benno sagt, du kannst mit einem Säbelschlag einen ganzen Hammel durchhauen!«
»Benno erzählt viel.«
»Aber ich hab den Säbel gesehen. Und deine Degen auch! Und das Zimmer, wo du übst.«
»Das ist kein Zimmer, sondern ein Fechtboden«, erklärte Karl Hopf lächelnd.
Flora betrachtete die Masken in dem Ahornholzschrank. »Und was sind das für komische Dinger?«
»Reiseandenken aus Marokko und Indien.«
»Sie waren in Indien?«, fragte Victoria überrascht.
»Unter anderem, ja.«
»Mein ältester Bruder lebt seit vielen Jahren in Poona.«
»Ich weiß. Ihre Schwester erwähnte es.«
Victoria unterdrückte die bissige Erwiderung, die ihr auf der Zunge lag. Die Beziehung zwischen diesem Hundezüchter und ihrer Schwester ging sie nichts an. Sie war hier, um einen Hund abzuholen. Punktum.
Flora inspizierte noch immer die Masken. »Und was machst du damit?«
Karl Hopf grinste. »Bei Vollmond kleine Kinder erschrecken.«
»Ich bin kein kleines Kind!«
»Habe ich das denn behauptet?«
Flora zeigte auf den Paravent. »Und wo geht’s da hin?«
»Ins Spiegelzimmer.«
»Und was ist da drin?«
»Was glaubst du denn, was darin ist?«
»Ich schau einfach nach.« Sie verschwand hinter dem Wandschirm, kam aber sofort zurück. »Die Tür ist abgeschlossen. Gibst du mir den Schlüssel?«
Er lächelte. »Ein anderes Mal.«
»Wann?«
»Wenn ihr mich wieder besuchen kommt.«
»Versprichst du’s?«
»Ja.«
»Du musst es mir schwören. Bei allem, was dir lieb ist!«
Er hob seine rechte Hand. »Ich gelobe bei allem, was mir in meinem Leben lieb und teuer ist, Fräulein Flora Henriette Biddling bei ihrem nächsten Besuch das streng gehütete Geheimnis des Spiegelzimmers zu offenbaren. Zufrieden?«
»Kannst du mir ein klitzekleines bisschen von dem Geheimnis nicht schon heute verraten? Bitte.«
»Hast du nicht gehört, was Herr Hopf gesagt hat?«, fragte Victoria gereizt. »Wir gehen jetzt hinunter in den Salon. Deine Schwester wartet.«
»Fein. Ich erzähle ihr, dass wir bald wiederkommen!« Flora rannte aus dem Zimmer; Briddy folgte kopfschüttelnd.
»Ich möchte mich für das Verhalten meiner Tochter entschuldigen«, sagte Victoria, als sie mit Hopf die Bibliothek verließ.
»Ach was.«
»Ich finde es nicht richtig, dass Sie ihr erlauben, Sie zu duzen.«
»Warum?«
»Es ist ungehörig.«
Er lächelte. »Manchmal sind Kinder ihren Eltern ähnlicher, als es ihnen lieb ist.«
»Ich glaube nicht, dass ich das mit Ihnen erörtern will.«
»Und warum nicht?«, fragte er freundlich.
»Es geht Sie nichts an!«
»In Indien gibt es das Sprichwort: Geduld verlieren heißt Würde verlieren.«
Victoria sah ihn ungehalten an. »Was hat Ihnen Maria alles über mich erzählt?«
»So viele nette Dinge, dass ich neugierig darauf war, Sie kennenzulernen. Die Idee mit dem Hund stammt von mir.«
»Sie haben vergessen, mir Doyles Geschichte zu geben.«
»Ein Grund mehr, bald wiederzukommen.« Er nahm ihre Hand und küsste sie. »Ich würde mich sehr freuen.«
Sein Blick ließ sie unsicher werden. Sie zog ihre Hand weg und ging voraus. Was bildete er sich ein? Sie war eine verheiratete Frau und kein junges Mädchen, das es zu erobern galt! Aber seine Bewunderung tat trotzdem gut.
»Ich schlage vor, ich lasse Kaffee bringen, und Sie fragen, was immer Sie möchten«, sagte er, als sie in den Salon gingen.
»Ich wüsste nicht, was ich Sie fragen sollte, Herr Hopf.«
Er lächelte. »Vielleicht, was Maria sonst noch erzählt hat?«
Als sie das Haus verließen, war der Regen in Schnee übergegangen, den der Wind als weiße Tupfen auf Hüte, Haare und Mäntel trieb. Vicki hielt sich schützend ihren Schal vors Gesicht. Karl Hopf trug die Kiste mit Malvida zum Wagen und half dem Kutscher beim Verstauen.
»Ist es ihr auch bestimmt nicht zu kalt da drin?«, fragte Flora.
»Zieh endlich deine Handschuhe an!«, mahnte Victoria.
Flora streckte Hopf ihre unbehandschuhte Hand hin. »Nächste Woche kommen wir wieder.«
Hopf sah Victoria an. »Das wäre schön.«
»Auf Wiedersehen«, sagte Vicki förmlich. Sie stieg hinter Tessa in den Wagen, ohne seine Hilfe anzunehmen.
»Das nächste Mal darf ich um ein wenig mehr Freundlichkeit bitten«, sagte Victoria zu Vicki, als sie aus dem Hof fuhren.
»Ich mag ihn nicht.«
»Das ist kein Grund, sich unhöflich zu benehmen.«
»Ich weiß nicht, was du hast«, sagte Flora. »Karl ist doch nett.«
»Er hat mich ungehörig angestarrt!«
»Mama hat er aber viel mehr angestarrt als dich«, sagte Flora.
Victoria schoss das Blut zu Kopf. Vicki verzog das Gesicht. »Er hat Manieren wie ein Sachsenhäuser Gassenkehrer.«
Flora lachte. »Du bist ja bloß neidisch.«
»Hör auf, solchen Blödsinn zu reden!«
Victoria sah ihre Älteste überrascht an. Gefühlsausbrüche war sie von ihr nicht gewöhnt. »Ich bin sicher, dass Herr Hopf dir keinesfalls zu nahe treten wollte.«
»Ja, bestimmt«, lenkte Vicki ein. »Ich habe mich ungebührlich verhalten und entschuldige mich, Mutter.«
Ihr Gesicht verriet keine Regung. Victoria hätte viel darum gegeben, ihre Gedanken lesen zu können. Sie sah aus dem Fenster. Der Schnee schien über die Felder zu tanzen, und für einen Moment glaubte sie, Karl Hopfs grüne Augen schauten sie aus dem Zwielicht an.
Es war dunkel, als sie in Frankfurt ankamen. Der Kutscher pfiff nach einem Burschen. Ein schlaksiger Junge brachte eine Lampe und half beim Aussteigen. Victoria bat ihn, die Kiste mit Malvida ins Haus zu tragen.
»Haben Sie’s schon gehört?«, fragte er.
»Was denn?«
»Na, der Mord, gnädige Frau!«
»Welcher Mord?«
»Heut’ Mittag auf der Zeil. Beraubt und erschlagen, sagen die Leut’.« Er schüttelte sich. »Da kriegt man Angst, wenn man bloß drüber redet.« Er nahm die Kiste und ging voraus.
Louise öffnete ihnen die Tür. »Stellen Sie sich vor, Herr Lichtenstein ist ermordet worden!«, sagte sie statt einer Begrüßung. »Am helllichten Tag. Mitten in der Stadt!«
»Um Gottes willen!«, rief Victoria.
»Ist das der Mann, bei dem wir mein Piano gekauft haben?«, fragte Flora.
»Wir gehen nach oben, Florchen«, bestimmte Vicki, aber Flora schüttelte den Kopf.
»Die Leut’ sagen, man hat ihm den Schädel gespalten«, bemerkte der Junge.
»Aber warum denn? Er war doch so nett«, meinte Flora traurig.
»Die Leut’ sagen, das Blut ist überall hingespritzt.«
»Spare dir die Details gefälligst für deinesgleichen auf!«, fuhr Victoria ihn an.
Der junge Bursche zog den Kopf zwischen die Schultern. »Jawohl, gnädige Frau. Wohin soll ich die Kiste bitte bringen?«
»In den blauen Salon. Weiß man denn schon, wer es war?«, wandte sie sich an Louise.
Die Zofe schüttelte den Kopf. »Es soll mehrere Verhaftungen gegeben haben. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Und überall Polizei.«
»Dann ist Papa noch gar nicht da?«, fragte Flora enttäuscht.
Victoria strich ihr übers Haar. »Du kannst ihm dein Hündchen morgen zeigen, Liebes.«
»Ich will aber heute Abend, Mama! Bitte.«
»Malvida ist nach all der Aufregung bestimmt sehr müde. Ich bleibe auf, bis er heimkommt und erzähle ihm von ihr. Und morgen früh darfst du sie ihm vorstellen.«
»Weckst du mich auch ganz bestimmt rechtzeitig?«
»Versprochen.«
Flora wischte sich eine Träne weg. »Bei allem, was dir lieb ist?«
»Bei allem, was mir lieb ist.«
»Danke, Mama! Komm, Vicki«, wandte sie sich an ihre Schwester. »Lass uns schauen, wie es Malvida geht.«
»Du bist ein rechter Quälgeist, Florchen«, sagte Vicki, aber es klang alles andere als böse. Hand in Hand liefen sie die Treppe nach oben. Nachdenklich folgte Victoria ihnen. Karl Hopf ist ein faszinierender Mensch – und Mann. Ausnahmsweise war sie mit ihrer Schwester einer Meinung.
Abendblatt, Freitag, 26. Februar 1904
Wolff´s telegr. Corresp.-Bureau: Der Krieg in Ostasien entbehrt noch immer entscheidender Schläge, und es ist keineswegs ausgeschlossen, daß das Ringen noch recht lange dauert.
Anzeige
Es ist ein Unterschied, ob 65 oder 72 Tasten an dem Klavierspiel-Apparat funktionieren. Die Phonola hat 72 Töne und gestattet, alle Komponisten in der Originalausgabe zu spielen, was nur für sie allein zutrifft. Die Phonola wird an den Flügel oder das Klavier angelehnt.
Preis Mk 850.-
Luxusmodell Mk 1100.-
Verlangen Sie die Broschüre „Die Phonola“ von Ludwig Hupfeld, Leipzig, Berlin W., Leipziger Str. 106 pt. u. I. Et.
General-Depot für Frankfurt a. M.:
L. Lichtenstein und Co., Zeil 69
Raubmord auf der Zeil. Im letzten Raum des geräumigen vierteiligen Pianofortelagers lag die Leiche vor einem Bechsteinflügel. Um den Hals war ein Strick acht bis zehn Mal geschnürt, so daß gleichzeitig Totschlag und Erdrosselung vorliegt. Die Angehörigen, die Palmengartenstraße 4 wohnen, wurden telephonisch benachrichtigt. Der Ermordete stand in den fünfziger Jahren und erfreute sich allgemeinen Ansehens.
Ein Berichterstatter meldet noch: Es ist noch nicht festgestellt, was geraubt ist. Man nimmt an, daß die Bluttat von mindestens zwei Personen verübt worden ist. Die Verbrecher sind vermutlich auch mit Blut bespritzt gewesen.
Drei
Polizeirat Franck hatte graues, über der Stirn lichtes Haar, und man sah ihm an, dass er gute Mahlzeiten zu schätzen wusste. Am wohlsten fühlte er sich, wenn die Dinge in ruhigen Bahnen liefen, wenn alles seine Ordnung hatte. Er war in Berlin geboren und aufgewachsen, aber er hatte nichts Preußisches an sich. Als ihm der Mord an Lichtenstein gemeldet wurde, war er im Begriff, zu Tisch zu gehen, und bevor er irgendeine Entscheidung treffen konnte, brach um ihn herum jene Hektik aus, die er verabscheute, weil sie ihm keinen Raum für klare Gedanken ließ. Er verfügte die Überwachung der Bahnhöfe und beauftragte seinen Bürogehilfen, alle im Haus befindlichen Kriminalbeamten in sein Büro zu rufen.
Zehn Minuten später hielt er eine Besprechung ab und beorderte die Kommissare Biddling und Beck zum Tatort. Er informierte den Vertreter des Polizeipräsidenten, telefonierte mit dem Ersten Staatsanwalt und ging ins Erdgeschoss hinunter, um mit dem Leiter der Schutzmannschaft zu sprechen. Danach verließ er das Präsidium, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der ungeliebte Termin in seinem Kalender geriet darüber in Vergessenheit.
Richard Biddling wusste, dass ihm nach Brauns Pensionierung Kommissar Beck zugeteilt werden würde. Glücklich war er darüber nicht. Fachlich gab es an Beck nichts auszusetzen, aber sein Charakter erschwerte eine gedeihliche Zusammenarbeit: übertriebener Ehrgeiz, Unbeherrschtheit und Starrsinn. Hatte er sich einmal auf eine bestimmte Meinung festgelegt, war es so gut wie aussichtslos, ihn von etwas anderem zu überzeugen. Da er sich tatsächlich selten irrte, verstärkte sich sein Hang zur Rechthaberei noch.
Zwischen Polizeipräsidium und Tatort lagen gute fünfhundert Meter, die die Männer zu Fuß und schweigend zurücklegten. Für die prachtvollen Bauten auf Frankfurts mondäner Einkaufsstraße hatten sie keinen Blick. Sie passierten die Kaiserliche Oberpostdirektion, und vor ihnen tauchten die Hauptwache und der Turm der Katharinenkirche auf. Das Haus mit der Nummer 69, ein schmuckloser Geschäftsbau, lag schräg gegenüber der Wache, links von der Kirche. Ein Firmenschild mit weithin sichtbaren Lettern zog sich über die gesamte Breite des ersten Stockes: L. Lichtenstein & Co. Pianinos. Flügel. Auf der Straße und vor dem Haus hatten sich Schaulustige versammelt; Schutzleute versuchten vergeblich, sie zum Weitergehen zu drängen.
Irgendwie schaffte es Beck, sich einen Weg zu bahnen, und Richard ging ihm hinterher. Den Eingang bewachte ein älterer Schutzmann, dessen Miene keinen Zweifel daran ließ, dass er von seinem Säbel Gebrauch machen würde, sollte es jemand wagen, ihm zu nahe zu kommen.
»Wo?«, fragte Beck.
Der Beamte nahm Haltung an. »Erste Etage geradeaus, Herr Kommissar!«
»Herrgott! Haben die hier kein Licht?«, schimpfte Beck im Treppenhaus. Vor den Lichtensteinschen Geschäftsräumen stand ein junger Polizeidiener mit einer Lampe in der Hand. »Dürfte ich fragen, wer Sie sind?«
»Kommissar Beck, Kommissar Biddling!«, sagte Beck.
Durch die offen stehende Tür sah Richard ins Kontor. Aus Lichtensteins Schreibpult waren die Schubladen herausgerissen. Richard dachte daran, wie er am Dienstag vor einer Woche an diesem Pult den Kaufvertrag für Floras Klavier unterzeichnet hatte. Es kam ihm vor, als wäre es gestern gewesen. Von links waren undeutlich Stimmen zu hören.
»Wer ist da drin?«, fuhr Beck den Jungen an.
»Schutzmann Heinz«, antwortete er schüchtern. »Und Dr. Meder aus der Goethestraße. Und ein paar Leute aus dem Haus, glaube ich.«
»Ach? Halten die ein Kaffeekränzchen mit der Leiche ab? Wofür stehen Sie eigentlich hier herum?«
»Ich bitte höflichst um Verzeihung, Herr Kommissar, aber Schutzmann Heinz hat gesagt ...«
»Das klären wir später«, unterbrach Richard. Becks Gehabe ging ihm auf die Nerven. Obwohl er natürlich im Recht war. An einem Tatort hatten Zuschauer nichts verloren. Die Stimmen kamen aus dem vorletzten Lagerraum, einem fensterlosen Schlauch, vollgestellt mit Klavieren aller Art und durch Gaslicht notdürftig erleuchtet. Im Halbdunkel sah Richard sechs Männer miteinander diskutieren. Einer davon trug Uniform.
»Könnten Sie mir verraten, was Sie hier tun?«, fragte Beck.
Der Uniformierte salutierte. Er stellte sich als Schutzmann Heinz vor und erklärte, dass es sich bei den Männern um wichtige Zeugen handele, deren Verbleib vor Ort er bis zum Eintreffen der Kriminalbeamten verfügt habe.
»Mhm«, sagte Beck. »Ich sehe mir jetzt den Tatort an, und Kommissar Biddling wird Sie eingehend zur Sache befragen.«
Richard spürte, wie ihm das Blut zu Kopf stieg, aber er zwang sich, ruhig zu bleiben. Es war nicht der richtige Ort, Führungskompetenzen zu erörtern. Er sah Schutzmann Heinz an. »Gibt es im Haus einen Raum, in dem sich die Herren bis zur Befragung aufhalten können?«
»Ich wohne in der Dachetage«, sagte einer der Männer. Er stützte sich auf einen Stock, und seine Stimme zitterte vor Nervosität. »Wenn Sie nichts dagegen haben, könnten wir dort warten.«
»Einverstanden«, sagte Richard. »Herr Heinz – Sie begleiten die Männer in die Wohnung von Herrn ...?«
»Neander«, stellte sich der Mann vor.
»Dr. Meder?«, wandte sich Richard an einen korpulenten Mann, der eine Arzttasche in der Hand hielt. Er nickte. »Sie kommen bitte mit uns mit.« Kommissar Beck verzog das Gesicht, sagte aber nichts.
Die beiden Kriminalbeamten und der Arzt gingen in den vierten und größten Lagerraum. An den Wänden standen Klaviere und Flügel, dazwischen befand sich ein schmaler Gang. Durch das Fenster konnte Richard die Katharinenkirche sehen. Es kam so wenig Licht herein, dass man die Gasbeleuchtung eingeschaltet hatte, aber selbst das reichte nicht, um den gesamten Raum zu erhellen.
»Er liegt bei dem Flügel am Kamin«, sagte Dr. Meder. »Und ist entsetzlich zugerichtet.«
Richard ging voraus. Vor dem Bechsteinflügel, den Flora unbedingt hatte haben wollen, breitete sich eine Blutlache aus. Hermann Lichtenstein lag seitlich davon, die Füße übereinandergeschlagen, um den Hals ein Seil, das Gesicht abgewandt. Sein Hemd war zerrissen, die Hosentaschen waren nach außen gestülpt. Beck stellte die Lampe auf dem Flügel ab. Auf dem Holz schimmerte Blut. Einer der beiden Kerzenhalter war abgebrochen.
»Letzte Woche war er noch ganz«, sagte Richard.
Beck bückte sich und betrachtete einen kleinen Schlüssel und einen Uhrenkompass, die neben einem umgestürzten Klavierhocker lagen. Er sah Dr. Meder an. »Haben Sie die Lage der Leiche verändert?«
»Als man mich rief, stand noch nicht fest, dass Herr Lichtenstein tot war. Ich musste einige Untersuchungen vornehmen.«
»Welche?«
»Das Herz pulsierte nicht mehr, und die Augenprobe blieb erfolglos; mithin war der Tod eingetreten.«
Kommissar Beck deutete auf das zerrissene Hemd. »Waren Sie das?«
»Nein«, sagte Dr. Meder.
Richard sah an dem Toten vorbei zum Fenster. »Können Sie etwas über den Todeszeitpunkt sagen, Doktor?«
»Da die Leiche trotz des großen Blutverlusts noch warm war, als ich eintraf, ist es wahrscheinlich, dass der Tod erst kurz zuvor eintrat.«
»Was keinerlei Rückschluss auf den Tatzeitpunkt zulässt«, konstatierte Beck. Er zeigte auf den Kopf des Toten. »Es sei denn, Sie sagen mir, wie lange man mit solchen Verletzungen überleben kann.«
»Ich vermute, nicht sehr lange.«
»Und was heißt das in Stunden und Minuten ausgedrückt?«
Richard fuhr mit der Hand über die Augen. Er sah sich mit Lichtenstein die neuesten Gerüchte über den Russisch-Japanischen Krieg erörtern, während Victoria und Flora Instrumente anschauten.
»Die Lage wird immer verworrener. Selbst die russische Kriegsleitung in Port Arthur scheint nicht zu wissen, oder wenigstens tut sie so, wo die Japaner anzugreifen beabsichtigen.«
»Angeblich hat der Stellvertreter von Admiral Alexejew verlauten lassen, dass sie eine Landung in Tschingwantao vorbereiten.«
»Ich will das hier!«, sagte Flora.
»So genau kann ich mich nicht festlegen«, sagte Dr. Meder. »Aber Lichtensteins Auslaufer, Herr Schick behauptet, dass er nicht einmal eine Stunde lang weg war, und daher vermute ich ...«
»Das Schlussfolgern überlassen Sie mir«, schnitt ihm Beck das Wort ab. »Wie und wo hat die Leiche gelegen, als Sie eintrafen?«
Richard bemühte sich vergeblich, dem Gespräch zu folgen. Lichtenstein lächelte. »Das ist ein Bechsteinflügel, gnädiges Fräulein.«
»Na und?«
»Ein solches Instrument ist nicht eben billig«, sagte er schmunzelnd.
»Ich möchte ihn trotzdem haben«, sagte Flora.
»Von einem Flügel war nicht die Rede«, bemerkte Richard.
»Aber Großpapa hätte bestimmt nichts dagegen.«
»Wir sollten ihn zumindest vorher fragen, Liebes«, sagte Victoria.
»Du bekommst ein Klavier oder gar nichts!«, bestimmte Richard.