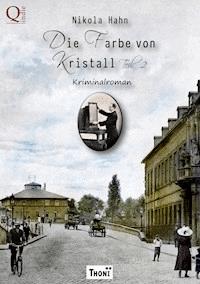4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thoni-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Klaus Winterfeldt ist seit zwanzig Jahren glücklich mit Krankenschwester Hedi verheiratet, Vater von zwei wohlgeratenen Kindern und der Meinung, dass einen altgedienten Großstadtpolizisten wie ihn so schnell nichts aus der Bahn werfen kann. Doch als sich seine Frau mit der ausgeflippten Künstlerin Vivienne Belrot zusammentut, um eine baufällige Wassermühle im Odenwald zu restaurieren, verwandeln sich seine Kinder plötzlich in Rebellen und Hedi wirft ihren Job hin und fordert die Scheidung. Als wäre das nicht genug, verdonnert ihn sein Chef, mit der jungen Polizistin Dagmar Streife zu fahren, die gerade ihre Ausbildung beendet hat und alles besser weiß. Während der Streifenbeamte Klaus, souverän und mit Gleichmut, pöbelnde Taxifahrerinnen und ausländerhassende Ausländer besänftigt, Unfälle aufnimmt und Gespenster aus Wohnstuben alter Damen vertreibt, gerät das Leben des Ehemanns und Vaters Winterfeldt immer mehr aus den Fugen. Um seine Ehe zu retten, will er beweisen, dass Vivienne Belrot eine Betrügerin ist. Doch je mehr Indizien er seiner Frau präsentiert, desto abweisender reagiert sie. Klaus ahnt nicht, dass sich hinter der Fassade der erfolgreichen Malerin eine tragische Geschichte verbirgt, die mit Hedis Kindheit und der alten Mühle verknüpft ist. Und dass nicht nur seine Frau, sondern auch seine junge Kollegin ihm gewisse Dinge verschwiegen haben. Als Klaus endlich merkt, welchen Fehler er gemacht hat, geht es für ihn um Leben und Tod … // aus: Lesart, Unabhängiges Journal für Literatur: "Was wäre nicht alles zu tun gewesen: den Müll vier Etagen hinunter tragen, ein paar Blusen bügeln, die Treppe putzen. aber da war dieses verflixte Buch "Die Wassermühle", dessen Lektüre so schwer zu unterbrechen ist. Kann eine Frau durch die Lektüre gar kurzzeitig zur "Rabenmutter" werden? Vor diesem Buch sei also gewarnt, sollten Sie Vergnügen an der Lebensnähe eines Romangeschehens haben."// --- Einladung zu einer Reise in die Literatur und Kunst.--- Wenn Sie gerne wissen möchten, wie und warum die Brüder Grimm, Monet und seine Seerosen, Wilhelm Busch, Goethe & Co in Nikola Hahns heiteren Roman hineinfanden, können Sie die Antworten auf einer literarischen Reise im Anhang des eBooks entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nikola Hahn
Die Wassermühle
Roman
Vers. 3/2016
überarb., u. erw. Ausgabe mit illustr. Literaturglossar 2013
Die Erstausgabe des Romans erschien 2000 bei Econ Ullstein List; 7. unveränderte Aufl. 2008 im Ullstein Taschenbuch
Unter dem Titel Die Wassermühle und ein Polizistenleben liegt die Neuausgabe auch als Schmuckausgabe im Paperback und Hardcover vor.
© für die Neuausgabe: Thoni Verlag 2013-2016
www.thoni-verlag.com
Titelgestaltung unter Verwendung eines Fotos von
Martina Berg: Alte Ölmühle in Lemgo-Brake
Satz u. Layout: N. Hahn
ISBN 978-3-944177-02-1
Ein Qindie-Buch im Thoni Verlag
Das Qindie-Siegel steht für Qualität & Unabhängigkeit.
Weitere Informationen im Internet: qindie.de
* zum Buch * zur Autorin * Hinweis:
Die Bilder können in Lesegeräten mit der »Lupenfunktion« vergrößert werden. Für eine optimale Darstellung der Bildeffekte wählen Sie bitte die Hintergrundfarbe »Papier« oder weiß.
Die Wassermühleist ein Roman. Geschichte und handelnde Personen sind frei erfunden. Warum die Details dem einen oder anderen trotzdem bekannt vorkommen könnten? Die Wassermühlespielt eben mitten im Leben.
Wenn dich die Frauen hassen,
musst du ohne Abendessen schlafen gehen.
Sprichwort aus Tunesien
Als Künstler male ich nicht, um ein Heilmittel zu finden,
sondern, um meinen eigenen Wahnsinn zu verstehen.
Reginald Herard, Wahl-Offenbacher
Denn das Naturell der Frauen
ist so nah mit Kunst verwandt.
Goethe, Faust
Kapitel 1
„Das Ei ist hart.“
Es gab Dinge, auf die Hedi Winterfeldt allergisch reagierte. Der Satz: Das Ei ist hartstand auf dieser Liste oben. Vor allem montagmorgens kurz vor halb sieben. Sie verteilte Honig auf ihrem Toast. „Koch dir’s demnächst selber!“
Klaus Winterfeldt grinste. „Es kann nicht allzu schwer sein, den Messbecher bis zum richtigen Strich zu füllen, oder?“
„Es kann auch nicht allzu schwer sein, die schmutzige Wäsche in den Wäschekorb zu werfen, statt sie nach dem Zufallsprinzip im Schlafzimmer zu verteilen!“, sagte Hedi. Sie war beim Aufstehen auf die Gürtelschnalle getreten, die Klaus samt Hose hatte fallen lassen, wo er sie ausgezogen hatte: gestern Abend vor ihrem Bett.
Klaus fuhr sich durch sein Haar und schlug die Offenbach-Post auf. „Ich glaube, es ist ungefähr so schwer wie die Geschirrspülmaschine richtig einzuräumen.“
„Womit wir beim Thema wären.“ Die Spülmaschine kam gleich nach dem Ei.
Klaus ließ die Zeitung sinken und zwinkerte Hedi zu. „An irgendwas muss es liegen, dass bei dir immer nur die Hälfte sauber wird, Schatz.“
Hedi zählte stumm bis drei und biss in ihren Toast. Eigentlich war Klaus ein unkomplizierter Mann mit Hang zu häuslichem Chaos. Wenn es jedoch um weichgekochte Eier, perfekt eingeräumte Spülmaschinen oder das sachgerechte Zusammenfalten leerer Milchtüten ging, konnte er pedantisch werden.
„Mojn. Wo sind die Brötchen?“
Ungekämmt und mit offenen Schuhen schlurfte der sechzehnjährige Sascha ins Esszimmer. Er ließ sich auf einen der beiden noch freien Stühle fallen, schob seine langen Beine unter den Tisch und gähnte. Ein Blick in die Gesichter seiner Eltern sagte ihm, dass es heute besser wäre, sich mit Toastbrot zufriedenzugeben.
„Hast du deinem Vater die Mathearbeit gezeigt?“, fragte Hedi.
Klaus blätterte zum Sportteil. Sascha schüttelte den Kopf. Er fuhr durch sein verstrubbeltes Haar und griff nach dem Glas mit Nuss-Nougat-Creme. Nicht zum ersten Mal fiel Hedi auf, wie sehr sich Vater und Sohn in Gestik und Aussehen ähnelten. Leider öfter auch im Benehmen.
„Er hat eine Fünf geschrieben“, sagte sie.
„Mhm. Das muss besser werden, mein Sohn. So ein Mist! Die Kickers haben schon wieder verloren!“
Sascha grinste. Hedi stellte ihre Tasse scheppernd auf den Unterteller zurück. „Also, das ist ja ...!“
Klaus faltete die Zeitung zusammen und stand auf. „Ich muss los.“
Die vierzehnjährige Dominique tappte herein. Sie ging an Klaus vorbei und lümmelte sich auf den Stuhl neben ihrem Bruder. Sie sagte nicht guten Morgen, denn sie war der Meinung, dass an einem Morgen um diese Uhrzeit nichts Gutes sein konnte.
„Du wirst dir in dem Fetzen den Tod holen!“, sagte Hedi mit Blick auf das bauchnabelfreie T-Shirt ihrer Tochter.
„Besonders hübsch sieht es auch nicht aus“, bemerkte Klaus.
Lässig warf Dominique ihre kastanienbraune Mähne über die Schultern. „Paps, du hast keine Ahnung.“
„Zieh wenigstens eine gescheite Jacke drüber, ja?“, sagte Klaus.
Hedi stellte ihren und Klaus’ Frühstücksteller zusammen. Klaus küsste sie auf die Wange. „Tschüss, Schatz. Ich liebe dich auch mit Backstein im Magen.“
„Sehr witzig!“
Hedi brachte das Geschirr in die Küche. Sie hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel und schaute zur Uhr. Zwanzig vor sieben. Klaus war spät dran. Zum Glück lag seine Dienststelle, das Vierte Polizeirevier, nur zehn Gehminuten entfernt. Das war einer der Gründe gewesen, warum sie vor sechzehn Jahren in eine Wohnung mitten in der Stadt gezogen waren, die nicht einmal einen Balkon hatte. Hedi nahm das fertige Toastbrot aus dem Röster und ging ins Esszimmer zurück.
Dominique schraubte am Nuss-Nougat-Glas. „Scheiße! Leer. Mama, hast du zufällig ...?“
„Dir bleibt die Wahl zwischen Kirschkonfitüre und Johannisbeergelee.“
Angewidert betrachtete Dominique die beiden mit Cellophan verschlossenen handbeschrifteten Gläser neben dem Brotkorb. „Ich hab keinen Bock auf Juliettes Zuckerpampe.“
„Dann iss den Toast eben trocken!“ Hedi warf das Brot in den Korb und lief hinaus.
Dominique schüttelte den Kopf. „Hab ich zufällig irgendwas verpasst heute Morgen?“
„Du hättest dich etwas diplomatischer ausdrücken können“, nuschelte Sascha mit vollem Mund. „Du solltest langsam wissen, dass sie keinen Spaß versteht, wenn’s um Tante Juliette geht.“
„Ich auch nicht!“, erwiderte Dominique trotzig.
Tante Juliette war Hedis letzte lebende Verwandte; sie wohnte in einer alten Wassermühle im Odenwald und versorgte die Winterfeldts regelmäßig mit eingekochtem Obst und Gemüse aus ihrem großen Garten. Zu Weihnachten strickte sie bunte Socken und verschenkte Kisten voller wurmstichiger Äpfel, die Klaus und die Kinder bis zum Frühjahr in diversen Offenbacher Abfallkörben entsorgten.
Sascha schob sich den Rest seines dick bestrichenen Toasts in den Mund. Dominique sah ihn böse an. „Das nächste Mal lässt du mir gefälligst was übrig!“
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben eben, Schwesterherz.“
„Doofbacke!“, sagte Dominique und streckte ihm die Zunge heraus.
* * *
Es gab Tage, an denen Hedi beim morgendlichen Blick in den Badspiegel lächeln konnte. An solchen Tagen stieg sie pfeifend über Gürtelschnallen, kochte weiche Frühstückseier und nahm Dominiques Nörgeleien als Ausdruck der seelischen Not einer pubertierenden Vierzehnjährigen hin. Es waren Tage, an denen sie den Teppichboden im Wohnzimmer eigentlich noch ganz gut in Schuss, die daraufstehenden Möbel irgendwie gemütlich und die verblassten Abziehbildchen auf den Badezimmerfliesen rührend fand. Heute war kein solcher Tag. Sie stopfte ihre Baumwollbluse in die Jeans, verteilte einen Klecks Creme in ihrem Gesicht und ärgerte sich über die offene Zahnpastatube und den Kamm, der sich in ihrem Haar verhakte.
Ihr letzter Friseurbesuch war lange her. Sie hatte sich zu einer garantiert haarschonenden Dauerwelle überreden lassen und seitdem das Gefühl, dass sich auf ihrem Kopf ein verfilzter Handfeger breitmachte. Sie warf den Kamm in die unterste Schublade des Badezimmerschranks, kramte nach Haarnadeln und steckte ihre störrischen Locken zusammen. Sie zupfte den Pony ins Gesicht und entdeckte zwei silberne Fäden zwischen den dunklen Strähnen, die sie mit einem energischen Ruck herausriss.
Es klopfte kurz, und Dominique kam herein. „Ich muss aufs Klo.“
Hedi warf einen letzten Blick in den Spiegel und ging hinaus. Dominique verriegelte die Tür.
Aus dem Wohnzimmer drangen Schreie; Schüsse fielen, und es wurde still. Sascha saß auf der Couch und sah zu, wie Arnold Schwarzenegger über zwei Leichen stieg.
„Herrgott! Kannst du die Kiste nicht wenigstens morgens auslassen?“, sagte Hedi gereizt.
„Sorry, aber Axel will seinen Film zurück.“
„Axel?“
„Einer aus meiner Klasse.“
Hedi griff nach der DVD-Hülle und schüttelte den Kopf. Unglaublich, was heutzutage für Sechzehnjährige freigegeben wurde. „Räumt den Tisch ab, bevor ihr geht.“
„Mhm“, sagte Sascha mit verklärtem Blick auf Schwarzeneggers Bizeps.
Die abgetretenen Holzstufen in dem alten Mietshaus knarrten, als Hedi vom dritten Stock nach unten ging. In der zweiten Etage war alles ruhig, in der ersten schrie das Baby der türkischen Familie. Im Erdgeschoss war wieder einmal die Beleuchtung defekt. Manchmal kam Hedi der Gedanke, dass neue Fenster, einige Eimer Farbe für Fassade und Treppenhaus und eine Fuhre Erde und Pflanzen genügen würden, um aus dem unansehnlichen Gebäude aus der vorletzten Jahrhundertwende samt dem trostlosen Hinterhof ein hübsches Haus zu machen, in dem es sich passabel wohnen ließ. Als sie durch die Hofeinfahrt auf die Straße trat, wehte ihr nieselnder Oktoberregen ins Gesicht. Das fahle Licht der Straßenlaternen färbte die Bäume grau, auf den Autodächern klebte welkes Laub. Der Gehweg war mit Mülltonnen zugestellt. Über den Häusern blinkten die Positionslichter einer Boeing im Landeanflug auf den nahen Rhein-Main-Flughafen; der Lärm war erbärmlich.
Hedi kämpfte mit ihrem störrischen Regenschirm, der sich nicht öffnen ließ. Zu Fuß schaffte sie den Weg von ihrer Wohnung bis zum Schwesternzimmer in der Chirurgischen Klinik III des Stadtkrankenhauses in zwölfeinhalb Minuten. Mit dem Rad war sie sieben Minuten schneller, vorausgesetzt, es war noch da, wenn sie es brauchte. Und das kam in einem Achtfamilienhaus ohne abschließbaren Fahrradkeller einem Vabanquespiel gleich. Sie hatte es nacheinander mit einem teuren und einem billigen Modell versucht. Das billige hatte sie zwei Tage länger gehabt als das teure und sich dann fürs Laufen entschieden.
Seit Jahren nahm sie denselben Weg über die Luisenstraße und die Hohe Straße in den Starkenburgring. Sie begann keinen Arbeitstag, ohne dem Pfauenhaus und der Lächelnden Frau im Vorbeigehen einen guten Tag gewünscht zu haben. Hedi hatte nur wenige Marotten. Das Pfauenhaus und die Lächelnde Frauwaren zwei davon.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass nicht nur Klaus heute spät dran war. Sie beschleunigte ihre Schritte, lief die Luisenstraße entlang am Amtsgericht vorbei und passierte kurz darauf die Nummer fünf: An Sommertagen leuchtete das Haus golden, der frühmorgendliche Oktoberregen machte es grau; die beiden Pfauen kümmerte das nicht.
„Warum hat man sie wohl radschlagend auf zwei Bäume gemeißelt?“
„Wetten, dass ich es schneller herausbekomme als du?“
Klaus und sie waren sehr verliebt gewesen, als sie die filigran gearbeitete Jugendstilfassade zum ersten Mal betrachtet hatten. Das Geheimnis der steinernen Pfauen hatten sie nie gelöst.
Hedi nickte kurz in Richtung des Hauses, ging am Bahnhof vorbei durch die Unterführung und bog in die von Bäumen gesäumte Hohe Straße ein. Regenschwarz lag die Skulptur auf ihrem Steinsockel und strich sich das Haar aus dem Gesicht. Hedi glaubte fest daran, dass es Tage gab, an denen sie ihr zulächelte. Heute war es zu dunkel dazu.
Eine Minute nach Dienstbeginn erreichte sie den Haupteingang des Krankenhauses. Das Gebäude, in dem ihre Station lag, befand sich im hinteren Bereich des Geländes: ein mit Waschbetonplatten verkleidetes Hochhaus, das seine Farbe selbst in der grellsten Sommersonne nicht wechselte; es war und blieb grau.
Die verschwenderische Blütenfülle, die den Fahrweg zum Haus am vergangenen Freitag noch in ein buntes Band gefasst hatte, war zu bräunlichem Matsch zerfroren. Im Eingang standen zwei junge Frauen und rauchten. Vor der Patientenaufnahme im Erdgeschoss saß ein Mann mit einem weinenden Kind. Zusammen mit den ersten Besuchern wartete Hedi auf den Aufzug. Nach zwei Minuten entschied sie sich für die Treppe.
Die Nachtschwester stand schon auf dem Gang. Sie trug einen schwarzen Mantel über ihrem weißen Kittel und sah müde aus. „Gott, Hedi! Wo bleibst du so lange?“
„Tut mir leid, Inge. Ich ...“
„Schon gut. Ich will nur raus aus diesem Irrenhaus!“
„Wieso? Was war denn?“
„Der übliche Stress halt.“ Inge deutete aufs Schwesternzimmer. „Ich habe euch frischen Kaffee aufgesetzt.“
„Ist Brigitte noch nicht da?“
„Belinda auch nicht.“ Inge lächelte. „Du solltest deine Kolleginnen zu etwas mehr Pünktlichkeit erziehen statt ihnen nachzueifern, Hedwig Ernestine.“ Sie drehte sich um und ging in Richtung Aufzug davon.
Hedi warf ihr einen wütenden Blick hinterher. Sie hasste es, mit ihrem vollen Namen angesprochen zu werden, selbst wenn es im Scherz geschah. Als ob es nicht gereicht hätte, eine geborene Klammbiel zu sein, hatte ihre Mutter sie mit zwei Vornamen einer altmodischen Kitschromanschriftstellerin gestraft. Eine Woche nach Marianne Klammbiels Tod hatte Hedi einhundertfünfundneunzig Courths-Mahler-Romane in Kisten verpackt und in die Müllverbrennung gefahren. Danach hatte sie sich besser gefühlt.
Sie ging ins Schwesternzimmer. Der frisch aufgebrühte Kaffee konnte die schalen Gerüche einer durchwachten Nacht nicht überdecken. Hedi leerte den überquellenden Aschenbecher aus, der auf dem schmucklosen Tisch in der Mitte des Raums stand, und öffnete das Fenster. Im Nebenzimmer tauschte sie ihre Stiefel und die Jeans gegen Birkenstock-Sandalen und eine weiße Hose; über ihre Bluse zog sie einen weißen Kittel.
Sie hatte sich gerade eine Tasse Kaffee eingeschenkt, als Brigitte hereinkam. Sie warf ihre nasse Jacke auf den erstbesten Stuhl und zupfte ihre rostrote Igelfrisur in Form. „Tut mir leid, aber ...“
Hedi grinste. „Deine Tochter kam mal wieder nicht in die Pötte.“
„Nö. Diesmal war’s die Müllabfuhr.“
Seit ihr zweiter Mann mit einer Jüngeren durchgebrannt war, versuchte sich Brigitte in der Rolle der berufstätigen Mutter mit Schulkind. Ihre Depressionen versteckte sie hinter Galgenhumor. Sie holte eine Tasse aus dem Schrank, kippte aufs Geratewohl Zucker hinein und füllte sie bis zum Rand mit Kaffee. „Der Schlaumeier vor mir machte den Motor aus, schlug eine Zeitung auf und fragte grinsend, warum ich mich wegen der paar Minuten so anstelle. Es gibt Tage, da sollte man im Bett bleiben. Wo ist eigentlich Belinda?“
Hedi strich sich eine Ponysträhne aus dem Gesicht. „Vermutlich ebenda.“
Belinda war die Jüngste im Team und dafür bekannt, dass sie in regelmäßigen Abständen von mysteriösen Leiden heimgesucht wurde, die sie mindestens eine Woche lang ans Krankenlager fesselten.
Die Tür ging auf, und eine etwa siebzigjährige Frau humpelte herein. Ihr struppiges Haar stand nach allen Seiten ab, ihr von Runzeln durchzogenes Gesicht war rot angelaufen. „Die halten mich hier fest! Das ist Freiheitsberaubung!“
„Könnten Sie bitte etwas leiser sein? Sie wecken das ganze Haus auf“, sagte Hedi.
„Hilfe, Hilfe! So helfen Sie mir doch!“
„Verdammt noch mal! Ruhe jetzt!“
Die Frau hörte auf zu schreien. Sie sah Hedi an und fing an zu weinen. Gemeinsam mit Brigitte brachte Hedi sie zurück in ihr Zimmer.
Zehn Minuten später rief Belinda an. Sie hustete Hedi ins Ohr. „Ich fühle mich furchtbar!“
Hedi warf Brigitte einen vielsagenden Blick zu. „Wie lange, Belinda?“
„Der Arzt sagt, ich hätte mir da eine ganz hartnäckige Sache eingefangen. Acht Tage bin ich auf jeden Fall krankgeschrieben. Es tut mir ja so leid.“
„Ich bin gerührt, Belinda. Gute Besserung.“ Verächtlich ließ Hedi den Hörer auf den Apparat fallen.
„Sie fängt dieses Jahr mit den Weihnachtsvorbereitungen früher an als sonst“, sagte Brigitte.
„Wir haben Ende Oktober!“
„Vielleicht hat sie ein paar Kalenderblätter zuviel abgerissen?“
„Kaum juckt unserer Belinda der kleine Zeh, feiert sie drei Tage krank, und wir können sehen, wo wir bleiben!“
„Ihre Abwesenheit fällt doch sowieso nur dadurch auf, dass der Kaffee länger reicht.“
Hedi rang sich ein Lächeln ab. „Entschuldige. Aber ich musste mich heute schon beim Frühstück ärgern.“
„Lass dich scheiden, und du bist alle Sorgen los“, sagte Brigitte ironisch.
Hedi trank ihren Kaffee aus. „Manchmal träume ich davon, auf eine Südseeinsel auszuwandern.“
Die Klingel von Zimmer fünfhundertvier schrillte. Hedi stellte die leere Tasse in die Spüle und ging nachsehen. Die alte Dame hatte ihr Haar gekämmt und lächelte. „Hätten Sie vielleicht eine Tasse Tee für mich, Schwester? Haben Sie schlecht geschlafen? Sie sehen müde aus.“
* * *
Als Hedi am frühen Nachmittag mit mehreren Einkaufstüten bepackt nach Hause kam, dröhnte ihr im Treppenaufgang ein dumpfes Bumm-Bumm entgegen. Die Türkin aus dem ersten Stock putzte die Treppe; sie lächelte scheu, als Hedi ihr im Vorbeigehen einen guten Tag wünschte.
Im zweiten Stock wartete Rosa Ecklig. Sie stemmte ihre Arme in die Hüfte. „Sorgen Sie auf der Stelle dafür, dass dieser Krach aufhört! Sonst rufe ich die Polizei!“
„Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie sich damit noch ein wenig gedulden würden, Frau Ecklig“, sagte Hedi freundlich.
Rosa Ecklig straffte ihre mageren Schultern. „Sie sollten sich wirklich mehr um Ihre Kinder kümmern, Frau Winterfeldt! Ich werde Jochen morgen sagen ...“
„Einen schönen Tag noch.“ Hedi schluckte ihren Zorn hinunter und ging an ihr vorbei nach oben. Warum mussten sie auch ausgerechnet über der Schwippschwägerin von Klaus’ Vorgesetztem wohnen? Und wann kapierte Dominique endlich, dass von eins bis drei Mittagsruhe zu herrschen hatte! Hedi stellte die Tüten ab und kramte nach dem Wohnungsschlüssel. Ein Glück, dass wenigstens die Brancatellis von nebenan lärmfest waren. Jedenfalls hatten sie sich noch nie beschwert. Hedi schleppte die Tüten in den Flur und ging in Dominiques Zimmer.
Ihre Tochter lag auf dem Bett und blätterte in einem Modejournal. Von der Wand hinter ihr lächelte ein schwarzhaariger Jüngling in Lebensgröße. Hedi fand, der Kerl sah aus wie weichgespült. Sie zog den Stecker der Stereoanlage heraus. Dominique fuhr hoch. „Mama! Du kannst doch nicht einfach ...“
„Das nächste Mal verscherbele ich das Ding auf dem Flohmarkt! Ist das klar?“
„Den Song muss man aber laut hören! Sonst törnt’s echt null an.“
„Pass auf, dass mich nicht gleich was echt null antörnt!“
Dominique schlug die Zeitschrift zu und rollte sich schmollend zur Wand.
In der Küche sah es zum Fürchten aus. Auf der Anrichte lag eine angeknabberte Pizza in einer fettigen Pappschachtel; daneben eine zerknüllte Chipstüte, hartgewordene Toastbrotscheiben und der nasse Kaffeefilter. Der Tisch im Esszimmer war nicht abgeräumt. An Tante Juliettes Kirschkonfitüre klebte Eidotter. Sascha hockte mit Kopfhörern auf dem Sofa und sah zu, wie Claude van Damme über eine Leiche stieg.
Hedi nahm die Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus. „Könnt ihr nicht einmal den Saustall hier aufräumen?“
Sascha setzte die Kopfhörer ab. „Dominique hat in der Küche rumgefuhrwerkt. Soll sie auch saubermachen.“ Er griff nach seiner Jacke und stand auf. „Ich hab ein Date mit Corinna. Tschüss.“
„Wer ist Corinna?“
Statt einer Antwort knallte die Wohnungstür.
Hedi ließ sich auf die Couch fallen und fragte sich, wann sie den entscheidenden Fehler gemacht hatte. Und warum sie es nicht fertigbrachte, ordentlich auf den Tisch zu hauen. Oder einfach ohne Ankündigung für vier Wochen in Urlaub zu fahren. Sie drückte auf die Fernbedienung.
„Du Arschloch! Du hast’n doch solang’ angebaggert, bisser mit dir in die Kiste gesprungen is!“, schrie eine grell geschminkte Frau in zu kurzem Rock.
„Das musst du grad sagen, du Schlampe!“, schrie eine noch greller geschminkte Frau zurück. In ihrer oberen Zahnreihe klaffte eine Lücke. „Du hast’s doch bloß nur auf dem seine Knete abgesehn!“
„Weißt du, was du bist? Du bist doch die allerletzte ...“ Es folgte ein Piepton. „Genau das biste, und sonst nix!“
„Aber Frau Schäfer“, sagte die Moderatorin milde lächelnd. „Wollen wir nicht lieber versuchen, eine Lösung für Ihr Problem zu finden, anstatt uns gegenseitig zu beschimpfen?“
Hedi schüttelte den Kopf und schaltete um.
„Du bist doch viel zu schade für den Typen! Guck dir den doch mal an! Macht den Dicken und hat noch nix geschafft in seinem ganzen Leben!“
Hedi schaltete um.
„Wann kapierst du’s endlich? Du bist hässlich! Du bist fett! Du ödest mich an!“
„Aber wir haben doch ... Ich dachte doch ...“ Der Rest ging in Tränen unter.
Hedi schaltete den Fernseher aus und wünschte sich, für mindestens ein Jahr mit der Lächelnden Frau zu tauschen.
Kapitel 2
Das Vierte Polizeirevier der Stadt Offenbach war ein schmuckloser Nachkriegsbau, von dem blassgrüne Farbe abblätterte. In der Toilette neben dem Spindraum im Obergeschoss zeugten schwarze Flecken von den vergeblichen Bemühungen, dem undichten Flachdach mit einem Eimer Teer beizukommen.
Weil sich Landesregierung und Kommunalpolitiker nicht einigen konnten, ob eine Stadt mit mehr als einhundertzwanzigtausend Einwohnern drei oder vier Polizeireviere benötigte, wurde die Aufnahme des Vierten Reviers in das Modernisierungsprogramm von Jahr zu Jahr verschoben. Immerhin hatte es mit der Einführung der EDV ein paar neue Schreibtische gegeben.
Dienstgruppenleiter Michael Stamm saß hinter dem Wachtisch und sah Fernschreiben durch, als Klaus um fünf vor sieben in Uniform hereinkam.
„Kissel will dich sprechen“, sagte er. „Scheint dringend zu sein. Er war schon zweimal hier und hat gefragt, wo du bist.“
Klaus verdrehte die Augen. „Was Erbaulicheres hast du mir um diese Uhrzeit nicht anzubieten, Chef?“
Michael grinste. „Um acht tritt unsere neue Kollegin ihren Dienst an.“
„Wenn sie es mit dem Kinderkriegen so eilig hat wie ihre Vorgängerin, haben wir nicht lange Freude an ihr.“ Klaus verließ den Wachraum. Er ging durch den schummrigen Flur zum Büro des Dienststellenleiters und klopfte.
„Herein!“, rief eine herrische Stimme.
Der Erste Polizeihauptkommissar Jochen Kissel saß aufgerichtet hinter seinem fast leeren Schreibtisch. Sein Büro war das größte im Haus und das einzige, das während der vergangenen Jahre frische Farbe gesehen hatte. Die Neonröhren an der Decke verbreiteten ein ungemütliches Licht. Kissel war seit zweiundvierzig Jahren bei der Polizei, seit mehr als siebzehn Jahren Leiter des Vierten Reviers und spätestens seit seinem zwanzigjährigen Dienstjubiläum figurlich außer Form geraten. Er galt als Choleriker. Unter den Schichtdienstbeamten kursierte die Wette, dass eher die Hölle gefröre, als dass Kissel mit einem freundlichen Morgengruß die Wache betrat.
Er warf Klaus einen strengen Blick zu. „In Ihrem Bericht vom Donnerstag sind Rechtschreibfehler, Winterfeldt!“
„Mhm“, sagte Klaus. Es war zwecklos, seinem Vorgesetzten zu erklären, dass das nachts um halb vier schon mal vorkommen konnte.
Kissel zog die oberste Schublade seines Schreibtischs auf und holte drei Blätter heraus. „Ich dulde keine Schlampereien! Sie schreiben das noch mal! Verstanden?“
Klaus nickte, nahm den Bericht entgegen und verließ das Büro. Er überflog die einzelnen Seiten, zerriss sie und warf die Schnipsel in den Altpapiersack, der neben der Ladekiste im Flur stand.
„Na? Was war es diesmal?“, fragte Michael, als Klaus in die Wache zurückkam.
„Zweimal Denn ohne Doppel-n. Unser Dienststellenleiter hält meinen Festnahmebericht vom Donnerstag deshalb für verbesserungsbedürftig.“
„Das darf doch nicht wahr sein! Ich habe den Kollegen vom Einbruch vor einer halben Minute Stein und Bein geschworen, dass das Ding seit Freitagmorgen in der Post ist.“
Klaus zuckte mit den Schultern. „Demnächst unterschreibe ich mit Müller.“
„Das tust du doch ohnehin schon“, sagte Michael grinsend. Es war allgemein bekannt, dass Klaus seinem Streifenpartner Uli Müller regelmäßig schriftliche Arbeiten abnahm, die Kissels Schreibtisch anstandslos passierten.
Dass Klaus Winterfeldt bei Dienststellenleiter Kissel einen schweren Stand hatte, lag nicht nur an der regelmäßigen Berichterstattung von Rosa Ecklig, sondern auch an einer sechzehn Jahre zurückliegenden Begegnung im Spindraum. Klaus war neu auf dem Revier, und niemand hatte ihn über hausinterne Gepflogenheiten aufgeklärt. Über Notruf wurde eine Schlägerei gemeldet. Klaus rannte die Treppe hinauf, stieß die Tür zum Spindraum auf und knipste das Licht an. Auf dem Bett, das den Beamten nachts zum Ruhen diente, waren Dienststellenleiter Kissel und eine junge Blondine zugange.
„Was suchen Sie hier?“, schrie Kissel.
„Äh ... ich wollte meinen Knüppel runter holen“, sagte Klaus verdattert.
„Wollen Sie mich verarschen?“
„Wenn Sie bitte entschuldigen? Wir müssen zu einer Schlägerei, und ich habe meinen ... na ja, Polizeistock hier vergessen.“
Kissel zog das Uniformhemd über seine Blöße. „Raus, Winterfeldt! Auf der Stelle!“
Noch Wochen danach begegneten alle Angehörigen des Vierten Polizeireviers ihrem Chef mit einem Lächeln, und die dienstlichen Beurteilungen des Streifenpolizisten Winterfeldt hatten lange Zeit nicht für eine Beförderung ausgereicht.
Wenn Klaus von Kissel absah, fand er seinen beruflichen Alltag im Großen und Ganzen in Ordnung. Es gab Höhen und Tiefen und mit den Jahren fiel ihm der Wechseldienst schwerer, aber er war gern auf der Straße. Die Vorstellung, in einem stickigen Büro im Polizeipräsidium tagein, tagaus über Akten zu brüten, jagte ihm einen Schauer über den Rücken.
In jungen Jahren hatte er sich trotzdem breitschlagen lassen, eine Bewerbung zur Kriminalpolizei abzugeben. Er musste imaginäre Würfel falten, rechnen, rechtschreiben und schlecht kopierten Politikerfotos die richtigen Namen zuordnen. Was das mit Kriminalistik zu tun hatte, begriff er bis heute nicht. Zuletzt wurde sein Denkvermögen geprüft. Kreuzen Sie an, ob eine Schlussfolgerung logisch ist, die aus zwei vorausgegangenen Sätzen gezogen wird.
Die ersten Sätze lauteten: Alle Affen sind Äpfel. Alle Äpfel können fliegen. Also können alle Affen fliegen.
Klaus zog die Schlussfolgerung, auf eine Karriere bei der Kripo zu verzichten. Er nahm einen Nebenjob bei der Firma Tachnon an und ging nach Dienstende Heizungsröhrchen ablesen. Das machten andere Kollegen auch. Es brachte ein Zusatzeinkommen, das er sparte, um seiner Familie eines Tages ein Haus kaufen zu können. Diesen Traum träumte er, seit er verheiratet war.
Um Viertel nach acht beorderte Dienststellenleiter Kissel die Beamten der D-Schicht in den Sozialraum. Zwei Minuten später kam er mit einer sehr schlanken, schwarzhaarigen jungen Frau herein. Sofort hefteten sich alle Blicke auf sie. Sie zupfte verlegen an ihrer Uniform und sah an den Beamten vorbei zur Wand.
Kissel wartete, bis alle Geräusche im Raum verstummt waren. „Meine Herren! Ich darf Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass Frau Polizeikommissarin Dagmar Streibel ab heute in Ihrer Dienstgruppe Dienst versehen wird. Ganz besonders freut es mich, dass es gelungen ist, die seit Längerem vakante Stelle von Kollegin Schmidt wieder mit einer jungen Dame besetzen zu können.“
„Blablabla“, raunte Klaus seinem Streifenpartner Uli ins Ohr.
„Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, meine Herren, geht mein Bestreben dahin, in allen Dienstgruppen mindestens eine weibliche Beamtin zu haben. Im Gegensatz zu so manchem Gestrigen in unseren Reihen bin ich nämlich durchaus der Meinung, dass Frauen für die Polizei eine Bereicherung darstellen. In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen verraten, dass unsere junge Kollegin das Fachhochschulstudium als Jahrgangsbeste abgeschlossen hat. Der eine oder andere von Ihnen wird also einiges von ihr lernen können, was rechtstheoretische Fragen angeht.“
Kommissarin Streibel bekam einen roten Kopf.
Klaus fand, dass sie aussah wie achtzehn. Da sie mit ihrer Ausbildung fertig war, musste sie jedoch mindestens zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig sein. Die Ärmel ihres Uniformhemds waren zu lang, die Manschetten über ihre schmalen Handgelenke gerutscht. Die flotte Kurzhaarfrisur passte nicht zu ihrem unsicheren Auftreten. Klaus fragte sich, welcher Teufel sie geritten hatte, zur Polizei zu gehen.
Jochen Kissel reichte ihr die Hand. „Ich darf mich vorerst von Ihnen verabschieden?“ Er wies auf Michael. „Der Dienstgruppenleiter der Dienstgruppe Dora, Herr Stamm, wird sich um Sie kümmern und Ihnen einen kompetenten Beamten zur Seite stellen, der Sie in die Dienstgeschäfte einweisen wird. Sollten Sie darüber hinaus irgendwelche Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, zu mir kommen. Ich werde stets ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte haben.“ Er lächelte ihr zu und verließ den Raum.
Michael Stamm stand auf. „Am besten kommst du erst mal mit mir auf die Wache, und wir erledigen den ganzen Papierkram.“
Dagmar Streibel nickte erleichtert. Sie gingen hinaus.
„Ich werde stets ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte haben“, äffte ein junger Polizist Kissel nach. „Ich möchte wissen, warum die Sesselfurzer um die Weiber immer so ein Geschiss machen! Zu mir hat er vor einem Jahr gesagt: Da ist die Wache! Den Rest erklärt Ihnen der Dienstgruppenleiter.“
„Vielleicht hättest du dich sorgfältiger schminken sollen, Stampe!“, sagte ein solariumgebräunter Beamter in Klaus’ Alter.
Alle lachten.
„Du musst gerade dein Maul aufreißen, Hans-Jürgen“, sagte Stampe gereizt. „Wo du im Umkreis von zehn Kilometern keinem Rock widerstehen kannst!“
„Die Kleine ist ein bisschen zu dünn für meinen Geschmack“, sagte Hans-Jürgen süffisant. „Aber einen knackigen Hintern hat sie.“
„Ganz im Gegensatz zu dir“, konterte Stampe und hatte die Lacher auf seiner Seite.
„Zeit für eine Streife, oder?“, sagte Klaus zu Uli.
„Seid ihr gar nicht neugierig, wem Michael unsere weibliche Beamtin zuteilt?“, fragte Stampe.
Hans-Jürgen grinste. „Da unser Herr Kissel etwas von einem kompetenten Beamten erzählt hat, wird es Kollege Winterfeldt kaum treffen.“
Klaus zog es vor zu schweigen.
„Ich bin tatsächlich gespannt, mit wem sie fährt“, sagte Uli im Flur.
Klaus zuckte mit den Schultern. „Das ist mir so egal wie der berühmte Sack Reis in China. Solange Michael nicht auf die Idee kommt, dich als Bärenführer zu reaktivieren.“
Uli lachte. Viele Jahre lang hatte er junge Beamte ausgebildet, die in die Dienstgruppe versetzt wurden. Mit ihm zusammen hatte Klaus seinen ersten Unfall aufgenommen, seine erste Verfolgungsjagd absolviert und seinen ersten Wohnungseinbrecher festgenommen; nur das Berichteschreiben hatte er sich von anderen abgeschaut. Seit Michael Stamm Dienstgruppenleiter war, gab es keine festen Ausbilder mehr. Klaus war nicht böse darum. Er und Uli bildeten ein eingeschworenes Team. Wenn es sich einrichten ließ, nahmen sie sogar zur gleichen Zeit Urlaub.
„Ich gehe davon aus, dass sie erst einmal irgendwo als Dritte mitfährt“, sagte Uli.
„Hoffentlich nicht bei uns“, erwiderte Klaus.
„Hast du Kollegin Schmidt immer noch nicht verziehen?“
„Meine Arbeitsfreude leidet beträchtlich, wenn ich nicht mal mehr ungestraft einen harmlosen Witz erzählen darf!“
„Ich kann mich nicht erinnern, dass deine Witze jemals harmlos gewesen wären, Kollege“, sagte Uli grinsend. „Außerdem hat’s schon der alte Goethe gewusst: Mit Frauen soll man sich nie unterstehen zu scherzen.“
„Apropos ... Kennst du den Unterschied zwischen einer Blondine und einem Hohlblock?“
„Wieso? Gibt’s da einen?“
Lachend betraten sie die Wache. Michael Stamm war dabei, Dagmar Streibel den Funktisch zu erklären. Uli ging zu seinem Aktenfach und zog einen Stapel Papier heraus. Klaus trug eine Präventivstreife in die Statistik ein.
Dienststellenleiter Kissel kam herein. Sein Gesicht war rot. Er baute sich vor dem Wachtisch auf. „Wer hat zuletzt den Hundewagen gefahren?“
„Warum?“, fragte Michael.
Kissel warf ihm den Zündschlüssel zu. „Das Blaulicht ist defekt! Ich will, dass das heute noch repariert wird! Klar?“
Michael betrachtete interessiert den Schlüssel in seiner Hand. „Das Blaulicht ist defekt? Wie gibt’s denn so was?“
Klaus griff zu einem x-beliebigen Fahrtenbuch und studierte angestrengt die vormonatliche Benzinabrechnung.
„Jedesmal, wenn ich die Bremse betätige, blinkt es!“,rief Kissel. „Und das Martinshorn heult auch los!“
Michael schüttelte den Kopf. „Müller wird den Wagen unverzüglich in die Werkstatt fahren, Herr Kissel.“ Er sah Uli an, der in einer Akte las. „Hast du gehört? Der Hundewagen muss in die Werkstatt.“
Uli schaute von der Akte auf. „Wird sofort erledigt, Chef.“
„Das will ich hoffen!“, sagte Kissel und verschwand.
„Warum war Herr Kissel denn so wütend?“, fragte Dagmar. „Es kann doch niemand etwas dafür, wenn ...“
Michael sah Uli an. „Was hast du mit dem Streifenwagen angestellt?“
„Nichts, Chef.“
„Und warum grinst du dann so blöd?“
„Die Vorstellung, dass unser Dienststellenleiter bei seiner Ordnungsstreife Schweißausbrüche bekommen hat, gefällt mir.“
„Was denn für eine Ordnungsstreife?“, fragte Dagmar.
„Der liebe Herr Kissel bekommt so wenig Gehalt, dass er sein Leben in einer Landesbedienstetenwohnung zum Sozialhilfetarif an der Offenbacher Peripherie fristen muss“, sagte Uli sarkastisch. „Als Ausgleich leistet er einen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitslage, indem er regelmäßig allen falsch geparkten Fahrzeugen seiner Nachbarn Strafzettel verpasst.“
„Übertreib’s nicht! Irgendwann merkt auch ein Jochen Kissel, dass die Anzahl seiner Missgeschicke mit den Dienstzeiten der D-Schicht korreliert“, sagte Michael.
Das Telefon klingelte. Michael meldete sich. „Herr Wachtmeister, nu hawwe se mir schon dreimol des Audo uffgebroche! Unn stelle Sie sich vor, heut moje komm ich runner, unn es is scho widder uffgebroche! Wos kann ich do mache?“, fragte eine alkoholisierte männliche Stimme.
„Sie können Anzeige erstatten.“
„Awwer ich hab doch scho dreimol Aazeich erstattet, unn des hatt nix genützt!“ Michael hatte den Hörer kaum aufgelegt, als es wieder klingelte.
„Mein Nachbar lackiert sein Auto im Vorgarten!“, sagte eine weibliche Stimme.
„Na und?“, fragte Michael.
„Ich fühle mich belästigt!“
„Dann gehen Sie hin und sagen ihm, dass er aufhören soll.“
„Ich bin doch gar nicht zuständig für so was!“
„Entschuldigen Sie bitte, aber ...“
„Wofür zahlen wir eigentlich Steuern?“, rief die Frau wütend und legte auf.
Uli nahm den Schlüssel des Hundewagens vom Wachtisch. „Was dagegen, wenn ich mit Klaus Präventivstreife fahre?“
„Vorher müsstet ihr in der Groß-Hasenbach-Straße vorbeischauen. Frau Westhoff hat Besuch.“
„O Gott“, sagte Klaus. „Nicht schon wieder.“
Michael grinste. „Ich habe ihr versprochen, die Special Agents vorbeizuschicken, sobald sie abkömmlich sind. Los, los, die Dame wartet!“ Er sah Dagmar an. „Wenn du willst, kannst du mitfahren.“
„Gern“, sagte Dagmar. „Ich muss nur schnell meine Waffe aus dem Schließfach holen.“
Klaus verdrehte die Augen. Genauso hatte er sich das vorgestellt!
„Ich bin Uli, und der mürrische Kollege zu meiner Rechten heißt Klaus“, sagte Uli, als sie in den Garagenhof gingen.
„Dagmar“, sagte Dagmar. Sie sah Uli an. „Sag mal, warst du das wirklich?“
„Was denn?“
„Na, das mit dem Hundewagen! Wie hast du das hingekriegt?“
Uli zuckte die Schultern. „Manchmal schlägt das Schicksal eben die Richtigen.“
„Hast du keinen Schiss, dass Herr Kissel dich erwischt?“
„Ich bin Edeka-Beamter.“
„Wie bitte?“
„Ende der Karriere“, sagte Klaus.
Uli fuhr den Streifenwagen aus der Garage, öffnete die Motorhaube und machte sich an diversen Kabeln zu schaffen. Dagmar stieg auf der Beifahrerseite ein. Klaus nahm wohl oder übel auf dem Rücksitz Platz.
„Was ist denn das für ein Besuch, den diese Frau Westhoff hat?“, fragte Dagmar, als sie vom Hof fuhren.
„Ziemlich unangenehme Sache“, sagte Uli.
„Gefährlich?“
„Mhm.“
„Könntest du bitte etwas konkreter werden?“
„Angst brauchst du keine zu haben“, sagte Klaus.
„Ich habe keine Angst! Ich möchte lediglich über den Sachverhalt informiert werden, damit ich eine Lagebeurteilung vornehmen und mögliche Einsatzvarianten prüfen kann.“
„Soso“, sagte Uli. Im Innenspiegel sah Klaus sein Grinsen. Er bog in die Geleitsstraße, dann in die Groß-Hasenbach-Straße ein.
„Macht ihr euch etwa lustig über mich?“, fragte Dagmar pikiert.
Uli zog die Augenbrauen hoch. „Nichts liegt mir ferner, Kollegin.“ Vor einem heruntergekommenen Mehrfamilienhaus hielt er an. „Für den Besuch von Frau Westhoff gibt es nur eine Einsatzvariante.“
„Und die wäre?“
„Augen zu und durch“, sagte Klaus, nahm das Handfunkgerät und stieg aus.
Maria Westhoff wohnte in einer Zweizimmerwohnung unterm Dach. Sie war eine grauhaarige Dame und trug ein elegantes Kostüm. Ihr faltiges Gesicht war dezent geschminkt; ihre geschwollenen Füße steckten in Filzpantoffeln. „Bin ich froh, dass Sie endlich da sind“, flüsterte sie. „Sie sind zurückgekommen.“
„Alle?“, fragte Uli.
„Alle!“ Sie sah Dagmar an. „Wer sind Sie, bitte?“
„Frau Kommissarin Streibel wird die Sache überwachen“, sagte Uli.
„Sie sind eine richtige Kommissarin? Wie die im Fernsehen? Aber warum haben Sie dann eine Uniform an?“
„Weil ich keine Kriminalkommissarin, sondern eine Polizeikommissarin bin“, sagte Dagmar.
Maria Westhoff wandte sich an Uli. „Heißt das etwa, dass die ganzen Kommissare vom Tatort gar nicht von der Polizei sind?“
„Doch, doch“, beruhigte er sie. „Aber sollten wir uns nicht um Ihre Gäste kümmern?“
Maria Westhoff sah ängstlich zur geschlossenen Wohnzimmertür. „Diesmal sind sie durchs Dach gekommen.“
„Mhm“, sagte Uli. „Haben Sie das Werkzeug parat?“
Maria Westhoff nickte und verschwand in der Küche.
„Könnt ihr mir verraten, was das hier werden soll?“, fragte Dagmar ungehalten.
Uli legte einen Zeigefinger auf den Mund.
Maria Westhoff kam mit einer Blechschüssel und einem Kochlöffel zurück. „Geht es auch damit?“, fragte sie leise. „Die Töpfe sind nicht gespült.“
Uli nahm die Schüssel und den Löffel und betrachtete beides eingehend von allen Seiten. Er sah Klaus an. „Was meinst du, Kollege?“
„Ich denke schon“, sagte Klaus.
„Also gut. Wenn ich sie zusammengetrieben habe, gibst du den Eliminationsbefehl!“
Klaus nahm das Funkgerät aus seinem Anorak. Uli schlich zur Wohnzimmertür, öffnete sie einen Spalt und fing an, mit dem Löffel im Dreivierteltakt auf die Schüssel zu schlagen. Maria Westhoff hielt sich jammernd die Ohren zu.
„Jetzt!“, rief Uli.
Klaus hantierte am Funkgerät und zählte laut bis zehn. Uli ging ins Wohnzimmer und stellte das Fenster auf Kippe.
Maria Westhoff strahlte. „Sie sind weg! Alle weg!“
Uli gab ihr die Schüssel und den Kochlöffel zurück. Klaus steckte das Funkgerät ein. „Vergessen Sie nicht, das Fenster nach genau zwölf Minuten wieder zu schließen“, sagte er.
Maria Westhoff nickte eifrig. „Ihre Männer sind wirklich unschlagbar, Frau Kommissarin!“, sagte sie zu Dagmar.
Dagmar bekam einen roten Kopf. Klaus hatte Mühe, sich das Lachen zu verbeißen. Maria Westhoff begleitete sie zur Tür und verabschiedete sie mit einem überschwänglichen Dankeschön.
„Wenn ihr es lustig findet, alte Menschen auf den Arm zu nehmen, ist das eure Sache. Ich mache da jedenfalls nicht mit!“, sagte Dagmar, als sie die Treppe hinuntergingen.
„Wie hättest du den Fall gelöst?“, fragte Uli.
„Wir müssen die zuständigen Stellen informieren. Die Frau ist krank. Sie braucht Hilfe!“
„Die zuständigen Stellen haben festgestellt, dass weder Fremd- noch Eigengefährdung vorliegt“, sagte Klaus.
„Abgesehen davon, dass sie ein- bis zweimal pro Monat strahlenverseuchte Geister durch Wände und Decken kommen sieht, ist sie völlig normal“, sagte Uli.
„Einer unserer harmlosen Fälle“, bemerkte Klaus.
„Es ist trotzdem nicht richtig, sie derart an der Nase herumzuführen“, beharrte Dagmar, als sie weiterfuhren.
„Du darfst ihr beim nächsten Mal gerne erläutern, dass in ihrem Wohnzimmer keine Gespenster herumsitzen, Frau Kommissarin“, sagte Klaus amüsiert.
Dagmar drehte sich zu ihm um. Alle Unsicherheit war aus ihrem Gesicht verschwunden. „Genau das werde ich tun, Kollege! Außerdem möchte ich klarstellen, dass ich mir meinen Dienstgrad nicht ausgesucht habe. Und dass ich Herrn Kissels Ansprache genauso daneben fand wie ihr. Es wäre deshalb nett, wenn ihr euch eure Anspielungen ab sofort sparen würdet.“
„Eins zu null für dich“, sagte Uli lachend.
Die Frisur steht ihr, dachte Klaus.
Kapitel 3
Als Klaus nach Hause kam, hatte Hedi die Wohnung wieder in einen menschenwürdigen Zustand gebracht. Sie stand im Wohnzimmer und bügelte Wäsche. Im Fernsehen lief eine Wiederholung der Lindenstraße.
Klaus nahm die Zeitung vom Sideboard. „Hallo, Schatz! Ich war noch bei Ralf.“
Ralf war geschieden und arbeitslos, wohnte seit ewigen Zeiten im ersten Stock und schimpfte abwechselnd über die Kinder seiner türkischen Nachbarn und die bosnischen Nichtsnutze aus dem Erdgeschoss. Schon kurz nach ihrem Einzug hatte sich Klaus mit ihm angefreundet und vergeblich darauf gehofft, dass sich die beiden Frauen ebenfalls gut verstehen würden. Mit Ralfs Scheidung hatte sich das Thema glücklicherweise erledigt. Hedi legte ein T-Shirt zusammen. „Du hattest um Viertel vor eins Dienstschluss. Jetzt ist es halb sechs.“
Klaus setzte sich aufs Sofa und schlug die Zeitung auf. „Entschuldige. Wir haben nicht auf die Uhr gesehen.“
„Das tut ihr nie, bevor das Bier alle ist.“
„Ist noch was zu essen da?“
Hedi zog ein Uniformhemd aus dem Korb. Sie hasste Bügeln. Es kam gleich nach Bettenbeziehen und Badputzen. Sie hatte es zu delegieren versucht, aber die Tipps aus der Annabella waren gescheitert. Ihre Familie konnte über Körbe voller zerknitterter Kleidungsstücke steigen und in zahnpastaverklebte Waschbecken schauen, ohne negative Empfindungen zu haben.
„Sag mal, hörst du mir zu?“
Hedi ließ beinahe das Bügeleisen fallen. „Wie?“
„Ich wüsste gern, ob ich etwas zu essen bekomme.“
„Deine Kinder haben es vorgezogen, sich von Chips und Pizza zu ernähren. Der Rest steht im Kühlschrank.“
„Von den Chips?“
„Von der Pizza!“
Klaus legte die Zeitung weg und stand auf. „Warum bist du so gereizt?“
„Das fragst du noch?“
Lächelnd nahm er ihr das Bügeleisen ab und stellte es auf die Ablage. Er fasste ihre Hände. „Ich habe eine ganze Stunde Zeit bis zum Nachtdienst.“
Hedi machte sich los. „Ich nicht.“
Er küsste sie auf die Nase. „Es gibt Dinge, die wichtiger sind als Bügeln, hm? Und mehr Spaß machen sie auch.“
„Ach ja? Wer beschwert sich denn ständig, dass er keine frischen Hemden mehr im Schrank hat!“
Klaus sah sie zerknirscht an. „Ich geb’s ja zu, dass ich für diese Art von hausfraulicher Tätigkeit hoffnungslos unbegabt bin. Aber dafür trage ich ab und zu den Müll runter und kümmere mich um den Wagen.“
„Du liebe Zeit! Das bisschen Tanken und Ölwechseln könnte ich auch noch übernehmen.“
Klaus grinste. „Sofort, wenn du willst. Zur Belohnung darfst du eine Woche lang harte Frühstückseier kochen.“
Früher hätte Hedi ihm lachend in die Seite geboxt. Nach einer kleinen Verfolgungsjagd durchs Wohnzimmer hätte er sie ins Schlafzimmer getragen und später die Wäsche zusammengelegt, dass es ein Graus war. Sie griff zum Bügeleisen. Klaus ging zum Sofa zurück.
„Dann halt nicht.“
„Was erwartest du? Dass ich vor Freude in die Luft springe, weil du fast fünf Stunden brauchst, um nach Hause zu kommen?“
„Es tut mir leid.“
Das Telefon klingelte. Hedi stellte das Bügeleisen beiseite und meldete sich. „Hallo Hedwig! Vivienne hier. Stell dir vor, ich wohne sozusagen in deiner Nachbarschaft! In Frankfurt mit Blick auf den Main. Ist das nicht fantastisch?“
„Mit wem spreche ich, bitte?“, fragte Hedi.
„Hedwig Ernestine, verheiratete Winterfeldt!“, kam es empört aus dem Hörer. „Hast du vergessen, dass wir jahrelang im selben Klassenzimmer gehockt haben?“
„Vivienne Chantal Belrot?“, fragte Hedi ungläubig.
Vivienne lachte. „Ich bin gerade beim Aufräumen und fand den Zettel, den du mir auf unserem Jahrgangstreffen gegeben hast. Und da dachte ich, ruf doch einfach mal an.“
„Mhm“, sagte Hedi. Auf dem Klassentreffen vor fünf Jahren hatte sie mit Vivienne kaum zehn Sätze gewechselt, die Verabschiedung miteingerechnet. Ihr goldunterlegtes Visitenkärtchen hatte sie noch auf dem Weg zum Parkplatz weggeworfen. Warum hatte Vivienne es mit ihrem Zettel nicht genauso gemacht? Fünf Minuten später wusste sie, dass ihre ehemalige Klassenkameradin eine international anerkannte Künstlerin geworden war, interessante und wichtige Leute kannte und demnächst eine bedeutende Ausstellung haben würde.
„Und da hast du Zeit zum Telefonieren?“
„Ich möchte meine alte Freundin Hedwig an meinem Glück teilhaben lassen!“
Hedi konnte sich nicht erinnern, dass sie und Vivienne irgendwann Freundinnen gewesen waren. Das Klassentreffen war ihr dafür umso besser im Gedächtnis. In ein roséfarbenes Seidenkleid gehüllt, schwebte Vivienne in den Saal. Erste Falten, graue Haare, leicht aus der Fasson geratene Formen? Sie hatte damit keine Probleme, und sie wusste es zu demonstrieren. Hedi fühlte sich hässlich neben ihr. Plötzlich war die Saalbeleuchtung zu hell, das Buffet zu üppig, das Benehmen der männlichen Anwesenden kindisch und der Abend ein Reinfall.
„Übermorgen habe ich einen Termin frei“, sagte Vivienne. „Was hältst du von einem kleinen Kaffeeplausch bei Georgies?“
„Und wo wohnt der?“
„Sag bloß, du kennst das Georgies nicht? Der Szene-Treff in Frankfurt!“
„Ich lebe in Offenbach.“
Vivienne lachte. „Dann komm halt zum Dom. Ich nehme an, den finden auch Offenbacher. Um Viertel vor vier am Haupteingang?“
„Weißt du, eigentlich ...“
„Ich bin gespannt, was du mir alles zu erzählen hast! Also dann bis Mittwoch, ja?“
„Ja. Tschüss.“ Hedi legte auf. Warum sagte sie immer Ja, wenn sie Nein meinte! Sie ging zum Bügelbrett zurück. Klaus hatte sich den Pizzarest aus dem Kühlschrank geholt, und sie ärgerte sich, dass sie ein schlechtes Gewissen bekam, weil sie ihm nichts gekocht hatte.
„Wer war das denn?“, fragte er kauend.
„Eine Schulfreundin.“
„Es klang nicht so, als hättest du dich über ihren Anruf gefreut.“
Hedi nahm eine Bluse aus dem Korb. „Es gibt noch mehr Dinge, über die ich mich heute nicht gefreut habe!“
„Was wollte sie?“
„Sich mit mir treffen.“
„Warum?“
„Herrgott! Was weiß denn ich?“
„Es zwingt dich niemand, die Einladung anzunehmen, oder?“
„Genausowenig, wie dich jemand zwingt, im ersten Stock ständig nach links abzubiegen.“
„Ich habe gesagt, dass es mir leid tut. Könnten wir es dabei belassen?“
„Wie lange denn? Bis morgen?“
Klaus klappte die leere Pizzaschachtel zu und stand auf. „Ich muss zum Dienst. Mach’s gut.“ Er ging ohne Abschiedskuss.
Hedi hasste es, wenn er vor Auseinandersetzungen davonlief. Genauso, wie sie es hasste, in einem maroden Mietshaus zu wohnen, nur weil er jeden Cent für ein Eigenheim sparte, das sie sich doch nie würden leisten können. Und ganz besonders hasste sie es, dass er es nicht merkte, wenn sie einen schlechten Tag hatte!
Zwei Stunden später, der Mörder im Tatort war gerade dabei, sein Opfer umzubringen, klingelte das Telefon. Hedi hatte den Apparat in weiser Voraussicht in den Flur verbannt und es sich mit einer Dose Erdnüsse und einer flauschigen Decke auf der Couch bequem gemacht. Sie ließ es klingeln. Dominique steckte ihren Kopf zur Tür herein. „Oma Resi wünscht dich zu sprechen, Mama.“
Hedi verzog das Gesicht. „Ich bin nicht da.“
Dominique grinste. „Tja, das hättest du mir mal vorher sagen sollen. Aber ich bin nett und bringe sie dir.“
Mit einem unterdrückten Fluch stellte Hedi den Fernseher leise. Oma Resi war die Mutter von Klaus und hieß mit vollem Namen Therese Augusta Winterfeldt. Sie vertrat die Ansicht, dass eine Frau für den Haushalt und der Mann fürs Geldverdienen zuständig sei. Ihrer war vor vier Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Oma Resi lebte seitdem allein in ihrer Wiesbadener Fünfzimmerwohnung, ging montags zum Seniorenschwimmen, mittwochs zum Friseur und alle vierzehn Tage zur Kosmetikerin. Mindestens einmal pro Woche rief sie in Offenbach an, um ihren jüngsten Sohn zu fragen, warum ihm nichts Besseres eingefallen sei, als Polizist zu werden und eine Krankenschwester zu heiraten.
Dominique gab ihr das Telefon.
„Guten Abend, Schwiegermama“, sagte Hedi freundlich.
„Ist Klaus da?“
„Er hat Nachtdienst.“
„Heute Morgen sagte mir dein Sohn, dass er im Frühdienst ist!“
„Ich habe dir vorige Woche erklärt, dass die Polizei Frühdienst und Nachtdienst am selben Tag hat.“
„Willst du damit andeuten, dass ich dement werde?“
„Soll ich ihm etwas ausrichten?“
„Ich werde wohl selbst mit meinem Sohn sprechen dürfen!“
„Er ruft dich morgen zurück.“
„Morgen habe ich Gymnastikstunde.“
„Den ganzen Tag?“
„Nachmittags kommen meine Freundinnen zum Romméspielen.“
„Ich sage ihm, er soll abends anrufen.“
„Vormittags passt es besser.“
„Da schläft er.“
„Du lässt zu, dass dein Mann bis in die Puppen im Bett herumliegt?“
„Er hat Nachtdienst, Schwiegermama.“
„Ich melde mich. Auf Wiederhören!“ Es klang wie eine Drohung.
Hedi legte das Telefon weg und kuschelte sich in ihre Decke. Der Kommissar war auf dem Weg zum Tatort. Bevor er ankam, klingelte das Telefon. Es gab Tage, an denen Hedi ernsthaft darüber nachdachte, einfach zu verschwinden.
„Guten Abend, Hedwig“, meldete sich Hedis Schwägerin Anette. Sie lehnte es ab, Hedi zu sagen. Hedi fand sie albern. „Bitte entschuldige, dass ich dich so spät noch störe, aber ich bin in der Bredouille.“
Soviel Freundlichkeit konnte nur eins bedeuten. Willst du mal wieder deinen Sohn loswerden?“
„Ich bitte dich, Hedwig! Es ist bloß so, dass ich am Freitag zum Shopping nach New York fliege. Kann ich Christoph-Sebastian auf dem Weg zum Flughafen bei euch vorbeibringen?“
„Ich muss arbeiten.“
„Und Klaus?“
„Was ist mit deinem Mann?“
„Bernd ist auf einer Tagung in Wien.“
Dass Klaus sich von seinem Bruder zur Patenschaft für Christoph-Sebastian hatte überreden lassen, nahm Hedi ihm bis heute übel. Sie mochte weder Bernd noch Anette. Und Christoph-Sebastian war das ungezogenste Kind, das ihr je begegnet war.
„Christoph-Sebastian freut sich so sehr auf einen Besuch bei euch“, sagte Anette.
„Sicher. Es macht ja auch Spaß, den DVD-Player mit Butterkeksen zu füllen und unsere Wohnzimmermöbel grün anzustreichen.“
„Er hat es nicht böse gemeint. Außerdem hat Bernd alles bezahlt.“
„Du wolltest mich wegen Kindesmisshandlung anzeigen!“
„Wie konnte ich ahnen, dass Christoph-Sebastian sich so gekonnt in seinem Gesicht herummalt?“
„Wie konnte ich ahnen, dass dein Sohn, statt Zähne zu putzen, meine Kakteensammlung rasiert? Du musst dein Shopping verschieben. Klaus hat am Freitag Nachtdienst. Tschüss.“
„Nein, nein, es gibt nichts Neues“, sagte der Kommissar. „Wir drehen uns eigentlich nur im Kreis.“
„Warum soll es euch besser gehen als mir“, murmelte Hedi, schaltete den Fernseher aus und ging ins Bett.
Kapitel 4
Klaus war noch nicht von der Nachtschicht zurück, als Hedi am nächsten Morgen aus dem Haus ging. Früher hatte er angerufen, wenn es später wurde, und in ihrer Nachtdienstwoche war er regelmäßig mit Uli auf einen Kaffee im Krankenhaus vorbeigekommen. Jahrelang hatte Hedi sich Sorgen gemacht, wenn er nicht pünktlich heimkam. Längst hatte sie damit aufgehört.
Durch den Dunst über den Häusern schien der Mond; sein Licht reichte nicht, um Einzelheiten im Gesicht der Lächelnden Frau zu erkennen. Es war kalt. Aber der Tag versprach sonnig zu werden.
Nach der Morgenvisite wurde die alte Frau Beck von Zimmer fünfhundertvier entlassen. Tagelang hatte sie darauf gedrängt. Als anstelle ihrer Tochter ein Taxifahrer kam, um sie abzuholen, weinte sie und weigerte sich mitzugehen. Hedi versuchte vergeblich, sie zu trösten. Sie gab dem Taxifahrer einen Wink, draußen zu warten.
„Ihre Tochter ist berufstätig, Frau Beck, oder?“, fragte sie, als er das Zimmer verlassen hatte.
„Aber sie hat mir versprochen, mich heimzufahren!“
„Bestimmt hat sie so schnell nicht freibekommen. Eigentlich wären Sie ja auch erst morgen dran gewesen, hm?“
„Sie hat versprochen zu kommen!“, beharrte die alte Frau.
Hedi hatte die Angst vor der Einsamkeit zu oft in den Gesichtern ihrer Patienten gesehen, um sie nicht zu erkennen. „Haben Sie eine Telefonnummer, unter der ich Ihre Tochter erreichen kann?“
Frau Beck kramte in ihrer Manteltasche und gab Hedi einen verknitterten Zettel.
Der Taxifahrer wartete im Flur. Hedi bat ihn um zwei weitere Minuten Geduld. Als sie kurz darauf Frau Beck sagte, dass ihre Tochter mit den Kindern ganz bestimmt am frühen Nachmittag vorbeikomme, brach sie erneut in Tränen aus. Diesmal vor Freude. Hedi wunderte sich, wie einfach es war, einen Menschen glücklich zu machen. In solchen Momenten liebte sie ihren Beruf.
Das Bett in Zimmer fünfhundertvier blieb nicht lange unbelegt. Noch vor dem Schichtwechsel wurde eine Achtzigjährige mit einem Oberschenkelhalsbruch eingeliefert. Ihr zwei Jahre älterer Ehemann wich nicht von ihrer Seite.
In der Wohnung war es still, als Hedi mittags nach Hause kam. Sascha und Dominique waren noch in der Schule, Klaus schlief. Das Frühstücksgeschirr hatte er in die Spülmaschine geräumt, den Brotkorb und die leere Kaffeekanne auf die Anrichte gestellt. Hedi wischte ein paar verbliebene Krümel vom Tisch und öffnete das Fenster.
In dem Ahornbaum vor dem Haus sang eine Amsel. Ein buntbelaubter Zweig reichte bis zur Fensterbrüstung. Hedi riss ein Blatt ab; andere lösten sich und trudelten nach unten. Das Blatt in ihrer Hand roch nach Vergänglichkeit. Sie ließ es fallen. Schon als Kind hatte sie Sentimentalitäten verabscheut. Nur zu Weihnachten machte sie eine Ausnahme. Und in der alten Mühle bei Tante Juliette. Sie sah in den wolkenlosen Oktoberhimmel hinauf und bekam Sehnsucht.
Sie setzte Kaffee auf, ging ins Schlafzimmer, knipste das Licht an und musste lächeln. Klaus hatte das Kissen unter seinem Kopf zusammengeknüllt und das Federbett bis zum Kinn gezogen. Unten schauten seine nackten Füße heraus. Genauso hatte er dagelegen, als sie ihm nach der ersten gemeinsamen Nacht das Frühstück ans Bett brachte. Behutsam strich sie über sein dunkles Haar. Über der Stirn wurde es licht, an den Schläfen grau. Er sah blass aus. Sie küsste ihn wach. Er schlang die Arme um sie und zog sie aufs Bett.
„Hilfe!“, rief sie prustend. „Du erwürgst mich!“
„Ich liebe diese Art von Wecker.“
Hedi befreite sich lachend. „Ich habe Kaffee gekocht. Damit du fit wirst.“
„Das bin ich bereits“, sagte er fröhlich und griff nach ihrem Arm.
Hedi sprang auf und zog den Rollladen hoch. „Sieh zu, dass du unter die Dusche kommst, du Bettratte! Draußen scheint die Sonne.“
Klaus ließ sich seufzend ins Kissen zurückfallen. „Von wegen Bettratte! Wir hatten die ganze Nacht Stress. Außerdem habe ich eine viel bessere Idee: Du lässt den Rollladen wieder runter, und wir trinken den Kaffee im Bett.“ Er grinste. „Danach.“
Hedi öffnete das Fenster. Es ging in den Hof hinaus. Der Anblick des Hinterhauses war deprimierend. Die einzigen Farbflecke in der grauen Fassade waren blaue Plastiksäcke hinter den verwitterten Fenstern im oberen Stock. Aus der verbeulten Dachrinne hing ein Büschel vertrocknetes Gras. Von den Bewohnern des Hinterhauses wusste Hedi nur, dass sie jung waren und öfter wechselten. Den Hausbesitzer störte das nicht, solange sie die Miete pünktlich bezahlten.
Sie drehte sich zu Klaus um, der immer noch keine Anstalten machte aufzustehen. „Tante Juliette hat angerufen“, flunkerte sie. „Wir sind um vier Uhr zum Kaffee eingeladen.“ Sobald Klaus unter der Dusche war, würde sie mit ihr telefonieren. Sie war sicher, dass sie sich freuen würde.
„Das ist nicht dein Ernst!“
Klaus fuhr mit der gleichen Begeisterung zu Tante Juliette wie Hedi zu Bernd und Anette, aber sie fand, dass er ihr einen Gefallen schuldig war. Sie zog ihm die Decke weg.
„Los! Raus aus den Federn! So ein Wetter muss man ausnutzen!“
„Lass uns Kaffee trinken und anschließend ein bisschen spazierengehen. Aber bitte nicht im Odenwald, ja?“
„Juliette hat ...“
„Ruf sie an und sag ihr, wir besuchen sie ein anderes Mal.“
„Wenn du nicht mitkommst, fahre ich allein.“
„Hedi, bitte. Nach dem chaotischen Dienst heute Nacht verspüre ich nicht das geringste Verlangen, fast siebzig Kilometer durch die Weltgeschichte zu gurken.“
„Ich habe Juliette seit Monaten nicht mehr gesehen!“
Klaus stand auf. „Ich bin nicht in der Stimmung, mit dir zu streiten.“
„Und ich bin nicht in der Stimmung, ständig deine faulen Ausreden anzuhören, sobald ich meine Tante besuchen will. Also, was ist?“
„Lass es uns auf nächste Woche verschieben.“
„Nein.“ Hedi drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Sie nahm ihre Jacke von der Garderobe, steckte Portemonnaie und Autoschlüssel ein und verließ die Wohnung.
Als sie den Opel aus der Parklücke manövriert hatte, schaute sie zum dritten Stock hinauf. Die Wohnzimmergardine bewegte sich. Von Klaus war nichts zu sehen. Glücklich fühlte sie sich nicht.
Auf der Landstraße nach Hassbach kehrte ihre gute Laune zurück. Sie ließ das Seitenfenster herunter; der kühle Fahrtwind zerzauste ihr Haar. Es herrschte kaum Verkehr. Im Gegensatz zur Stadt machte ihr das Autofahren auf dem Land Spaß. Stoppelfelder wechselten mit gepflügten Äckern, auf denen Wintergetreide spross, dann führte die Straße durch einen Buchenwald. Buntes Laub verdeckte den Chausseerand.
Als Hedi aus dem Wald herauskam, sah sie auf einem Hügel die ersten Häuser von Hassbach: modern, großzügig, mit Gauben, Erkern und roten Dächern. Der alte Ortskern verbarg sich in der Senke dahinter: etwa zwei Dutzend Fachwerkhäuser, die sich um eine kleine Kirche drängten. Sie bog nach rechts ab und folgte der Straße bis zu dem verwitterten Holzschild mit der Aufschrift Zur Eichmühle. Der Weg war ungepflastert und voller Schlaglöcher; Steine knallten gegen das Wagenblech. Selbst wenn Klaus ohne Murren in den Odenwald fuhr: Spätestens hier fing er an zu fluchen. Im Gegensatz zu ihm war Hedi der Meinung, dass es bei einem Auto, das knapp zweihundertfünfzigtausend Kilometer auf dem Buckel hatte, auf einen Kratzer mehr oder weniger nicht mehr ankam.
Der Weg durchschnitt ein Eichenwäldchen; zwischen den Bäumen gluckerte der Mühlbach talwärts. Es roch nach feuchter Erde. Hedi lächelte. Wie viele Jahre vergangen waren, seit sie als Kind unter den hohen Bäumen ihre ersten Steinpilze gefunden hatte! Bis zu ihrem vierzehnten Geburtstag hatte sie fast alle Ferien in der Eichmühle verbracht und sich nichts Schöneres vorstellen können, als Bachkiesel zu sammeln, Kirschen aus Juliettes Garten zu naschen oder ihr Frühstücksei nestwarm aus dem Stall zu holen.
An das Wäldchen schlossen sich hügelige Wiesen an, und in ihrem Grund, von Obstbäumen umgeben, lag Juliettes Zuhause: zwei schindelgedeckte, im rechten Winkel zueinander stehende Fachwerkgebäude. Über dem größeren breitete sich die Krone einer alten Eiche aus, die der Mühle ihren Namen gegeben hatte.
Das Mühlhaus stammte aus dem siebzehnten Jahrhundert und war mehrfach umgebaut worden. Im rechten Teil wohnte Juliette, der linke war seit Jahrzehnten ungenutzt. Mahlwerk und Wasserrad standen schon still, als Hedi ihren ersten Sommer im Odenwald verlebte; auf dem verstaubten Balkenboden hatte sie Verstecken gespielt.
Etwa zweihundert Meter vor der Mühle kreuzten sich Bach und Straße. Zwischen Schlehensträuchern und Birken tauchte eine schmale Holzbrücke auf. Hedi schaltete zurück, und der Opel rumpelte über die verwitterten Bohlen. An Juliettes Garten vorbei fuhr sie in den Hof und parkte vor dem kleineren Gebäude, das gute hundertfünfzig Jahre jünger war als die Mühle und früher als Scheune, Stall und Geräteraum gedient hatte. Hedi erinnerte sich an zwei gescheckte Kühe, schwarze und weiße Kaninchen, schmutzige Schweine und an die Ziege Rosemarie. Geblieben waren die Kaninchen. Den Geräteraum nutzte Juliette seit Jahren als Unterstand für ihren ausrangierten alten Käfer.
Hedi ließ den Wagen offen und ging zum Mühlhaus. Efeu und wilder Wein wuchsen bis aufs Dach hinauf. Der rechte Klappladen vor Juliettes Schlafzimmerfenster hing schief. Die Bourbonrosen vor dem Haus waren gestutzt; in einem Steintrog neben der Haustür blühte Heidekraut. Der Wein färbte die Fassade rot. Wo die Blätter gefallen waren, zeigten sich rissige Balken und Gefache, aus denen Lehm bröckelte. Ein Mühlstein und ein Menschenherz / Wird stets herumgetrieben. / Wo beides nichts zu reiben hat, / Wird beides selbst zerrieben.
Der Hausspruch über der Tür war verblasst, aber Hedi kannte ihn auswendig. Sie war im Begriff zu klingeln, als sie das Hollandrad sah. Es stand gegen den efeubewachsenen Stamm der Eiche gelehnt. Das Prinzesschen war da! Am liebsten wäre sie auf der Stelle umgekehrt, aber dazu war es zu spät. Die Haustür ging auf.
„Hedi!Was für eine Überraschung!“ Juliettes von unzähligen Fältchen durchzogenes Gesicht zeigte überschwängliche Freude. Sie umarmte ihre Nichte und küsste sie auf beide Wangen.
„Hallo, Tante Juliette. Ich hatte heute überraschend Zeit, und da dachte ich ...“
„Gut gedacht, Kind! Du kommst genau richtig. Wir haben Apfelstrudel gemacht.“
„Du hast Besuch?“, fragte Hedi gespielt überrascht.
„Ja. Elli ist da.“ Juliette ging durch den schummrigen Flur voraus ins Wohnzimmer, Hedi folgte lustlos.
Das Letzte, was sie sich wünschte, war, den Nachmittag in Gesellschaft von Elli zu verbringen, die eigentlich Elisabeth Stöcker hieß und im Dorf früher Prinzesschen genannt worden war. Sie saß auf Juliettes zerschlissenem Sofa und grüßte freundlich. Hedi grüßte zurück und setzte sich ebenfalls. Der Tisch war für zwei Personen gedeckt. Neben dem Strudel stand ein Glaskrug mit Vanillesauce. Es duftete nach Äpfeln, Nüssen und Zimt. Juliette holte noch einen Teller und Besteck aus der Küche.
Elisabeth schnitt den Strudel auf. „Sie haben Glück. Eine halbe Stunde später, und wir hätten alles ratzeputz aufgegessen.“
Hedi betrachtete ihre schwieligen Hände, das rotwangige Gesicht, die altmodische Frisur: Elisabeth Stöcker war keine schöne Frau, aber auch nicht hässlich. Sie wirkte dick, aber sie war es nicht. Hedi kannte sie fast nur im Kittel, aber heute hatte sie ein dunkles schlichtes Kleid an. Sie war das Urbild einer Odenwälder Bäuerin. Nur die grünen Augen passten nicht. Aber selbst die rechtfertigten es in keiner Weise, sie Prinzesschen zu nennen. Schon damals nicht, als Hedi beschlossen hatte, die dazugehörige Person nicht zu mögen.
„Wir haben eine prächtige Tomatenernte gehabt“, sagte Juliette. „Du kannst dir nachher welche mitnehmen. Große gelbe, kleine gelbe, rotgrüngestreifte, orangefarbene, braune, violette, flaschenförmige ... Was du willst.“
Hedi sah Juliette an, als zweifelte sie an ihrem Verstand. Elisabeth lachte. „Ihre Tante hat historische Tomatensorten gepflanzt. Ein kleines Hobby von mir, und dieses Jahr konnte ich sie endlich überreden, mitzumachen. Wäre ja schade, wenn die schönen alten Sorten auf Nimmerwiedersehen verschwänden, nur weil die Saatgutkonzerne den Markt beherrschen.“
„Lila Kartoffeln und weiße Möhren baut Elli auch an. Du glaubst nicht, wie gut die schmecken!“
„Schön“, sagte Hedi. Wenn sie etwas garantiert nicht interessierte, waren es lila Kartoffeln und weiße Möhren.
„Wir haben vielleicht eine Idee, was wir mit der alten Gärtnerei anfangen könnten“, sagte Juliette.
Hedi goss Vanillesauce über ihren Strudel und probierte. Er schmeckte noch köstlicher als er roch. Aber nicht einmal das konnte ihre Laune heben. Das so selbstverständlich dahingesagte Wir ärgerte sie. Und die Zukunft der verfallenen Gewächshäuser jenseits der Streuobstwiese interessierte sie noch weniger als lila Kartoffeln. „So? Was denn?“
„Ellis Sohn hat Interesse, sie wiederzueröffnen“, sagte Juliette.
„Nun ja. Erst einmal muss er seine Lehre beenden“, sagte Elisabeth verlegen. „Und sich nach einem geeigneten Partner umsehen.“
„Ich würde mich freuen, wenn es klappt“, sagte Juliette. „Dann käme wieder ein bisschen Leben in die alte Mühle.“
Hedi sah sie erstaunt an. „Aber dir hat es doch nie etwas ausgemacht, allein zu leben.“
„Hedilein, ich werde alt. Und alte Leute fangen an, weiße Mäuse zu sehen.“ Sie zog eine Nadel aus ihrem Dutt und steckte eine störrische Locke fest. Ihr Haar war grau, solange Hedi denken konnte. Wenn sie es nach dem Waschen offen trug, fiel es bis zur Taille. Silbernes Wolkenhaar hatte Hedi als Kind gesagt und gehofft, dass ihre eigenen dünnen Zöpfchen eines Tages bis zu den Zehenspitzen wachsen würden. Die Courths-Mahler war schuld, dass es anders gekommen war.
„Wir haben auch schon daran gedacht, einen Teil der Mühle zu vermieten“, sagte Elisabeth. „Nur: Wer zieht freiwillig hier heraus?“
Hedi war es, als hätte ihr jemand einen Faustschlag versetzt. Tante Juliette war stark und fröhlich und klagte nie. Sie las keine Romane von Hedwig Courths-Mahler und war auch sonst das Gegenteil von Marianne Klammbiel. Deshalb liebte Hedi sie. Und hatte vergessen, dass sie sechsundachtzig war: sechzehn Jahre älter als Frau Beck, die sie am Morgen getröstet hatte, weil ihre Tochter nicht kam. „Warum hast du denn nicht angerufen, wenn es dir nicht gut ging?“
Juliette lachte. „Nun mach nicht so ein Gesicht, Hedilein! Elli hat bloß überlegt, wie man einer alten Schachtel wie mir ein bisschen Trubel ins Haus bringen könnte.“
„Juliette, du solltest ehrlich zu ihr sein.“ Elisabeth sah Hedi an. „Anfang August ist sie beim Hühnerfüttern gestürzt, und wenn ich nicht zufällig vorbeigekommen wäre ...“
Hedi wurde blass. „Warum weiß ich nichts davon?“
„Der Fuß ist wieder heil, und basta“, winkte Juliette ab. „Außerdem kommt die liebe Elli jeden Tag zufällig vorbei.“
„Ich brauche Abwechslung vom Dorftratsch“, sagte Elisabeth.
Juliette zwinkerte Hedi zu. „Der Dorftratsch ist so schlimm, dass sie mich kein Gras mehr für die Kaninchen mähen lässt, mir verbietet, den Hühnerstall auszumisten und den Hof zu kehren.“
Elisabeth grinste. „In Wahrheit komme ich nur, um deine Räucherkammer zu benutzen und Frühstückseier abzustauben.“