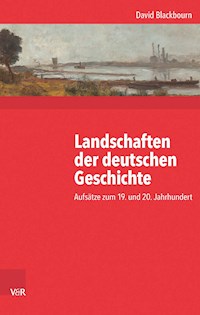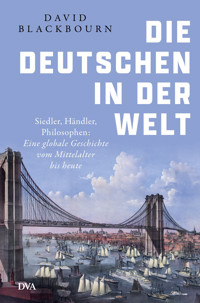
34,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie lebten Deutsche in Minnesota, in Südaustralien, in Liverpool oder im brasilianischen Rio Grande, wie prägten sie die dortige Kultur, zum Guten und zum Schlechten?
Wer deutsche Geschichte erzählt, bewegt sich zumeist in den Grenzen der Staatsnation, oder konzentriert sich auf die deutsche Gewaltherrschaft und Eroberungsgeschichte des 20. Jahrhundert mit ihren Folgen bis heute. David Blackbourn beweist mit seinem augenöffnenden Buch, wie kurz diese Perspektive greift. Er wählt einen globalen Ansatz und zeigt, wie seit rund fünfhundert Jahren Menschen, Güter, Erfahrungen und neue Ideen aus Deutschland in vielfältiger Weise mit der ganzen Welt verbunden waren. Blackbourn blickt nach Amerika und Asien, nach Afrika und ins restliche Europa, er erzählt Geschichten von Händlern und Missionarinnen, von Siedlern und Wissenschaftlerinnen, Entdeckern, Denkern und Söldnern. Ein überraschender, grandios erzählter neuer Blick auf Deutschland, der zeigt, dass man nicht nur eine Weltgeschichte der Spanier, der Franzosen oder der Engländer schreiben kann – sondern auch eine faszinierende deutsche Geschichte aus globaler Sicht.
Mit zahlreichen Abbildungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1695
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Wer deutsche Geschichte erzählt, bewegt sich zumeist in den Grenzen der Staatsnation oder konzentriert sich auf die deutsche Gewaltherrschaft und Eroberungsgeschichte des 20. Jahrhundert mit ihren Folgen bis heute. David Blackbourn wählt hingegen einen globalen Ansatz und zeigt, wie seit rund fünfhundert Jahren Menschen, Güter, Erfahrungen und neue Ideen aus Deutschland in vielfältiger Weise mit der ganzen Welt verbunden waren. Ein überraschender, grandios erzählter neuer Blick auf Deutschland, der zeigt, dass man nicht nur eine Weltgeschichte der Spanier, der Franzosen oder der Engländer schreiben kann – sondern auch eine faszinierende deutsche Geschichte aus globaler Sicht.
Autor
David Blackbourn, geboren 1949, ist Cornelius Vanderbilt Distinguished Chair of History Emeritus an der Vanderbilt University in Tennessee. Zuvor war er Coolidge Professor of History an der Harvard University und dort Leiter des Minda de Gunzburg Center for European Studies. Er ist einer der führenden Historiker, die sich mit der Entstehung des modernen Deutschlands beschäftigen. Sein zusammen mit Geoff Eley veröffentlichtes Buch Mythen deutscher Geschichtsschreibung (1980) entfachte eine Debatte um den deutschen »Sonderweg«. Blackbourns 2007 erschienene Studie Die Eroberung der Natur. Eine Geschichte der Deutschen Landschaft wurde von der Kritik begeistert aufgenommen.
DAVID BLACKBOURN
Die Deutschen in der Welt
Siedler, Händler, Philosophen: Eine globale Geschichte vom Mittelalter bis heute
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
DVA
Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2023 unter dem Titel Germany in the World. A Global History 1500 – 2000 bei Liveright Publishing Corporation, a division of W. W. Norton & Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 David Blackbourn
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: picture alliance / World History Archive
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28491-6V001
www.dva.de
Für Celia
Inhalt
Einleitung
Teil I Die Deutschen in einer sich wandelnden Welt
Kapitel 1 Neue Welten
Kapitel 2 Brände
Kapitel 3 Reiche
Teil II Deutschland und die Geburt der Moderne
Kapitel 4 Revolutionen
Kapitel 5 Wissen
Kapitel 6 Weltliteratur
Teil III Die Deutschen und die deutsche Nation in einer sich globalisierenden Welt
Kapitel 7 Eine Nation unter anderen
Kapitel 8 In Bewegung
Kapitel 9 Globaler Verkehr und der Anspruch der deutschen Kultur
Teil IV Das verdammte »Deutsche Jahrhundert«
Kapitel 10 Krieg, Republik, Drittes Reich
Kapitel 11 Das entscheidende Jahrzehnt
Kapitel 12 Die beantwortete deutsche Frage
Epilog
Dank
Abkürzungen
Anmerkungen
Personenregister
Sachregister
Bildnachweis
Einleitung
In Schlagzeilen ist ständig von Deutschlands Platz in der Welt die Rede: »Deutschland nimmt 1 Million syrische Flüchtlinge auf«, »Deutscher Axel-Springer-Verlag will Politico kaufen«, »Türkisch-deutscher Regisseur gewinnt Golden Globe« und – natürlich – »Deutschland macht sich für die Ukraine stark«. Nachdem Donald J. Trump zum US-Präsidenten gewählt worden war, wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel häufig als »Führerin der freien Welt« bezeichnet. Wenn man die Idee, dass Nationen »Marken« seien, so abscheulich sie ist, akzeptiert, dann befindet sich die Marke Deutschland auf einem Höhenflug. Auf dem Anholt Ipsons Nation Brands Index belegte es 2021 zum siebenten Mal hintereinander den ersten Platz.
Aber es gibt auch eine dunklere Seite, die sich ebenfalls in Schlagzeilen wiederfindet: »Deutschlands China-Problem« verweist auf ein Konfliktfeld, auf dem Handel, Geopolitik und Moral aufeinanderprallen, und »USA klagen sechs Personen an, während Volkswagen 4,3-Milliarden-Dollar-Vergleich zustimmt« bezieht sich auf einen Skandal um einen der deutschen Blue-Chip-Konzerne. Zudem hat Volkswagen als im Dritten Reich gegründetes Unternehmen eine befleckte Vergangenheit. Man liest regelmäßig von Beispielen dafür, wie die NS-Vergangenheit einen Schatten auf die Gegenwart wirft. »Deutschlands zweitreichster Klan entdeckt dunkle Nazivergangenheit«, erfuhr man 2019. Gemeint war die Familie Reimann, deren Milliarden heute aus dem Verkauf von Krispy-Kreme-Donuts, Jimmy-Choo-Schuhen und Calvin-Klein-Parfüm stammen. Aber es ist nur recht, darauf hinzuweisen, dass die Familie Reimann, wie vor ihr Volkswagen, Historiker beauftragt hat, zu erforschen, was ihre Vorfahren getan haben. Diese Bereitschaft ist ein erkennbares, ja prägendes Merkmal des heutigen Deutschlands, das von vielen als Musterbeispiel für Vergangenheitsbewältigung angeführt wird.
Mein Buch schaut aus globaler Perspektive auf Deutschland. Man stelle es sich als eine neue deutsche Geschichte für ein globales Zeitalter vor. Eine solche Geschichte wird dringend gebraucht. Neu ist sie insofern, als die vielfältigen Verbindungen zwischen den deutschsprachigen Ländern in Mitteleuropa und der weiten Welt im Mittelpunkt meiner Darstellung stehen und nicht nur am Rande behandelt werden. In diesem Buch geht es um die Bewegung von Menschen, Gütern und Ideen in den letzten fünf Jahrhunderten. Ich zeige, wie Deutsche, im Guten wie im Schlechten, als Akteure in der Welt aufgetreten sind, und untersuche, welche Auswirkungen dies im Innern hatte. Zugleich betrachte ich das Spiegelbild davon, die Nichtdeutschen, die in deutsche Lande kamen, um sie zu erobern oder dort zu arbeiten oder zu studieren, und die Kulturpraktiken, die sie mit sich brachten. Im Folgenden tritt ein buntes Tableau von Menschen auf: Händler und Missionare, Musiker und Bergbauingenieure, Studenten und Wissenschaftler, Entdecker und Soldaten, Auswanderer und Exilierte. Auch einige nichtmenschliche Geschöpfe spielen eine Rolle: Pflanzen und Tiere, absichtlich nach Deutschland gebrachte, die in botanischen oder zoologischen Gärten eine neue Heimat fanden, ebenso wie invasive und Epidemien verursachende Arten, die als blinde Passagiere ins Land kamen.
Über ein Buch wie das vorliegende nachgedacht habe ich das erste Mal zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Damals erschien die Idee, aus dem nationalen Rahmen herauszutreten, gewagter als heute, da das Wort »global« zum Klischee geworden ist und das Adjektiv »transnational« als akademischer Gemeinplatz in Förderanträge eingestreut wird, um sie aufzupeppen. Die frühen Verfechter einer übernationalen Geschichtsschreibung sahen sich als Herausforderer des Zeitgeists, dementsprechend scharf war ihre Sprache. Es war die Rede davon, »Geschichte vor der Nation zu retten«[1]. Zeitgenössische Ereignisse trugen sicherlich zu dieser Abwendung von einer eng national gefassten Geschichtsschreibung bei. Die Globalisierung unterstrich die Bedeutung grenzüberschreitender Bewegungen, Ströme, Austausche und Netzwerke – alles Begriffe, die für uns alltäglich geworden sind. Dazu können wir die gegenwärtige postkoloniale Abrechnung mit Reich und Rasse hinzufügen. Debatten über die Rückgabe von Museumsbeständen wie den Benin-Bronzen, einschließlich der nach Hunderten zählenden im Berliner Ethnologischen Museum, haben die Art und Weise, wie wir über europäische Geschichte nachdenken, ebenso beeinflusst wie die Tatsache, dass europäische Großstädte eine erhebliche Zahl nichtweißer Einwohner haben. Dass sie dort – oft an den Rand gedrängt und entfremdet – leben, ist eine Folge des Imperialismus. Diese Diskussionen haben die britische, französische und niederländische Geschichte in vielversprechende neue Kanäle gelenkt. Und Deutschland? Es besaß nur kurze Zeit ein Kolonialreich, von 1884 bis 1918, aber lange genug, um in Afrika zwei völkermörderische Kriege zu führen, die manche Historiker mit dem Holocaust in Zusammenhang gebracht haben.[2] Kolonien hatten zudem einen Platz in der deutschen Vorstellungswelt, und zwar lange bevor es sie in der Realität gab und lange nachdem sie verschwunden waren. Die koloniale Dimension der deutschen Geschichte verdient die Aufmerksamkeit, die sie jetzt erhält und die ihr in meinem Buch zuteilwird.
Als ich anfing, über dieses Buch nachzudenken, reagierte ich zum Teil auf Entwicklungen wie diese, denn alle Geschichte ist Gegenwartsgeschichte. Aber Geschichte folgt auch einem eigenen Rhythmus. Was mich wirklich dazu brachte, es zu schreiben, war die Frage, wie es wäre, eine Geschichte zu schreiben, welche die Nation nicht als selbstverständlichen Rahmen hinnähme. Ich war lange von der Idee fasziniert, »mit Maßstäben zu spielen«.[3] Wenn man mit stärkerer Vergrößerung auf einen Ort oder ein Ereignis schaut, entdeckt man Dinge, die vorher unsichtbar waren. Aber auch umgekehrt: Wenn man sehr große Prozesse in den Blick nimmt, werden bisher verborgene Muster erkennbar. Diese beiden Alternativen zum nationalen Rahmen, die Mikro- und die Makroperspektive, schließen einander nicht aus. »Das Weltweite schafft das Lokale nicht ab«, stellte der französische Philosoph Henri Lefebvre fest.[4] In diesem Buch treten die beiden Perspektiven häufig gemeinsam auf, gewissermaßen als die Version eines Historikers davon, was Geschäftsleute Globalisierung nennen.
Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Mich interessieren die Feinheiten des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, weil sie so vielsagend sind. Man denke etwa an das Quecksilber, das im 16. Jahrhundert in Spanien unter der Aufsicht eines deutschen Handelshauses gewonnen, auf Spezialschiffen über den Atlantik gebracht und auf Mauleseln die Bergpfade hinauf zu den Minen von Potosí transportiert wurde, wo man mit seiner Hilfe Silber aus Gestein löste. Das Silber wurde dann nach Europa verschifft, wo es den lokalen Handel befeuerte, oder es wurde auf »Manila-Galeonen« auf die Philippinen gebracht und verband so die europäischen, amerikanischen und asiatischen Handelsströme. Dieses Buch ist voller Waren – von Pfeffer und anderen Gewürzen über Diamanten und Perlen bis zu Kaffee, Zucker, Tabak und den übrigen »Kolonialwaren« des 19. Jahrhunderts und schließlich zu der Fülle von Autos, Waschmaschinen und sonstigen Produkten aus der Traumwelt der Reklame des 20. Jahrhunderts. Wenn man ihren Weg von ihrem Ursprungsort bis zum Ort des Konsums verfolgt, erfährt man viel über Status, Macht, Geschlecht und anderes, von Wissenschaft bis Mode. Auch die Abwehr von Waren ist vielsagend. Lange vor der berüchtigten Autarkiepolitik der Nationalsozialisten gab es eine Ablehnung von Pfeffer und anderen Gewürzen im 16., von Kaffee im 18. und von importiertem Getreide und Fleisch im 19. Jahrhundert. In diesem Buch erfahren Sie, warum.
Auch Menschen überquerten Ländergrenzen. Im 19. Jahrhundert verließen fünfeinhalb Millionen Deutsche ihr Land und schufen eine globale Diaspora. Ich habe zu rekonstruieren versucht, was es bedeutete, in einem der »Kleindeutschlands« in den USA, in Südaustralien oder Rio Grande do Sul in Brasilien zu leben. »Massenauswanderung« war die Summe Tausender Einzelentscheidungen. Sie kam nicht zufällig in Gang, sondern war von Wirtschaftszyklen verursacht und durch Kettenmigration geformt, das heißt, Menschen aus bestimmten Gegenden in Deutschland gingen in bestimmte Gegenden im Ausland, und andere folgten ihnen. So kamen viele der Deutschen im englischen Liverpool aus Württemberg, was zu einer spektakulären Vermischung zweier ausgeprägter Dialekte geführt haben muss. Als immer mehr Menschen weggingen, begannen Nationalisten ihren »Verlust« zu beklagen und sie als »Auslandsdeutsche« zu bezeichnen statt als »Auswanderer«. Bewahrten sie ihr »Deutschsein«? Das hing davon ab, woher sie kamen, ob sie sich in einer Stadt oder auf dem Lande niederließen, ob sie einer eng verbundenen religiösen Gemeinschaft angehörten, wie alt sie waren und ob sie verheiratet oder alleinstehend waren. Was daraus entstand, ist häufig schwer einzuordnen. Was für eine Sprache ist es zum Beispiel, wenn Deutsche, die sich in Australien niederließen, davon sprachen, jemand würde »seinen Foot downputten«?
Die Antwort lautet: eine Hybridsprache. »Hybridität« ist einer der nützlichsten Begriffe, wenn es darum geht, kulturelle Kontakte zu beschreiben, wie sie in der einen oder anderen Form in jedem Kapitel dieses Buchs behandelt werden.[5] Sie erstrecken sich über weite Lebensbereiche: Sprache, Literatur, Musik, Tanz, bildende Kunst, Philosophie, Naturwissenschaft, Technik, Pädagogik, Architektur, Design und Sport. Einmal übernehmen Deutsche Dinge von anderen, ein andermal ist es umgekehrt. Dieses Geben und Nehmen als »Beeinflussung« zu bezeichnen, ist zu vage, aber wenn man von »Transfer« spräche, würde man die vollständige Übernahme von Stilen, Ideologien oder Institutionen andeuten, und dies entspräche kaum dem, was tatsächlich geschah. Selbst bei Dingen wie der scheinbar direkten deutschen Übernahme englischer Sportarten oder amerikanischer Tänze wie Tango und Cakewalk prägte der lokale Kontext die Rezeption. Bei komplexeren Fragen – zum Beispiel: War die deutsche Universität für Amerika ein »Vorbild«? – benötigt man ein umfangreicheres Vokabular. Ein Historiker hat eine lange Liste von Begriffen für die Beschreibung dieses Austauschs aufgestellt. Hier eine kleine Auswahl: Transfer, Nachahmung, Aneignung, Übersetzung, Akkulturation, gegenseitige Befruchtung.[6] In der Praxis war die Bewegung von Ideen und Praktiken häufig das Werk von Einzelnen: von Kulturvermittlern und Verbindungsleuten. Bei manchen gehörte es zum Beruf (wie bei Gelehrten, Buchhändlern, Übersetzern, Missionaren), bei anderen geschah es eher unbewusst und unabsichtlich (wie bei Auswanderern und Kaufleuten). Die deutschen Vertreter beider Kategorien in diesem Buch sind leicht zu erkennen; transnationale Männer und Frauen führen ein transnationales Leben.
Diplomaten hatten ein berufliches Interesse daran, über Entwicklungen in anderen Ländern auf dem Laufenden zu sein. Viele betätigten sich zudem als Kulturvermittler, besonders in den frühen Jahrhunderten, als die Diplomatie ein weniger spezialisierter Beruf war. Einer von ihnen hinterließ ein Bonmot, das heute noch in Zitatensammlungen enthalten ist: Ein Diplomat, hatte er festgestellt, sei »ein Gentleman, der entsandt wird, um im Ausland zum Besten seines Landes zu lügen«. Es stammt von Henry Wotton, der es 1604 ins Poesiealbum eines deutschen Freundes schrieb; Wotton hatte in Deutschland studiert, bevor er zu einem solchen Gentleman wurde. Als Diplomat lieferte er seiner Regierung Informationen über die Ereignisse im Heiligen Römischen Reich; gleichzeitig stellte er eine Verbindung zwischen der Gelehrten- und Wissenschaftswelt Großbritanniens und des Kontinents her. Er war ein Vermittler in der zeitgenössisch so genannten »Republik der Lettern«.[7] Im Folgenden wird man vielen Deutschen begegnen, die dieser Republik angehörten, bevor sie im 19. Jahrhundert, überwiegend durch Deutsche, in die universitätsbasierten Wissenschaftlernetzwerke unserer Zeit umgewandelt wurde.
Man wird also Diplomaten kennenlernen, die über den Tellerrand ihres Berufs hinaussahen. Die internationalen Beziehungen haben zwar ihren Platz in diesem Buch, sind allerdings nicht sein Hauptthema. Krieg spielt indes eine bedeutende Rolle. Wie auch nicht? So wie die deutschen Lande ein europäisches Drehkreuz für Waren und Ideen waren, nahmen sie auch geopolitisch eine herausragende Stellung ein. »Deutschland ist der Kampfplatz, darauf man um die Meisterschaft von Europa gefochten«, erklärte der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz 1670.[8] Er schrieb dies eine Generation nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648), der große Teile Deutschlands verwüstetet hatte, und nur zwanzig Jahre bevor die Truppen des französischen Königs Ludwigs XIV. im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 – 1697) das Rheinland in Trümmer legten. Ein Jahrhundert später gestalteten die französischen Revolutionskriege und die napoleonischen Kriege die deutschen Lande neu, indem sie das Heilige Römische Reich zerstörten und Hunderte winziger Fürstentümer von der Landkarte strichen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dann die Vereinigung Deutschlands durch Erfolge der preußischen Armee in drei innerhalb von sieben Jahren geführten Kriegen ermöglicht.
Aufgrund der Entstehung des deutschen Nationalstaats war dies ein entscheidender Wendepunkt. Aber dies war es auch in anderer Hinsicht: Dreieinhalb Jahrhunderte lang waren europäische Kriege auf deutschem Boden ausgefochten worden, doch für die Kriege von 1864 bis 1871 traf dies ebenso wenig zu wie für die Kolonialkriege und die beiden globalen Konflikte des 20. Jahrhunderts, jedenfalls bis in die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs. Und noch etwas anderes hatte sich verändert: Von den spanischen Heeren des 16. Jahrhunderts bis zu Napoleons Grande Armée wurden Deutsche rekrutiert, um für andere zu kämpfen. Damit war nun Schluss. Fortan war die deutsche Militärexpertise gefragt, von Japan bis Lateinamerika. Carl von Clausewitz’ berühmtes Buch Vom Kriege war zwar schon 1832 erschienen, wurde aber erst im späten 19. Jahrhundert in andere Sprachen übersetzt. Das hatte freilich einen unglücklichen Aspekt zur Folge. Die Verknüpfung der Begriffe »Deutschland« und »Militarismus« wurde immer enger, bis die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts sie nahezu unauflöslich machten. Es dauerte Jahrzehnte, bis Deutschland diesen Ruf ablegen konnte.
Lassen Sie mich vorweg auf einige Fragen antworten. Ist dieses Buch eine durch die deutsche Brille gesehene Weltgeschichte? Nein, es ist eine durch eine globale Brille gesehene deutsche Geschichte.[9] Ich hoffe, dass auch an Weltgeschichte Interessierte es lesen werden, aber es ist – was bereits unbescheiden genug ist – ein Versuch, die deutsche Geschichte neu zu schreiben. Umfasst »global« auch »europäisch«? Darauf kann ich nur mit einem nachdrücklichen Ja antworten. Obwohl im Folgenden Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien mehr Raum gewidmet wird als in Geschichtswerken über Deutschland sonst üblich, erfahren Deutschland und die Deutschen in ihrem Wirken auf der eurasischen Landmasse aber noch mehr Aufmerksamkeit. Dies spiegelt wider, wo die größten Bewegungen von Menschen, Waren und Ideen stattfanden. Eine weitere Frage, die ich mir häufig gestellt habe (und die mir häufig gestellt wird), ist, ob die Deutschen nicht eher Preußen, Bayern oder Thüringer waren? Es genügt nicht, darauf hinzuweisen – obwohl es zutrifft –, dass Engländer in der atlantischen Welt auf die Frage, woher sie kommen, beispielsweise antworten: »Aus Bristol«, oder Spanier: »Aus der Extremadura«.[10] Am Ende ist das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Nationalstaats ausschlaggebend. Dies ist eines der Themen dieses Buchs.
Damit hängen zwei weitere Fragen zusammen. Eine ist pragmatischer Art. Die Bibliotheksregale sind voller Reihenwerke über die »deutsche« Geschichte, deren Darstellung häufig weit in die Vergangenheit zurückreicht. Von den 24 Bänden des Standardhandbuchs zur deutschen Geschichte, dem »Gebhardt«, sind 15 der Zeit vor der Gründung des deutschen Nationalstaats im Jahr 1871 gewidmet. Ein Buch, das damit wirbt, dass es eine andere, globalere Perspektive anlegt, muss sich mit Werken auf dem eigenen Gebiet messen. Es hat wenig Sinn zu behaupten, dass man auf neue Weise auf die deutsche Geschichte schauen sollte, aber erst nach der Bismarck-Ära. Warum dann nicht, und dies ist die zweite Frage, mit den Alemannen oder im Mittelalter beginnen? Es gibt viele gute Gründe dafür, eine deutsche Geschichte im Jahr 1500 beginnen zu lassen: Es war der Zeitpunkt, an dem die Menschen begannen, routinemäßig vom Heiligen Römischen Reichdeutscher Nation zu sprechen. Gleichzeitig entstand eine gemeinsame Form der Sprache, das Frühneuhochdeutsche, das sich im Süden herausbildete und in der Reichs- und der sächsischen Kanzlei benutzt und rasch von anderen übernommen wurde. Bald darauf kam das Wort »Muttersprache« im Hochdeutschen auf. Nicht zuletzt begannen in dieser Zeit Humanisten wie Conrad Celtis und Johannes Cochläus über ein Gebiet namens »Deutschland« zu schreiben, wo Menschen lebten, die »Deutsche« genannt wurden.[11]
Die größte Frage, die Leser wahrscheinlich haben werden, lautet: Was ist neu und anders daran, wenn man die deutsche Geschichte durch eine globale Brille betrachtet? Die Antwort darauf ist zweigeteilt. Zum einen werden manche Dinge nur durch eine solche Brille sichtbar, und zum anderen erscheinen bekannte Wahrzeichen der deutschen Geschichte in einem anderen Licht. Ein Beispiel für die sichtbar werdenden Dinge wurde bereits erwähnt: die sich über Jahrhunderte erstreckende Tradition, dass Deutsche für andere kämpften, für Portugiesen, Spanier, Holländer, Briten. Dies ist nach meiner Ansicht indes nur ein Teil eines größeren Musters. In den ersten Kapiteln dieses Buchs widerspreche ich der verbreiteten Vorstellung, dass das binnenländische Deutschland in seine eigenen Angelegenheiten verstrickt war, während andere die Beziehungen zwischen Europa und der außereuropäischen Welt gestaltet haben. Die »nicht zur See fahrende deutschsprachige Welt« sei, wie uns weisgemacht wird, an den großen europäischen Expeditionen und Reisen kaum beteiligt gewesen.[12] Der Philosoph Peter Sloterdijk bringt diese Auffassung auf den Punkt: Es gebe »eine Weltgeschichte Spaniens, eine Weltgeschichte Englands, eine Weltgeschichte Frankreichs, eine Weltgeschichte Portugals und vielleicht auch eine Weltgeschichte Hollands. Was die Weltgeschichte der Deutschen angeht, darf des Historikers Höflichkeit für diesmal von ihr schweigen.«[13] Dies trifft einfach nicht zu. Deutsche waren in den expandierenden Welten der Portugiesen, Spanier, Holländer, Franzosen und Briten allgegenwärtig – als Soldaten, Schiffskanoniere, Kaufleute, Ärzte, Forschungsreisende, Missionare und Siedler. Sie halfen nicht nur, diese Reiche – im Guten wie im Schlechten – zu dem zu machen, was sie wurden, sie verbanden auch das binnenländische Mitteleuropa auf vielfältige Weise mit diesen Welten. Wie sie es taten, wird im Folgenden dargestellt. Beispielsweise muss man nach meiner Ansicht erkennen, dass es in den drei Jahrhunderten nach 1500, also in der Zeit, auf die sich die Historiker des atlantischen Raums für gewöhnlich konzentrieren, einen »deutschen Atlantik« gab. Die Deutschen waren dort zahlreich vertreten und halfen die atlantische Welt zu formen. Daraus folgt, dass man auf der Negativseite der Bilanz auch die deutsche Rolle im Sklavenhandel wahrnehmen muss.
Warum ist dies so lange unsichtbar geblieben? Ein Grund dafür ist, dass sich Deutsche, wenn sie durch die Reiche anderer kamen oder sich in ihnen niederließen, häufig als Chamäleons oder Gestaltwandler erwiesen. Mehr als andere Angehörige anderer Völker verschmolzen sie mit der lokalen Umgebung. Sie wechselten sogar ihre Namen: Aus Ehinger wurde in Neuspanien Eynguer oder Alfinger. Manchmal waren die neuen Namen einfache Übersetzungen, wenn etwa aus Zweig LaBranche oder aus Blümel Flores wurde. Linguisten nennen dies Lehnübersetzungen. Dass die deutsche Herkunft häufig unsichtbar wurde, deutet auf eine bedeutsame Tatsache hin: Sie verschwanden in den Reichen anderer, weil es kein deutsches Weltreich gab. Deshalb waren sie für Spanien Konquistadoren und (hessische) Hilfstruppen für Großbritannien, deshalb handelten sie mit Asien über Antwerpen und Lissabon, und deshalb wurden sie Kolonisten in Französisch-Guayana, Niederländisch-Surinam und Britisch-Nordamerika. Das Fehlen einer Flagge zählte, die Staatsmacht war ausschlaggebend.
All dies hatte langfristige Auswirkungen darauf, wie Deutsche sich selbst sahen. Einerseits bewirkte es die Überzeugung, dass man über dem schmutzigen Geschäft von Eroberung und Ausbeutung stehe und ein reineres Reich bewohne. Und es stimmt, dass deutsche Forschungsreisende indigenen Völkern häufig mit außerordentlicher Sympathie entgegentraten und die Art, wie sie im britischen, spanischen und russischen Reich behandelt wurden, kritisierten. Die Besorgnis über die Bedrohung für andere Spezies, bis hin zur Ausrottung, war ein anderes Nebenprodukt dieser kritischen Distanz. Auch die Ansicht, dass die deutsche Empfindungsfähigkeit weniger grob, also feiner war als diejenige anderer Nationen, war im goldenen Zeitalter der deutschen Kultur in den Jahrzehnten vor und nach 1800 weit verbreitet. Johann Gottfried Herder ging in seiner Vorrede zur deutschen Übersetzung des indischen Schauspiels Sakuntala auch kritisch auf den Kolonialismus ein. Bedauerlicherweise, schrieb er, seien »diese Geistes- und Gemütsschätze der friedseligsten Nation unseres Erdballes« zuvor in der Übersetzung der Sprache der Engländer anvertraut worden, »der kaufmännischsten Nation desselben Balles«.[14] Solche Selbstgerechtigkeit beförderte eine auffällige, langfristige deutsche Identifikation mit Kolonialvölkern, die im 20. Jahrhundert eine toxische Form annahm, da sich viele Deutsche nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Versailler Vertrag als weiteres koloniales Opfer von Franzosen und Angelsachsen betrachteten und dieses selbstmitleidige Ressentiment von den Nationalsozialisten ausgebeutet wurde. Damit haben wir ein ganzes Cluster von Jahrhunderte überspannenden Themen.
Das politische Exil ist ein weiteres ständiges Thema, das sichtbar wird, wenn man durch eine globale Brille auf die deutsche Geschichte schaut. Über die Jahrhunderte hinweg haben viele Menschen die deutschen Lande verlassen, weil sie um ihr Leben, ihre Freiheit oder ihren Lebensunterhalt fürchteten. Am bekanntesten sind die nach Hunderttausenden zählenden Emigranten aus Hitler-Deutschland. Die meisten von ihnen waren Juden, zu denen Nichtjuden hinzukamen, die das Land verließen, weil sie Kommunisten, Sozialdemokraten oder aufgrund ihrer künstlerischen oder sonstigen Tätigkeit missliebig waren. Die Emigranten verteilten sich auf den gesamten Erdball, von Allahabad über Schanghai, Moskau und Istanbul bis nach Sydney und Südkalifornien. Waren nicht auch sie Teil der deutschen Geschichte, ganz gleich, ob sie später zurückkehrten oder nicht? Die meisten würden, wenn sie über diese Frage nachdenken, sicherlich mit Ja antworten. Dieses Buch fordert sie auf, über sie nachzudenken. Dieselbe Frage könnte man auch in Bezug auf frühere Emigranten stellen, wie auf die beiden, die sich nach der Flucht vor den Gräueln des Dreißigjährigen Krieges im Ausland einen Namen machten. Der Calvinist Samuel Hartlib – »der größte Verstand Europas« – ging nach London, während es den katholischen Priester Athanasius Kircher – »der letzte Mensch, der alles wusste« – nach Rom zog. Beide waren bemerkenswerte Figuren, die sich im Zentrum bedeutender Informationsnetzwerke befanden, die sich über Europa und darüber hinaus erstreckten. Wie die begabten Emigranten der 1930er-Jahre – »Hitlers Geschenk« – waren sie eine geistig bereichernde Gabe der kriegszerrissenen deutschen Lande. In diese Kategorie fielen auch zwei Wellen politischer Flüchtlinge im 19. Jahrhundert. Die erste setzte nach den repressiven Karlsbader Beschlüssen im Jahr 1819 ein, die Radikale veranlassten, in die Schweiz, nach Frankreich und Großbritannien oder in die Vereinigten Staaten zu gehen. Die zweite folgte nach der Revolution von 1848, als erneut enttäuschte Radikale ins Ausland flohen, überwiegend in dieselben Länder wie ihre Vorgänger, manche aber auch an weiter entfernte Orte, wie Australien, wo die 48er einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die heimische Gesellschaft ausübten. Dies ist einer der Hinweise, die dieses Buch für die Beantwortung der Frage bereithält: Wo hat die moderne deutsche Geschichte stattgefunden?
Wenden wir uns dem zweiten Teil der Antwort auf die Frage nach der globalen Perspektive zu. Sieht man bekannte Wahrzeichen in einem anderen Licht und, wenn ja, auf welche Weise? Ein sehr gutes Beispiel ist die Reformation. Mein Schwerpunkt liegt in dieser Hinsicht weder auf der deutschen Nation und Martin Luther noch auf der Reformation in den Städten oder der Haltung der deutschen Fürsten und der Staatsbildung. Über all dies gibt es bereits zahlreiche ausgezeichnete Studien.[15] In diesem Buch erscheint die Reformation vielmehr als eine in Deutschland – und der Schweiz – entstandene explosive Bewegung, die zunächst in Europa und dann weltweit eine umwälzende Wirkung auf Politik, Gesellschaft und Kultur ausübte. Außerdem löste sie mehrere Fluchtwellen aus; derjenigen von Hartlib und Kircher folgte später eine Welle hugenottischer Emigranten, die aus Frankreich nach Deutschland flohen. Auf die Reformation reagierte die katholische Gegenreformation, die deutsche Jesuiten bis nach China und Lateinamerika brachte und in Form von Missionen, neuen Andachtspraktiken und der architektonischen Wahrzeichen des Barocks nach Deutschland reimportiert wurde.
Auch solche Grundpfeiler der modernen deutschen Geschichte wie der Nationalismus und die Vereinigung sehen auf den folgenden Seiten anders aus. Vielfach wird angenommen, der deutsche Nationalismus unterscheide sich von anderen Nationalismen, sei weniger bürgerlicher und stärker völkischer Art und wurzle in Blut und Boden. So gesehen erscheint die rassisch definierte »Volksgemeinschaft« der Nationalsozialisten wie ein gleichsam natürlicher Endpunkt. Fasst man jedoch einen breiteren Kontext in den Blick, sieht man eine komplexere, diskontinuierlichere und weniger selbstbezogene Entwicklung. Was wollten die deutschen Nationalisten in den 1820er-, 1830er- und 1840er-Jahren? Sie wollten eine deutsche Nation, die das kleinteilige Gefüge der deutschen Fürstentümer überwinden sollte. Dies war die Bedeutung von Hoffmann von Fallerslebens Vers von 1841, »Deutschland, Deutschland über alles«: Die Nation sollte über eigensüchtigen Interessen stehen, nicht über anderen Nationen. Hoffmann war ein Progressiver, der seine akademische Anstellung verloren hatte und ins Exil gezwungen worden war. Die meisten deutschen Nationalisten seiner Zeit waren Liberale oder Progressive, die nationale Bestrebungen anderswo – in Lateinamerika, Griechenland oder Polen – als Elemente einer gemeinsamen Sache verstanden. Deutsche Nationalisten, ob sie nun radikale Hitzköpfe oder nüchterne Liberale waren, bezogen 1848 ihre politischen Vorbilder aus dem Ausland, Republikaner aus Frankreich und der Schweiz, Gemäßigte aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Das Scheitern der Revolution war eine Wasserscheide. Der deutsche Nationalismus wurde in den 1850er- und 1860er- Jahren merklich schärfer, wie die meisten Historiker heute übereinstimmend feststellen, obwohl der Nationalismus in Deutschland – und anderswo – erst im späten 19. Jahrhundert eine derart scharfe, rassistisch gefärbte Tonlage annahm, dass selbst liberale Nationalisten, die in den 1860er-Jahren in die Politik eingetreten waren, die Sprache der jungen Alldeutschen nicht mehr verstanden.
Auch die deutsche Vereinigung unter Otto von Bismarck sieht, aus globaler Perspektive betrachtet, anders aus. Sie wurde in den 1860er-Jahren vorbereitet, einem entscheidenden Jahrzehnt des weltweiten Aufbaus und Wiederaufbaus von Nationen – in Italien, Russland, Japan, Kanada, Mexiko und nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo der Bürgerkrieg die Nation, wie unvollkommen auch immer, neu gestaltete. Es war auch ein Bürgerkrieg, derjenige zwischen Preußen und Österreich – Zeitgenossen sprachen von einem »Bruderkrieg« –, der 1866 über Deutschlands Zukunft entschied. Er war ebenfalls ein Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd, allerdings war in diesem Fall der Norden, also Preußen, der sezessionistische Akteur. Kurz, die deutsche Vereinigung geschah im Rahmen einer größeren Veränderung, die in den 1860er-Jahren die Weltordnung umformte. Die neu gestaltete deutsche Nation blieb im Innern gespalten. Bemühungen, diese Spaltung zu überwinden, stießen, soweit sie überhaupt unternommen wurden, auf ein Hindernis, mit dem solche Bestrebungen auch anderswo konfrontiert waren: Sie wurden in einer Zeit unternommen, in der das Land Teil einer enger verbundenen, vernetzten Welt wurde. Das Subnationale, Nationale und Übernationale waren in Bewegung befindliche Teile, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegten. Die Folge waren Reibungen. Um 1900 herum wurden Handel, Kommunikation, kulturelle Bewegungen und das Zeitgefühl selbst von einer »großen Beschleunigung« erfasst.[16] In vieler Hinsicht ähnelte die damalige Entwicklung der heutigen Globalisierung. Doch dann stießen die Art und die Geschwindigkeit dieser Veränderung, wie heute, auf den vehementen Widerstand derjenigen, die das Gefühl hatten, geopfert oder zurückgelassen zu werden. Deutschland war bei all dem mittendrin.
Und so kommen wir zum 20. Jahrhundert, das vor allem eine Frage aufwirft: Gibt es eine globale oder transnationale Geschichte von NS-Deutschland, die uns das Regime und seine Verbrechen in einem anderen Licht zeigt? Ja, die gibt es. Aber zunächst muss betont werden, dass es sich um ein genozidalesdeutsches Regime handelte, ganz gleich, wie viele nichtdeutsche Vorbilder, Einflüsse und Parallelen sich finden lassen und wie viele nichtdeutsche Kollaborateure und Mittäter benannt werden können. Wenn es im Folgenden mit anderen Regimen verglichen wird, dann nicht, um es mit ihnen gleichzusetzen; Gemeinsamkeiten und äußere Anregungen aufzuspüren bedeutet nicht, es zu relativieren, geschweige denn zu entschuldigen. Gleichwohl war der Nationalsozialismus ein Produkt sowohl seiner Zeit als auch der deutschen Geschichte. Hitler bewunderte nationalistische »starke Männer« wie Chiang Kai-shek und Atatürk; in der Parteizentrale der NSDAP in München stand an prominentem Platz eine lebensgroße Mussolini-Büste, und in Hitlers dortigem Büro hing ein signiertes Porträtfoto von Henry Ford. Der Nationalsozialismus bezog seine Ideen aus vielen Quellen: aus antisemitischen Verschwörungstheorien antibolschewistischer russischer Emigranten, der britischen und skandinavischen Eugenik, amerikanischen Rassengesetzen. Vor allem war er Teil einer größeren faschistischen Bewegung, in der er anfangs den italienischen Faschismus imitierte, bevor er sich zu ihrem Anführer aufschwang. Dies geschah erst in den 1930er-Jahren. Als Hitler und Mussolini 1934 in Venedig zum ersten Mal zusammentrafen, war der »Duce« immer noch der dominierende Partner. Die deutschen Braunhemden fügten sich ein in die Reihen der Schwarz-, Grau-, Grün- und Blauhemden in anderen Teilen Europas; jede Farbe war vertreten, nur Rot nicht, da die Roten überall der Feind waren. Dies war eine der Gemeinsamkeiten der verschiedenen Spielarten des Faschismus. Es gab noch viele andere Gemeinsamkeiten, sowohl stilistische als auch substanzielle. Obwohl es hypernationalistische Bewegungen waren, kann man, so paradox es klingt, auch von einem Faschismus ohne Grenzen sprechen.[17] Aber um es noch einmal zu betonen: Trotz aller Anleihen und Angleichungen seitens des Nationalsozialismus – und kaum etwas von seiner Ideologie und Politik war wirklich originär – war die daraus entstandene Mischung eigenständig. Die deutsche Variante war eine einzigartig radikale und zerstörerische Form des Faschismus.
Das schrecklichste Symbol dafür war der Holocaust. Insbesondere in den letzten 35 Jahren haben umfangreiche Forschungsarbeiten auf beeindruckende Weise gezeigt, wie die deutschen Entscheidungsprozesse abliefen, und zugleich die Stimmen der Opfer hörbar gemacht. Außerdem haben sie unterstrichen, dass der Genozid ein von Deutschland geleitetes Unterfangen war, an dem sich jedoch auch eine große Zahl von Nichtdeutschen beteiligte – als Führer von verbündeten oder Satellitenstaaten wie Rumänien und Kroatien, Angehörige von paramilitärischen Einheiten und später auch von deutsch kontrollierten Polizeikräften im Baltikum, in der Ukraine und anderswo. Nichtdeutsche töteten Juden in großer Zahl. Sie identifizierten Juden für die Deutschen und nutzten ihre Kenntnis der lokalen Gegebenheiten, um Juden aufzuspüren, die sich in Wälder oder Sümpfe geflüchtet hatten; sie räumten Ghettos und Arbeitslager, verluden Juden an Transitpunkten überall auf dem Kontinent in Eisenbahnzüge und dienten bei Razzien und in Konzentrationslagern als Wachen. Und so wie die Komplizenschaft von Deutschen über die NS- und SS-Führung hinaus auch viele »gewöhnliche Deutsche« umfasste, machten sich auch unter Nichtdeutschen nicht nur lokale faschistische Paramilitärs und Polizisten zu Komplizen, sondern auch Firmeninhaber, Beamte, Versicherungen und andere, die davon profitierten, wenn Juden in Todeslager transportiert wurden. Je mehr wir erfahren, desto mehr bröckelt die alte Dreiparteieneinteilung in Täter, Opfer und Zuschauer, denn viele der Letzteren wurden auf die eine oder andere Weise zu Komplizen. Aber es gab auch Zuschauer wie den Vatikan, das Internationale Rote Kreuz, die Hollywood-Studios und alliierte Entscheidungsträger, deren Untätigkeit im Rahmen einer globalen Geschichte des Holocaust genau untersucht werden muss.
Der letzte Teil dieses Buchs lautet: Das verdammte »deutsche Jahrhundert«. Aufgrund der Wirtschaftsdynamik des Landes und des herausragenden Rufs, das es auf den Gebieten von Bildung, Wissenschaft und Kultur genoss, glaubten um 1900 viele, das neue Jahrhundert würde ein deutsches werden. Es wurde zwar ein deutsches Jahrhundert, aber aus den schlechtesten vorstellbaren Gründen. Deutschlands Schande wurde der Weltgesellschaft zu einer Lehre. Aber die große Bedeutung der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert erschöpft sich nicht im Dritten Reich und seinen Folgen, so zentral sie in jeder historischen Darstellung sein müssen. Andere bedeutende Ereignisse des deutschen 20. Jahrhunderts haben ebenfalls Spuren in der allgemeinen Vorstellungswelt hinterlassen: die Schlachten des Ersten Weltkriegs, die Hyperinflation der frühen 1920er-Jahre, die kulturelle und sexuelle Modernität der Weimarer Republik, die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mit den ikonischen Bildern der »Trümmerfrauen« inmitten von Ruinen und der Berliner Luftbrücke, dann das geteilte Land der Ära des Kalten Kriegs, dessen ultimatives Symbol die Berliner Mauer war. All dies zeigt, wie tief Deutschland in die größeren Strömungen der Weltgeschichte eingebettet war. Es gibt noch andere Schnappschussmomente, die das Deutschlandbild auch von Menschen prägen, die sich nicht besonders für das Land interessieren. Je nach Alter mögen sie sich an John F. Kennedys »Ich bin ein Berliner«-Rede von 1963 oder Willy Brandts Kniefall am Denkmal für das Warschauer Ghetto im Jahr 1970 erinnern; ganz bestimmt sind ihnen Angela Merkels weltweit beachteten Worte »Wir schaffen das« über die Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Deutschland im Gedächtnis geblieben. Darüber hinaus gibt es Embleme Deutschlands, wie das Oktoberfest, Volkswagen, die Berliner Philharmoniker, die Band Kraftwerk, die ebenfalls zu seiner modernen Geschichte gehören.
Im 20. Jahrhundert wurde die deutsche Geschichte noch globaler, noch vernetzter. Die Liste der Akteure ist umfangreicher als in früheren Kapiteln. Man begegnet immer noch Kaufleuten, Soldaten, Gelehrten und Emigranten. Aber zu ihnen gesellen sich andere Frauen und Männer, die zur grenzüberschreitenden, ständig in Bewegung befindlichen Welt des 20. Jahrhunderts gehören: Entwicklungshelfer, Austauschstudenten, Touristen, Kulturdiplomaten, Au-pairs, Sportler, Menschenrechtskämpfer, Menschenhändler, Backpacker-Touristen, Anti-Atomkraft-Demonstranten, Delegierte von Partnerstädten, Stadtterroristen, Spione, tourende Orchester, Jazzkapellen, Rockbands und Rapper, Migranten und Flüchtlinge. Sie alle stehen dafür, dass die deutsche Geschichte nicht an den deutschen Grenzen endet. Manche von ihnen erinnern uns auch daran, dass die Kontakte und Bewegungen von Menschen in einer vernetzten Welt nicht immer zuträglich sind: Wie manche Ideen und Praktiken, die sich über Grenzen hinweg verbreiten, sind sie keine Beispiele für Kosmopolitismus und wohlmeinende Anstrengungen wohlmeinender Menschen, welche die Hindernisse für das gegenseitige Verständnis einreißen möchten.[18]
Zum Schluss eine letzte Frage: Was für eine Art von Geschichte ist dies? Wie der letzte Absatz andeutete, habe ich mein Netz weit ausgeworfen. Politik, Krieg und Frieden, Wirtschaft, Kultur, Geschlecht, Bildung, Naturwissenschaft, Umwelt, Rasse, Religion: Das alles hat seinen Platz. Außerdem habe ich mich um ein Gleichgewicht bemüht zwischen Geschichten, ohne die Geschichtsschreibung unlebendig wäre, und Argumentation, ohne die sie keinen Sinn hätte. Vor allem aber habe ich einzufangen versucht, was der Historiker Edward Palmer Thompson in einer wunderbaren Formulierung den »Strom des gesellschaftlichen Lebens« genannt hat.[19]
Noch ein Wort zum Umfang der Darstellung. Ich habe versucht, die deutsche Geschichte in einer Dimension, der räumlichen, auszudehnen, ohne sie in einer anderen, der zeitlichen, einzuengen. Dieses Buch umfasst fünf Jahrhunderte. Ich habe bereits einige Gründe genannt, warum es aus deutscher Sicht sinnvoll ist, mit der Zeit um 1500 zu beginnen. Aber es gibt auch breitere historische Entwicklungen, die diese Entscheidung rechtfertigen. Damals entstand ein neues europäisches Staatensystem, die neue Druckkunst begann sich auszuwirken, die »Vereinigung des Globus durch Krankheiten« nahm ihren Lauf, und die Portugiesen begannen sich mit ihren deutschen Kanonieren, den Venezianern und Genuesen folgend, am Aufbau einer Weltwirtschaft zu beteiligen.[20] All diese Gründe sprechen dafür, um 1500 zu beginnen. Vor einigen Jahren schrieb ich unter dem Titel »Honey, I Shrunk the German History!« ein Lamento darüber, dass sich heute drei Viertel der Bücher, Aufsätze und Konferenzpapiere über die deutsche Geschichte mit der Zeit seit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen.[21] Niemand wird behaupten können, dass das 20. Jahrhundert in diesem Buch zu kurz kommt, aber ich hoffe, man wird mir auch darin zustimmen, dass ein weiter gefasster Zeitrahmen neue Sichtweisen ermöglicht.
Teil I Die Deutschen in einer sich wandelnden Welt
Kapitel 1 Neue Welten
Seeleute, Eroberer und Legenden
Wo könnte man besser beginnen als in Nürnberg? Die Stadt hatte um 1500 etwa 30 000 Einwohner. Damit war sie eine der größten in deutschen Landen – dreimal so groß wie Berlin. Nürnberg war das Zentrum vieler Dinge. Ein Zeichen ihrer politischen Bedeutung war, dass der Reichstag des Heiligen Römischen Reichs Anfang der 1520er-Jahre zweimal dort tagte. Die Stadt war Sitz einiger der reichsten deutschen Handelshäuser und Kreuzungspunkt von Ost-West- und Nord-Süd-Handelswegen. Zu ihren angesehenen Einwohnern zählten der Maler Albrecht Dürer und führende humanistische Gelehrte wie Johannes Cochläus. Als Zentrum des Druck- und Verlagswesens fehlte es Nürnberg nicht an wohlhabenden Mäzenen, und so konnte es die Früchte der Gelehrsamkeit von nah und fern ernten. Conrad Celtis, ein weiterer deutscher Humanist, bescheinigte den Nürnbergern: »Wie die Bienen Blüte um Blüte aufsuchen, damit sie eine Wabe bauen und ihre Zellen mit reicher Beute füllen können, so sammeln jene in verschiedenen Ländern gewaltige Reichtümer und schaffen sie in ihre Stadt.«[1] Keine Stadt in deutschen Landen führt deutlicher vor Augen, dass diese einen Knotenpunkt in Europa bildeten, eine Kontaktzone, in der Völker und Kulturen zusammenkamen.
Hieronymus Münzer war einer der Nürnberger Bürger, die in die Welt hinausgingen. Der Arzt und Humanist mit einem starken Interesse für die Kartografie hatte sich in Nürnberg niedergelassen und 1493 an der berühmten Nürnberger Chronik mitgearbeitet, zu der er die erste gedruckte Deutschlandkarte beisteuerte. 1494 brach er zu einer einjährigen Reise auf die Iberische Halbinsel auf. Später beschrieb er mit großer Genauigkeit, was er gesehen hatte: Altarbilder, Bibliotheken, heiße Quellen und Weingärten. Außerdem erwähnte er die vielen Deutschen, die er auf seiner Reise getroffen hatte – Kaufleute, Handwerker, Drucker und Künstler aus allen Teilen des Heiligen Römischen Reichs, von Danzig und Stettin im Norden bis nach Kempten und Ulm im Süden. Sogar Menschen aus einem Dorf in der Nähe seines Geburtsorts, der Kleinstadt Feldkirch, war er begegnet. Wohin er auch kam, überall traf er auf Deutsche, die ihn herumführen konnten.[2]
Das Heilige Römische Reich war eine Welt in Bewegung. Deutsche hatten an den Kreuzzügen teilgenommen, und in jüngerer Zeit war es am Ostrand des Reichs, einer Kontaktzone, die gelegentlich zu einer Kriegszone wurde, zu Zusammenstößen mit den osmanischen Türken gekommen. 1529 belagerten die Osmanen Wien, und in den nächsten anderthalb Jahrhunderten brachen an dieser Front immer wieder Kämpfe aus. Im Spätmittelalter waren Deutsche in großer Zahl nach Osten gewandert und hatten sich in einem großen Bogen vom Baltikum bis an die untere Donau niedergelassen. Es gab Vertreter sogenannter »unehrenhafter Berufe«, wie Messerschleifer, Wandermusiker, Komödianten und Akrobaten. Zu den Fernreisenden gehörten auch Wandergesellen. In deutschen Landen erstmals nach dem Schwarzen Tod im 14. Jahrhundert erwähnt, waren sie bald gut organisiert. Dann gab es Soldaten, die selbstbewussten deutschen Landsknechte, die überall in Europa wegen ihrer Kampfkraft gefragt, aber auch gefürchtet waren, weil sie im Ruf standen, diebisch zu sein, zu vergewaltigen und die Pest zu verbreiten.[3]
Künstler und Gelehrte waren ständig auf Reisen. Dürer verbrachte zwei lange Abschnitte seines Lebens in Italien. Außerdem lebte er während seiner Lehrjahre und dann noch einmal 1520/21, als er Ende vierzig war, einige Zeit in den Niederlanden – in Gent, Brügge, Brüssel und Antwerpen, wo er »18 stüber [für] mein dodten [Patenkind] umb ein rothes piret [Barett]« ausgab und »12 stüber verspilt[e]«.[4] Conrad Celtis studierte in Italien und reiste anschließend durch Kroatien und Ungarn nach Krakau, wo er Ostern 1489 eintraf. Dort blieb er ein Jahr, ging auf Wisentjagd, besuchte ein Salzbergwerk und erkundete die Karpaten, bevor er nach Nürnberg zurückkehrte.[5] So gut wie jeder deutsche Humanist verbrachte einige Zeit in Venedig, Florenz, Bologna oder Padua. Auch Angehörige der religiösen Elite und fromme Adlige reisten als Pilger, für die alle Wege nach Rom führten, nach Italien. Andere folgten dem quer durch Europa führenden Pilgerweg nach Santiago de Compostela in Spanien. Und um 1520 verbreiteten Anhänger von Luthers Lehre diese bereits eifrig in Großbritannien, Skandinavien und Osteuropa.
Das Heilige Römische Reich im Jahr 1500. Es bestand aus derart vielen winzigen Fürstentümern, dass die Karte – mit den Worten von Simon Winder – aussah, »als sei eine Puzzle-Fabrik explodiert«[6].
Kaufleute verfügten über eigene Netzwerke. Die Hanse besaß Niederlassungen in Nowgorod, Bergen und Brügge sowie eine berühmte Balkenwaage am Nordufer der Themse, dort, wo sich heute der Bahnhof Cannon Street befindet. 1500 hatte die Hanse ihre große Zeit bereits hinter sich. Die Schließung der Nowgoroder Niederlassung durch Zar Iwan III. im Jahr 1494 war ein Zeichen für den politischen Druck, unter dem die Hanse stand. Gleichzeitig bekam sie Konkurrenz von der englischen Handelsgesellschaft Merchant Adventurers und den Holländern. Aber ein großer Teil des verlorenen Nordhandels wurde von anderen deutschen Kaufleuten übernommen, die statt der Seewege Landrouten benutzten. Die berühmtesten von ihnen waren die Augsburger Fugger, die mit allem handelten, was man sich denken kann, und nebenbei Fürsten finanzierten. Ihre Agenten mit den herzförmigen Taschen aus hellem, weichem Leder traf man überall in Europa. Eine ihrer Routen führte über die Alpen nach Venedig und Genua. Agenten der anderen großen Handelshäuser aus Augsburg und Nürnberg nahmen denselben Weg. In Venedig angekommen, begaben sie sich zum Fondaco dei Tedeschi direkt neben der Rialtobrücke, das teils Lagerhaus und teils Unterkunft für deutsche Kaufleute war. In Augsburg andererseits machte sich die Verbindung nach Venedig in italienisierender Architektur bemerkbar.[7]
Auf einem Aquarell von 1516 ist Jakob Fugger, bekannt als »der Reiche«, in seiner luxuriösen »goldenen« Schreibstube abgebildet, während er seinem Buchhalter Anweisungen gibt. Im Hintergrund ist ein Schrank zu sehen, dessen Schubladenbeschriftungen von der Größe seines Handelsreichs künden: »Inspruck«, »Venedig«, »Rom«, »Mayland«, »Craca« (Krakau), »Antorff« (Antwerpen), »Lisbona« (Lissabon).[8] Dass Lissabon genannt wurde, ist bedeutsam, denn dreißig Jahre zuvor wäre dies noch nicht der Fall gewesen. Fugger hatte seine dortige »Faktorei« oder Niederlassung 1503 eröffnet. Einige Jahre später besaß das Handelshaus auch in Spanien ein eigenes Netzwerk von Agenten. Wie der langsame Niedergang der Hanse und die wachsende Bedeutung Antwerpens im 16. Jahrhundert waren auch die zunehmenden Aktivitäten oberdeutscher Handelshäuser auf der Iberischen Halbinsel ein Zeichen des Wandels, der sich damals vollzog. Sie zeigen, wie Deutsche die neuen Gelegenheiten, die sich nach den Reisen von Christoph Kolumbus, Bartolomeu Dias und Vasco da Gama boten, ergriffen.
Deutsche Wirtschaftshistoriker haben die Rolle untersucht, die Fugger und andere Handelshäuser, wie die Welser, auf den neuen globalen Handelsrouten spielten, während Kunsthistoriker sich damit befasst haben, wie Motive aus den neuen Welten in Ost und West in Dürers Werk Eingang fanden – in Form etwa eines Holzschnitts, der ein Nashorn (Rhinozeros) zeigt, und einer Kohlezeichnung mit dem Bildnis eines Afrikaners.[9] Doch die weitergehende deutsche Beteiligung an der Erkundung, Eroberung und Ausbeutung dieser Welten beginnt gerade erst die Aufmerksamkeit zu finden, die sie verdient.[10] In den meisten Schriften über die deutsche Geschichte wird sie kaum erwähnt. Noch immer hält sich weithin die Auffassung, das binnenländische Deutschland habe bei all dem nur am Rand gestanden. Was die deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert vorantrieb und den narrativen Impetus der Standarddarstellungen dieser Zeit liefert, ist die Reformation. Während Spanien und Portugal die Welt unter sich aufteilten, waren die deutschen Fürsten und Städte – so scheint es für gewöhnlich – in innere Kämpfe verstrickt, die sich von Luthers Auftritt auf dem Reichstag zu Worms im Jahr 1521 über das militärische Vorgehen des Kaisers gegen die Protestanten in den 1540er-Jahren bis zum Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 hinzogen.
Doch der Religionsstreit, der das Heilige Römische Reich im 16. Jahrhundert erschütterte, fand in einem globalen Umfeld statt. Was in Deutschland gesagt und getan wurde, war mit Ereignissen jenseits des Indischen Ozeans und des Atlantiks verknüpft. Der Reichstag zu Worms zum Beispiel, auf dem Luther mit berühmt gewordenen Worten die Forderung, seine Lehre zu widerrufen, zurückwies und Kaiser Karl V. ihn als Häretiker verurteilte, behandelte in derselben Sitzung eine Reihe von Verordnungen gegen Handelsmonopole und deren Geschäftsgebaren. Damit reagierte der Reichstag auf den deutschen Osthandel mit Gewürzen aus Asien; auf dem nächsten Reichstag, der stattfand, als die Nachricht von Ferdinand Magellans Weltumrundung in Deutschland eintraf, kam dieses Thema erneut zur Sprache. Luther selbst wetterte gegen den »Außenhandel, der aus Kalkutta und Indien und dergleichen Ländern Waren herbringt, wie kostbare Seide, Goldarbeiten und Gewürze, die nur zur Pracht dienen und keinen Nutzen haben, der saugt aus Land und Leuten das Geld heraus«.[11] Sein Verbündeter Ulrich von Hutten pries ein imaginäres goldenes Zeitalter deutscher Selbstgenügsamkeit, das angeblich durch die Einfuhr von »allerläppischsten Waren«, wie »Pfeffer, Ingwer, Zimt, Safran, Kubebe[n-Pfeffer]«, zerstört wurde.[12]
Karl V., der Luther verurteilte, war erst zwei Jahre zuvor, 1519, mithilfe großzügiger, durch Darlehen der Fugger und Welser finanzierter Bestechungszahlungen an die Kurfürsten zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gewählt worden. Bei seiner Wahl war er bereits König von Spanien, und als Hernán Cortés ihm im selben Jahr 1519 die Eroberung von Montezumas Aztekenreich meldete, erklärte er, Karl könne sich jetzt Kaiser sowohl von Neuspanien als auch von Deutschland nennen. Er sei dabei, zum »Herrn der Welt« zu werden.[13] Karl erklärte, in Anspielung auf den spanischen Erwerb eines Reichs in der Neuen Welt, »Plus ultra« – immer weiter – zu seinem Wahlspruch, und er war es auch, der die transatlantische spanische Schifffahrt organisierte, so dass regelmäßig Flotten zwischen Sevilla und Havanna, Cartagena und Veracruz hin- und herfuhren.[14] Die relative Vernachlässigung Deutschlands durch Karl war einer der Gründe, weshalb das Luthertum nach 1521 auf Kosten des Reichs an Einfluss gewinnen konnte. Aber es trifft auch zu, dass die Deutschen bis zu Karls Abdankung im Jahr 1556, als der spanische und der österreichische Teil des Herrschaftsgebiets der Habsburger getrennt wurden, in einem »Reich, in dem die Sonne niemals untergeht«, lebten.[15]
Der Habsburger Anspruch auf die Weltherrschaft wurde durch einige der besten Arbeiten der Nürnberger Goldschmiede verherrlicht. Um zu erkunden, wie deutsche Lande an den gefeierten europäischen Expeditionen und Reisen beteiligt waren, bietet jedoch ein bescheideneres Material einen besseren Einstieg: Holz. Denkt man an die Deutschen und ihre Wälder um 1500, fällt einem wahrscheinlich die Wiederentdeckung von Tacitus’Germania, des Werks, das erstmals das Klischeebild der Deutschen als langhaariger Waldmenschen aufbrachte, durch Humanisten wie Conrad Celtis ein.[16] Aber was die Deutschen um 1500 mit ihren Wäldern vorwiegend taten, war, sie abzuholzen, weniger für sich selbst als vielmehr für iberische Schiffsbauer. Nordeuropäisches Holz stand hoch im Kurs. Die großen portugiesischen Pinienwälder, die Pinhal de Leiria, konnten die Nachfrage nicht decken, weshalb Hanseschiffe deutsches und skandinavisches Holz in großen Mengen nach Portugal transportierten. 1494 wurde für den Schiffsbau bestimmtes deutsches Holz vom Zoll befreit.[17] Auch nach Spanien lieferte Deutschland Holz und andere Materialien für den Schiffsbau. 1523 teilte Karl V. den Städten Lübeck und Danzig mit, dass Jakob Fugger beauftragt worden sei, genügend Kupfer, Masten, Teer und Tauwerk zu beschaffen, um acht Schiffe zu beladen, die nach La Coruña gesandt werden sollten. Die Städte wurden aufgefordert, Fugger bei der Erfüllung seines Auftrags zu unterstützen.[18]
Der deutsche Beitrag zum Bau hochseetauglicher Schiffe in Spanien und Portugal ging indes weit über die Lieferung von Holz und Teer hinaus. Einige der portugiesischen Schiffe, die in den 1480er- und 1490er-Jahren die westafrikanische Küste erkundeten und von dort häufig Sklaven abtransportierten, waren entweder in Deutschland oder nach deutschen Plänen gebaut. Immerhin hatten Deutsche die Hanse geschaffen, einen »Seestaat«, der in einer Liga mit Venedig, Genua und Portugal spielte.[19] Im 15. Jahrhundert hatte sich der Schiffsbau in Nord- und Südeuropa gegenseitig befruchtet, was zu einem guten Teil die Entdeckungsreisen erst ermöglichte. Die iberische Reconquista im Spätmittelalter, an der deutsche Schiffe teilnahmen, öffnete dem nichtislamischen Schiffsverkehr die Straße von Gibraltar und führte zu engeren Beziehungen zwischen dem Mittelmeer im Süden und der Nord- und Ostsee im Norden. Ein Marinehistoriker spricht von einem »Dialog zwischen Nord und Süd« und einer »maritimen Symbiose«.[20] Genueser und venezianische Schiffe fuhren nach Flandern, und Hanseschiffe segelten nach Süden. Deutsche Schiffe steuerten die Iberische Halbinsel nicht nur an, um ihre kostbare Holzladung zu löschen, sondern auch, weil infolge der enormen Expansion des Kabeljau- und Heringsfangs in nördlichen Gewässern die Salznachfrage gestiegen war, die in Portugal befriedigt wurde. Die Anforderungen der »Salzflotten« regten eine hybride Schiffsentwicklung an. Das Ergebnis – der Rumpf und die Takelage der von den iberischen Ländern auf See geschickten Schiffe – war ein kompakter, schneller und manövrierfähiger Schiffstyp, der überallhin segeln und eine schwere Bewaffnung in Form von Kanonen tragen konnte.[21]
Diese Schiffe hatten, neben Italienern, Flamen und Engländern, auch deutsche Mannschaftsmitglieder. Bekannt ist, dass mindestens ein Deutscher auf Magellans letzter Reise mitsegelte, denn Hans von Aachen (Juan Aleman de Aquisgran) kehrte im September 1522 als einer von 18 Überlebenden der 270 Mann, die drei Jahre zuvor in See gestochen waren, auf der Vittoria nach Sevilla zurück. Als Teil der Indienflotte liefen zwischen 1497 und 1590 über 700 Schiffe aus dem Hafen von Lissabon aus. Die Todesrate ihrer Mannschaften betrug knapp 10 Prozent (bei Kapitänen und Jesuiten war sie niedriger).[22] Deshalb brauchte man unbedingt ausländische Matrosen. Deutsche wurden auf portugiesischen Schiffen zumeist als Kanoniere angeheuert, als bombardeiros alemães. Hans von Aachen war einer von ihnen, ebenso wie ein Deutscher, dessen Name nicht bekannt ist, der 1502 an Vasco da Gamas zweiter Reise teilnahm und seine Erlebnisse in einem Tagebuch festhielt.[23] Der bei Weitem bekannteste deutsche Kanonier war der aus Hessen stammende Hans Staden, ein früherer Soldat, der auf die See floh und an Bord eines deutschen Salzschiffs nach Portugal gelangte, wo er 1547 auf einem portugiesischen Schiff mit Fahrtziel Brasilien als Kanonier anheuerte. Von dieser Reise kehrte er sicher nach Lissabon zurück, doch beim nächsten Mal, zwei Jahre später, hatte er weniger Glück. Das spanische Schiff, das aus Sevilla kommend zum Río de la Plata unterwegs war, sank vor der brasilianischen Küste, und nachdem er auf einer portugiesischen Küstenfestung gedient hatte, geriet er in die Gefangenschaft von Tupinambá-Indianern. Der Bericht, den er später, 1557, über die Gefangenschaft veröffentlichte – die Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschenfresser Leuthen in der Newenwelt America gelegen –, wurde zu einem Bestseller.[24]
Deutsche Kanoniere waren in Portugal und Spanien hoch angesehen. In dieser Zeit kontrollierten Deutsche die Metalllieferungen, und ihre Kanonengießereien galten als die besten in Europa. Nach Ansicht des spanischen Militärautors Luis Collado waren die deutschen und flämischen Gussstücke »die besten, die es gab«.[25] In den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts importierten Spanien und Portugal deutsche Kanonen in großer Stückzahl. Außerdem lockten sie deutsche Kanonengießer und Rüstungsunternehmen auf die Iberische Halbinsel. In Lissabon war schon vor 1466 eine in deutschem Besitz befindliche Schießpulverfabrik errichtet worden. Die später hinzukommenden Kanoniere stießen in der portugiesischen Hauptstadt auf eine beachtliche deutsche Gemeinde aus Kaufleuten, Handwerkern und Druckern. Manche hatten sich wie Hans Staden allein auf den Weg gemacht. Andere waren in Antwerpen, dem Endpunkt des portugiesischen Gewürzhandels, gruppenweise rekrutiert worden. Es gibt einige Belege, die den Umfang dieser Wanderung erkennen lassen. Als Hieronymus Münzer 1494/95 durch die Iberische Halbinsel reiste, bemerkte er im Hafen von Lissabon ein unter deutschem Kommando stehendes Schiff mit dreißig deutschen Kanonieren an Bord, und 1525 forderte das an der Malabarküste gelegene Cochin bei der portugiesischen Krone die Entsendung von hundert Kanonieren an, von denen die Hälfte Deutsche sein sollten.[26]
Heute glaubt niemand mehr, dass die Portugiesen sich ihren Weg nach Asien (und Afrika) einfach freischossen. Vielmehr nutzten sie lokale Rivalitäten aus und schlossen Abkommen, um ihre Handelsposten errichten zu können. Auch waren sie bei militärischen Zusammenstößen mit Nichteuropäern nicht immer erfolgreich.[27] Gleichwohl war die portugiesische Seemacht keine Legende, und die Marineartillerie war ein wichtiger Bestandteil dieser Macht. Portugiesische Schiffe waren schwer bewaffnet; manche hatten Dutzende von Kanonen an Bord.[28] Dementsprechend wurden die deutschen bombardeiros wertgeschätzt. Sie standen über den gemeinen Matrosen auf einer Stufe mit dem Schiffsbarbier und dem Zahl- und Proviantmeister und genossen einige Privilegien. In Portugal wurde ihnen eine Unterkunft zur Verfügung gestellt, sie durften Waffen tragen und erhielten eine Pension. Im späten 15. Jahrhundert gab es in Lissabon derart viele bombardeiros alemães, dass sie die Bartholomäus-Brüderschaft zu dominieren begannen, die bedeutendste Organisation der deutschen Gemeinde, die aus einer von Hansekaufleuten gegründeten Kirchengemeinde hervorgegangen war. Die deutschen Kanoniere brachten ihre Institutionen mit nach Indien, wo sie in Cochin und Goa Kirchengemeinden gründeten. Bis zu den 1540er-Jahren hatten viele von ihnen den Beruf gewechselt und sich dem Handel zugewandt. Manche heirateten südasiatische Frauen. Einige scheinen sich mit ihrem artilleristischen Wissen an lokale Herrscher verdingt zu haben, was ein frühes Beispiel für einen Technologietransfer von West nach Ost wäre. Zu diesem Zeitpunkt hatten die bombardeiros alemães bereits eine entscheidende Rolle bei der portugiesischen Expansion gespielt, sowohl jenseits des Atlantiks nach Brasilien als auch die westafrikanische Küste entlang und in den Indischen Ozean hinein.[29]
Neben deutschen Kanonieren dienten auch deutsche Musketiere der portugiesischen Krone, aber in geringerer Zahl; das portugiesische Reich stützte sich überwiegend auf die Seemacht und die Kontrolle strategischer Küstenstützpunkte. Deutsche Landsoldaten fand man eher im spanischen Heer. Dies galt für die Herrschaftszeit sowohl Karls V. als auch Philipps II., dessen ausgedehntes Reich in Spanien, Italien, Flandern sowie Nord- und Südamerika die spanischen Personalressourcen überforderte. Trotz ihres Rufs, streitsüchtig und gewalttätig zu sein, wurden die deutschen Landsknechte hoch geschätzt. 1572 kämpften mindestens 20 000 deutsche Fußsoldaten und weitere 11 000 Berittene auf verschiedenen Kriegsschauplätzen, vor allem in Europa, für den spanischen König.[30] Die Rolle deutscher Soldaten in den spanischen Besitzungen in Amerika war in der Herrschaftszeit Karls V. am größten. Von einem von ihnen wissen wir, weil er später einen Bericht über seine Erlebnisse verfasste. Ulrich Schmidel stammte aus einer bayerischen Kaufmannsfamilie. 1534, mit Mitte zwanzig, heuerte er in Cádiz bei einer spanischen Expeditionsflotte aus 14 Schiffen an, die zum Río de la Plata segeln sollte; es war die Expedition, während der Buenos Aires gegründet wurde. Laut Schmidels Bericht nahmen neben 2500 Spaniern »150 Hochteusche, Niederlennder unnd Sachsen« an ihr teil.[31] Möglicherweise bildete sich bei diesen Soldaten aus verschiedenen Teilen des Heiligen Römischen Reichs aufgrund des Zusammenseins im Ausland sogar eine Art gemeinsamer deutscher Identität heraus.[32] Schmidel blieb fast zwanzig Jahre in Südamerika und nahm an Eroberungsexpeditionen den Paraguay-Fluss hinauf und bis ins Gebiet des heutigen Bolivien teil.
Schmidel und seine Kameraden waren deutsche Konquistadoren in den Jahren zwischen 1520 und 1550, einer Ära, die von manchen »Zeitalter des Conquistador« genannt wird.[33] Der problematischste deutsche Beitrag zu dieser gewalttätigen Ära der Entdeckungen, Eroberungen und Ausplünderungen betraf Venezuela– »Klein-Venedig« – unter der Herrschaft der Welser aus Augsburg. Sie hatten die Wahl Karls V. zum römisch-deutschen Kaiser mitfinanziert und dem ständig geldklammen Karl in den 1520er-Jahren mit weiteren Krediten ausgeholfen, die sogar noch größer waren als diejenigen der Fugger. Im März 1528 gewährte Karl Agenten der Welser ein asiento, einen Vertrag über Wirtschaftsprivilegien. Zwei Jahre zuvor hatten die Welser in Santo Domingo auf Hispaniola eine Niederlassung eröffnet, die Zucker, Perlen und Gold nach Spanien ausführte und Lebensmittel, Luxusgüter und die Mittel für weitere Eroberungen auf dem amerikanischen Festland – Waffen und Pferde – importierte. Die Ressourcen des Handelshauses machten es für die spanische Krone attraktiv, da es die Anfangskosten der Erschließung bisher nicht ausgebeuteter Gebiete übernehmen konnte. Nach dem Vertrag von 1528 sollten die Welser Venezuela »erobern und besiedeln«. Es wurde erwartet, dass sie binnen zwei Jahren zwei Ansiedlungen mit jeweils mindestens 300 Kolonisten gründeten und die nötigen Befestigungen errichteten. Die damit verbundenen Kosten sollten sie selbst übernehmen; außerdem sollten sie auf ihre Einnahmen das »königlichen Fünftel« zahlen.[34]
Die Welser-Ära in Venezuela begann Ende Februar 1529, als dessen erster Gouverneur, Ambrosius Ehinger, mit 300 Mann auf dem Festland eintraf und sich in der Küstenstadt Coro einrichtete, die damals von einigen Dutzend Europäern bewohnt wurde, die sich aufgrund der nahe gelegenen Perlenbänke dort angesiedelt hatten. Nur ein halbes Jahr nach Ehingers Ankunft unternahm er zusammen mit dem größten Teil der Neuankömmlinge die erste entrada oder Expedition, die zum Muster der Welser-Herrschaft in Venezuela wurde und dem Vorgehen der Konquistadoren anderswo glich. Ehinger verbrachte nur ein Viertel seiner Zeit als Gouverneur in der Hauptstadt. Gleiches galt für seine Nachfolger Nikolaus Federmann, Georg Hohermuth und Philipp von Hutten (einen Cousin des Humanisten und Luther-Gefährten Ulrich von Hutten), die allesamt die erste Gelegenheit ergriffen, Coro hinter sich zu lassen und auf Expeditionen zu gehen. Hohermuth brachte 1535 die größte Gruppe von Neuankömmlingen mit, die während der Welser-Zeit in Venezuela eintraf. Obwohl er vorher noch nie aus Europa herausgekommen war, begab er sich nur drei Monate nach seiner Ankunft mit fast 500 Mann auf eine entrada. Hutten blieb über fünf Jahre in Venezuela, verbrachte aber nur sechs Monate in der Hauptstadt. Während die angehenden Kolonisten und ihre Anführer Expeditionen unternahmen, die manchmal Jahre dauerten, ging es in den Ansiedlungen, in Coro ebenso wie in der zweiten Siedlung, Maracaibo, nicht voran. Von einer wirtschaftlichen Entwicklung konnte kaum die Rede sein, und die Ausfuhren waren vernachlässigbar. Niemand bemühte sich darum, das Potenzial der Perlenbänke auszuschöpfen oder, was noch erstaunlicher war, die Rohstoffvorkommen des Landes auszubeuten.
Man könnte Venezuela eine »gescheiterte Kolonie« nennen, so wie die französische Kolonie in Kanada in den 1540er-Jahren und später die englische Kolonie Roanoke Island in Virginia, die scheiterte, als Probleme aufgrund fehlgeleiteter Arbeitsressourcen und der Vernachlässigung der Sicherung langfristiger Prosperität durch Wetterbedingungen verstärkt wurden.[35] Venezuela war allerdings nie wirklich eine Kolonie. Obwohl von Agenten eines Handelshauses verwaltet, war es eine Ausgangsbasis für Erkundung und Eroberung – eine Konquistadoren-Unternehmung wie andere auch, deren Fußtruppen aus in Sevilla oder auf den Kanarischen Inseln rekrutierten Spaniern bestanden, während die Anführer zufälligerweise Deutsche waren. Die Männer – und es waren ausschließlich Männer –, die als Erste nach Venezuela kamen, gingen fast alle auf entradas, ebenso die meisten, die nach ihnen eintrafen, 1530 und 1535. Viele von ihnen hatten bereits an Expeditionen anderswo in Amerika teilgenommen oder in den Italienischen Kriegen gekämpft. Das Kontingent von 1535 war besonders stark militärisch geprägt. Die Neuankömmlinge, die in Coro an Land gingen, waren mit Bogen, Arkebusen, Lanzen und Rapieren bewaffnet und begierig darauf, Indianer zu »erobern« und zu Christen zu machen und nebenbei hübsche Profite einzustreichen. Auch die Art der Finanzierung der Kolonie trieb die Menschen dazu, an entradas teilzunehmen. Kolonisten erhielten von den Welsern Kredite, die sie verzinst zurückzahlen mussten, während sie gleichzeitig die hohen Preise für über Santo Domingo importierte Güter und Proviant zahlen mussten. Es ist nachvollziehbar, dass verschuldete Kolonisten, die in den ums Überleben kämpfenden Städten Coro und Maracaibo praktisch dienstverpflichtete Knechte waren, auf Risiko gingen und sich dazu entschlossen, sich mit Welser-Krediten für Expeditionen ins Inland auszurüsten.
In den Jahren der Welser-Herrschaft in Venezuela wurden sechs Expeditionen unternommen. Sie dauerten von Mal zu Mal länger, dabei wurden beachtliche Entfernungen zurückgelegt, insgesamt rund 20 000 Kilometer, mehr als bei jeder anderen Unternehmung der Konquistadoren. Von Coro führten die entradas nach Westen in die kolumbianischen Anden und ins hinter ihnen gelegene Tal des Río Magdalena. Auch nach Süden machten sich die Konquistadoren auf den Weg, durch die zum Orinoco-Becken gehörende Ebene östlich der Anden bis zum Standort des heutigen Bogotá, den Federmanns zweite Expedition 1538 zur selben Zeit wie zwei spanische Konquistadoren erreichte. Huttens letzte entrada drang tief ins Amazonasbecken vor, in Gebiete, die bis zu Alexander von Humboldts wissenschaftlicher Expedition über 250 Jahre später kein Europäer mehr betrat. Die Expeditionen der Gouverneure oder Generalkapitäne der Welser waren klassische, von Bewaffneten auf Pferden und zu Fuß unternommene Erkundungs- und Eroberungsmissionen von Konquistadoren. Eines ihrer Ziele war es, eine Westpassage nach Asien zu finden. Aber in erster Linie gingen die Expeditionen auf Schatzsuche – nach einem Schatz, wie Francisco Pizarro ihn nach der Eroberung des Inkareichs in Peru an sich gebracht hatte, oder nach dem Gold, das angeblich in dem mythischen Königreich El Dorado zu finden war. Die entradas forderten von ihren Teilnehmern einen beträchtlichen Blutzoll. Ehinger und Hutten kamen beide ums Leben, Hohermuth starb zwei Jahre nach der Rückkehr von einer Expedition, die seine Gesundheit ruiniert hatte, in Santo Domingo. Die Überlebensrate lag bei nicht mehr als 40 Prozent, das heißt, Hunderte von Teilnehmern blieben auf der Strecke.
Die Ergebnisse waren, wie sich herausstellte, bescheiden. Zwar wurde auf den Expeditionen geplündert, die Beute fiel aber nur gering aus. Ehingers zweite entrada in den frühen 1530er-Jahren war die erfolgreichste, aber die Beute wurde von den nach Coro zurückkehrenden Teilnehmern verloren. Die Konquistadoren in Venezuela fanden überall Dinge von Wert – goldene Ohrringe und dergleichen –, die eingeschmolzen werden konnten. Aber einen Schatz, wie sie ihn suchten, fanden sie nicht. Dies hätte sich geändert, wenn Federmann den Vorrang seines Anspruchs auf die Reichtümer des Muisca-Königreichs in Cundinamarca hätte durchsetzen können, aber die spanische Krone vergab dieses Gebiet – das zum Vizekönigreich Neugranada wurde – an einen spanischen Anwärter. Zweifellos rechneten die Welser ihre Einkünfte aus der Provinz herunter, um ihre Abgaben an die Krone zu verringern, aber Venezuela war offensichtlich weniger profitabel als andere spanisch-amerikanische Provinzen, von Peru über Mexiko bis Neugranada. Die meisten Expeditionen brachten nicht einmal die eigenen Kosten ein. Sie wurden immer mehr zu verzweifelten Versuchen, wenigstens etwas aus dem gescheiterten venezolanischen Unternehmen herauszuholen, bevor die spanische Krone den Vertrag kündigte.
Dies schien angesichts der in der Welser-Gesellschaft ausgebrochenen Streitigkeiten über Venezuela