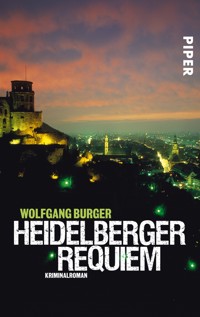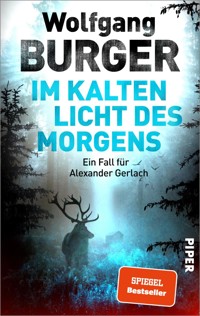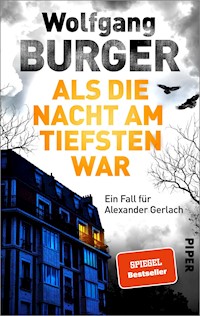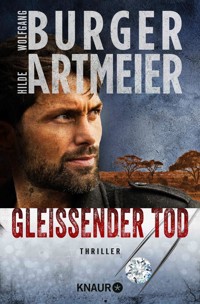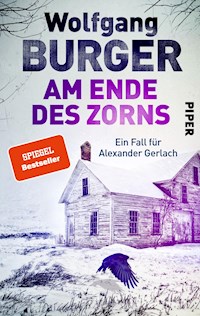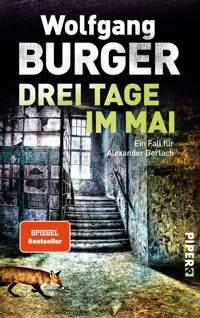9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Kriminaloberrat Alexander Gerlach nach einem Sturz vom Rad im Krankenhaus erwacht, erinnert er sich schemenhaft daran, von einem Mann gestoßen worden zu sein. War es Fred Heergarden, der sich selbst vor einigen Tagen aufgebracht des Mordes an seiner Frau bezichtigt hatte? Deren Tod liegt bereits viele Jahre zurück, doch damals deutete nichts auf einen Mord hin. Ist etwas dran an Heergardens spätem Geständnis, und besteht tatsächlich ein Zusammenhang zu Gerlachs Unfall?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Rebecca
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
3. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96286-5
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung eines
Fotos von Gandee Vasan/Riser/Getty Images (Katze) und
Image Source/Getty Images (Zimmer)
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
1
Dieser hohe reine Ton in meinem Kopf …
Das überirdisch helle Licht …
War ich tot?
Plötzlich wurde es wieder dunkel. Der seltsame Ton blieb, klang jedoch nicht nach Sphärengesang oder Engelsjubel. Jemand drückte grob an mir herum. Ein Arzt? War ich beim Arzt? Und wenn ja, warum? Inzwischen konnte ich auch wieder sehen. Verschwommen zwar, aber immerhin. Einen altertümlichen Kronleuchter sah ich, eine gemusterte Tapete in Brauntönen, dunkelgrüne Samtvorhänge – nein, das war keine Arztpraxis und auch kein Krankenhaus. Aber es fummelte eindeutig jemand an mir herum, wie Ärzte es tun, brummelte medizinisches Fachlatein dazu, ein Daumen zog herzlos mein rechtes Augenlid hoch, wieder knallte das grelle Licht auf die Netzhaut.
»Oho«, sagte eine gemütliche Altmännerstimme, »wir sind ja aufgewacht!«
Ich hätte es vorgezogen, weiter bewusstlos zu sein, denn mir war speiübel. Dazu die mörderischen Kopfschmerzen, ein Hirn aus Watte. Irgendwer hatte jemanden umgebracht, das wusste ich noch. Ich versuchte, etwas zu sagen, brachte jedoch nur ein jämmerliches Keuchen zustande.
»Heißen Sie Gerlach?«
»Das Licht ist so hell«, krächzte ich.
»Versuchen wir bitte mal, dem Licht mit den Augen zu folgen.«
Die künstliche Sonne bewegte sich langsam hin und her. Ihr zu folgen war ein Kinderspiel.
»Hm«, brummte der Arzt befriedigt. »Ohrgeräusche?«
»Was?«
»Hören Sie irgendwelche Geräusche?«
»Nein. Aber das Licht! Bitte!«
»Schon vorbei.«
Wie wunderschön Dunkelheit sein konnte.
»Ihr Name ist also Gerlach?«
»Ja«, erwiderte ich und vermied es, dabei zu nicken.
Der Mann, der offenbar wirklich Arzt war, knetete weiter an mir herum, als wäre ich ein Rinderbraten, dessen Garungsgrad zu testen war.
»Vorname?«
»Alexander.«
»Was für einen Tag haben wir heute?«
Offenbar wollte er mit seinen dämlichen Fragen meine Hirnfunktionen testen.
»Samstag. Siebter Februar.«
»Und was sind wir von Beruf?«
»Bei Ihnen tippe ich auf Arzt.«
»Oho, er macht schon wieder Witze! Sie meinte ich natürlich.«
»Polizei …« Ich musste mich räuspern, was in meinem Magen eine kleine Rebellion auslöste. »Ich bin Polizist. Kripo.«
Etwas Hartes schlug sacht gegen meine rechte Kniescheibe. Gehorsam zuckte das dazugehörige Bein. Ich zwang mich, die Augen wieder zu öffnen, versuchte, das Bild klar zu stellen, aber es wollte mir immer noch nicht gelingen. Das mittlerweile wieder gedämpfte Licht schmerzte dennoch in den Augen, und alles, was ich ansah, verschwamm sofort wieder.
Das Wenige, was ich erkannte, verstärkte jedoch meinen anfänglichen Verdacht: Wo immer ich hingeraten war – eine Arztpraxis war es nicht. Arztpraxen waren üblicherweise hell und pflegeleicht eingerichtet, und von den Decken baumelten eher selten Kronleuchter mit nachgemachten Edelsteinen.
Eine Frau.
Irgendjemand hatte seine Frau umgebracht.
Und etwas stimmte dabei nicht. Wenn ich nur gewusst hätte, was.
»Sie sind sogar der Chef, nicht wahr?«, fuhr mein Quälgeist mit dem Hämmerchen fort. »Wir haben uns erlaubt, einen Blick in Ihre Geldbörse zu werfen, während Sie weg waren.«
»Was ist überhaupt los? Wo bin ich? Ist mir …« Wieder musste ich mich räuspern. »… was passiert?«
»Sie sind vom Rad gestürzt. Und haben sich dabei anscheinend eine zünftige Commotio cerebri zugezogen. Eine Gehirnerschütterung, wie der Volksmund es nennt. Und der Raum, in welchem Sie gerade allmählich wieder zur Besinnung kommen, ist mein Wohnzimmer.«
Der alte Mann schob sein Gesicht in mein Blickfeld. »Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, verzeihen Sie. Kamphusen. Dr. Kamphusen, Internist im schwer verdienten Ruhestand.« Seine Augen blickten trotz der ernsten Miene freundlich. Das Haar war voll und schlohweiß. Jetzt lächelte er sogar. Allzu schlimm schien es nicht um mich zu stehen. »Und das da drüben, das ist Svantje. Seit vierzig Jahren und elf Tagen meine bessere Hälfte und noch ein gutes Stück länger die gute Seele meiner Praxis.«
»Hallo«, sagte ich heiser. »Freut mich.«
Demnach konnte er nicht der Mann sein, der seine Frau umgebracht hatte. Ich versuchte den Kopf in die Richtung zu wenden, in die er blickte. Aber in meinem Magen wurde daraufhin unverzüglich Großalarm ausgelöst. Seufzend gab ich den Plan fürs Erste auf. Svantje Kamphusen konnte ich mir auch später noch ansehen. Ich schloss wieder die Augen. Dunkelheit. Nichts war im Moment schöner als Dunkelheit und Ruhe.
»Svantje hat Sie nämlich gefunden, müssen Sie wissen. Vor fünfzehn Minuten erst. Nur ein paar Meter von unserer Haustür entfernt.«
»Ich kam gerade vom Einkaufen«, fügte eine erstaunlich jung klingende Frauenstimme eifrig hinzu. »Und dann haben Sie dagelegen. Einfach so auf dem Gehsteig. Auf Ihrem Rad. Bewusstlos.«
»Nicht ganz, mein Schatz«, korrigierte der Arzt mit sanfter Strenge. »Herr Gerlach war ja ansprechbar und konnte sogar aus eigener Kraft gehen. Obwohl Sie über starke Sehstörungen geklagt haben.« Nun sprach er offenbar wieder mit mir. »Aber dann sind Sie uns plötzlich zusammengeklappt. Sie waren nur für wenige Minuten weg. Eine mittelschwere Gehirnerschütterung, würde ich nach der ersten, zugegeben flüchtigen Anamnese sagen.«
»Ich war mit dem Rad unterwegs? Wo sind wir eigentlich?«
»Sie können sich nicht erinnern?«
Bloß nicht den Kopf schütteln!
»Kein bisschen.«
Dr. Kamphusen erhob sich und packte sein Hämmerchen weg. »Die üblichen Symptome bei einer Commotio cerebri. Ansonsten ist alles heil geblieben, wie es scheint. Ein paar Schrammen und Prellungen, das vergeht rasch in Ihrem Alter.«
In meinem Alter – das hatte schon lange niemand mehr zu mir gesagt. Zumindest nicht in diesem angenehmen Sinn. Immerhin würde ich in wenigen Jahren fünfzig werden. Ein Umstand, der mir in letzter Zeit manchmal zu denken gab. Die Malaisen des Alters rückten mit jedem Tag unaufhaltsam näher: Prostataprobleme, Erektionsschwäche, Inkontinenz.
Der Arzt raschelte außerhalb meines Sichtfelds geschäftig herum. »Die Erinnerung wird mit der Zeit zurückkehren. Vielleicht nur zum Teil, vermutlich alles. Man wird sehen. Und nun lassen wir Sie ins Uniklinikum bringen …«
»Ich …«
»Keine Sorge, nur für ein paar Tage und nur zur Beobachtung. Ich habe dort einen alten Freund, der …«
»Klinik ist nicht nötig«, fiel ich ihm ins Wort. »Mir geht’s schon wieder prima.«
Er zögerte. Brummte etwas, das ich nicht verstand. »Ich kann Sie nicht zwingen. Aber mein Rat als Arzt …«
Es gelang mir, meiner Stimme eine gewisse Festigkeit zu geben, als ich sagte: »Keine Klinik.«
»Sie hätten einen Helm tragen sollen«, meinte Frau Kamphusen schnippisch. Offenbar nahm sie mir übel, dass ich mich nicht der Autorität ihres Göttergatten fügte. »So etwas kann leicht böse ausgehen, glauben Sie mir.«
»Gibt es jemanden, den wir benachrichtigen können?«, fragte Dr. Kamphusen. »Eine Frau? Kann jemand Sie abholen? Sie dürfen in den nächsten Tagen nicht ohne Aufsicht sein. Es kann zu Komplikationen kommen. Plötzliche Bewusstlosigkeit, zum Beispiel.«
Nein, eine Frau gab es nicht, beziehungsweise doch, aber die konnte mich unmöglich abholen, weil sie mit einem anderen Mann verheiratet war. Beaufsichtigen konnten mich meine Töchter, die waren jedoch zu jung zum Autofahren. In ein Krankenhaus wollte ich auf gar keinen Fall. Ich bat meine Retter, mir ein Taxi zu rufen. Der Vorschlag wurde rundweg abgeschmettert.
Schließlich, als ich wieder halbwegs normal sehen und ohne Hilfe stehen konnte, ein starkes Schmerzmittel geschluckt und mir einige tausend Ermahnungen und Belehrungen angehört hatte, fuhr der betagte Arzt mich in seinem alten Ford nach Hause. Hoch und heilig musste ich versprechen, dass ich in den nächsten Tagen und Nächten keinen Augenblick allein sein würde.
»Ich habe zwei praktisch erwachsene Töchter zu Hause«, erklärte ich meinem Retter während der Autofahrt durchs nördliche Heidelberg und – in der letzten Abendsonne – über die Neckarbrücke. »Sehr zuverlässig. Sehr gewissenhaft. Außerdem geht’s mir schon wieder viel besser.«
»Sie sind ein erwachsener Mann. Ich kann Ihnen nur Ratschläge geben.«
»Was ist eigentlich mit meinem Rad?«
Svantje hatte mein geliebtes Motobecane-Rad mit Dreigangschaltung in der Garage untergestellt, erfuhr ich.
»Das können Sie abholen, wenn Sie wieder auf dem Damm sind. Ihr Bedarf an Radtouren dürfte fürs Erste gestillt sein.«
Wie recht er hatte! Immer noch war mir schwindlig und ein wenig übel. Trotz der Tablette hämmerten die Kopfschmerzen in meinem Schädel, als müsste er von innen ausgebeult werden. Die Augen hielt ich die meiste Zeit geschlossen, weil das gemeine Licht so schmerzte. Warum musste ausgerechnet heute die Sonne scheinen, nachdem es zwölf Wochen lang nur grau, nass und trüb gewesen war?
»Wir werden uns umgehend ins Bett legen, ja?«, gab mir Dr. Kamphusen noch mit auf den Weg, als wir uns an der Haustür verabschiedeten. »Sollten sich neue Symptome einstellen oder die alten zurückkehren, dann rufen Sie bitte diesen Kollegen hier an.« Er kritzelte eine Telefonnummer und die Anschrift in ein Notizbuch mit glänzenden Messingbeschlägen, riss das kleine Blatt aus und überreichte es mir. »Jonas ist ein alter Freund von mir, praktiziert nicht weit von hier in der Weststadt und ist ein erfahrener Allgemeinmediziner. Zudem ist er einer der wenigen, die heutzutage noch Hausbesuche machen. Sollten sich keine neuen Symptome einstellen, wovon ich ausgehe, dann gehen Sie morgen trotzdem zu ihm.« Er schüttelte kräftig meine Hand, sah mir ein letztes Mal besorgt in die Augen. »Bei Jonas sind Sie in guten Händen. Die meisten Doctores sind ja heutzutage technikvernarrte Quacksalber und willenlose Sklaven der Pharmaindustrie.«
Minuten später lag ich in meinem Bett und war heilfroh, wieder in der Waagerechten zu sein. Die Treppe war eine schwere Herausforderung gewesen. Natürlich ging es mir bei Weitem nicht so gut, wie ich behauptet hatte. Meine Töchter waren bei meinem Anblick mehr interessiert als beunruhigt gewesen. Ihr gefühlloser Kommentar hatte gelautet: »Zu uns sagst du immer, wir dürfen nicht ohne Helm fahren.«
Samstag, der siebte Februar. Das war mir immerhin ohne Anstrengung wieder eingefallen. Ein ungewöhnlich warmer, sonniger Tag für diese Jahreszeit. Deshalb hatte ich nach dem Mittagessen spontan beschlossen, eine kleine Radtour zu unternehmen, ein wenig Winterspeck wegzustrampeln, frische Luft in die Lungen zu pumpen nach dem ewigen Wintermief. In Richtung Norden war ich geradelt. Aus der Weststadt heraus, über den Neckar, durch das weitläufige Gelände der Unikliniken, am Zoo vorbei, über die noch völlig kahlen Felder zwischen Handschuhsheim und der Autobahn. In Ladenburg hatte ich später einen Cappuccino getrunken. Auf einer proppenvollen sonnigen Terrasse am Marktplatz. Und das Anfang Februar!
2
»Nette Beule haben Sie da«, stellte Dr. Jonas Slavik am Sonntagvormittag fest. Zuvor hatte er mich einer oberflächlichen und, wie ich fand, ziemlich herzlosen Untersuchung unterzogen.
Eigens für mich hatte er seine Praxis aufgeschlossen, die zum Glück nur wenige hundert Meter von meinem Krankenbett entfernt in einer schönen Jugendstilvilla untergebracht war. »Wie haben Sie das eigentlich angestellt? Am Hinterkopf?«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich wahrheitsgemäß. »Warum?«
»Weil Radfahrer normalerweise nach vorne fallen, über den Lenker. Deshalb haben sie ihre Beulen üblicherweise an der Stirn oder an der Seite. Sie müssen einen sensationellen Salto hingelegt haben. Und Helme sind ja nichts für echte Männer wie uns, was?« Sein Lachen klang unangemessen schadenfroh, fand ich.
»Es geht da ziemlich abwärts«, versuchte ich mich kraftlos zu verteidigen. Das hatte ich gesehen, als ich in den alten Ford seines noch älteren Freundes und Kollegen stieg. Immer noch regte sich nichts in meinem Kopf, wenn ich versuchte, mir die Minuten vor dem Sturz ins Gedächtnis zu rufen. Da war nur eine schwarze Wand. Keine Bilder. Nicht der flüchtigste Schatten einer Erinnerung an den Unfall oder die Zeit davor, so sehr ich mich auch bemühte.
»Sonst alles heil geblieben?«, erkundigte sich Dr. Slavik.
»Im Rücken tut’s auch ein bisschen weh.«
»Dann mal das Hemd hoch, bitte … ooh, ah, schön, sehr schön …Da haben Sie aber mal ein hübsches Hämatom. Sehr sauber abgegrenzt. Ganz symmetrisch. Und wunderbare Farben. Sind Sie auf was Hartes gefallen? Einen Stein vielleicht?«
»Keine Ahnung«, wiederholte ich meinen derzeitigen Lieblingssatz.
»Schön, sehr schön.« Er lachte befriedigt, erlaubte mir, das Hemd wieder in die Hose zu stopfen. »Das wird alles wieder. Reflexe sind im Rahmen des in Ihrem Alter Üblichen.«
In meinem Alter, schon wieder. Aber dieses Mal war es wohl anders gemeint als bei Dr. Kamphusen.
»Jetzt machen wir noch einen kleinen Sehtest, und dann sind wir auch schon fertig. Sie sind privat versichert?«
»Ich bin Beamter.«
»Schön. Sehr schön.«
Am Morgen waren die Zwillinge eifrig ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen. Sie hatten mich genötigt, wenigstens einige Stückchen Toastbrot zu frühstücken und ein Glas handgepressten Orangensaft zu trinken, wegen der Vitamine. Meinen zaghaften Einwand, Vitamine würden gegen Gehirnerschütterungen vielleicht nicht helfen, hatten sie resolut vom Tisch gewischt. Später hatten sie hin und wieder überprüft, ob ich nicht etwa plötzlich ins Koma gefallen war, und jedes Mal nachgefragt, ob ich nicht doch etwas essen wolle.
Was ich jedoch am allerwenigsten hatte an diesem Sonntagvormittag, war Appetit. Vielleicht würde meine so unsanft und peinlich geendete Radtour am Ende auf ganz unerwartete Weise doch noch zur Reduktion meines Körpergewichts beitragen? Die Kopfschmerzen waren inzwischen erträglich, wenn ich regelmäßig meine Tabletten nahm und ruckartige Bewegungen vermied.
Mittlerweile schienen Sarah und Louise ihren Krankenpflegerinnenjob schon langweilig zu finden, denn als ich vom Arzt zurückkehrte, fragten sie umständlich an, ob es vielleicht okay wäre, wenn sie vielleicht ein klein wenig in die Stadt … Freunde treffen und so. Nur für ein Stündchen oder zwei oder so. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden. Sie legten mir Handy und Telefon neben das Bett, stellten eine Flasche Wasser und zwei liebevoll belegte Brötchen daneben und verkrümelten sich erleichtert.
Zigarettenrauch!
Im Halbschlaf, aus dem Nichts, war plötzlich eine Erinnerung da: Zigarettenrauch hatte ich gerochen, kurz bevor es Nacht wurde um mich. Jemand hatte geraucht.
Am Nachmittag kam Theresa vorbei, brachte ein Sträußchen lachsfarbene Rosen mit sowie eine Flasche Sekt, die wir irgendwann auf meine Genesung leeren würden. Die Zwillinge hatten sie angerufen und über meinen beklagenswerten Zustand aufgeklärt. Sie trug heute einen Rock, der nicht ganz bis zu den Knien reichte, setzte sich neben mein Bett, roch gut und bemitleidete mich ein wenig. Da ich als Gesprächspartner nicht viel taugte, begann sie bald, mir die Zeit zu vertreiben, indem sie von diversen Unfällen erzählte, die sie im Lauf ihres bewegten Lebens mehr oder weniger glücklich überstanden hatte.
Ich versuchte tapfer zuzuhören, dämmerte jedoch immer wieder für Sekunden weg.
»Ich weiß bis heute nicht, wie ich das fertiggebracht habe«, hörte ich sie sagen. »Fünfzehn oder sechzehn muss ich damals gewesen sein – und zack, liege ich auf einmal im Graben. Leider war da so ein furchtbar stacheliger Busch, und davon habe ich diese hässliche Narbe hier an der Innenseite des Oberschenkels …«
Sie sprang auf, stellte den linken Fuß auf mein Bett, zog unbekümmert den Jeansrock hoch, und mir wurde vorübergehend wieder schwindlig. In diesem Moment begann das Telefon auf meinem Nachttisch zu trillern.
Theresa ließ den Rock fallen und sah mich auffordernd an. »Möchtest du nicht …?«
Ich schüttelte matt den Kopf. Nein, ich mochte nicht. Schließlich, als es partout nicht aufhören wollte, nahm ich das Telefon doch in die Hand und schaute aufs Display. Wie ich befürchtet hatte, war es Doro.
»Nein«, sagte ich und lege das Telefon wieder zur Seite.
Endlich verstummte das blöde Ding. Allerdings nur, um Sekunden später erneut loszulegen.
»Wer ist es denn?«, wollte Theresa wissen.
»Eine …« Ich hustete. Mein Kopf dröhnte. Das Telefon trillerte. »Eine alte Schulfreundin.«
Theresas Blick wurde sofort inquisitorisch. »Wie alt ist sie denn, diese Schulfreundin?«
»So alt wie ich ungefähr. Und du wirst mir jetzt bitte keine Eifersuchtsszene machen.«
»Hätte ich denn Grund dazu?«
»Natürlich nicht.«
»Du hast mir nie von ihr erzählt. Wie heißt sie denn?«
Dieses Mal schien Doro nicht aufgeben zu wollen. Ich brauchte dringend ein neues Telefon mit Anrufbeantworter.
»Dorothee. Doro. Ich habe sie erst im Dezember wiedergetroffen. Bei dieser Sache mit dem verschwundenen Mädchen. Du erinnerst dich?«
Theresa nickte mit immer noch hochgezogenen Brauen.
»Nach fast zwanzig Jahren. Wusste gar nicht, dass sie auch in Heidelberg lebt …«
»War sie eine gute Schulfreundin, diese … Doro?«
Niemand ist imstande, einen Namen mit so viel Verachtung auszusprechen wie eine eifersüchtige Frau.
»Im Gegenteil. Sie war eine Zicke. Ich konnte sie nicht leiden.«
»Und deshalb ruft sie dich am Sonntagnachmittag an?«
»Theresa, Herrgott!« Ich mäßigte meine Stimme sofort wieder und sank in mein Kissen zurück. »Wir waren in derselben Klasse, das war’s auch schon.«
Endlich verstummte das nervtötende Getriller. Theresa entspannte sich. Beäugte misstrauisch noch ein wenig das Telefon. Vor den Fenstern brach die tief stehende Sonne durch die Wolken.
»Wärst du so nett, die Vorhänge …?«, fragte ich mit betont leidender Miene. »Das Licht …«
Sie sprang auf und zog die dunkelblauen Vorhänge zu. Setzte sich wieder.
»Hast du in den letzten Tagen von einem Fall gehört oder gelesen, bei dem jemand seine Frau umgebracht hat?«, fragte ich vorsichtig.
»Seine Frau umgebracht?«, fragte Theresa verdutzt zurück. »Solltest du als Kripochef so was nicht am besten wissen?«
»Ich habe so ein … ich weiß nicht. Du hast also nichts gehört?«
Sie zuckte die Achseln. »Nö.«
Die nächsten Sekunden verstrichen schweigend. Es war ein zähes Schweigen voller unausgesprochener Fragen.
»Da fällt mir ein«, sagte Theresa schließlich und warf mit einer schnellen Bewegung ihre honigblonde Lockenpracht zurück, »damals war ich noch Studentin. Es gab da jemanden, er war Assistent, ein ganz knuddeliger Typ. Ich hatte vielleicht ein bisschen zu hohe Absätze an dem Tag …«
»Willst du jetzt aus Rache mich eifersüchtig machen? Ich bin Rekonvaleszent, Theresa. Ich brauche Schonung und Verständnis.«
»Ich bin nicht im Geringsten eifersüchtig. Er hat das ganze Semester lang den Prof vertreten, und wie ich ihm also nach dem Seminar hinterherlaufe, um ihn noch irgendwas zu fragen, da knicke ich um, und zack. Er hat mich sogar in die Klinik gefahren zum Nähen. Aber es ist trotzdem nichts daraus geworden. Ich war wohl einfach nicht sein Typ.«
Wieder stellte sie den linken Fuß auf mein Bett, wieder rutschte der Rock so weit nach oben, dass ich freie Sicht auf die geheimsten Stellen ihres wohlgebauten Körpers hatte.
»Diese Narbe hier am Unterschenkel. Man sieht sie kaum noch, findest du nicht auch?«
Die seidenweiche Innenseite ihrer Oberschenkel. Der bordeauxrote, fast durchsichtige Slip, der meine Blicke im Gegensatz zur unsichtbaren Narbe am Unterschenkel magisch anzog. Meine Kopfschmerzen wurden sofort wieder stärker. Sicherheitshalber schloss ich die Augen.
»Du siehst ja gar nicht hin!«
»Mir ist gerade … ein bisschen schwindlig.«
»Denkst du an deine Doro?«
»Theresa, bitte entschuldige, aber ich kann es im Moment nicht freundlicher ausdrücken: Du spinnst.«
Minuten später verabschiedete sie sich mit einem kühlen Kuss auf den Mund, um sich für einen lange geplanten Theaterbesuch am Abend hübsch zu machen. Im Mannheimer Nationaltheater gab man Goethes Faust, Teil eins. Sie würde zusammen mit ihrem Mann hingehen.
Als hätte Doro geahnt, dass ich jetzt allein war, legte das Telefon erneut los.
»Was machst du nur für Sachen, Alexander?«, fragte sie aufgebracht. »Du bist vom Rad gefallen?«
»Mache ich hin und wieder ganz gern. Hält die Reflexe auf Trab.«
»Rede keinen Unsinn. Du hast eine Gehirnerschütterung, habe ich gehört.«
»Von wem?«
»Von deinem Sohn.«
»Henning? Und woher …?«
»Von wem wohl? Von deinen Töchtern. Hast du ihnen endlich …?«
»Rufst du mich an, um mir Vorwürfe zu machen?«
»Aber nein.«
»Du könntest mich zum Beispiel fragen, wie’s mir geht.«
»Wie geht es dir?«
»Schlecht. Ich habe mörderische Kopfschmerzen. Bei der kleinsten Bewegung wird mir schwindlig. Ich liege im Bett und blase Trübsal.«
»Das tut mir leid, Alexander. Du gehörst eigentlich in ein Krankenhaus. Und trotzdem solltest du allmählich …«
»Ich werde mit ihnen reden. Heute noch. Wenn ich es irgendwie hinkriege. Spätestens morgen.«
»Was ist denn überhaupt passiert? Wieso bist du gestürzt?«
»Wenn ich das wüsste. Ich muss irgendwie einen Purzelbaum über den Lenker gemacht haben. Aber ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Der Arzt sagt, es sei normal bei einer Gehirnerschütterung, dass man anfangs kleine Gedächtnislücken hat.«
»Du musst endlich mit deinen Töchtern reden, Alexander. Sie müssen es wissen. Henning muss es wissen. Ich möchte ihn aber nicht aufklären, solange du nicht …« Sie seufzte. »Ich will, dass zwischen uns endlich Klarheit herrscht.«
Ich zog es vor zu schweigen.
»Ich bin diese Heimlichtuerei so leid«, fuhr sie fort. »Außerdem werde ich in letzter Zeit das Gefühl nicht los, dass Henning etwas ahnt.«
»Ich werde es meinen Mädels sagen, sobald es irgendwie passt.«
»Es scheint nie zu passen bei dir.«
»Herrgott!« Nein, nicht aufregen! Die Kopfschmerzen steigerten sich sofort wieder ins Unerträgliche. Ich zwang mich zur Ruhe. Atmete flach. »Ich kann doch nicht einfach beim Frühstück sagen: Mädels, gute Neuigkeiten, ihr habt seit Neuestem einen Bruder.«
»Einen Halbbruder.«
»Juristisch gesehen ist Henning ja überhaupt nicht mein Sohn.«
»Alexander, jetzt hör mir bitte mal zu. Es interessiert mich einen feuchten Kehricht, wie die Juristen das nennen. Ich habe achtzehn lange Jahre darunter gelitten, dass ich Henning seine Herkunft verheimlichen musste. Wie sehr ich gelitten habe, weiß ich übrigens erst, seit ich dich wiedergetroffen habe.«
Bei den Ermittlungen im Dezember hatte ich – allerdings ohne ihr Zutun – herausgefunden, dass ich vor fast zwei Jahrzehnten bei einem Klassentreffen und unter Alkoholeinfluss einen Sohn gezeugt hatte.
»Wenn du nicht Manns genug bist, deine Töchter aufzuklären, dann werde ich es eben selbst tun.«
»Bei der Polizei nennen wir so was Erpressung!«
»Es interessiert mich nicht, wie man das bei der Polizei nennt. Ich werde es tun.«
»Ich rede ja mit ihnen. Bald. Fest versprochen.«
»Du hast es schon fünfmal fest versprochen.«
»Zählst du etwa mit?«
»Natürlich.«
»Sobald ich wieder auf den Beinen bin, okay?«
Wieder seufzte sie. »Und nächstes Mal setzt du bitte einen Helm auf, wenn du aufs Rad steigst. Ich will nicht, dass Henning seinen eben erst wieder aufgetauchten Vater gleich wieder verliert.«
Die nächste Frau, die mich an diesem elenden Sonntagnachmittag anrief, um mir Vorwürfe zu machen, war Sönnchen, meine Sekretärin.
»Sie machen ja Sachen, Herr Gerlach! Wie geht’s Ihnen denn?«
»Steht es jetzt schon in der Zeitung? Oder ist es in den Fernsehnachrichten gekommen?«
»Meine Nichte hat mich vorhin angerufen und gesagt, Sie hätten einen Fahrradunfall gehabt.«
»Ihre Nichte?«
»Facebook, Herr Gerlach.«
»Ich glaube, ich muss mal ein paar ernste Worte mit meinen Töchtern reden.«
»Sie haben nicht verraten, was genau passiert ist. Bloß, dass Sie einen Fahrradunfall gehabt haben und das Bett hüten müssen.«
»Weiß die Welt auch schon, wie lange ich noch liegen muss? Das würde mich nämlich auch interessieren.«
»Ein paar Tage bestimmt. Mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen, das weiß ich auch ohne Internet. Sie liegen doch hoffentlich brav im Bett?«
»Im Moment ja. Aber morgen, spätestens übermorgen bin ich wieder im Büro.«
»Das werden wir ja sehen. Was ist denn eigentlich passiert?«
»Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich vom Rad gefallen und habe mir den Kopf gestoßen. Und wenn Sie jetzt auch nur ein Wort zum Thema Helm sagen, dann haben Sie einen neuen Feind auf der Welt, Frau Walldorf!«
»Sie haben also wirklich keinen aufgehabt?«
»Was genau bedeutet das Wörtchen ›wirklich‹ in Ihrer Frage?«
»Bei Facebook wird behauptet, Sie seien ohne Helm unterwegs gewesen und …«
Meine Kopfschmerzen schwangen sich zu ungeahnten Höhen auf. »Ich werde meinen Töchtern das Internet abklemmen«, stieß ich durch die Zähne hervor. »Sobald ich aufstehen kann, klemme ich ihnen das Internet ab.«
»Gar nichts klemmen Sie ab. Sie bleiben jetzt erst mal im Bett. Und Sie kommen morgen auch nicht ins Büro. Ich werd Sie krankmelden. Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Sie bleiben einfach nur im Bett und werden wieder gesund. Und keine Angst, die Welt geht schon nicht unter ohne Sie.«
Der Tag war noch nicht zu Ende. Tage, die man im Bett verbringt, sind überhaupt erstaunlich lang.
Noch eine dritte Frau rief mich an. Diese allerdings erst, als es draußen schon dunkelte, und erstaunlicherweise wusste sie noch nichts von meinem blamablen Unfall.
»Mama, du?«
»Ja, ich. Wie geht’s dir, Alex?«
»Prima. Und dir? Wie ist das Wetter bei euch in Portugal?«
»Mir geht es gut. Sehr gut, danke.« Ach herrje, da gab es offenbar ein Problem. »Windig ist es. Seit Tagen schon. Sehr windig.«
»Soll im Winter am Meer hin und wieder vorkommen. Du bist doch nicht etwa krank?«
»Krank?«, fragte meine einundsiebzigjährige Mutter, als wäre das eine ganz und gar weltfremde Frage. »Wie kommst du denn darauf?«
»Du klingst so … Du klingst nicht, als würde es dir gut gehen, ehrlich gesagt.«
»Ich bin kerngesund. Mir geht es wunderbar.«
Nein, da stimmte etwas ganz und gar nicht. Meine Mutter rief mich üblicherweise zweimal im Jahr an, seit sie mit Vater zusammen ihren Wohnsitz an die Algarve verlegt hatte. Einmal an Weihnachten und einmal zu meinem Geburtstag. Sie zählte nicht zu der Sorte Mütter, die in ihrer Rolle aufgehen.
»Und wie geht’s Papa?«
»Dem geht es auch gut. Sehr gut sogar.«
»Mama, raus mit der Sprache – was ist los? Du rufst mich doch nicht einfach so an.«
»Wieso denn nicht? Man wird als Mutter doch einfach mal sein Kind anrufen dürfen. Dir geht es wirklich gut?«
»Mir geht es wunderbar.«
»Und Sarah und Louise?«
»Denen geht es sowieso immer gut. Obwohl, in zwei Wochen gibt’s Zeugnisse, und dann wird sich das wahrscheinlich ändern …«
»Sind sie immer noch in der Pubertät?«
»Mittendrin. Aber das meiste Geschirr ist noch heil.«
»Fehlt ihnen die Mutter denn gar nicht?«
»Doch, natürlich.«
»Und wie sieht es aus …?«
»Wie sieht was aus?«
»Gibt es vielleicht eine neue Frau in deinem Leben?«
»Nein. Ja.«
»Ja? Wer ist sie? Ist sie nett? Mögen die Kinder sie?«
»Ja, sie ist nett. Wenigstens meistens. Und ja, die Mädels mögen sie.«
»Habt ihr vor zu heiraten?«
»Davon ist momentan keine Rede, Mama.«
Dass Theresa bereits verheiratet war, brauchte meine Mutter nun wirklich nicht zu wissen. Sonst würde sie vermutlich ab sofort täglich anrufen.
»Werdet ihr uns endlich mal besuchen hier unten im Süden? Es ist wirklich schön hier.«
»Ich weiß, Mama. Irgendwann kommen wir ganz bestimmt. Und du wirst auch meine neue … Partnerin kennenlernen. Ihr werdet euch mögen, da bin ich mir sicher. Du hast doch nicht etwa Heimweh, Mama? Das Wetter hier im Norden, ich kann dir sagen …«
»Heimweh? Um Gottes willen, nein! Ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr in Deutschland bin. Wie hoch liegt der Schnee zurzeit?«
»Hier liegt kein Schnee. Vorhin hat sogar ein bisschen die Sonne geschienen. Und gestern war’s so warm, dass ich eine kleine Radtour gemacht habe.«
»Mit den Mädchen? War die … Frau auch dabei? Wie heißt sie eigentlich?«
»Erstens: Für pubertierende Mädchen gibt es nichts Uncooleres als Radtouren mit ihrem Papa. Zweitens: Sie war nicht dabei. Drittens: Sie heißt Theresa. Und viertens: Du wirst auf deine alten Tage ganz schön neugierig, Mama.«
Mein Scherz kam nicht gut an.
»Man wird sich als Mutter doch wohl noch dafür interessieren dürfen, wie es dem eigenen Fleisch und Blut geht!«
»Natürlich, Mama. Aber … du willst mir wirklich nicht sagen, was los ist?«
»Was soll los sein?«
»Papa geht’s auch gut?«
»Sehr gut geht es dem sogar. Sehr gut.«
Ein bisschen klang es wie: zu gut. Da unten im windigen Süden hing der Haussegen offenbar gewaltig schief. Aber heute würde ich nicht erfahren, was mir die ungewohnte Anhänglichkeit meiner Mutter bescherte. So plauderten wir noch ein wenig über das Wetter in Mitteleuropa im Speziellen und die Klimaerwärmung im Allgemeinen und legten schließlich auf im Einvernehmen darüber, dass es uns allen – von Kleinigkeiten abgesehen – sehr gut ging.
Nun war es dringend Zeit für die nächste der Schmerztabletten, die Dr. Kamphusen mir mitgegeben hatte. Alle sechs bis acht Stunden durfte ich eine davon nehmen. Ich hatte die Dosis eigenmächtig ein wenig erhöht, denn schließlich hatte ich keine Lust, ewig im Bett zu liegen und mit dröhnendem Kopf die Decke anzustarren.
3
Am Montagmorgen hielt sich mein Drang, aus dem Bett zu springen, immer noch in Grenzen. Wie ich es auch drehte und wendete, so sehr ich es auch hasste – ich war vorübergehend außer Gefecht. So wählte ich um Viertel nach acht meine eigene Nummer in der Polizeidirektion. Sönnchen nahm nach dem zweiten Klingeln ab.
»Meine Cousine hat am Samstag übrigens auch einen Salto über den Lenker gemacht«, war das Erste, was sie zu erzählen wusste.
»Am Samstag war anscheinend halb Heidelberg mit dem Rad unterwegs«, brummte ich.
»Wenn sie keinen Helm aufgehabt hätte – ach so, das Wort darf ich ja nicht …«
Wir gingen die Termine des Tages durch und sicherheitshalber auch gleich die des Dienstags. Zu meiner Erleichterung war nichts dabei, was keinen Aufschub duldete. »Sönnchen, Sie wissen doch alles, was in Heidelberg passiert. Ist Ihnen irgendwas bekannt geworden von einem Mann, der in letzter Zeit seine Frau umgebracht hat?«
»Seit der Geschichte in Hirschberg letzten November nicht. Wieso?«
»Nur so.«
Der Gattinnenmord in Hirschberg hatte zu den aus kriminalistischer Sicht eher einfachen Fällen gezählt: Arbeitslosigkeit, Krankheit, Hoffnungslosigkeit, Geldsorgen und Alkohol. Nachdem der Täter wieder halbwegs nüchtern und bei Sinnen gewesen war, hatte er selbst die Polizei gerufen, den Kollegen die Tür geöffnet, ihnen die Waffe ausgehändigt – ein kleines Beil, das er sonst zum Holzhacken benutzte – und sich widerstandslos festnehmen lassen. Nein, das war nicht die Geschichte, die ich suchte. Der Mann saß längst im Gefängnis und wartete auf seinen Prozess.
»Sind Sie diesen komischen Kerl am Freitag eigentlich ohne Probleme wieder losgeworden?«, fragte Sönnchen.
»Welcher komische Kerl?« Noch während ich die drei Worte aussprach, fiel es mir wieder ein: Ein älterer, groß gewachsener und sehr hagerer Mann war kurz vor Dienstschluss in mein Büro geplatzt, ohne Termin, ohne Anmeldung, aufgewühlt und zornig. Nicht einmal Sönnchen hatte es geschafft, ihn aufzuhalten. Der Name des Besuchers war mir dummerweise entfallen.
»Sie können sich nicht mal daran erinnern? Da muss es Sie ja schlimmer erwischt haben …«
»Natürlich kann ich mich erinnern! War eine ziemliche Nervensäge, der Kerl, aber nachdem er eine Weile rumgeschimpft hat, ist er freiwillig wieder abgezogen.«
»Tut mir leid, dass ich losmusste, wie er noch bei Ihnen drin war. Aber ich hab einen ganz dringenden … Was hat er eigentlich gewollt?«
Ja, was hatte er eigentlich gewollt? Fettige, viel zu lange Haare hatte er gehabt, im Nacken zu einem dünnen Schwänzchen gebunden. Eine nicht mehr ganz saubere und schon ziemlich verblichene Jeans hatte er getragen, dazu ein kariertes Hemd und eine abgewetzte schwarze Lederjacke mit vielen Taschen und ohne Ärmel. Und kolossalen Mundgeruch hatte er gehabt. Und außerdem hatte er nach Rauch gestunken. Die Finger der Rechten waren gelb gewesen vom Nikotin. Sollte er etwa …? Natürlich!
Plötzlich war alles wieder da. Seine Stimme. Seine Worte. Meine Erinnerung kehrte zurück. Nur der Name. Der Name fehlte noch.
»Er hat behauptet, er hätte seine Frau umgebracht«, sagte ich.
»Und da rennt er schnurstracks zur Kripo und macht ein solches Tamtam? Wenn ich eine Mörderin wäre, dann würde ich ein bisschen bescheidener auftreten, ehrlich gesagt.«
»Der Mord ist vor einer Ewigkeit passiert, hat er gesagt. Angeblich war er lange im Ausland.«
»Und jetzt plagt ihn auf seine alten Tage das Gewissen?«
»Ungefähr so hat er es formuliert, ja: Sein Gewissen lässt ihm keine Ruhe.«
»Sie haben ihm die Geschichte doch nicht etwa geglaubt? Wenn das stimmen würde, dann müssten wir ja irgendwo einen ungeklärten Mordfall haben. Oder … soll ich vielleicht sicherheitshalber mal im Archiv …?«
»Ich weiß nicht. Er hat nicht gewirkt wie ein Verrückter, auch wenn er sich zeitweise so aufgeführt hat. Ich wollte sogar einen Blick in die Akte werfen, damit er sich beruhigt. Aber der Fall – falls es ihn überhaupt gibt – ist so alt, dass auf unseren Servern nichts darüber zu finden war.«
»Digital haben wir die alten Sachen ja nicht. Wenn’s diese Akte überhaupt gibt, dann liegt sie im Keller.«
»Ich habe ihm versprochen, mich darum zu kümmern, und da ist er schließlich wieder abgezogen.«
»Wenn Sie mir jetzt noch den Namen verraten, dann flitze ich runter zur Gerda. Mit der wollt ich sowieso schon seit Ewigkeiten mal wieder ein Schwätzchen halten. Ihr Mann ist letztes Jahr ganz plötzlich gestorben.«
»Das ist leider das Dumme: Der Name fällt mir nicht ein. Ist aber bestimmt nur eine Frage der Zeit.«
»Vor dreißig Jahren, hat er gesagt?«
»Ungefähr.«
»So viele Morde haben wir ja zum Glück nicht in Heidelberg …«
Wie wohl es tat, sich wieder zu erinnern! Ich bettete den kaum noch schmerzenden Kopf auf mein gemütliches Kissen und schloss die Augen. Inzwischen sah ich das knochige, von tausend Falten zerfurchte Gesicht des angeblichen Gattinnenmörders deutlich vor mir. Die tief liegenden, wässrigen, unentwegt zwinkernden Trinkeraugen, die rekordverdächtigen Tränensäcke, das fettige und schon ziemlich schüttere Haar. Fast roch ich noch den Schweißgeruch seines lange nicht gewaschenen Hemds. Seinen fauligen Atem. Und dazu den Gestank nach hunderttausend gerauchten Zigaretten, der aus allen seinen Poren zu dringen schien. Nur nach Alkohol hatte er merkwürdigerweise nicht gerochen, obwohl das gut gepasst hätte. Seine Hände hatten ziemlich gezittert.
Der Mann hatte – wie die meisten Menschen, die von einer fixen Idee besessen sind – eine enorme Hartnäckigkeit an den Tag gelegt. Er hatte insistiert, war laut geworden, am Ende sogar beleidigend. Auch mein Ton war schließlich nicht mehr so freundlich gewesen. Irgendwann war er mitten im Satz aufgesprungen und türenknallend davongestürmt.
Wenn mir nur sein Name wieder eingefallen wäre …
Am Morgen hatte es eine kurze Diskussion gegeben, ob meine jungen Pflegerinnen angesichts meines bejammernswerten Zustands nicht besser die Schule schwänzen sollten.
»Die Noten stehen doch eh schon alle fest.«
Zu ihrer Enttäuschung hatte ich mich geweigert, die vorbereiteten Entschuldigungen zu unterschreiben. Ich brauchte keine Aufsicht und keine Krankenpflegerinnen mehr. Verglichen mit dem Vortag ging es mir schon wieder blendend. Als ich allerdings aufstand, um mir aus der Küche einen Apfel zu holen, schwankte plötzlich die Welt, und ich musste mich schnell irgendwo festhalten. Auch das Sehen wollte noch nicht wieder zuverlässig funktionieren. Ganz abgesehen von diesen verfluchten Kopfschmerzen! Helles Licht konnte ich nach wie vor nicht vertragen.
Der Apfel wurde schließlich im Liegen und nur zur Hälfte verzehrt. Dann war mir der Appetit schon wieder vergangen. Eine Weile lag ich ganz still, betrachtete zum ersten Mal seit Langem wieder die beiden silbern gerahmten Bilder, die über meinem Bett an der Wand hingen. Stiche, die meine Heimatstadt Karlsruhe zeigten und aus dem Haushalt meiner Eltern stammten, die natürlich beim Umzug nach Portugal vieles hatten aussortieren müssen. Ich fühlte, wie der Schwindel nachließ, die Kopfschmerzen schwächer und schwächer wurden, lauschte auf die Alltagsgeräusche von der Straße. Und dann wurde mir langweilig.
Lesen kam nicht infrage, aber meine Mädchen hatten mir netterweise ein kleines Radio neben das Bett gestellt. Ein knatterbuntes, pausbäckiges Kinderradio mit erbärmlichem Ton. Ich fand einen Sender, der Musik brachte.
Meine Gedanken trudelten ziellos herum. Das Gedudel im Radio war einschläfernd, aber ein anderer Sender ließ sich nicht sauber einstellen. Wencke Myhre gab mir den Rat, nicht in jeden Apfel zu beißen. Daraufhin aß ich auch die andere Hälfte meines kargen Frühstücks.
Vor dem Fenster war es heute wieder so grau wie in den langen Wochen zuvor. Hin und wieder schien es ein wenig zu regnen. Meine Augenlider sanken herab. Und immer noch gelang es mir nicht, mich an den Namen des merkwürdigen Kerls vom Freitag zu erinnern. Oder daran, auf welchem Weg ich dorthin gelangt war, wo ich ziemlich genau vierundzwanzig Stunden später auf dem Gehweg …
Auf dem Gehweg?
Plötzlich war ich wieder wach. Ich tat alles Mögliche mit meinem Rad. Befuhr manchmal Einbahnstraßen in der falschen Richtung, missachtete sogar die eine oder andere rote Ampel. Aber niemals fuhr ich auf dem Gehweg. Zumindest nicht, wenn die Straße daneben so wenig befahren war wie die – wie hatte sie noch geheißen? Mir wurde klar, dass ich nicht einmal wusste, wo genau ich eigentlich verunglückt war. Neuenheim jedenfalls. Hanglage. Dort, wo die Häuser groß und die Grundstücke weitläufig waren. Dort, wo der wohlhabende Teil der Heidelberger Bevölkerung wohnte. Und immer wieder kehrten meine herumschweifenden Gedanken zu dem verrückten alten Kauz zurück, der angeblich seine Frau ermordet hatte.
Wenn mir nur der Name endlich wieder eingefallen wäre!
Irgendwann im Lauf des endlosen Vormittags rief ich, nur um wieder einmal eine menschliche Stimme zu hören, Sönnchen an und fragte sie, wie der Laden lief, so ohne den Chef. Ein winziges bisschen enttäuscht war ich schon, als sie gelassen erwiderte: »Keine Probleme. Alles im grünen Bereich.«
Außerdem richtete sie mir bei dieser Gelegenheit von meinem Vorgesetzten und allen Kolleginnen und Kollegen die allerherzlichsten Genesungswünsche aus.
»Würden Sie mir einen Gefallen tun, Sönnchen?«
»Fast jeden.«
»Würden Sie auf meinem Schreibtisch nachsehen, ob ich mir vielleicht den Namen dieses Kerls irgendwo notiert habe?«
Das tat ich üblicherweise, da ich schon immer dazu geneigt hatte, während eines Gesprächs den Namen meines Gegenüber zu vergessen. Dieses Mal hatte ich es offenbar unterlassen, denn Sönnchen fand nichts.
»Wie war das eigentlich, als er reinkam?«
»Es hat geklopft, ziemlich laut, und dann ist er auch schon vor mir gestanden. Er will zu meinem Chef, hat er gesagt und mich ganz bös angeguckt. Ich hab gesagt, so geht das aber nicht. Er hat gesagt, doch, das geht, weil, es ist wichtig. Ich bin dann aufgesprungen, weil er einfach weitergehen wollt. Da hat er mich ganz finster angeguckt und gesagt, ich wär nicht die erste Frau, die er abmurkst.«
»So hat er das gesagt? Abmurkst?«
»Wörtlich. Und eine Sekunde später ist er bei Ihnen drin gewesen und hat mir fast noch die Tür an den Kopf geknallt.«
Warum beschäftigte mich die kuriose Geschichte so? Weshalb kehrten meine Gedanken wieder und wieder zu diesem nicht allzu langen, wenn auch äußerst ungemütlichen Gespräch zurück? Nicht nur wütend war er gewesen. Auch verzweifelt. Hoffnungslos. Obwohl die Frau schon seit dreißig Jahren tot war.
Angeblich.
Ich wusste ja weder, ob diese Frau jemals existiert hatte, noch, ob sie tatsächlich tot war.
Auf dem Gehweg … Wie mochte ich nur auf den Gehweg geraten sein? War ich vielleicht gegen den Bordstein gefahren und über den Lenker …? Oder hatte mich jemand abgedrängt, ein entgegenkommendes Auto vielleicht? Dann hätte Svantje Kamphusen mich auf dem rechten Gehweg gefunden und nicht auf dem linken. War mir ein Kind in den Weg gesprungen? Eine Katze?
Ich versuchte, mich an die Stunden und Minuten vor meinem Sturz zu erinnern. Systematisch, von Anfang an. Ladenburg, Sonne, der Cappuccino auf dem Marktplatz. Gegenüber die kleine Buchhandlung, in deren Fenster ein buntes Plakat eine Lesung ankündigte. Den Namen der Autorin hatte ich nie zuvor gehört. Später war ich weitergeradelt, in Richtung Norden. Durch Heddesheim, genau, mit den beiden Hochhäusern am östlichen Ortsrand. Im höheren der beiden hatten wir vor einem Jahr eine ermordete Frau gefunden. Dann ein Golfplatz. Nördlich von Heddesheim gab es einen Golfplatz, wo Anfang Februar natürlich kein Betrieb herrschte. Ich erinnerte mich an einen Parkplatz, wo vereinzelte teure Autos herumstanden, und an Arbeiter, die auf dem weitläufigen Grün werkelten, das noch gar nicht richtig grün war. Warm war es gewesen. Viel zu warm für Anfang Februar.
Vor den Fenstern goss es jetzt in Strömen, wurde mir plötzlich bewusst, und es schien von Stunde zu Stunde dunkler statt heller zu werden.
Ich erhob mich vorsichtig, blieb ein Weilchen auf der Bettkante sitzen, bis mein Gehirn sich mit der neuen Lage angefreundet hatte, und schlurfte wie ein Achtzigjähriger zur Toilette. Anschließend suchte ich meine Radwanderkarte und fand sie nicht. Konnte ich auch nicht, fiel mir dann ein, denn die steckte immer noch in der Lenkertasche meines Rads, das immer noch in der Garage des Ehepaars Kamphusen stand.
Ein See! An einem kleinen Badesee war ich vorbeigekommen, am Rand von Weinheim. Gut gelaunte Enten, würdig watschelnde Gänse, keifende Möwen, Spaziergänger in der Spätwintersonne, viel zu warm angezogene Kinder, die das Federvieh begeistert fütterten. Ein Weilchen hatte ich auf einer Bank gesessen und dem bunten Treiben zugesehen.
In Hirschberg hatte ich sogar mit mir gerungen, ob ich mir ein Eis gönnen sollte. Das hätte jedoch mit meinem Vorsatz im Widerspruch gestanden, durch meine sportliche Betätigung ein wenig abzunehmen, und so hatte ich tapfer widerstanden. Später in der schon tief stehenden Sonne die Strahlenburg über Schriesheim, Weinberge, blattlose Rebstöcke, an denen noch vereinzelt verschrumpelte Trauben baumelten. Und dann – nichts mehr. Die restlichen sechs Kilometer und zwanzig Minuten blieben hartnäckig im Dunkeln.
Ich erwachte, als die Zwillinge aus der Schule kamen. Zwei Stunden lang hatte ich tief geschlafen. Ich fühlte mich frisch und ausgeruht und kerngesund. Außerdem hatte ich etwas geträumt. Normalerweise erinnere ich mich nicht an meine Träume, aber dieser war wohl zu aufwühlend gewesen: Ein großer, dunkler Mann hatte vor mir gestanden und mich bedroht. Breite Schultern, Anzug und Krawatte, was gar nicht zu seinem groben und vor Wut geröteten Gesicht passen wollte. Rekordverdächtige Tränensäcke. Nein, das konnte nicht sein. Der Kerl mit den Tränensäcken war zwar groß gewesen, aber schlank, fast dürr. Und im dunklen Anzug konnte ich ihn mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weshalb verfolgte mich diese dumme Geschichte nun auch noch bis in meine Träume? Nun ja, es gab momentan nicht viel Aufregendes in meinem Leben …
Ich bat meine Töchter um einen Cappuccino.
»Darfst du das denn?«
»Wer will es mir verbieten?«
»Der Arzt.«
»Den frag ich einfach nicht.«
»Willst du nicht erst mal was essen? Wir machen Pfannkuchen.«
»Ein bisschen vielleicht.«
»Wir machen Pfannkuchen mit Blaubeermarmelade, und dann isst du mit uns.«
Die Pfannkuchen schmeckten, als hätte ich sie selbst gebacken, und beim Essen kehrte plötzlich mein Appetit zurück. Die Zwillinge waren stolz auf sich und auf mich, und am Ende bekam ich zur Belohnung sogar meinen Cappuccino. Danach fühlte ich mich wiederhergestellt und beschloss, das Bett vorläufig zu verlassen.
Dr. Slavik hatte vollkommen recht, überlegte ich in der Langeweile des verregneten Montagnachmittags, während ich durch meine Vierzimmeraltbauwohnung tigerte. Wenn man mit dem Fahrrad stürzt, kann man sich an allen möglichen Stellen Beulen und Blutergüsse zuziehen, aber kaum am Hinterkopf. Den Bluterguss am Rücken zu besichtigen gestaltete sich schwierig, aber es ging. Der dunkelblaue Fleck mit Stich ins Grüne war klein und kreisrund. Ein Stein vielleicht, kleiner als eine Kinderfaust? Mein Kopf rebellierte heftig gegen meine Gymnastikübungen vor dem Spiegel. Das aus dem Boden ragende Ende eines Rohrs?
Schließlich kam mir eine Idee: Ich bat meine Töchter, die in Sarahs Zimmer gemeinsam über ihren Hausaufgaben brüteten, mein Hämatom zu fotografieren und mir außerdem einen ihrer beiden Laptops zu überlassen. Sarahs neues Smartphone wurde gezückt, und eine Minute später konnte ich meinen lädierten Rücken ohne Verrenkungen begutachten. Der Bluterguss war nicht nur rund, er hatte sozusagen Flügel. Oben und unten zwei gleich große, jedoch deutlich schwächere Abdrücke. Vollkommen symmetrisch. Vollkommen seltsam. Das war weder ein Stein gewesen noch ein Rohr, das konnte nur … ja was?
Im Internet sah ich mir den Norden Neuenheims aus der Vogelperspektive an, entdeckte jedoch nichts, was irgendwelche Erinnerungen ausgelöst hätte. Ich versuchte, die Anschrift von Dr. Kamphusen herauszufinden, fand aber nur die Internetseite seiner ehemaligen Praxis, die er vor fünf Jahren einem Nachfolger übergeben hatte. Ich rief dort an und stieß bei verschiedenen jungen Damen auf konsterniertes Unverständnis, gewürzt mit einem ordentlichen Schuss offener Ablehnung. Schließlich wurde ich an eine ältere Sprechstundenhilfe weitergereicht, die noch unter dem Vorgänger gedient hatte.
»Ja, der alte Herr Doktor«, seufzte sie wohlig und mit verhaltener Stimme. »Das waren noch andere Zeiten. Damals ist es noch um Patienten gegangen und nicht nur um Fallzahlen und Praxisbudgets. Zum Glück haben sie jetzt endlich diese dumme Praxisgebühr wieder abgeschafft. Was wollen Sie denn von ihm?«
»Ihm und seiner Frau einen Blumenstrauß schicken.« Ich erzählte ihr von meinem Unfall und der herzlichen Fürsorge des alten Arztes, der mir sozusagen das Leben gerettet hatte.
»Wegen der Gehirnerschütterung kann ich mich aber blöderweise nicht an die Adresse erinnern. Und hinfahren mag ich nicht …«
»Sollten Sie auch nicht, wenn das erst vorgestern gewesen ist. Haben Sie etwa keinen Helm aufgehabt?«
»Der ist mir leider beim Sturz runtergefallen.«
»Dann sollten Sie nächstes Mal den Riemen straffer ziehen. Wenn der Riemen nicht straff sitzt, nützt der ganze Helm nichts.«
Diesen nützlichen Hinweis versprach ich künftig unbedingt zu beachten. Daraufhin diktierte sie mir Straße, Hausnummer und zur Sicherheit auch noch die Telefonnummer ihres verehrten alten Chefs. Anschließend klagte sie noch ein wenig über geldgierige Ärzte und neunmalkluge junge Kolleginnen, und am Ende verabschiedeten wir uns wie Komplizen, die soeben einen fetten Coup ausgeheckt hatten.
Mithilfe ihrer Angaben fand ich das Haus des alten Arztes im Internet mit zwei Klicks. Es lag am steilen Westhang des Heiligenbergs. Unterhalb grenzte ein weitläufiges, fast parkähnliches Grundstück an den auch nicht gerade kleinen Garten des Ehepaars Kamphusen. Die Frau war vom Einkaufen gekommen, als sie mich fand, war also die Straße heraufgekommen, an dem dicht bewachsenen Nachbargrundstück vorbei. Und irgendwo dort musste ich gelegen haben. Mitten in dem kleinen Park stand ein großes, dunkles Haus, das wegen der Bäume in der Satellitenansicht nur schlecht zu sehen war. Eine Villa, fast ein kleines Schloss. Regte sich da etwas in meinem Kopf?
Nein. Nichts regte sich.
Ich klappte den Laptop zu und gönnte meinen erschöpften Augen Erholung. Versuchte, mir meinen Traum noch einmal in Erinnerung zu rufen. Der große, breite Mann im dunklen Anzug. Seine drohende Miene. Seine Hand an meiner Brust. Offenbar hatten wir eine Auseinandersetzung gehabt. Weshalb? Weil ich auf dem Gehweg geradelt war? Wohl kaum. Was war es dann? Und weshalb projizierte ich immer wieder die Augen des angeblichen Gattinnenmörders ins Gesicht des Schlägertyps im Anzug? Je mehr ich mich anstrengte, mir die Bilder ins Gedächtnis zu rufen, desto verworrener wurde alles. Am Ende war ich fast überzeugt, dass es einfach nur ein Traum gewesen war. Dass es nichts zu bedeuten hatte.
Ich brachte Sarah ihren Laptop zurück, der ziemlich verstaubt war, weil Computer aus der Mode gekommen waren, wie ich erst kürzlich gelernt hatte. Laptops taugten heutzutage nur noch für Hausaufgaben und für Opas. Moderne Menschen nutzten ihre Smartphones.
4
Mitten in der Nacht schrak ich aus einem unruhigen, schweißtreibenden Schlaf hoch. Wieder war ein winziger Schnipsel Erinnerung an die Oberfläche getrieben.
Meine Frage hatte gelautet: »Wann? Wann genau soll das denn gewesen sein?«
»Fünfundachtzig«, hatte der alte Mann mit den Trinkeraugen geantwortet. Er hatte mir vermutlich auch das genaue Datum genannt, aber an diesen Teil des Gesprächs konnte ich mich wieder nicht erinnern. Da war noch etwas gewesen. Etwas Ungewöhnliches. Die Frau hatte einen Beruf gehabt, einen nicht alltäglichen Beruf.
Ich konnte nicht mehr einschlafen, wälzte mich im Bett herum, grübelte und schaltete schließlich meinen alten Rechner ein. Aus der Küche holte ich mir ein Glas Orangensaft, stöberte lange und erfolglos im Internet nach Meldungen aus jener Zeit vor fast dreißig Jahren, in denen eine gewaltsam ums Leben gekommene Frau vorkam. Und fand nichts. Jetzt half nur noch das Archiv der Polizeidirektion weiter, das um diese Uhrzeit natürlich noch verwaist war.
Inzwischen war es halb fünf, zeigte mein Radiowecker mit grün leuchtenden Ziffern. Ich holte mir ein zweites Glas Orangensaft, legte mich wieder ins Bett, konnte immer noch nicht einschlafen. Die Zeit bis zum Sonnenaufgang kam mir wie eine Ewigkeit vor. Ab halb acht rief ich alle fünf Minuten in der Direktion an. Beim siebten Versuch nahm Sönnchen ab, noch ein wenig atemlos von den Treppen. Ich sagte ihr das Jahr, das der namenlose Besucher mir genannt hatte.
»Die Gerda kommt immer erst um halb neun«, wurde ich aufgeklärt. »Sonst geht’s Ihnen gut?«
»Nein. Wir haben im Schnitt drei, vier Mordfälle im Jahr. Und so gut wie alle werden aufgeklärt.«
»Ich geh nachher gleich in den Keller. Sobald ich was habe, hören Sie von mir.«
Nach dem kurzen Telefonat fühlte ich wieder den Puls in den Schläfen. Die Kopfschmerzen waren zurück. Nicht mehr so stark wie am Sonntag, aber sie schienen mir eine deutliche Warnung zu sein. Aufregung tat mir nicht gut. Sogar telefonieren überforderte meine Kräfte.
Frustriert schleppte ich mich in die Küche und traf dort auf meine schlaftrunkenen Töchter, die angeblich erst zur zweiten Stunde Unterricht hatten.
»Lehrermangel«, klärte man mich auf. »Seit du den Plako in den Knast gebracht hast, fällt andauernd Mathe aus.«
Ich nahm eine Tablette und wankte zu meinem Krankenlager zurück. Mir war wieder schwindlig wie am ersten Tag. Und so übel, dass ich für kurze Zeit fürchtete, mich übergeben zu müssen. Ich beschloss, bei Gelegenheit meinen alten Fahrradhelm abzustauben und griffbereit an die Garderobe zu hängen.
Im Dämmerschlaf hörte ich die Zwillinge die Wohnung verlassen, die ich im Zuge von Ermittlungen wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge um ihren Mathematiklehrer gebracht hatte. Opfer war eine junge Radfahrerin gewesen, von der ich nicht wusste, ob sie einen Helm getragen hatte. Jedenfalls hätte er sie nicht gerettet, denn sie war an inneren Blutungen im Bauchbereich gestorben. Vielleicht sollte man ja wie die alten Ritter im Blechpanzer …
Um zwanzig vor zehn lärmte mich das Handy aus dem Tiefschlaf. Ich brauchte einige Sekunden, bis ich wieder wusste, wo ich war und was diesen Radau veranstaltete. Es war Sönnchen.
»Unaufgeklärte Mordfälle haben wir fünfundachtzig gar keine gehabt«, verkündete sie. »Das genaue Datum hat er Ihnen nicht gesagt?«
»Wenn, dann kann ich mich nicht erinnern.«
»Wissen Sie irgendwas über die Frau?«
»Nur, dass sie einen ungewöhnlichen Beruf hatte.«
»Filmschauspielerin vielleicht?«
»Das könnte sein. Doch, da klingelt was.«
»Da hätte ich nämlich was. Viktoria Hergarden, eine Filmschauspielerin. Allerdings war’s kein Mord, sondern ein häuslicher Unfall mit Todesfolge.«
»Heergarten war der Name?«
»Vorne mit einem e und hinten mit d statt t.«
Hergarden.
Hergarden?
Je öfter ich den Namen vor mich hin murmelte, desto bekannter kam er mir vor.
»Das passt«, entschied ich schließlich. »So hat er geheißen. Sie sind ein Schatz, Sönnchen. Was genau ist damals passiert?«
»Laut Protokoll ist die arme Frau in ihrem Wohnzimmer ausgerutscht und mit dem Kopf auf den Couchtisch geknallt. Eine Nachbarin hat sie am nächsten Tag gefunden.«
»Wie alt war sie?«
»Jahrgang siebenundfünfzig – demnach war sie achtundzwanzig.«
»Fremdverschulden ist ausgeschlossen?«
»Absolut. Sie war allein in der Wohnung. Die Tür war abgeschlossen. Der Schlüssel hat innen gesteckt. Keine Spuren von gewaltsamem Eindringen. Die ist eindeutig über ihre eigenen Füße gestolpert. War übrigens eine Hübsche. Es sind Fotos dabei. Auf einem sieht man eine leere Sektflasche.«
»Wären Sie so lieb, mir die Akte in der Mittagspause vorbeizubringen?«
»So weit kommt’s noch! Sie sind krank und müssen sich schonen. Ich will mir später keine Vorwürfe machen müssen.«
»Dann schleppe ich mich eben zu Ihnen ins Büro, und Sie sind dann schuld, wenn es Spätfolgen gibt.«
»Das ist jetzt aber die ganz fiese Tour!«
»Sönnchen, ich bitte Sie! Wenn ich mich hier zu Tode langweile, werden Sie sich später auch Vorwürfe machen.«
Sie seufzte wie eine vielgeplagte Mutter. »Na gut. Wenn es Sie glücklich macht und Sie schön brav im Bett liegen bleiben, dann sollen Sie in Gottes Namen Ihre Akte kriegen, Herr Dickkopf.«
Ich bedankte mich ausführlich. Aber sie blieb reserviert.
»Sie sollten sich lieber um Ihre Gesundheit kümmern als um alte Mordgeschichten. Nach dreißig Jahren kommt’s auf einen Tag mehr oder weniger doch nicht an.«
Damit hatte sie zweifellos recht. Aber wie sollte ich das Denken abstellen? Indem ich Radio hörte, zum Beispiel. Mich ablenkte. An etwas Schönes dachte. Theresa eine ordentlich schwülstige SMS schrieb. Die postwendend beantwortet wurde. Meine Liebste versprach, mir demnächst einen Krankenbesuch abzustatten und in meinem Elend ein wenig Gesellschaft zu leisten.
»Bringe selbst gebackenen Marmorkuchen mit und koche dir einen feinen Kamillentee.« Den letzten Teil las ich mit leichtem Grausen.
»Seit wann backst du Kuchen?«, schrieb ich zurück.
»Seit drei Wochen. Vermutlich die ersten Anzeichen der Wechseljahre. Bücher schreiben kann ich ja offenbar nicht.«
Theresa war vierundvierzig und in letzter Zeit oft gedrückter Stimmung wegen des ausbleibenden Verkaufserfolgs ihres neuen Buchs. Kurz vor Weihnachten war es erschienen, eine unterhaltsam zu lesende und dennoch lehrreiche und sachlich solide Abhandlung über die Entwicklung des Terrorismus über die Jahrhunderte. Ich hatte gleich meine Zweifel gehabt, ob die Menschheit sich nach einem solchen Buch gesehnt hatte. Und nun lag es in den Regalen der Buchhandlungen wie Beton.
Schon eine halbe Stunde später war sie da und füllte mein Schlafzimmer mit dem Duft eines neuen Parfüms, sprühender Energie und guter Laune.
»Dior«, wurde ich aufgeklärt. »Magst du es?«
»Ich fürchte, mir wird schlecht davon«, erwiderte ich kläglich.
Wortlos kippte sie ein Fenster. Dann setzte sie sich auf die Bettkante und sah mich prüfend an.
»Kann es sein, dass du mich und mein Leiden nicht ganz ernst nimmst?«, fragte ich.
»Eine Gehirnerschütterung ist nichts, woran man stirbt.«
»Woher willst du das wissen?«, stöhnte ich. »Du hast gut reden.«
»Ich hatte selbst mal eine. Im Turnunterricht vom Barren gefallen. Mein größtes Talent im Fach Sport war nämlich, von etwas möglichst Hohem möglichst ungeschickt herunterzufallen.«
Aufgeräumt erzählte sie, dass sie in ihrer Jugend auch mehrfach mit dem Rad verunglückt war.
»Einmal habe ich nicht mal drauf gesessen, stell dir vor! Es war nach der letzten Schulstunde. Ich hatte es eilig, wollte das Schloss vom Hinterrad lösen, da hat mich irgendein Torfkopf von hinten geschubst, und zack, bin ich mitsamt Rad nach vorne umgekippt und habe mir am Sattel einen Schneidezahn ausgeschlagen.«
Sie ließ mich ihr makelloses Gebiss betrachten, deutete auf den verunglückten Zahn im Oberkiefer. »Man sieht überhaupt nicht, dass er überkront ist, findest du nicht auch?«, nuschelte sie dazu.
In dieser Sekunde wurde mir klar, woher der merkwürdige Bluterguss an meinem Rücken und die Beule am Hinterkopf stammten: Ich war rückwärts auf mein Rad gefallen. Und der Bluterguss am Rücken stammte von einem Pedal, das sich in meine Weichteile gebohrt hatte.
Da Theresa keine weiteren berichtenswerten Unglücksfälle mehr einfielen, erzählte ich von dem alten Mann, der so energisch behauptete, seine Frau ermordet zu haben.
»Und das Komische ist: Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass er bei meinem Unfall dabei war.«
»Hat er dich gestoßen?«
»Das nicht. Da müssen zwei gewesen sein. Aber ich kriege es einfach nicht zusammen. In meinem Gedächtnis ist ein schwarzes Loch von mindestens einer Viertelstunde. Bist du mit dem Auto da?«
»Ja.«
»Regnet es noch?«
»Kaum.«
Dreißig Minuten später standen wir am Hainsbachweg im Heidelberger Norden und sahen uns ratlos um. Das parkähnliche Grundstück, das westlich an Dr. Kamphusens Garten grenzte, war von einem übermannshohen, robusten Zaun aus massiven Eisenstäben umgeben. An den oberen Enden reckten sich Speerspitzen, die vor langer Zeit vielleicht sogar einmal golden geglänzt hatten. Das Grundstück dahinter war schattig und wirkte ungepflegt, das Haus selbst war aus unserer Position nicht sichtbar.
»Wo?«, fragte Theresa.
Ich hob die Schultern.
»Immer noch keine Erinnerung?«
Ich schüttelte vorsichtig den Kopf. »Irgendwie beunruhigend. Man weiß, man war hier, man weiß, es ist irgendwas passiert, aber es ist einfach … gelöscht.«
Wir spazierten ein Stück am Zaun entlang die Straße hinunter. Theresa hatte sich bei mir untergehakt, um mich halten zu können, falls mir plötzlich schwindlig werden sollte. Es klappte jedoch besser als befürchtet. Die frische Luft schien mir gutzutun. Ein feuchtkalter Wind blies von Westen her, aber die Temperatur lag deutlich über dem Gefrierpunkt. Nässesatte Wolken trieben träge über uns hinweg, als suchten sie einen Landeplatz. Manchmal nieselte es ein wenig. Auf der gegenüberliegenden Seite der schmalen Straße parkten Autos. Dahinter eine hohe Mauer aus rötlichem Sandstein, über die große Bäume ihre Kronen reckten.
»Und?« Theresa ruckelte ein wenig an meinem Arm, als könnte sie dadurch mein Gehirn zurechtrütteln.
»Nichts. Nichts. Nichts.«
»Da ist ein Törchen.«
Die in den Zaun eingelassene Tür war so schmal, dass nur ein nicht allzu umfangreicher Mensch hindurchschlüpfen konnte. Theresa vermutete, sie habe früher als Dienstboteneingang gedient.
»Oder für heimliche Liebespaare.«
»Du denkst wirklich immer nur an das Eine.«
Sie lachte fröhlich. »Wie der offizielle Zugang des Anwesens sieht es jedenfalls nicht aus.«
Ich drückte probeweise die Klinke, aber das Liebestor war fest verschlossen. Der dahinterliegende Weg war von matschigem Laub bedeckt und wand sich in gemächlichen Kurven in Richtung Haus, von dem jetzt immerhin das von hohen Backsteinkaminen gekrönte graue Dach zu sehen war.
»Hier vielleicht?«, fragte Theresa.
Wieder einmal zuckte ich die Achseln.
»Da liegt etwas.« Sie bückte sich und hob ein rotes Plastikteil auf. »Könnte ein Stück von deinem Rücklicht sein. Ist es beim Sturz kaputtgegangen?«
»Ich weiß es doch nicht!«, fuhr ich sie an, mäßigte aber sofort wieder meine Stimme. »Entschuldige, ich …«
Sie drückte mir einen kräftigen Kuss auf den Mund. »Würde mich auch nervös machen, so ein totaler Blackout. Aber bald bist du wieder der Alte, du wirst sehen.«
Wir machten kehrt und gingen zurück – nun den Hang hinauf. Jetzt merkte ich, dass ich längst nicht wieder gesund war. Mein Kopf rebellierte schon nach zwei Schritten, und wir mussten immer wieder stehen bleiben, bis mein Puls sich beruhigt hatte. Der hohe Zaun endete, das Grundstück des Ehepaars Kamphusen begann. Hier gab es keine eisernen Gitterstäbe und hohe Bäume, sondern ein kniehohes Sandsteinmäuerchen und Ziergesträuch. Wir bogen auf einen etwa zwei Meter langen, breiten Pflasterweg ein, erklommen drei erstaunlich anstrengende Stufen.
Theresa lief zu ihrem kleinen goldfarbenen Skoda, den sie am Straßenrand geparkt hatte. Wenig später kam sie mit dem Blumenstrauß zurück, den wir auf der Herfahrt gekauft hatten, und der Rotweinflasche, die aus meiner Küche stammte. Ich drückte den Klingelknopf. Innen gongte es würdig und laut.
Es war die Frau, die öffnete.
»Herr Gerlach!«, rief sie strahlend. »Es geht Ihnen schon wieder besser? Und was für wunderschöne Blumen!«
Ich überreichte der für ihr hohes Alter äußerst lebhaften kleinen Dame den Strauß, Theresa gab ihr die Flasche. Nicht nur ihre Stimme klang jung, auch der Blick war wach und neugierig.
»Ich wollte mich herzlich bedanken«, sagte ich. »Es geht mir dank Ihrer Fürsorge wirklich schon wieder ganz gut. Und ich würde mir gerne mein Fahrrad ansehen.«
»Wollen Sie es nicht gleich mitnehmen?«
Dazu war Theresas Skoda zu klein. »Ich hole es, sobald ich selbst wieder Auto fahren kann«, versprach ich.
»Hier stört es nicht, keine Sorge.«
Wir gingen am Haus entlang zum breiten Garagentor. Kies knirschte unter unseren Schritten. Frau Kamphusen zückte eine Fernbedienung, das Tor schwang leise brummend auf. Mein Rad lehnte an der Seitenwand. Das Rücklicht war kaputt, und wir brauchten uns nicht zu bücken, um festzustellen, dass das, was Theresa gefunden hatte, das fehlende Teil war.
»Wer wohnt in dem großen Haus unterhalb?«, fragte ich meine Retterin.
Ende der Leseprobe