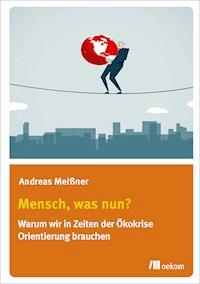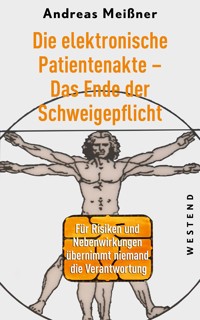
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Impfpass, Medikationsplan und Befunde an einer zentralen Stelle - das klingt gut. Ist aber bedenklich, denn bei der elektronischen Patientenakte geht es weniger um Gesundheit von Patienten, sondern um deren Daten. Aus Forschung und Industrie besteht ein großes Interesse daran. Jeder Bürger bekommt jetzt die E-Akte automatisch. Die Daten daraus fließen jetzt automatisiert direkt an die Forschung und in den europäischen Datenraum. Der mögliche Widerspruch wird leicht vergessen. Wenn dann noch, wie schon angedacht, KI die Praxisgespräche sofort erfassen und verwerten soll, ist die Schweigepflicht zerstört. Ein Warnruf aus ärztlicher Praxis -, der auch auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die elektronische Patientenakte aufmerksam machen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Andreas Meißner
Die elektronische Patientenakte – das Ende der Schweigepflicht
Für Risiken und Nebenwirkungen übernimmt niemand die Verantwortung
Mit einem Vorwort von Bernd Hontschik
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-86489-472-5
© Westend Verlag GmbH, Neu-Isenburg 2024
Umschlaggestaltung: Johannes Bröckers
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Cover
Vorwort
Geliefert, aber nicht bestellt
Einfaches unnötig kompliziert gemacht – das E-Rezept und die eAU
Warum das Interesse an der ePA so gering ist – ein Akzeptanzproblem
Es geht um Wirtschaft und Märkte, nicht um Gesundheit
Mit schlechten Daten wird gute Forschung nicht besser werden
Was wir besprechen, wird weitergeleitet an EU, USA und KI
Wie menschliche Medizin – minimal internetbasiert – weiter betrieben werden kann
Anmerkungen
Geliefert, aber nicht bestellt
Einfaches unnötig kompliziert gemacht – das E-Rezept und die eAU
Warum das Interesse an der ePA so gering ist – ein Akzeptanzproblem
Es geht um Wirtschaft und Märkte, nicht um Gesundheit
Mit schlechten Daten wird gute Forschung nicht besser werden
Was wir besprechen, wird weitergeleitet an EU, USA und KI
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
»Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Daten.«
(Eva Leipprand)
»Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus wahren.«
(Genfer Deklaration des Weltärztebundes)
Vorwort
Spätestens seit dem November 2023 weiß ich, dass Großalarm geboten ist. Da hat nämlich Gesundheitsminister Karl Lauterbach dem Spiegel ein Interview gegeben, dass mir Hören und Sehen vergangen ist. Der Minister ließ sich dabei über die großartigen Vorteile der Digitalisierung des Gesundheitswesens aus und verkündete allen Ernstes über die elektronische Patientenakte (ePA) in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI): »Wenn ich als Arzt mit einem Patienten spreche, habe ich bereits seine alten Befunde im Computersystem. Ich frage: Wie fühlen Sie sich? Die ganze Zeit hört eine Spracherkennungssoftware zu und überträgt die Stichpunkte, die wichtig sind, in die elektronische Patientenakte … (Ich) kann mit der KI über meine eigene ePA sprechen. Sie kann mir Empfehlungen geben, und ich kann sie fragen, ob bei meiner Behandlung vielleicht Fehler gemacht worden sind.« Mir blieb die Spucke weg. Da ist jemand Gesundheitsminister, lässt dabei keine Gelegenheit aus, sich als Arzt darzustellen, aber von der Medizin, von der täglichen ärztlichen und pflegerischen Arbeit hat dieser »Arzt« offensichtlich nicht die Spur einer Ahnung. Die Arzt-Patienten-Beziehung im realen Leben kennt der Minister nicht, aber über eine Patient-Spracherkennungsbeziehung und eine Spracherkennungs-KI-Beziehung und eine KI-ePA-Beziehung kann er ins Schwärmen geraten. Für die konkrete medizinische Arbeit ist das alles völlig unbrauchbar.
Die Digitalisierung ist Voraussetzung für eine ungeheure Geldschöpfung in der Gesundheitswirtschaft, die vor nicht allzu langer Zeit einmal das Gesundheitswesen war. Die Digitalisierung ist das moderne Goldene Kalb, das Objekt quasireligiöser Verehrung, ein Fetisch. Im realen Gesundheitswesen knirscht es aber an allen Ecken und Enden. Krankenhäuser werden reihenweise in die Insolvenz getrieben. Für Arztpraxen finden sich keine Nachfolger, stattdessen entstehen investoren-, also profitgetriebene Medizinische Versorgungszentren. In den Apotheken mangelt es hinten und vorne an Medikamenten. Der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal in den Kliniken hat inzwischen katastrophale Ausmaße angenommen. Da kann man noch so viel digitalisieren, und da kann Herr Lauterbach noch so lange mit seiner künstlichen Intelligenz plaudern, es wird nichts helfen. Digitalisierung ist im besten Fall ein Hilfsmittel, aber mit ihr kann man kein Problem lösen. Es sind Menschen, die in den Heilberufen tätig sind. Es sind Menschen, die krank oder gesund geworden sind. Es sind und bleiben analoge Probleme, die dringend gelöst werden müssen.
Dieses Buch ist ein fundamentaler Beitrag zu unser aller Aufklärung über die elektronische Patientenakte. Daran mangelt es bislang ganz und gar.
Daher ist ihm weiteste Verbreitung zu wünschen.
Frankfurt am Main, im April 2024,
Bernd Hontschik
Geliefert, aber nicht bestellt
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen etwas geliefert, was Sie nicht bestellt haben. Wenn es ein schönes Buch ist, eine Flasche Rotwein, das neueste Smartphone, haben Sie sicher nichts dagegen. Vor allem, wenn Sie nichts dafür bezahlen müssen. Sie wundern sich vielleicht über dieses unerbetene Geschenk. Umsonst ist ja nichts normalerweise. Und ja, schon bald wird klar, dass Gegenleistungen erwartet werden. Kein Geld, kein materieller Wert, aber der Lieferant und andere Interessenten wollen nun mehr von Ihnen wissen und Ihnen immer wieder ungefragt etwas anbieten können. So langsam wird Ihnen mulmig.
Sie bekommen jetzt tatsächlich etwas, was Sie nicht bestellt haben. Das Dumme dabei im Gegensatz zum Rotwein: Sie haben nicht viel davon, und Sie werden es wahrscheinlich gar nicht merken. »Geschenk« und Gegenleistungen werden sich lautlos vollziehen. Ihre Krankenkasse schaltet Ihnen eine elektronische Patientenakte (ePA) frei, und Sie liefern dafür Daten, die dann zentral gespeichert auf Servern von Firmen wie IBM und Bitmarck liegen. Alle Bürger:innen dieses Landes werden damit beglückt. Auch die, die gerade erst geboren werden oder neu nach Deutschland kommen.
Sie fragen sich, warum Sie von diesem Geschenk nichts mitbekommen haben. Sie erinnern sich, da war irgendwann ein Schreiben Ihrer Krankenkasse im Briefkasten, in dem von unverständlichen technischen Dingen die Rede war. Sie haben es vielleicht auf den Tisch oder in eine Ablage gelegt, bald verschüttet von neuen Briefen und anderen Dingen. Das Kleingedruckte, nämlich dass Sie widersprechen dürfen, ja aktiv widersprechen müssen, wenn Sie das Geschenk nicht wollen, haben Sie möglicherweise übersehen.
Sie haben aber auch anderweitig nichts davon mitbekommen – weil nicht darüber gesprochen wird. Eine Talkshow etwa hat es zu diesem umfassenden Digitalisierungsprojekt im Gesundheitswesen bisher nicht gegeben. Allenfalls war da eine Meldung in der »Tagesschau« kurz vor Weihnachten 2023. Da wurde davon berichtet, dass der Bundestag gerade eines der wichtigsten Vorhaben von Gesundheitsminister Lauterbach beschlossen hat: Bis Ende 2025 soll für 80 Prozent aller Bürger:innen eine elektronische Patientenakte (ePA) eingerichtet und deren Inhalt dann auch für die Forschung genutzt werden. Der Beitrag war kurz, eingezwängt zwischen Dax, Ukrainekrise und Tarifstreit im Zugverkehr – alles Themen, die momentan wichtiger erschienen, während mit der »ePA für alle«, wie sie jetzt genannt wird, die bisher größte Datensammelinfrastruktur für die intimsten Daten eines Menschen aufgebaut wird – was ja eigentlich eine öffentliche Diskussion wert wäre.
Diese IT-Thematik ist trocken, technisch, abstrakt, und zieht daher kaum Interesse auf sich. Ich stoße dazu im Bekannten- und Kollegenkreis nur auf geringe Resonanz. Das sei zu lang und komplex, höre ich, und dafür, sich jetzt noch in weitere Konfliktthemen einzulesen, fehlten schlicht Lust und Kraft. Das ist verständlich, denn das menschliche Sorgenreservoir ist begrenzt. Corona, Krieg und Klima haben dieses bereits gefüllt, und fast täglich kommen neue Krisen dazu. Und ein schlechtes Gewissen, wie leichtfertig und unüberschaubar permanent Konzernen Daten überlassen werden, besteht sowieso.
Das schwer verständliche Thema, um das es hier geht, würde es aber erfordern, sich einzuarbeiten, um als Patient:in wie auch als Ärztin oder Arzt die sensiblen Krankheitsdaten verwalten zu können. Auch Praxisinhaber waren bei dem 2018 mit Zwang eingeführten Anschluss ihrer Praxen an das Gesundheitsdatennetz, die Telematikinfrastruktur (TI), überfordert – und sind es immer noch. Begriffe wie Konnektoren, elektronischer Arzt- und Praxisausweis, virtuelle private Netze und Security Module Cards würden regelrecht Schwindelattacken verursachen, meinte ein Kollege damals treffend. All dies sind nötige Elemente beim Anschluss an die TI, über welche Anwendungen wie die ePA und das elektronische Rezept laufen. Angeschlossen haben sich bis heute weit über 90 Prozent der Praxen. Sie haben das nicht aus Begeisterung getan, sondern um den Honorarabzug zu vermeiden, der bei mir wiederum seit 2019 jedes Quartal vollzogen wird. Warum habe ich mich bisher nicht an das Datennetz angeschlossen? Weil ich auch über sechs Jahre nach seiner Einführung noch nicht von Sinn und Zweck der teuren Innovationen überzeugt bin. Da ist nicht alles schlecht, aber Nutzen, Aufwand und Risiken stehen in keinem angemessenen Verhältnis. Zumal wenn es offenbar in erster Linie um Daten geht, nicht um bessere Gesundheit.
Im Gegensatz zur fehlenden öffentlichen Diskussion haben Patient:innen in meiner Praxis schon länger etwas von der Thematik mitbekommen. »Eines ist sicher: Ihre Daten bei uns. Ihre Gesundheitsdaten gehören nur Ihnen«, verkündet ein Plakat in meinem Wartezimmer. Denn Daten sind die Bezahlwährung der modernen Zeit. Jetzt nicht nur bei Amazon, Google oder Microsoft, sondern auch im deutschen Gesundheitswesen. So unbemerkt, wie Sie die ePA bekommen, so unbemerkt fließen die Daten dann weiter an ein staatliches Forschungsdatenzentrum. Auch dies wurde jüngst gesetzlich geregelt. Sind die Daten einmal dort, ist keinerlei Kontrolle mehr für die Betroffenen möglich.1
Bei dieser staatlichen Stelle soll dann die forschende Industrie die Nutzung der Daten beantragen können. Entscheidend wird dabei der Nutzungszweck sein, nicht der Absender. Der Zugriff auf Daten soll damit niedrigschwellig ermöglicht werden. So könnten auch Konzerne wie Amazon und Google hier Daten anfordern, denn auch sie und ihre Tochterunternehmen sind im Gesundheitsbereich aktiv. Die Daten sollen für gemeinwohlorientierte Forschung genutzt werden – die sich jedoch selten eindeutig von Gewinnorientierung trennen lässt. So gibt es zahlreiche Verbindungen zwischen Universitäten und Industrie, die ihrerseits neue Absatzmöglichkeiten sucht. Den Zugang zu den Daten genehmigt eine Zugangsstelle, die beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) angesiedelt ist. Dies ist eine dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde, die somit selbst ein politischer Player ist. Aktuell sieht es so aus, dass letztlich ein Sachbearbeiter dieses Instituts darüber entscheidet, ob ein Antrag genehmigt wird, was gemeinwohlorientiert ist und welche Gesundheitsdaten weitergegeben werden.2
Auch diesem Datenfluss an das Datenzentrum müssen Sie aktiv widersprechen, wenn Sie dies nicht wünschen. Die Frage ist, ob die gewonnenen Daten die Forschung überhaupt verbessern und ob nicht andere Forschungshindernisse bestehen als der oft behauptete Datenmangel. An die Daten der E-Akte jedenfalls wollen viele, nicht nur Forschungsinstitute oder Universitäten. So hatten beispielsweise neben der Pharmaindustrie auch der Bundesverband der Deutschen Industrie und der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie schon ihr Interesse daran angemeldet. Das sind nicht unbedingt Verbände, die direkt in die Behandlung von Patient:innen involviert sind. Da trifft es sich gut, dass ein automatisierter Datenfluss geplant ist, wie wir gleich sehen werden.
Die Akte selbst kommt nun also automatisch für jede Bürgerin und jeden Bürger. Sie wird »verbindlich«, informiert ein Werbeportal für Ärztinnen und Ärzte. So kann man Zwang auch umschreiben. Er betrifft im Übrigen auch Privatversicherte, wenn ihre Krankenversicherung eine ePA innerhalb der TI anbietet. Bisher musste die Akte von Versicherten aktiv bei der Kasse beantragt werden, wofür ein Registrierungsprozess nötig war. Ob es allein wegen dieser Komplexität war, dass nur ein Prozent der Versicherten diese Möglichkeit genutzt hat, sei dahingestellt. Genauso könnte mittlerweile ein Sättigungsgrad an Bildschirm- und Technikverwendung erreicht sein. Vermehrt wird über emotionale Erschöpfungseffekte, die durch digitale Medien auftreten, berichtet, weshalb ihre Nutzung von hoher Ambivalenz geprägt ist.3 Laut einer aktuellen Befragung sind Deutsche 71 Stunden pro Woche online.4 Das lässt sich mit der »ePA für alle« sicher noch steigern, fraglich nur, ob das dann der Gesundheit zuträglich ist. Denn der Studie zufolge will jeder Dritte unter 40 die Internetnutzung reduzieren, dies vor allem aus gesundheitlichen Gründen – in der Hoffnung, dass weniger Onlinezeit die Konzentration, Produktivität und Kreativität im Alltag steigert.