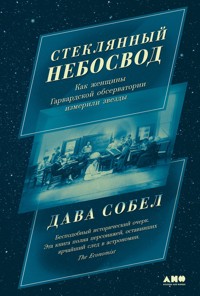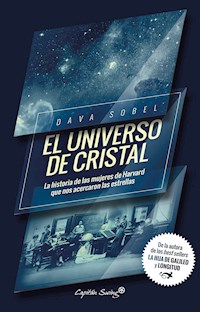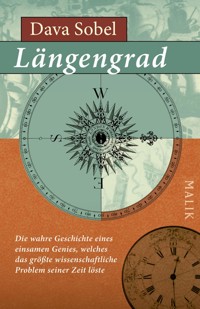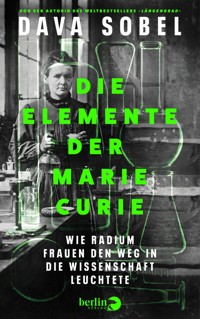
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dava Sobelerzählt die Geschichte der berühmten Naturwissenschaftlerin und der 45 Frauen, die sie in ihrem Labor ausgebildet hat. Wie Marie Curie auch, waren sie fasziniert von der rätselhaften Radioaktivität und erforschten die Struktur der Atome als grenzenlose Energiequelle. Sie kamen aus aller Welt. Viele wurden später in ihrer Heimat einflussreiche Pionierinnen an Universitäten und in ihren Forschungsgebieten. Andere gaben unterm gesellschaftlichen Druck auf und heirateten. Einigen gelang es, Forschung und Ehe zu kombinieren. Viele blieben lange miteinander in Freundschaft verbunden und gründeten eine Gesellschaft zur Förderung von Frauen in der Forschung. In Paris trafen sie sich lange nach Mme Curies Tod, um ihrer Mentorin zu gedenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Aus dem Englischen von Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß (Kollektiv Druckreif)
© bei Atlantic Monthly Press/Grove Atlantic, New York 2024
The Elements of Marie Curie. How the Glow of Radium Lit a Path for Women in Science, Atlantic Monthly Press/Grove Atlantic, New York 2024
© der deutschsprachigen Ausgabe 2025
Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von © HarperCollinsPublishers Ltd 2024
Covermotiv: Bettmann / Getty Images und Yagi Studio / Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Vorwort
Formel für eine Ikone: Marie Curie (1867 – 1934)
Teil 1
École Municipale de Physique et de Chimie
42 Rue Lhomond, Paris
Kapitel 1
Mania (Wasserstoff)
Kapitel 2
Marie (Eisen)
Kapitel 3
Madame Curie (Wolfram und Molybdän)
Kapitel 4
Pierre (Uran)
Kapitel 5
André (Actinium)
Kapitel 6
Eugénie (Radiotellur)
Teil 2
Sorbonne-Annex
12 Rue Cuvier
Kapitel 7
Harriet (Emanation)
Kapitel 8
Ellen (Kupfer und Lithium)
Kapitel 9
Lucie (Helium)
Kapitel 10
Sybil (Thorium)
Kapitel 11
Eva (Radium)
Kapitel 12
Jadwiga und Irén (Gold)
Kapitel 13
Hertha (Kohlenstoff)
Kapitel 14
Suzanne (Platinum und Iridium)
Kapitel 15
Maurice (Ionium)
Teil 3
Das Radium-Institut: Curie-Labor
1 Rue Pierre-Curie
Kapitel 16
Irène (Blei)
Kapitel 17
Marthe (Chlor)
Kapitel 18
Madeleine (Radioneon)
Kapitel 19
Léonie (Sauerstoff)
Kapitel 20
Missy (Silber)
Kapitel 21
Catherine (Mesothorium)
Kapitel 22
Frédéric (Radon)
Teil 4
Großproduktionsanlage
Arcueil
Kapitel 23
Alicja (Polonium I)
Kapitel 24
Éliane (Polonium II)
Kapitel 25
Angèle (Bismut)
Kapitel 26
Isabelle und Antonia (Thallium)
Kapitel 27
Branca (Bor)
Kapitel 28
Willy (Beryllium)
Kapitel 29
Marie-Henriette, Marietta, et al. (Aluminium)
Kapitel 30
Ève (Radiophosphor)
Nachwort
Marguerite (Francium)
Die Radioaktivisten
Ihre Angehörigen und Mitstreiter
Glossar
Die radioaktiven Zerfallsreihen
1. Die Uran-Reihe
2. Die Actinium-Reihe
3. Die Thorium-Reihe
Quellen
Bibliografie
Bildnachweise
Nachweise für die Fotostrecke des Bildteils
Nachweise für die Bilder im laufenden Text
Dank
Bildteil
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Widmung
Für Harry Arthur Kobrin und Van Samuel Hix, zwei künftige Feministen
Vorwort
Formel für eine Ikone: Marie Curie (1867 – 1934)
Sogar heute, fast hundert Jahre nach ihrem Tod, ist Marie Curie die einzige Frau in der Wissenschaftswelt, deren Name den meisten Leuten ein Begriff ist. Marie Curie wurde zu einer Ikone, trotz aller Hindernisse. In ihrer Heimatstadt Warschau war Frauen der Zugang zu Hochschulen verwehrt, an eine Karriere als Wissenschaftlerin und Forscherin war nicht zu denken. Dennoch gelang es ihr, eine herausragende Position in der Welt der Wissenschaften einzunehmen und sie bis heute voll und ganz auszufüllen.
Der Physiknobelpreis, den Marie zusammen mit ihrem Mann Pierre 1903 erhielt, und der Chemienobelpreis, der ihr 1911 allein verliehen wurde, trugen zweifellos dazu bei, ihren Namen unsterblich zu machen. »Zweifache Nobelpreisträgerin« bringt Maries anhaltenden Ruhm griffig auf den Punkt: Sie bekam als erste Frau einen Nobelpreis – und als erster Mensch zwei. Bis heute ist niemand sonst mit Nobelpreisen in zwei verschiedenen Wissenschaftskategorien ausgezeichnet worden.[1]
Ihre Nobelpreismedaillen, beide aus reinem Gold, symbolisieren die Kluft zwischen den unterschiedlichen Idealvorstellungen von Weiblichkeit und Wissenschaft. Jede Medaille trägt das bärtige Antlitz des Stifters Alfred Nobel, des Mannes, der das Dynamit erfunden hat. Auf der Rückseite stellen zwei Göttinnen in wallenden Gewändern den Augenblick einer Entdeckung dar. »Scientia« hebt mit ihrer Rechten den Schleier vom Gesicht der barbusigen »Natura«, die, ein Füllhorn im Arm, mit ernster Miene verharrt. Das Bild verweist Frauen in das Reich der Allegorie, während der darunter eingravierte Name des Preisträgers normalerweise der eines Mannes vom gleichen Schlag wie Alfred Nobel ist.[2]
Der Nobelpreis im Jahr 1903 brachte den Curies Ansehen und ein Vermögen in Höhe von siebzigtausend Goldfranc ein. Umgekehrt verlieh auch Marie Curie dem Nobelpreis, der erst seit 1901 vergeben wurde, Glanz. Das öffentliche Aufsehen, das Maries Auszeichnung erregte, machte sowohl ihren Namen als auch den des Preises weltweit bekannt.
Nach Pierres vorzeitigem tragischen Unfalltod im Jahr 1906 schwor die trauernde Marie, ihr gemeinsames Werk fortzuführen. Sie übernahm anstelle ihres Mannes die Leitung des Curie-Labors und auch seinen Lehrstuhl an der Pariser Universität, wodurch sie die erste Professorin an dieser Institution wurde. In dieser einzigartigen Position zog sie unwillkürlich zahlreiche begabte junge Frauen an, die unter ihrer Führung arbeiten oder studieren wollten. Sie kamen aus Frankreich, aber auch aus dem Ausland, so wie einst Marie, als sie ihre Heimat verlassen hatte, um an der Sorbonne zu studieren – Frauen aus Osteuropa, Skandinavien, Großbritannien und Kanada, die darauf brannten, Chemikerinnen oder Physikerinnen zu werden.[3] Während Marie den Wissensdurst ihrer Laborschützlinge stillte, organisierte sie auch eine kleine kooperative Schule für die Söhne und Töchter ihrer Freunde und gab dort wöchentlich praxisorientierten Physikunterricht.
Als Marie ihren zweiten Nobelpreis erhielt, war sie allerdings nicht mehr nur berühmt, sondern wegen einer skandalträchtigen Liebesaffäre auch berüchtigt. Erst ihre Frontbesuche während des Ersten Weltkriegs mit einem selbst konzipierten tragbaren Röntgengerät stellten ihren Ruf als Heldin wieder her. Auch bei zwei triumphalen Amerikareisen in den 1920er-Jahren zog sie viel Bewunderung auf sich, als sie wie üblich in einem schlichten Kleid und mit ihrer unverstellten Art vor großen Versammlungen oder mit dem Präsidenten sprach. Lange vor ihrem Tod 1934 bereitete sie ihre ältere Tochter darauf vor, ihr als Laborleiterin nachzufolgen. Ihre jüngere Tochter, die Marie während ihrer letzten Tage in einem Sanatorium begleitete, sollte später die Lebensgeschichte ihrer illustren, liebevollen Mutter in einer gefeierten Biografie mit dem schlichten Titel Madame Curie erzählen.
Diese Biografie ging, wie auch viele danach folgende, nur am Rande auf die fünfundvierzig ehrgeizigen Wissenschaftlerinnen ein, die eine prägende Zeit ihres Lebens im Curie-Labor verbracht hatten. Vom Rätsel der Radioaktivität ebenso fasziniert wie Marie, und ohne Rücksicht auf die damit verbundenen Gefahren, machten sie weitere Entdeckungen, untersuchten die Kraft der Strahlen zur Behandlung von Krankheiten und erforschten die erstaunliche Welt im Innern des Atoms als Quelle unbegrenzter Energie. Einige von ihnen kehrten in ihre Heimatländer zurück und wurden dort die ersten Professorinnen oder lehrten als Erste die neue Wissenschaft von der Radioaktivität.
Angesichts der gesellschaftlichen Vorbehalte und der Erwartungen ihres jeweiligen Umfelds gaben manche von Maries Schützlingen ihre Karriere auf, als sie heirateten. Andere blieben bewusst ledig, um ihre Forschungen fortführen zu können. Nur wenigen gelang es, beides zu verbinden. Aus den im Labor geschlossenen Freundschaften entstand später eine internationale Gemeinschaft, die sich der schulischen und beruflichen Förderung von Frauen verschrieb. Noch lange nach ihrem Aufenthalt in Paris erinnerten sich diese Frauen immer und immer wieder an kleine Momente in Marie Curies Gegenwart – etwa, dass sie gewohnheitsmäßig ihre vom Radium betäubten Finger aneinanderrieb oder zuweilen ein Lächeln über ihr trauriges Gesicht huschte, das sie plötzlich in Schönheit erstrahlen ließ.
Teil 1
École Municipale de Physique et de Chimie
42 Rue Lhomond, Paris
Am Anfang war das Wort, und das Wort war … Wasserstoff.
Diane Ackerman, The Planets: A Cosmic Pastoral
Um aus Pechblende Uran zu gewinnen, dafür gibt es zu jener Zeit Fabriken. Um daraus Radium zu gewinnen, dafür gibt es in einem Hangar eine Frau.
Lydia Davis, Samuel Johnson ist ungehalten
Kapitel 1
Mania (Wasserstoff)
Die Frau, die man gemeinhin als Madame Curie kennt, erblickte am 7. November 1867 als Maria Salomea Skłodowska das Licht der Welt. Das jüngste von fünf Kindern wurde zu Hause Mania oder in der Verkleinerungsform Maniusia gerufen, manchmal auch Anciupecio. Weil sie nicht nur das Nesthäkchen war, sondern zudem altklug und von zierlicher Gestalt, bedachte man sie mit mehr Kosenamen als jedes ihrer Geschwister. Im Alter von vier Jahren brachte sie sich selbst das Lesen bei und vertiefte sich dermaßen darin, dass die anderen darum wetteiferten, mit welchen Tricks sie sie ablenken konnten.
Ihr frühes Interesse an Naturwissenschaften verdankte sie ihrem Vater Władysław Skłodowski, der an einem Warschauer Knabengymnasium Mathematik und Physik unterrichtete. Zu Hause bewahrte er ein Barometer und andere wissenschaftliche Geräte auf, und seine Begeisterung für solche Dinge übertrug sich auf seinen Sohn und seine vier Töchter. Ebenso hoch schätzte er Sprache und Literatur. Wenn er den Kindern am Samstagabend vorlas, suchte er oft ein englisches Buch wie Charles Dickens’ David Copperfield aus und übersetzte den Text aus dem Stegreif ins Polnische. Bei französischen und deutschen Werken konnte er sich diese Mühe sparen, denn seine Kinder beherrschten mehrere Fremdsprachen. Er erzog sie auch zu einer besonderen Hochachtung vor den Dichtern, die die Ruhmestaten polnischer Helden priesen.
Laut seiner Familie hatte der Vater nur einen Makel: Er hing der aussichtslosen Sache eines polnischen Nationalstaats an. Das einst größte Land Europas hatte gegen seine aggressiven Nachbarn Österreich, Preußen und Russland eine Niederlage nach der anderen erlitten, bis diese im Jahr 1795 das gesamte Gebiet des ehemaligen Polens unter sich aufgeteilt hatten. Bürger, die sich weiterhin kulturell als Polen sahen, taten sich zusammen und forderten die Wiederherstellung eines eigenständigen Staates, doch die nationalistischen Aufstände von 1830 und 1863 wurden brutal niedergeschlagen, die Anführer gehenkt und Tausende ihrer Gefolgsleute nach Sibirien verbannt. Als stolzer Pole, der an einem Gymnasium im von Russen regierten Warschau unterrichtete, geriet Skłodowski eines Tages mit seinem Vorgesetzten aneinander und wurde daraufhin entlassen. Unglücklicherweise hatte der patriotische Lehrer etwa zur selben Zeit seine ganzen Ersparnisse in das Unternehmen seines Schwagers investiert – eine dampfbetriebene Mühle auf dem Land, die bankrottging und sie beide ruinierte.
Ein noch härterer Schicksalsschlag traf Manias Mutter Bronisława Boguska Skłodowska, die ebenfalls in Warschau unterrichtete und eine private Mädchenschule leitete. Einige Jahre nach der Geburt ihres fünften Kindes machten sich bei ihr erste Anzeichen einer Tuberkulose bemerkbar – einer damals ebenso weitverbreiteten wie tödlichen Krankheit. Obwohl man noch nicht viel über die Übertragungswege wusste, ergriff Bronisława alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen und benutzte beispielsweise ausschließlich ihr eigenes Geschirr. Aus Angst, ihre Kinder anzustecken, vermied sie es, sie zu umarmen und zu küssen. Als sich ihr Zustand verschlechterte, suchte sie Ruhe und frische Luft (die einzigen damals bekannten Heilmittel) in Bergkurorten in Österreich und Südfrankreich, wohin sie ihre älteste Tochter Zofia begleitete. Von 1874 an klagte Mania zwei Jahre lang immer wieder darüber, dass diese ihr so teuren Menschen so lange abwesend waren.
Wegen der Kosten für die Behandlung der Mutter sah sich die Familie ein ums andere Mal gezwungen, in zusehends ärmlichere Wohnungen umzuziehen. Der verzweifelte Vater nahm immer öfter Schuljungen als Pensionäre auf, die in den Schlafzimmern der Kinder nächtigten. Mania und ihre Schwestern mussten ins Wohnzimmer ausweichen, wo sich tagsüber jedoch ebenfalls Jungen zum Lernen aufhielten. Aufgrund der beengten Wohnsituation erkrankten die beiden älteren Mädchen der Skłodowskis, Zofia und Bronia, an Typhus. Bronia erholte sich nach einigen Wochen Fieber, aber die vierzehnjährige Zofia, die ihre Mutter so lange gepflegt hatte, wurde im Januar 1876 von der Krankheit dahingerafft. Ihre Mutter starb zwei Jahre später, im Mai 1878, als Mania zehn Jahre alt war.
»Diese Katastrophe war das erste große Unglück in meinem Leben und stürzte mich in eine tiefe Depression«, verriet Marie Curie Jahrzehnte später in einem autobiografischen Essay.[4] »Meine Mutter besaß einen außergewöhnlichen Charakter. Ungeachtet ihrer Intellektualität hatte sie ein großes Herz und ein ausgeprägtes Pflichtgefühl … Der Einfluss, den sie auf mich ausübte, war außerordentlich, denn bei mir ging die natürliche Liebe des kleinen Mädchens zu seiner Mutter mit einer innigen Bewunderung einher.«
Die übrigen Familienmitglieder rückten noch enger zusammen. Bronia übernahm viele Aufgaben im Haushalt, und der trauernde Ehemann hielt die Familientraditionen aufrecht, etwa die Zusammenkünfte mit Freunden und Verwandten, die allen »ein wenig Freude bescherten«.
Mania besuchte zunächst die Mädchenschule in der Fretastraße – auf die schon ihre Mutter gegangen war, an der diese später unterrichtet und die sie schließlich geleitet hatte. Mehr noch, Mania war in dieser Schule, nicht weit vom Warschauer Zentrum entfernt, sogar geboren worden, in der Dienstwohnung, die man der Mutter zur Verfügung gestellt hatte. Erst 1868, Mania war noch ein Baby gewesen, war die Familie fortgezogen. Als sie dann als Erstklässlerin dorthin zurückkehrte, mussten sie und ihre ein Jahr ältere Schwester Helena von ihrer Wohnung in der Nowolipkistraße, die westlich des Stadtzentrums am Rand des jüdischen Viertels lag, jeden Tag einen langen Fußmarsch auf sich nehmen.
Zu Beginn ihres dritten Schuljahrs, im Herbst 1877, wurden die Schwestern an einer anderen, näher gelegenen Schule angemeldet, einer privaten Mädchenschule. Deren unerschrockene Leiterin sorgte für eine Erziehung, die die polnische Kultur und Sprache förderte, womit sie heimlichen Widerstand gegen die russischen Behörden leistete. Beim Eintreffen des Amtsinspektors mussten die Schülerinnen und Lehrerinnen oft hastig die polnischen Texte wegräumen und einen Unterricht in einem der anerkannten Fächer vortäuschen, etwa Handarbeit oder russische Geschichte – natürlich auf Russisch. Aufgrund ihrer hervorragenden Russischkenntnisse wurde Mania mehr als einmal aufgerufen, damit sie die Fragen des Inspektors beantwortete. »Das war wegen meiner Schüchternheit wahrlich eine Prüfung für mich«, schrieb sie später. »Am liebsten wäre ich weggelaufen und hätte mich versteckt.«
Das nächste Schuljahr, das nur wenige Monate nach dem Tod ihrer Mutter begann, verbrachte sie bereits am Gymnasium Nr. 3, einer staatlichen Mädchenschule, an der die Lehrer, wie Mania sich erinnerte, »ihre Schülerinnen wie Feinde behandeln«. Allerdings konnte nur an einer solchen staatlichen Einrichtung ein anerkannter Abschluss erworben werden. Sie ging nun zusammen mit ihrer Freundin Kazia Przyborowska, die sie wie eine Schwester liebte, zur Schule und danach zu Kazia nach Hause, wo sie von deren Mutter umsorgt und mit Süßigkeiten verwöhnt wurde.
»Weißt du, Kazia«, schrieb Mania ihr während der Sommerferien auf dem Bauernhof eines Onkels, »trotz allem habe ich die Schule gern. Vielleicht wirst du dich über mich lustig machen, und doch sage ich dir, dass ich sie gern habe, sehr gern sogar. Ich bemerke es jetzt erst. Bilde dir nur nicht ein, dass sie mir fehlt! Nein, das gewiss nicht. Aber der Gedanke, dass ich bald wieder in die Schule komme, ist gar nicht traurig, und die beiden Jahre, die ich noch dort bleibe, kommen mir gar nicht mehr so schrecklich, so furchtbar lang vor, wie ich geglaubt habe.«[5]
Mania ist fünfzehn, als sie am 12. Juni 1883 die Schule als Klassenbeste und ausgezeichnet mit einer Goldmedaille abschließt – wie zuvor schon ihr Bruder Józef und ihre Schwester Bronia. Józef war vom Knabengymnasium direkt zum Medizinstudium an die Warschauer Universität gegangen. Auch Bronia hätte gern diesen Weg eingeschlagen, doch der stand nur Männern offen. Und so träumte sie davon, eines Tages in Paris an der Sorbonne Medizin zu studieren, wo auch Frauen zugelassen wurden. Helena wiederum war nach Abschluss des Gymnasiums qualifiziert genug, um als Lehrerin in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, und hatte außerdem eine gute Stimme, die ihr eine Karriere als Sängerin ermöglichen würde. Ehe Mania sich über ihre eigenen Zukunftspläne klar werden konnte, belohnte ihr Vater sie für ihre guten schulischen Leistungen mit einem Ferienjahr bei den zahlreichen Verwandten der Familie; ihre erste Station war beim Bruder ihrer Mutter im ländlichen Süden – ausgerechnet bei jenem Bruder, der den Vater damals in die finanzielle Bredouille gebracht hatte. Jetzt verbrachte Mania dort die glücklichste Zeit ihres Lebens.
»Es fällt mir schwer, an die Existenz von Chemie und Algebra zu glauben«, schrieb sie Kazia. »Ich habe beides vollkommen vergessen.« Zu den Freizeitaktivitäten, die sie in ihren Briefen aufzählte, gehörten die Lektüre »harmloser und alberner kleiner Romane«, Waldspaziergänge, Reifentreiben und kindliche Fang- und Würfelspiele, Schaukeln (»hoch und wild«), Schwimmen, Krebsangeln mit Fackeln, Reiten und das Sammeln wilder Erdbeeren. Begleitet wurde sie in diesem Sommer auf dem Land von Lancet, dem Hund der Familie, dessen lautstarkes Gebell sie erheiterte. Im Herbst reiste sie weiter nach Süden ins Karpatenvorland, wo sie die nächsten Monate beim Bruder ihres Vaters verbrachte.
[1] Eine Porträtzeichnung von Lancet in Manias Tagebuch
An festlichen Winterabenden rasten Mania und ihre Cousinen in Bäuerinnentracht auf Schlitten durch die Wälder, eskortiert von jungen Männern auf Pferden. Im ersten Haus, das auf ihrem Weg lag, trafen sie auf andere Feierlustige, und auch ein Schlitten voller Musikanten schloss sich ihnen an. Stundenlang tanzten sie Mazurka, Oberek und Walzer, und dann ging es nicht etwa heimwärts, sondern weiter zum nächsten und zum übernächsten Haus. Bei dieser »Kulig« genannten Tradition wurde den Gästen bei jedem Halt ein Festmahl aufgetischt. Und auch wenn bereits der neue Tag anbrach, feierte man in den Häusern der Gastgeber noch fröhlich weiter.
Dieses sorgenfreie Jahr erstreckte sich bis in den Sommer 1884, als Mania und Helena auf den Landsitz einer ehemaligen Schülerin ihrer Mutter eingeladen waren. Die Flusslandschaft und die Gastfreundlichkeit, die sie auf dem nordöstlich gelegenen Gut Kępa kennenlernten, stellten sogar die Vergnügungen des »Kulig« in den Schatten. Wie Mania Kazia berichtete, lag »Kępa am Zusammenfluss von Narew und Biebrza – was heißt, dass es jede Menge Wasser zum Schwimmen und Bootfahren gibt, und das macht mir große Freude. Ich lerne gerade rudern – was mir schon ganz gut gelingt –, und zum Baden ist es perfekt. Wir tun, was uns gerade in den Sinn kommt, schlafen manchmal nachts und manchmal am Tag, tanzen und treiben solchen Unfug, dass wir eigentlich ins Irrenhaus eingesperrt gehören.« Am Morgen des 25. August musste Mania nach einer Ballnacht sogar ihre neuen Tanzschuhe wegwerfen, weil sie sie durchgetanzt hatte.
Schließlich kehrte sie nach Warschau in die nun deutlich kleinere Wohnung ihres Vaters zurück. Zwar unterrichtete er noch, nahm aber keine Pensionäre mehr auf. Die inzwischen fast siebzehnjährige Mania konnte nun als Nachhilfelehrerin für Französisch, Arithmetik und Geometrie ebenfalls etwas zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, doch das war eine zähe Angelegenheit. »Ein Mädchen, das uns über Freunde kannte, kam vorbei und erkundigte sich nach Nachhilfe«, schrieb sie. »Als Bronia sagte: ›ein halber Rubel pro Stunde‹, nahm es Reißaus, als stünde das Haus in Flammen.«
Um sich weiterzubilden, besuchten Mania und Bronia heimlich die »Fliegende Universität«. Das begrenzte Lehrangebot dieser Wanderschule hing von den Fachkenntnissen ihrer ehrenamtlichen Lehrer ab, die sich immer mit acht bis zehn Studierenden in der einen oder anderen Privatwohnung trafen. Die Räumlichkeiten wechselten ständig, um der Entdeckung durch die Polizei zu entgehen. Zwar konnte man das Studium von Fächern wie Anatomie oder Naturgeschichte kaum als subversiv bezeichnen, doch war es nach russischem Recht bereits illegal, Frauen eine höhere Bildung zukommen zu lassen.
Inspiriert vom Geist der »Fliegenden Universität«, stattete Mania einem Schneideratelier regelmäßige Besuche ab, las den Angestellten vor und baute eine Leihbibliothek mit polnischen Büchern für sie auf. In ihrer Freizeit las sie Romane und philosophische Texte, fertigte in einem Notizbuch Zeichnungen von Blumen und Tieren an (darunter von Lancet), schrieb Gedichte und tüftelte an einem Plan, wie es ihr – und Bronia – gelingen könnte, in Frankreich zu studieren.
Sie würde sich eine Stelle als Gouvernante suchen. Wenn sie bei einer Familie arbeitete, würde sie nicht nur mehr verdienen, sondern hätte freie Kost und Logis. Mit einem Großteil ihres Gehalts – vielleicht bis zu vierhundert Rubel im Jahr – könnte sie für Bronias Lebensunterhalt in Paris aufkommen. Und fünf Jahre später, wenn Bronia Ärztin geworden wäre, wäre sie selbst an der Reihe und würde, dann mit Unterstützung von Bronia, ihr Studium an der Sorbonne beginnen.
Die zwanzigjährige Bronia hatte genug gespart, um sich die Reise nach Paris und das erste Jahr an der medizinischen Fakultät leisten zu können. Im Herbst 1885 machten sich die Schwestern an die Umsetzung des Plans, den Mania ersonnen hatte. Doch bereits im Dezember sah Mania sich außerstande, ihren Teil der Abmachung einzuhalten. Denn sie fühlte sich in ihrer Stellung bei der Familie des Rechtsanwalts B. wie eine Gefangene. Ihrer Cousine Henrietta vertraute sie an, sie wünsche »ein solches Höllenleben … nicht meinem ärgsten Feind! Mein Verhältnis zu Frau B. wurde am Ende so frostig, dass ich es nicht länger aushielt und ihr dies auch sagte. Da sie von mir ebenso angetan war wie ich von ihr, kamen wir entsprechend miteinander aus.« Durch ihren Aufenthalt bei den B. verlor Mania ihre Naivität hinsichtlich des menschlichen Charakters. »Ich habe gelernt, dass es die Personen, die in den Romanen beschrieben sind, wirklich gibt und dass man mit Leuten, die der Reichtum moralisch verdorben hat, nichts zu tun haben darf.«
Schnell fand sie eine neue Stelle, diesmal zwar weit weg von zu Hause – in Szczuki, etwa achtzig Kilometer nördlich von Warschau –, aber bei einer verträglicheren Familie und für ein Jahressalär von fünfhundert Rubel. Als sie am 1. Januar 1886 aufbrach, stellte sie sich vor, dass ihre Reise sie in eine bewaldete Hügellandschaft führen würde, ähnlich der, die sie im Sommer zuvor so geliebt hatte. Stattdessen fand sie sich inmitten von achtzig Hektar Ackerland wieder, auf dem nichts als Zuckerrüben angebaut wurde. Und die Gewinnung des Zuckers aus den Rüben fand in einer trostlosen Fabrik statt, direkt neben dem Haus der Familie Żorawski, ihren neuen Arbeitgebern. Hinter der Fabrik standen ein paar Hütten gedrängt beieinander, in denen die auf den Feldern arbeitenden Bauern wohnten. Auch der nahe gelegene Fluss bot wenig Erbauliches, sondern stand ganz im Dienst der Fabrik und entsorgte deren Abfall. Trotzdem ließ Mania ihre Cousine Henrietta einen Monat nach ihrer Ankunft dort wissen, dass sich ihre Lage sehr verbessert habe: »Die Ż. sind sehr nette Leute. Mit der ältesten Tochter Bronka habe ich mich angefreundet, was dazu beiträgt, dass sich mein Leben angenehm gestaltet. Meine Schülerin Andzia, die bald zehn wird, ist ein gehorsames Kind, allerdings sehr unordentlich und verzogen. Aber Vollkommenheit kann man natürlich nicht erwarten.«
Mania arbeitete sieben Stunden am Tag – drei mit Bronka und vier mit Andzia. Die jüngeren Kinder – ein dreijähriger Junge und ein sechs Monate altes Mädchen – hellten mit ihren Possen Manias Stimmung auf. Die drei älteren Söhne, die in einem Internat lebten beziehungsweise in Warschau studierten, hatte sie bisher noch nicht kennengelernt.
[2] Mania und Bronia Skłodowska, 1886
Wenn Frau Żorawska Gäste empfing, bat sie Mania manchmal, mit ihnen Konversation zu treiben oder als vierte Mitspielerin beim Kartenspielen einzuspringen, was Mania natürlich gerne tat. In ihrer Freizeit organisierte sie in Eigeninitiative einen Unterricht für die Bauernkinder und brachte ihnen jeden Tag zwei Stunden lang Lesen und Schreiben in polnischer Sprache bei, denn in der Schule lernten sie nur Russisch. Spätabends und frühmorgens widmete sie sich ihrer eigenen Lektüre, um ihrem letztendlichen Ziel, dem Physik- und Mathematikstudium an der Sorbonne, näher zu kommen. In ihrem Brief an Henrietta vom Dezember 1886 erwähnte sie, dass sie »die Physik von John Frederic Daniell …, die Soziologie von Spencer auf Französisch … [und] das Lehrbuch der Anatomie und Physiologie von Paul Bert auf Russisch« lese, und zwar parallel. Denn »die fortlaufende Beschäftigung mit ein und demselben Gegenstand könnte mein schon stark überanstrengtes Gehirn ermüden. Wenn ich mich absolut unfähig fühle, mit Nutzen zu lesen, löse ich algebraische und trigonometrische Aufgaben; die vertragen kein Nachlassen der Aufmerksamkeit und bringen mich wieder ins rechte Fahrwasser.«
Eine bestimmte Form der Ablenkung von ihrem prall gefüllten Terminplan blieb in ihren Briefen an Henrietta allerdings unerwähnt. Während ihres ersten Jahres in Szczuki hatte sie Kazimierz kennengelernt, den ältesten Sohn der Familie, der an der Universität studierte, und sich in ihn verliebt. Aus der Romanze wurde mehr, doch als Kazimierz seinen Eltern eröffnete, dass er um Manias Hand anhalten wolle, verboten sie ihm, die mittellose Gouvernante zu heiraten. Kazimierz vermochte sich nicht gegen sie durchzusetzen, und Mania, die es sich nicht leisten konnte, ihre Einkommensquelle zu verlieren, schluckte den Ärger und die Schmach hinunter und konzentrierte sich auf ihre Arbeit.
Nach dieser Episode verdüsterte sich ihr Blick auf die Zukunft. Im März 1887, fünfzehn Monate nach Antritt ihrer Stelle in Szczuki, trug sich ihr Bruder mit dem Gedanken, als Arzt in der Provinz zu praktizieren, woraufhin Mania ihn beschwor, sich lieber etwas Besseres in der Großstadt zu suchen. Wenn er solche Kompromisse eingehe, sagte sie, »würde ich darunter ungeheuer leiden, denn da ich nun für mich jede Hoffnung verloren habe, etwas zu werden, konzentriert sich mein ganzes Streben auf Bronia und dich. Wenigstens ihr beide müsst euer Leben nach eurer Begabung einrichten. Diese Begabung, die ohne Zweifel in unserer Familie vorhanden ist, darf nicht verloren gehen und muss in einem von uns zum Durchbruch kommen. Je weniger Hoffnung ich für mich habe, desto mehr erhoffe ich für euch.«
Im März darauf klang sie noch verzagter. »Wenn ich nicht an Bronia denken müsste, würde ich in eben diesem Augenblick meinen Abschied von den Żorawskis nehmen und mich nach einer anderen Stelle umsehen …« Doch trotz der Trostlosigkeit und der Enttäuschung, die sie gelegentlich äußerte, trieb sie ihre eigene Bildung unablässig voran. »Denk dir nur«, schrieb sie an Józef, »Chemie lerne ich aus einem Buch. Du kannst dir vorstellen, wie wenig ich davon habe, aber was soll ich machen, da ich doch keinen Platz für Experimente oder praktische Arbeit habe?«
Als Mania zu Ostern 1889 ihre Verpflichtungen gegenüber Andzia zur Gänze erfüllt hatte, verließ sie Szczuki, um eine andere Gouvernantenstelle anzunehmen, diesmal bei der vermögenden Familie Fuchs in Warschau. In deren luxuriösem Haus fühlte sie sich durchaus wohl, zog aber bereits nach einem Jahr zu ihrem Vater zurück und verdiente sich ihren Unterhalt erneut mit Nachhilfestunden. Als sie sich wieder an der »Fliegenden Universität« anmeldete, stellte sie fest, dass die Zahl der Studentinnen von zweihundert auf eintausend angewachsen war und der Unterricht nun gezwungenermaßen nicht mehr in privaten Räumlichkeiten stattfand, sondern in verschiedenen geheimen Einrichtungen.
Durch einen älteren Cousin mütterlicherseits erhielt sie zum ersten Mal Zutritt zu einem richtigen Labor, und zwar im Museum für Industrie und Landwirtschaft im Zentrum von Warschau. Dort führte sie abends und an Sonntagen auf eigene Faust einige der Experimente durch, von denen sie in den Abhandlungen über Chemie und Physik gelesen hatte. Dabei lief nicht immer alles glatt. »Im Ganzen aber«, so erinnerte sie sich später, »zog ich aus dem Schaden die Lehre, dass der Fortschritt auf diesem Gebiet sich weder rasch noch leicht ergibt, und bildete im Zuge dieser ersten Versuche meinen Sinn für experimentelle Naturforschung aus.«
*
Manias zuvorkommender Cousin Józef Boguski hatte in jungen Jahren an der Universität von Sankt Petersburg Chemie bei Dmitri Mendelejew studiert, dem Urheber des Periodensystems der Elemente. In dieser bemerkenswerten Tabelle war das gesamte bekannte Wissen über die Bausteine der stofflichen Welt zusammengefasst. Man konnte auf einen Blick erkennen, welche Elemente gemeinsame Merkmale besaßen, welche am wahrscheinlichsten eine Bindung mit anderen eingingen und welche Anteile sie jeweils daran hatten. Zudem erhielten die uralten Begriffe »Atom« und »Element« eine wissenschaftliche Bedeutung.[6]
Für griechische Philosophen der Antike, die über die kleinstmögliche stoffliche Einheit nachdachten, bedeutete »Atom« (a-tom) »unteilbar«. Bis ins 19. Jahrhundert bezeichnete »Atom« ein unsichtbares, nicht weiter teilbares Teilchen, das unvorstellbar klein war und dennoch die Eigenschaften des jeweiligen Elements in sich trug. Unter dem Begriff »Element« wiederum verstand man im Lauf seiner langen Geschichte eine Vielzahl verschiedener grundlegender Entitäten, etwa Feuer, Luft, Erde und Wasser. Die Handwerker früherer Kulturen schmolzen Eisen und vermischten Kupfer und Zinn zu Bronze; man lernte, die Qualitäten von Silber für Ziergegenstände zu nutzen, und schätzte Schwefel als Bestandteil von Putz- und Bleichmitteln, Arzneien und Streichhölzern. Die Alchimisten des Mittelalters strebten danach, bestimmte unedle Elemente wie Blei in das Edelmetall Gold umzuwandeln. Zur Zeit der Französischen Revolution wurde eine Liste mit dreiunddreißig »einfachen Stoffen« erstellt, die die Palette der Chemiker um die Gase Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff erweiterten. Durch die Entdeckung von Calcium, Kalium, Silizium, Iod und ein paar Dutzend weiterer Stoffe im 19. Jahrhundert war die Zahl der bekannten Elemente auf dreiundsechzig angewachsen, und Mendelejew versuchte, eine Art Ordnung in diese immer länger werdende Liste zu bringen.
Er entschied sich für das Atomgewicht als Ordnungsprinzip. Auch wenn keine Waage so etwas Winziges wie ein Atom wiegen konnte, hatten Chemiker im vorangegangenen Jahrhundert durch Theorie und Experiment eine Lösung für dieses Problem gefunden: Beim Wiegen verschiedener Gase gleichen Volumens stellten sie fest, dass Wasserstoff am leichtesten von allen war, und ordneten ihm daher das Atomgewicht 1 zu. Wenn Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser reagierten, war die Menge an Sauerstoff im Verhältnis zum Wasserstoff immer achtmal so groß, deshalb wurde das Atomgewicht von Sauerstoff auf 8 festgelegt – erst später erkannte man, dass sich beim Wasser zwei Wasserstoffatome mit einem Sauerstoffatom verbinden, und korrigierte daraufhin das Atomgewicht von Sauerstoff auf 16. Weil sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff leicht Bindungen mit anderen Elementen eingehen, dienten diese beiden außerdem dazu, das Atomgewicht von Eisen, Natrium, Magnesium, Aluminium und anderen Elementen zu bestimmen.[7]
[3] Mendelejews erstes (auf Russisch) veröffentlichtes Periodensystem
Das Atomgewicht erwies sich als die beständigste Eigenschaft eines Elements. Es blieb gleich, während sich charakteristische Merkmale wie Farbe, Struktur oder Geruch normalerweise veränderten, sobald ein Element eine chemische Reaktion mit einem anderen einging. Natrium und Chlor beispielsweise – das eine ein weiches, silbrig weißes Metall, das andere ein giftiges Gas – verbinden sich zu Kristallen, die wir als gewöhnliches Tafelsalz (Natriumchlorid) kennen, doch ihre Atomgewichte bleiben unverändert.
Als Mendelejew die bekannten Elemente in einer aufsteigenden Reihe nach ihrem Atomgewicht anordnete, stellte er verwundert fest, dass bestimmte chemische Eigenschaften sich in regelmäßigen Abständen wiederholten. Diese periodische Wiederholung von Ähnlichkeiten bestärkte ihn in der Annahme, ein Naturgesetz entdeckt zu haben.
Mendelejew veröffentlichte sein Periodensystem 1869 in einer limitierten Auflage von zweihundert Exemplaren sowie in Zeitschriftenartikeln und in einem Lehrbuch für seine Studenten in Sankt Petersburg. Seit dem ersten Erscheinen und dank häufiger Nachbesserungen in den folgenden zwanzig Jahren gehörte es zum Inventar eines jeden Labors. Die neueste Version, die Mania Skłodowska im Museum für Industrie und Landwirtschaft zur Verfügung stand, enthielt auch drei erst kürzlich identifizierte Elemente: Gallium, Scandium und Germanium, benannt nach der Heimat ihrer Entdecker. Sie alle nahmen Stellen im Periodensystem ein, die Mendelejew absichtlich leer gelassen hatte, als hätte er gewusst, dass da noch etwas kommen musste. Einige ungewöhnlich große Atomgewichtsunterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Elementen deuteten für ihn auf die Existenz solcher Nachzügler hin. Also ließ er Platz für sie frei, gab ihnen provisorische Namen – etwa »Eka-Aluminium« für Gallium – und schätzte ihr mutmaßliches Atomgewicht. Mit seinen Vorhersagen bewies er eine geradezu prophetische Weitsicht.[8]
Wie Mania feststellte, klafften im Periodensystem immer noch etliche Lücken. Jederzeit konnte ein neues Element auftauchen und einen unbesetzten Platz unterhalb von Tellur oder Barium, zwischen Thorium und Uran oder womöglich sogar hinter Uran – dem bis dahin schwersten bekannten Element – einnehmen.
Eine Nachricht von Bronia aus Paris kündete die Einlösung des Versprechens an, das sich die Schwestern vor Langem gegeben hatten. Bronia hatte im Sommer 1890 einen Kommilitonen geheiratet, einen emigrierten Landsmann namens Kazimierz Dłuski, und mit ihm zusammen eine kleine Arztpraxis gegründet. In ihrer Wohnung war auch Platz für Mania.
»Deine Einladung nach Paris … hat sie in einen fiebrigen Zustand versetzt«, schrieb Władysław Skłodowski seiner ältesten Tochter. »Ich spüre, mit welcher Energie sie zu diesem Quell der Wissenschaft gelangen will, nach dem sie so sehr dürstet.«
Auf Bronias Rat hin schickte Mania ihre Matratze und andere sperrige Habseligkeiten als Frachtgut nach Paris, um sich die Kosten und Mühen zu ersparen, sie dort neu zu kaufen. Als weitere Sparmaßnahme entschied sie sich für die billigste Zugfahrkarte – eine Mischung aus dritter und vierter Klasse, was bedeutete, dass sie für den Streckenabschnitt durch Deutschland einen eigenen Klappstuhl mitbringen musste, außerdem genug zu essen und zu trinken, um die dreitägige Fahrt zu überstehen.
»Im November 1891, im Alter von vierundzwanzig Jahren«, erinnerte sie sich dreißig Jahre später, »gelang es mir also, den Traum wahr zu machen, der seit mehreren Jahren stets in meinem Geiste präsent gewesen ist.«
Kapitel 2
Marie (Eisen)
Keine ihrer früheren Reisen hatte Mania auf die Eleganz und Pracht von Paris vorbereitet. Zwar konnte auch Warschau mit einem königlichen Palast, prunkvollen Kirchen, noblen Stadthäusern und historischen Denkmälern aufwarten, doch über allem lag der triste Schleier der russischen Besatzung. In Paris hingegen diskutierten die Einwohner frei und in ihrer eigenen Sprache in aller Öffentlichkeit über ihre Ideen, was die Schönheit der Stadt in Manias Augen noch unterstrich. Wissenschaftliche Forschung, die sie in aller Heimlichkeit hatte betreiben müssen, fand hier an zahlreichen imposanten Orten statt. Das kürzlich fertiggestellte Institut Pasteur zog bereits Wissenschaftler aus anderen Ländern an und tat sich durch die weltweit ersten Vorlesungen in Mikrobiologie hervor. Im Jardin des Plantes, der nicht nur der Zierde diente, sondern ein jahrhundertealtes Herbarium von Heilkräutern beherbergte, wurde als Teil des Nationalen Naturkundemuseums eine Grande Galerie de l’Évolution eröffnet. Und in den Sockel des neuen Eiffelturms, den allerdings viele als Schandfleck im Stadtbild betrachteten, waren die Namen von zweiundsiebzig Astronomen, Chemikern, Physikern, Naturforschern, Ingenieuren und Mathematikern eingraviert, die Frankreich stolz zu seinen Söhnen zählte.
Die Pariser Universität Sorbonne wiederum war eine eigene Stadt in der Stadt, in der über neuntausend Studenten wohnten und die Professoren ihre Vorlesungen im formellen Gehrock hielten.
In der ersten Novemberwoche des Jahres 1891 schrieb sich Mania in der Faculté des sciences ein – als eine von nur dreiundzwanzig Frauen unter beinahe zweitausend Männern. Damit ihr Name zumindest halbwegs französisch klang, registrierte sie sich als Marie Skłodowska, und sie gewöhnte sich rasch daran, mit »Mademoiselle« angesprochen zu werden.
Doch wenn es Abend wurde und sie zu ihrer Schwester und ihrem Schwager in die Rue d’Allemagne zurückkehrte, ließ sie Paris hinter sich. Kaum hatte sie die Schwelle der Wohnung überschritten, war sie wieder in Warschau. Alles, von der Einrichtung bis hin zu den Freunden, die sie besuchten, beschwor Polen herauf. Nur die Patienten der Dłuskis waren Franzosen. Bronia und ihr Mann kümmerten sich um die medizinische Versorgung von La Villette, einem Viertel in der Nähe der Schlachthöfe am nordöstlichen Stadtrand. Von dort fuhr Mania-Marie mit einem von Pferden gezogenen Doppeldeckerbus zur Sorbonne und zurück, was sie jedes Mal eine ganze Stunde kostete, in der sie nicht lernen konnte.
Nach einigen Monaten mühsamen Pendelns kam sie zu dem Schluss, dass es besser sei, das Fahrgeld für die Miete eines Mansardenzimmers im Quartier Latin auszugeben. Mitte März schrieb sie ihrem Bruder Józef aus ihrer neuen Unterkunft mit der Adresse 3 Rue Flatters: »Es ist ein kleines Zimmer, sehr geeignet, und trotzdem sehr billig.«[9] Sie konnte in fünfzehn Minuten zum Chemielabor gehen, zum Hörsaal brauchte sie zwanzig.
»Ich arbeite tausendmal mehr als zu Beginn meines Aufenthalts«, schrieb sie Józef. Als sie noch bei den Dłuskis wohnte, »hatte mein kleiner Schwager die Angewohnheit, mich unentwegt zu stören. Er konnte es absolut nicht ertragen, dass ich irgendetwas anderes tat, als mit ihm zu plaudern, wenn ich zu Hause war. Ich musste ihm in dieser Frage den Krieg erklären.« Mittlerweile war der Frieden zwischen ihnen wiederhergestellt. »Natürlich hätte ich es ohne die Hilfe der Dłuskis niemals geschafft, das alles so zu bewerkstelligen.«
Begeistert von ihrer Unabhängigkeit, ignorierte Marie die Tatsache, dass sie nicht kochen konnte. In ihrem Elternhaus und während ihrer Anstellung als Hauslehrerin waren ihr die Mahlzeiten einfach vorgesetzt worden. Nun lebte sie, fern von Bronias Tisch, hauptsächlich von Tee und Butterbroten. Das bekümmerte sie nicht weiter, doch schon bald rebellierte ihr Körper in Form von häufigen Schwindelanfällen. Als sie vor einer polnischen Kommilitonin in Ohnmacht sank, erfuhren die Dłuskis davon, und Marie ließ sich widerwillig von ihrem »kleinen Schwager« eine Woche lang in La Villette aufpäppeln. Doch dann standen die Prüfungen an, und sie kehrte in ihre Mansarde zurück.
»Ich wohnte in einer Dachkammer«, erinnerte sie sich in späteren Jahren, »wo es im Winter eiskalt war, denn der kleine Ofen, für den oft die Kohle fehlte, beheizte sie nur unzureichend. In einem besonders strengen Winter war es nicht ungewöhnlich, dass das Wasser nachts in der Waschschüssel gefror; um schlafen zu können, musste ich alle meine Kleidungsstücke auf die Bettdecke legen. Meine Mahlzeiten bereitete ich mir im selben Zimmer mittels Spiritusbrenner und weniger Küchenutensilien zu. Oft bestanden sie nur aus Brot und einer Tasse Schokolade, Eiern oder Obst. Ich hatte keine Haushaltshilfe und trug das bisschen Kohle, das ich verfeuerte, allein die sechs Stiegen hoch.« Trotzdem hatte dieses Leben für sie »einen wirklichen Reiz«.
»Alles, was ich an Neuem sah und lernte, begeisterte mich. Es war, als würde sich mir eine neue Welt auftun, die Welt der Wissenschaft, die ich schlussendlich in völliger Freiheit kennenlernen durfte.«
Die das Universum beherrschenden Kräfte – Schwerkraft, Elektrizität, Magnetismus – prägten die Vorlesungen, die sie besuchte, die Experimente, die sie durchführte, und auch die Abhandlungen, über denen sie in der Bibliothek oder in ihrem Zimmer tage- und nächtelang brütete. Recht bald wurde ihr allerdings klar, dass sie trotz ihres jahrelangen ernsthaften und hingebungsvollen Einzelstudiums nicht adäquat auf ein Universitätsstudium der Mathematik vorbereitet war. Sogar ihr vermeintlich fließendes Französisch ließ sie mitunter im Stich. Also strengte sie sich umso mehr an und arbeitete noch härter. Zwei Jahre später, im Juli 1893, war sie schließlich die Jahrgangsbeste und erhielt die licenciée ès sciences physiques.
Mit diesem Abschluss in Naturwissenschaften hätte das Abenteuer ihrer Bildung enden können, doch ein Alexandrowitsch-Stipendium in Höhe von sechshundert Rubel reichte für die erneute Anmietung eines Mansardenzimmers und für ein weiteres Jahr an der Sorbonne. »Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, wie froh ich bin, wieder in Paris zu sein«, schrieb sie Józef Mitte September 1893 nach einem kurzen Aufenthalt in der Heimat. »Es fiel mir sehr schwer, mich abermals von Vater zu trennen, aber ich konnte sehen, dass er wohlauf und munter war und ohne mich zurechtkommen würde – zumal du ja in Warschau lebst. Und für mich steht mein ganzes Leben auf dem Spiel.«
In Vorfreude auf den Studienbeginn lerne sie »unaufhörlich«, schrieb sie. In diesem Jahr strebte sie einen Abschluss in Mathematik an. Unter ihren Professoren waren der Physiker Gabriel Lippmann, der zu dieser Zeit das Verfahren der Farbfotografie perfektionierte, sowie der berühmte Mathematiker Henri Poincaré.
Anfang 1894 verhalf ihr Professor Lippmann zu einem Auftrag der Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. Sie sollte die magnetischen Eigenschaften Dutzender Stahlsorten untersuchen – eine Frage von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung. Seit fast einem Jahrtausend waren Magnete ein wesentlicher Bestandteil von Schiffskompassen. Zuletzt wurden sie in größerem Umfang auch in der elektrischen Energietechnik eingesetzt. Der elektrische Strom, der nun in Paris floss, ermöglichte die telegrafische Kommunikation, elektrisch betriebene Straßenbahnen sowie die nächtliche Beleuchtung von Alleen und ließ auch Aufzüge den Eiffelturm hinauf- und hinunterfahren. Um jedoch die viel stärkeren elektrischen Ströme, die die Moderne verlangte, erzeugen und messen zu können, benötigte man neue Instrumente, und für diese brauchte man vor allem Magnete.
Die Stahlstudie wäre ein geeignetes Thema für eine Doktorarbeit, meinte Lippmann, falls Mademoiselle sich entscheiden sollte, diesen höchsten akademischen Grad anzustreben. Dass sie dazu befähigt war, stand für ihn offenbar außer Frage. Bis dahin würde sie für ihre Arbeit ein kleines Salär erhalten. Da Marie sich ihrer mangelnden Erfahrung auf diesem Gebiet bewusst war, nahm sie das Angebot eines Freundes an, sie einem Physiker vorzustellen, der sich bereits mit der Erforschung des Magnetismus auskannte und ihr vermutlich behilflich sein könnte.
Maries erster Eindruck von Pierre Curie – »einem hochgewachsenen jungen Mann mit kastanienbraunem Haar und großen, klaren Augen«, der vor einer offenen Glastür stand – hat sich ihr unauslöschlich eingeprägt.[10] Er war damals fünfunddreißig, acht Jahre älter als sie, obwohl sie fand, dass er jünger aussah. »Mir fiel sein ernsthafter und freundlicher Gesichtsausdruck auf, sowie eine gewisse Lässigkeit in seiner Haltung, die auf einen Träumer schließen ließ, der seinen Gedanken nachhing.« Er begegnete ihr mit »einer schlichten Herzlichkeit«. Als ihre Unterhaltung von wissenschaftlichen zu sozialen und humanitären Themen überging, die beide bewegten, spürten sie eine überraschende Seelenverwandtschaft.
Keiner der beiden war zu diesem arrangierten Treffen gekommen, um den Partner fürs Leben zu finden. Marie war von ihrem Liebsten schmerzlich verschmäht worden. Pierre Curie wiederum hatte der Intimität schon lange abgeschworen. In den Tagebucheinträgen, die er im Alter von zweiundzwanzig Jahren geschrieben hatte, hatte er nüchtern erklärt: »Die Frau, weit mehr als wir, liebt das Leben um des Lebens willen: Geniale Frauen sind selten. Wenn wir Männer also … alle unsere Gedanken einem Werk widmen, das uns den uns Nahestehenden entrückt, haben wir mit den Frauen zu kämpfen. Die Mutter will vor allem die Liebe ihres Kindes, und sei es auf Kosten seiner geistigen Entwicklung. Die Geliebte will gleichfalls den Mann besitzen und würde es ganz selbstverständlich finden, wenn man den größten Geist der Welt einer Liebesstunde opferte.«[11]
[4] Pierre Curie
Das nächste Mal trafen sie sich bei einer Versammlung der Société française de physique, wo Pierre Stammgast war und sich lautstark an den Diskussionen beteiligte. Kurz darauf schickte er Marie – adressiert an das Labor von Lippmann, wo sie an ihrem Projekt arbeitete – ein Exemplar seiner neuesten Veröffentlichung über die Symmetrie elektrischer und magnetischer Felder. Die Widmung lautete: »Für Mademoiselle Skłodowska, mit Hochachtung des Autors und in Freundschaft, P. Curie«.
»Einige Zeit später«, schrieb sie in ihrem autobiografischen Essay, »besuchte er mich in meiner Dachkammer und wir wurden gute Freunde.«
Das französische Wort für »Magnet«, aimant, bedeutet auch »liebevoll«. Und die Liebe ist eine treffende Metapher für die Anziehungskraft magnetischer Gegensätze. Zwei Stabmagnete haften fest aneinander, sobald man ihre entgegengesetzten Pole zusammenbringt, stoßen sich jedoch ab, wenn gleiche Polenden aufeinandertreffen. Und wie die menschliche Anziehungskraft kann auch die magnetische im Lauf der Zeit nachlassen. Obwohl die Wissenschaftler des späten 19. Jahrhunderts Materialien in »permanent« und »temporär« magnetisch wirkend einteilten, räumten sie ein, dass »permanenter Magnetismus« wahrscheinlich ebenso unrealistisch sei wie ewige Liebe. Man hoffte, Maries Studie würde aufzeigen, welche Aspekte bei der Stahlherstellung zu berücksichtigen waren, um besonders dauerhafte Magnete zu produzieren.
Seit uralter Zeit wurde in Schmelzhütten Eisenerz in Holzkohlefeuern erhitzt, um Kohlenstoffstahl zu gewinnen – ein härteres und festeres Metall als Eisen, bestens geeignet für Waffen und Werkzeug. Moderne französische Unternehmer griffen auf jeweils leicht modifizierte andere chemische Formeln zurück, sie reicherten ihre Legierungen mit zusätzlichen Elementen wie Chrom und Mangan an, um die eine oder andere wünschenswerte Eigenschaft des Stahls zu verstärken. Und sie differenzierten ihre Stahlprodukte noch weiter, indem sie das Material entsprechend erhitzten oder abkühlten, sei es durch Glühen, Abschrecken oder Tempern. Die Einzelheiten dieser Verfahren wurden als Geschäftsgeheimnis gehütet.
Für ihre Studie erhielt Marie siebenundvierzig französische Stahlproben, einige in Form von Ringen, aber die meisten als kleine Barren, zwanzig Zentimeter lang und mit einer quadratischen Querschnittsfläche von einem Zentimeter. Sie sollte nun bestimmen, welche davon sich am leichtesten magnetisieren ließen und ihre magnetischen Eigenschaften voraussichtlich über viele Jahre hinweg behielten.
Pierre hatte eigene unabhängige Forschungen zum Magnetismus an der Fachhochschule durchgeführt, wo er die Leitung des Studentenlabors innehatte. Im Rahmen eines Projekts wies er nach, dass Stoffe wie Eisen und Nickel ihre magnetischen Eigenschaften verlieren, wenn sie erhitzt werden, und er notierte bei den verschiedenen Materialien sorgfältig, bei welchen Temperaturen dies jeweils geschah.[12] Pierre war bestens vertraut mit den Geräten, die man benötigte, um eine magnetische Wirkung in Stahl zu erzeugen und die Stärke bestimmter Magnete zu messen – kurz gesagt, er kannte sich mit nahezu allen Versuchen an Magneten aus. Und er war gern bereit, dieses Wissen mit Marie zu teilen.
Obwohl Marie wie auch Pierre üblicherweise nicht viel Zeit mit Zerstreuungen verbrachten, fanden sie hin und wieder Gelegenheit, etwas gemeinsam zu unternehmen. Eines Tages ging er mit ihr zu »Mi-Carême«, dem Karneval mitten in der Fastenzeit, wo Marie in dem dichten Gewühl ein gutes Stück von ihm abgedrängt wurde und sie erst nach etlichen Minuten wieder zueinanderfanden. Dieser Zwischenfall schien Pierre eine Mahnung zu sein, wie leicht sich ihre zarten Bande lösen könnten. Er lud sie ein, seine Eltern kennenzulernen, in deren Haus im Pariser Vorort Sceaux er noch immer wohnte, und sie begriff die Bedeutung dieser Einladung.
Marie fand, dass Eugène und Sophie-Claire Curie ihren Eltern von der Wesensart her ähnelten, und sie schloss sie ebenso spontan ins Herz wie Pierre. Dennoch brachte sie es nicht über sich, einen Franzosen zu heiraten. Kaum hatte sie die akademische Ausbildung beendet und ihr Lizenziat für Mathematik – diesmal als Zweitbeste – abgeschlossen, fuhr sie eilends nach Hause zu ihrer eigenen Familie zurück.
In jenem Sommer 1894 waren Pierre und sie Tausende Kilometer voneinander getrennt, doch sie schrieben sich regelmäßig. »Es wäre doch schön«, so Pierre im August in einem Brief, »wenn wir, gebannt von unseren Träumen, gemeinsam durchs Leben gehen würden: von Ihrem patriotischen Traum; von unserem Traum von Humanität; und unserem Traum von Wissenschaft. Von all diesen Träumen ist allerdings wohl letzterer der einzige legitime.« Nur im Reich der Wissenschaft, erklärte er, könnten sie sicher sein, mehr Gutes als Böses zu tun. »Hier ist das Gebiet solider und überschaubarer, und so klein es ist, tatsächlich in unserem Besitz.«
Ein paar Tage später zeigte er sich besorgt. »Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, Sie in Frankreich festhalten zu wollen, Sie zur Exilantin zu machen, fern von Ihrem Land und Ihrer Familie, ohne dass ich Sie für ein solches Opfer mit etwas entschädigen kann.« Gleichzeitig war er ernsthaft davon überzeugt, dass ihre beruflichen Aussichten in Paris besser wären als in Polen. Wenn sie ihn schon nicht heiraten wolle, wäre sie dann damit einverstanden, freundschaftlich mit ihm zusammenzuleben? Es gäbe da etwas Passendes »in der Rue Mouffetard, mit Fenstern auf einen Garten hinaus«, schilderte er ihr. »Diese Wohnung ist in zwei getrennte Bereiche unterteilt.«
Im September schickte sie ihm ein Foto von sich, was ihn »ungeheuer« freute. Er zeigte es Jacques, seinem älteren Bruder und Partner in all den Jahren ihrer produktiven Forschung und bei der Erfindung mehrerer patentierter wissenschaftlicher Instrumente wie Analysenwaagen und Messgeräte zur Bestimmung der elektrischen Ladung. Jacques, inzwischen Professor für Mineralogie in Montpellier, fand, Marie sehe »sehr entschlossen, ja sogar eigensinnig« aus.
Als Marie im Oktober nach Paris zurückkehrte, zog sie in einen Raum in Bronias neuer Praxis, der außerhalb der Sprechzeiten leer stand. Pierre setzte sein Werben, so gut er konnte, von Sceaux aus fort. Dort lag seine Mutter schwer krank danieder, und sein Vater, der Arzt dieses etwa zehn Kilometer südlich von Paris liegenden Vororts, kümmerte sich um sie.
»Ich komme heute Abend nicht«, sagte Pierre ein Rendezvous mitten in der Woche ab und entschuldigte sich: »Mein Vater muss Hausbesuche machen, also bleibe ich bis morgen Nachmittag in Sceaux, damit Maman nicht allein ist.« Unsicher und etwas beklommen setzte er hinzu: »Ich spüre, dass Sie wohl immer weniger Wertschätzung für mich aufbringen, wohingegen meine Zuneigung zu Ihnen täglich wächst.«
Trotz seiner Brillanz und Originalität, ganz zu schweigen von den zahlreichen Arbeiten, die er bereits in physikalischen Fachzeitschriften veröffentlicht hatte, hatte sich Pierre nie die Mühe gemacht, einen Doktorgrad zu erwerben. Nach dem Universitätsabschluss in Physik an der Sorbonne arbeitete er als Laborassistent für ein Fakultätsmitglied und nahm schließlich die Stelle an, die er immer noch innehatte: Er organisierte und leitete das Studentenlabor an der Fachhochschule. Die Studenten bewunderten ihn, und die Verwaltung freute sich über seine eigenständigen Forschungsaktivitäten. Gelegentlich untersuchte Pierre ein Naturphänomen aus reiner Freude an der intellektuellen Herausforderung, ohne seine Ergebnisse zu veröffentlichen oder den Ruhm einer Entdeckung für sich zu beanspruchen. Selbstdarstellung war ihm derart zuwider, dass er sich nicht einmal um eine bessere Stelle bewarb, als einer der Dozenten an seiner Hochschule kündigte und somit eine Stelle frei wurde.
»Wie garstig ist doch diese Notwendigkeit, sich irgendeine Stellung suchen zu müssen«, klagte er in einem Brief an Marie. »Ich bin solcherart Tätigkeit nicht gewohnt, sie zermürbt mich im höchsten Maße.« Als ihm der Direktor der Hochschule eine offizielle akademische Auszeichnung zuerkennen lassen wollte, lehnte Pierre dies dankend ab. Unter anderem schrieb er: »Man hat mir erzählt, dass Sie mich erneut beim Präfekten für diese Auszeichnung vorschlagen wollen. Ich bitte Sie, dies nicht zu tun. Andernfalls wäre ich gezwungen, sie zurückzuweisen, da ich fest entschlossen bin, keinerlei schmückende Ehrungen anzunehmen. Ich hoffe, dass Sie mir diesen Schritt ersparen werden, der mich bei vielen Leuten einigermaßen lächerlich machen würde. Falls es Ihre Absicht ist, mir Ihre Unterstützung zu beweisen, so haben Sie das bereits getan, und zwar weit wirkungsvoller und auf eine Art, die mich gerührt hat, nämlich indem Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, sorgenfrei meiner Arbeit nachgehen zu können.«[13]
Auch wenn Pierre damit zufrieden war, verdiente er doch nur dreihundert Franc im Monat, etwa so viel wie ein Fabrikarbeiter. Maries Präsenz in seinem Leben beflügelte ihn jedoch, sich beruflich zu etablieren, und er begann mit einer Dissertation über seine Forschungsergebnisse in den vergangenen vier Jahren. Sie trug den Titel »Die magnetischen Eigenschaften von Körpern bei unterschiedlichen Temperaturen«.
Mit Interesse verfolgte Marie, wie Pierre an einem Märznachmittag im Jahr 1895 an der Sorbonne vor einer Jury aus Fakultätsmitgliedern, zu denen auch ihr Physikprofessor Gabriel Lippmann gehörte, erfolgreich seine Doktorarbeit verteidigte. Diese Männer entschieden über Pierres Zukunft, doch selbst als sie nun über ihn urteilen sollten, lauschten sie gebannt seinem fachkundigen Vortrag. »Ich erinnere mich an die Einfachheit und Klarheit seiner Ausführungen«, schrieb Marie später, »an die Haltung der Professoren, die ihre Wertschätzung verriet, und an die Diskussion zwischen ihnen und dem Kandidaten, die an eine Sitzung der Physikalischen Gesellschaft erinnerte.«
Dank seines beeindruckenden neuen akademischen Grades wie auch der Empfehlungen renommierter Wissenschaftler wurde Pierre in eine höhere Position befördert, die eigens für ihn geschaffen worden war. Er wurde Professor an der École Municipale de Physique et de Chimie Industrielles, der Hochschule, an der er bereits seit zwölf Jahren arbeitete, und erhielt mit sechstausend Franc im Jahr nun ein beinahe doppelt so hohes Gehalt.[14] Dennoch erklärte er sich bereit, nach Polen umzusiedeln, falls Marie es von ihm verlangte.
Mitte Juli teilte sie ihrem Bruder mit, weshalb sich ihre Pläne hinsichtlich der Sommerferien abrupt geändert hatten. Sie würde nicht wie üblich nach Warschau fahren – vielleicht sogar niemals wieder. Józef antwortete:
Ich glaube, es ist richtig, wenn du deinem Herzen folgst, und kein anständiger Mensch kann dir daraus einen Vorwurf machen. Da ich dich kenne, bin ich davon überzeugt, dass du von ganzem Herzen Polin bleiben und nie aufhören wirst, Teil unserer Familie zu sein … Und auch wir werden niemals aufhören, dich zu lieben und als eine der Unsrigen zu betrachten.
Ich sehe dich unendlich viel lieber glücklich und zufrieden in Paris als wieder zurück in unserer Heimat, gebrochen und um ein ganzes Leben betrogen, Opfer einer allzu feinfühligen Auffassung Deiner Pflicht. Wir müssen nun einfach versuchen, uns trotz allem so oft wie möglich zu sehen.
Tausend Küsse, liebe Mania, und lass mich dir noch einmal Glück, Freude und Erfolg wünschen. Grüß Deinen Verlobten herzlich von mir. Sag ihm, dass ich ihn als zukünftiges Familienmitglied willkommen heiße und ihm vorbehaltlos meine Freundschaft und Sympathie entgegenbringe. Ich hoffe, dass auch er Freundschaft und Achtung für mich empfinden wird.
Józef und seine junge Familie konnten nicht zur Hochzeit am 26. Juli 1895 reisen, aber Maries Vater und ihre Schwester Helena kamen, und Bronia und Kazimierz Dłuski natürlich ebenfalls. Die Zeremonie fand im Rathaus von Sceaux statt, wo Braut und Bräutigam sich das Eheversprechen gaben, aber keine Ringe tauschten. Nach einem kleinen Empfang, den Pierres Eltern in ihrem Garten gaben, fuhren die Frischvermählten auf Fahrrädern in ihre Flitterwochen an der bretonischen Küste.
[5] Marie und Pierre Curie als frisch verheiratetes Ehepaar, 1895
»Wenn du diesen Brief erhältst«, schrieb Marie an Kazia, ihre Freundin aus Kindertagen, »dann hat Deine Mania einen anderen Namen. Ich heirate den Mann, von dem ich dir letztes Jahr in Warschau erzählt habe. Es bekümmert mich, dass ich nun für immer in Paris bleiben muss, aber was soll ich tun? Das Schicksal hat uns in tiefer Zuneigung verbunden, und wir können die Vorstellung, getrennt zu sein, nicht ertragen.«
Sie hätte schon früher geschrieben, entschuldigte sie sich, aber sie habe sich erst kürzlich und »ziemlich plötzlich« dareingefunden, auf Dauer in Frankreich zu leben.
»Wenn du diesen Brief erhalten hast, dann schreib mir an: Madame Curie, École Municipale de Physique et de Chimie, 42 Rue Lhomond. Denn so heiße ich ab jetzt. Mein Ehemann unterrichtet an dieser Hochschule. Im nächsten Jahr wird er mich nach Polen begleiten, damit er mein Land kennenlernt, und ich werde nicht versäumen, ihn meiner lieben kleinen Wahlschwester vorzustellen und sie zu bitten, ihn in ihr Herz zu schließen.«