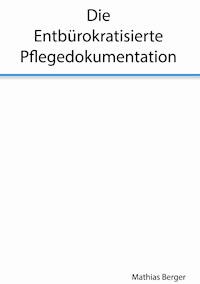
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die entbürokratisierte Pflegedokumentation ist eine große Chance für alle Beschäftigten in der Pflege. Durch die vereinfachte Form der Pflegedokumentation kann nicht nur Zeit eingespart werden sondern auch personelle Ressourcen und somit Geld, welches den Pflegebedürftigen und auch den Pflegekräften zugutekommen sollte. In diesem Buch erläutere ich die Hintergründe der entbürokratisierten Pflegedokumentation und zeige eine einfache Möglichkeit anhand des PDCA – Kreislaufes auf, wie diese Form der Pflegedokumentation in Ihrer Einrichtung implementiert werden kann. Ich erkläre, wie die Pflegedokumentation aussehen kann, welche Dokumente und Formulare enthalten sein sollen und wie die grundlegenden Formulare der vereinfachten Pflegedokumentation aufgebaut sind. Außerdem zeige ich auch anhand von praktischen Beispielen, wie die Strukturierte Informationssammlung (SIS) auszufüllen ist und welche Informationen enthalten sein müssen. Der Leser erfährt außerdem, welche Möglichkeiten er hat, die Maßnahmenplanung zu gestalten und welche Informationen enthalten sein müssen. Abschließend beschreibe ich, wie zukünftig mit Durchführungs- oder Leistungsnachweisen umgegangen werden sollte und welche wichtige Aufgabe der Pflegebericht haben wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Entbürokratisierte Pflegedokumentation
2.1 Hintergründe
2.2 Wird jetzt alles besser?
2.3 Vor- und Nachteile
Wie geht es weiter? – Ein Blick in die Zukunft
Implementierungsstrategie
So könnte die entbürokratisierte Pflegedokumentation aussehen
5.1 Stammblatt
5.2 Strukturierte Informationssammlung
5.3 Maßnahmenplanung
5.4 Durchführungsnachweis mit Pflegebericht und Evaluation
Ausfüllanleitungen zur Pflegedokumentation
6.1 Eingangsfragen an den Klienten und persönliche Einschätzung des Klienten der pflegerischen Situation
6.2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
6.3 Mobilität und Beweglichkeit
6.4 Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen
6.5 Selbstversorgung
6.6 Leben in sozialen Beziehungen
6.7 Nur ambulante Pflege: Haushaltsführung
6.8 Nur stationäre Einrichtungen: Wohnen und Häuslichkeit
6.9 Erste fachliche Einschätzung der für die Pflege und Betreuung relevanter Risiken und Phänomene
6.10 Ausfüllanleitung zur Maßnahmenplanung
6.11 Ausfüllanleitung zum Durchführungsnachweis und Pflegebericht
Fallbeispiel
7.1 Beispiel anhand eines praktischen Falles zum Ausfüllen der Strukturierten Informationssammlung (SIS)
7.2 Was bewegt Sie im Augenblick? Was können wir für Sie tun? Was bewegt Sie?
7.3 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
7.4 Mobilität und Beweglichkeit
7.5 Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen
7.6 Selbstversorgung
7.7 Leben in sozialen Beziehungen
7.8 Haushaltsführung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Was nicht dokumentiert ist, ist nicht erbracht“
Diesen Satz musste ich schon vor vielen Jahren während meiner Ausbildung oft hören. Die PDL hat ihn fast täglich benutzt. Schon damals habe ich mich gefragt ob das tatsächlich so sein soll und ob es vielleicht nicht auch anders geht? Meine Ausbildung habe ich in einer stationären Einrichtung absolviert. Wir, die Pflegekräfte, mussten immer sehr viel dokumentieren. Den Durchführungsnachweis, in der Größe eines DIN A4 Blattes, konnte man noch 3-mal auseinanderklappen und hatte dann ein 6 seitiges Formular welches nach jedem Dienst mühsam durchgearbeitet werden musste. Mir ist bereits zu dieser Zeit aufgefallen, dass die Pflegekräfte die Handzeichen einfach setzten, ohne wirklich darauf zu achten was sie da eigentlich „abkürzeln“. Täglich wiederkehrende Pflegemaßnahmen werden oft vom Pflegepersonal mit einem Handzeichen quittiert ohne die pflegerische Situation tatsächlich objektiv zu bewerten. So habe ich beobachtet, dass im Durchführungsnachweis beispielsweise „Bew. mobilisieren“ abgezeichnet wurde obwohl am selben Tag im Pflegebericht beschrieben wurde, dass es dem Bewohner nicht gut ging und er im Bett verblieb.
Eine weitere Tatsache die mir bereits während der Ausbildung negativ auffiel war, dass Bewohnerakten von Anfang an mit sämtlichen verfügbaren Formularen vollgestopft wurden. Es gab eine „Mustermappe“ und nach diesem Muster mussten alle neuen Dokumentationsmappen ausgestattet werden. Dies ist heute, aus eigener Erfahrung, in den meisten Einrichtungen noch immer so. Aus meiner Sicht ist dies jedoch der falsche Ansatz. Die Pflegedokumentationen sollten am Anfang nur mit den nötigsten Formularen versehen werden. Werden zusätzliche Assessmentformulare benötigt, kann man diese später in die Pflegedokumentation einbringen und ausfüllen. Es werden in den meisten Einrichtungen Assessmentformulare ausgefüllt, obwohl der Klient in diesem Bereich gar kein Risiko aufweist. So ist den Formularen an beispielsweise sechs aufeinanderfolgenden Monaten zu entnehmen, dass kein Risiko vorliegt. Ein sinnfreies Vorgehen ohne jegliche Aussagekraft! Es wird Zeit dass sich hier grundlegend etwas ändert.
2. Entbürokratisierte Pflegedokumentation
2.1 Hintergründe
Die Bundesregierung gab im Jahr 2013 eine Studie in Auftrag um den bürokratischen Aufwand in der Pflege zu ermitteln. Im April 2013 wurden die Ergebnisse dieser Studie vorgestellt: Rund 2,7 Milliarden Euro müssen jedes Jahr für die Pflegedokumentation aufgebracht werden. Für 2,7 Milliarden Euro könnten in jeder Pflegeeinrichtung Deutschlands 3 Vollzeitkräfte zusätzlich eingestellt werden.
Das statistische Bundesamt hat ermittelt, dass eine Pflegefachkraft im Schnitt 6 Stunden und 26 Minuten für das Anlegen der Pflegedokumentation aufbringen muss wenn ein Klient in ein Pflegeheim einzieht.
Dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) zufolge muss eine Pflegekraft von ihren 8 Stunden Arbeitszeit rund eine Stunde für die Pflegedokumentation aufwenden.
Angesichts des bereits vorhandenen und sich zukünftig zuspitzenden Fachkräftemangels sind diese Fakten mehr als bedenklich. Statt immer mehr zu dokumentieren, muss der Aufwand für die tägliche Pflegedokumentation erheblich reduziert werden, da er die Arbeitsbedingungen, Arbeitsmotivation und Arbeitszeit der Pflegekräfte beeinflusst und somit die Attraktivität des Pflegeberufes mitbestimmt.
Aus diesen und weiteren Gründen legte die Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der Pflege (OBF) Elisabeth Beikirch im Bundesministerium für Gesundheit im Juli 2013 Empfehlungen zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation vor.
Folgende Ziele wurden mit der Entwicklung des neuen Strukturkonzeptes für die Pflegedokumentation verfolgt(1):
Bisherige fachliche und juristische Aussagen zur Dokumentation zu hinterfragen,
Kritikpunkte aus der Fachpraxis und von den Verbrauchern aufzugreifen,
Die Bedeutung von fachlicher Kompetenz und beruflicher Erfahrung der Pflegenden stärker herauszustellen,
Den zeitlichen Aufwand für die Pflegedokumentation möglichst zu minimieren und eine gemeinsame Grundlage für die interne und externe Qualitätssicherung zu schaffen
Schaffung einer gemeinsamen Grundlage zur Pflegedokumentation für Heimaufsichten, Kranken- und Pflegekassen, Medizinischen Diensten der Krankenkassen und Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung e.V.
Die entbürokratisierte Pflegedokumentation soll sich zukünftig nicht mehr am 6-stufigen Pflegeprozessmodell von Fiechter und Meier orientieren sondern basiert nun auf dem WHO Modell mit 4 Schritten und den zugehörigen folgenden 4 Elementen:
Grafik 1: Pflegeprozessmodell nach WHO
Strukturierte Informationssammlung (SIS)
Individuelle Pflege- und Maßnahmenplanung
Durchführung der Pflege im Zusammenhang mit der veränderten Vorgehensweise mit dem Pflegebericht
Evaluation
1. Strukturierte Informationssammlung (SIS)
Die Strukturierte Informationssammlung (SIS) steht am Anfang des Pflegeprozesses. Sie wird zunächst im Rahmen des Erstgespräches eingesetzt und kann zu einem späteren Zeitpunkt bei veränderten pflegerischen Voraussetzungen oder zur Evaluation erneut eingesetzt werden.
Entwickelt wurde die SIS auf Basis des „Neuen Begutachtungsassessments“ (NBA). Das NBA ist in 7 bzw. 8 Module gegliedert die in der SIS in 5 bzw. 6 pflegerelevante Kontextkategorien (Themenfelder) eingeteilt wurden:
Kognition und Kommunikation
Mobilität und Bewegung
Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen
Selbstversorgung
Leben in sozialen Beziehungen
Für ambulante Pflegedienste: Haushaltsführung Für stationäre Einrichtungen: Wohnen und Häuslichkeit
Die Reihenfolge der Themenfelder kann im Erstgespräch variabel verändert werden.
Die SIS ist in vier Abschnitte eingeteilt:
Im ersten Abschnitt werden die allgemeinen Daten wie z.B. der Name der pflegebedürftigen Person eingetragen.
Im zweiten Abschnitt wird die persönliche und individuelle Sichtweise des Pflegebedürftigen und / oder seinen Angehörigen zu seiner aktuellen Situation, zu Wünschen und Erwartungen an die Pflege und ggf. auch pflegerelevante biografische Daten im Originalwortlaut verschriftlicht. Dieser Abschnitt soll dazu dienen ein Gespräch zu initiieren und dem Pflegebedürftigen und / oder seinen Angehörigen entsprechend Raum zu geben. Für die Pflegeperson hervorzuheben ist, dass die Aussagen genauso schriftlich fixiert werden sollen wie sie gemacht wurden.





























