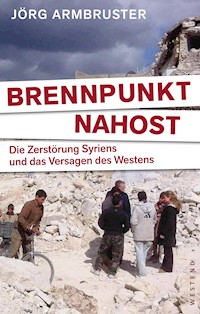19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre Arabischer Frühling: Gibt es noch Hoffnung im Nahen Osten? 2010/11 elektrisieren die Aufstände der arabischen Jugend die Welt, Demokratie und Freiheit scheinen zum Greifen nah. Zehn Jahre später ist die Bilanz ernüchternd: Die Region wird durch ständige Konflikte erschüttert und kommt nicht mehr zur Ruhe. Wie es so weit kommen konnte, erfährt Jörg Armbruster im Gespräch mit den Menschen vor Ort: Vom Konflikt zwischen Jung und Alt, Strenggläubigen und Liberalen und den großen Versäumnissen des Westens. "Sein Name und seine Person stehen wie für das wichtigste Gut in der Krisenberichterstattung: Glaubwürdigkeit." - Peter Boudgoust, ehem. SWR-Intendant
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jörg Armbruster
Die Erben der Revolution
Was bleibt vom Arabischen Frühling?
Hoffmann und Campe
Vorwort
Araber als Bombenleger oder Kopfabschneider, als grausame Dschihadisten oder autoritäre Patriarchen, als permanente Bedrohung und Inbegriff der Rückständigkeit. Die meisten Menschen im Westen haben solche Klischees in ihren Köpfen abgespeichert, mal als grelles Zerrbild, mal als kaum eingestandene Voreingenommenheit. Dass auch arabische Menschen davon träumen, ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Würde zu führen, und bereit sind, für diesen Traum auf die Straße zu gehen, das scheint man hier nur allzu oft zu übersehen. Dabei hat der Westen vor zehn Jahren genau dies miterleben können, auf fast allen Fernsehkanälen: Kairo, im Januar 2011. Tausende junge Ägypterinnen und Ägypter marschierten zum Tahrir-Platz. Eine radikale Wende fordern sie – eine Gesellschaft ohne Korruption, ohne politische Gefangene, ohne Angst vor der Geheimpolizei. Eine Gesellschaft, in der endlich die Menschenrechte gelten.
Kairo, im Januar 2021. Heute zählt Ägypten wieder zu den repressivsten Staaten der arabischen Welt. Spitzel belauschen in Cafés die Gespräche, politische Gefangene gehören zum Alltag. Die Menschen ducken sich wieder und haben Angst. Es ist, als habe es den Aufstand vor zehn Jahren nie gegeben.
Ist von dem großen Akt der Befreiung und der kurzen Zeit der Freiheit irgendetwas übrig geblieben? Was denken die Erben der Revolution heute? Gibt es sie überhaupt noch, diese einst so widerständige Opposition?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, bin ich im Herbst 2019 nach Kairo gereist. Hintergrundgespräche wollte ich führen, mich mit Freunden und Bekannten treffen. Wobei es angesichts der allgegenwärtigen Bespitzelung ungewiss war, ob sie sich überhaupt mit mir treffen wollten. Denn für die ägyptischen Staatssicherheitsbehörden und Gerichte grenzen Kontakte mit der internationalen Presse fast schon an Hochverrat. Schließlich weiß die Obrigkeit am Nil, dass sie in solchen Gesprächen alles andere als gut wegkommt. Und wer die Regierung kritisiert, landet schnell im Gefängnis.
Doch zu meiner Freude kam es ganz anders. Meine Wunschgesprächspartner ließen sich nicht abschrecken: »Komm vorbei. Ich freue mich. Es gibt viel zu erzählen.« Mein Angebot, die Informanten in dem Buch zu anonymisieren, lehnten viele ab: »Die Polizei weiß ohnehin, wie ich denke. Warum soll ich mich da verstecken«, so die einhellige Reaktion.
Selten haben mich Begegnungen mehr berührt als diese Besuche bei ägyptischen Oppositionellen. Die Widersacher des Regimes leiden zwar spürbar unter der Paranoia und der Brutalität dieses Überwachungsstaats, sich ihm aber zu unterwerfen, kommt für keinen infrage. »Nur so kann ich morgens noch in den Spiegel sehen«, gestand mir der Redakteur eines oppositionellen Online-Magazins. Ein Menschenrechtsanwalt erklärte mir, seine Frau und seine Kinder lebten im Ausland: »Daher muss ich hier auf niemanden Rücksicht nehmen.« Sie alle waren im Januar 2011 begeistert auf den Tahrir-Platz gezogen. Zweieinhalb Jahre später hatten sie das gewaltsame Ende ihres Traums erleben und damit erst einmal die Hoffnung begraben müssen, ein freies Leben führen zu können. Ähnliche Niederlagen haben auch die Menschen in Damaskus, Tripolis, Sanaa oder Manama erlebt. Auch hier waren die Aufstände mehr oder weniger schnell niedergeschlagen worden. Allein das kleine Tunesien scheint so etwas zu sein wie eine demokratische Enklave in der autoritär regierten arabischen Welt.
Haben die Erben dieser Revolutionen resigniert oder haben sie noch Hoffnung? Ist diese islamische Welt unmittelbar vor der Haustür Europas überhaupt reformierbar? Oder ist es vielleicht doch besser so, wie es heute ist? Nicht wenige Politiker in westlichen Hauptstädten scheinen das zu denken. Sie sehen in den autoritären Herrschern so etwas wie ein verlässliches Bollwerk gegen dschihadistische Gewalttäter und die letzte Bastion gegen Flüchtlinge aus Afrika. Und nicht nur in rechtspopulistischen Kreisen wird zuweilen gefragt: »Können Araber überhaupt Demokratie?« Schließlich haben doch die wenigen freien Wahlen während des Arabischen Frühlings zu nichts Gutem geführt. In Ägypten hatten die Muslimbrüder in Gänze, in Tunesien in Teilen die Macht übernommen.
Das ist zwar richtig. Doch in Ägypten waren die Muslimbrüder gerade mal ein knappes Jahr an der Regierung, ehe sie weggeputscht wurden. Und in Tunesien waren es am Ende die Wähler, die dafür gesorgt haben, dass die Islamisten heute eine weit weniger bedeutende Rolle in der Politik spielen als noch 2011. Außerdem haben die tunesischen Islamisten einen Häutungsprozess durchgemacht, der sie heute mehr einer konservativ-religiösen Partei wie der CSU ähneln lässt als gewaltbereiten Dschihadisten. Auch dies ist das Resultat einer demokratischen Entwicklung, der in diesem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet ist.
Ohnehin hat der Einfluss der Islamisten auf die arabische Jugend während der letzten zehn Jahre deutlich abgenommen. Dröhnende Heilsversprechen und schlichte Slogans wie »Der Islam ist die Lösung« verfangen immer weniger bei jungen Erwachsenen. Steht die islamische Welt also vor einer säkularen Wende? Dieses Buch versucht Antworten darauf zu geben.
Religiöse Lockrufe haben jedenfalls auch bei den jüngsten Revolutionen gegen diktatorische Langzeitherrscher keine Rolle gespielt. Weder in Algerien noch im Sudan. Im Gegenteil. Im Sudan hatten islamistische Despoten das Land dreißig Jahre in ihrer Gewalt gehabt, ehe die jungen Sudanesinnen und Sudanesen im Frühjahr 2019 mit ihnen endlich Schluss machten. Bei meinem Besuch in Khartum sagte mir einer dieser erfolgreichen Jungrevolutionäre kurz und knapp: »Nie wieder Islamisten. Nie wieder Religionsdiktatur. Von all dem haben wir die Schnauze voll!« Selbst glaubensstarke Sudanesen sehen ein: zu viel Islam in der Politik schadet dem Land.
Darüber hinaus hat diese Revolution an einer im Westen weit verbreiteten vermeintlichen Gewissheit gekratzt. Die islamische Welt unterdrücke die Frauen, heißt es bei uns gerne. Auch wenn die Annahme nicht ganz falsch ist: Die Aufstände im Sudan erzählen eine ganz neue Geschichte. Hier waren es in erster Linie Frauen, die sich 2019 an die Spitze der Erhebung gestellt haben. Gewerkschafterinnen und Geschäftsfrauen koordinierten die Proteste, Lehrerinnen und Hausfrauen führten sie an, Studentinnen standen in den ersten Reihen. Bei keiner anderen Revolte im Nahen Osten haben Frauen eine derartig entscheidende Rolle gespielt. Von starken Frauen und mutigen Studentinnen und Studenten handeln daher die beiden Kapitel über den Sudan. Außerdem zeigen sie, dass in diesem wie auch in anderen Ländern des Arabischen Frühlings die Aufstände von langer Hand vorbereitet waren. Sie kamen also alles andere als überraschend, wie im Westen gerne verbreitet wird.
Wie also sieht es aus mit der viel proklamierten Zeitenwende in der arabischen Welt? Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter?
Bei diesen Fragen konnte mir in Ägypten keiner meiner Gesprächspartner wirklich weiterhelfen. Schulterzucken. Ratlosigkeit. Im Sudan herrscht Unsicherheit, in Tunesien Instabilität. Eindeutige Antworten kann das Buch daher nicht geben. In einem allerdings waren sich alle einig: Von der Europäischen Union erwarten sie kaum mehr Hilfe in Sachen Demokratisierung. Im Stich gelassen fühlen sie sich: »Am Ende unterstützen die lieber das Regime als uns.« Nicht nur am Nil bekam ich diesen Satz zu hören. Der Putsch und die EU – ein trauriges Kapitel in diesem Buch, eines über Doppelmoral und Geschäftemacherei.
Um das Erbe der Revolutionen von 2011 scheint es also nicht gut bestellt zu sein. Und doch – es tut sich etwas bei den jungen Menschen in der arabischen Welt. »Wir sind noch nicht fertig«, sagen sie. Vor allem wollen sie sich nicht länger abspeisen lassen mit »leeren Versprechungen und kosmetischen Veränderungen«, wie eine Politikwissenschaftlerin der in Paris ansässigen Organisation »Arab Reform Initiative« schreibt. Der Wunsch nach einem Leben in Würde, Gerechtigkeit und Freiheit ist also ungebrochen, trotz aller Rückschläge. Nur, über Nacht wird die erhoffte Wende nicht kommen. Solche Umbrüche brauchen Zeit. Vielleicht Jahrzehnte. Niemand kann dies vorhersehen. Aber eines sollten wir nicht vergessen. Hier in Deutschland dauerte es 101 Jahre, ehe wir eine stabile Demokratie hatten – von der ersten Revolution 1848 bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949. Und die haben wir nicht uns zu verdanken, sondern den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs.
Jörg Armbruster, Frühjahr 2021
Kapitel 1Ägypten – Vor dem Putsch
Kairo, Tahrir-Platz
Es herrscht Chaos, wie immer am Nachmittag. Rushhour. Ein Höllenlärm aus wildem Hupen, knatternden Mopeds, Sirenengeheul, röchelnden Motoren und schalldämpferbefreiten Auspuffen. Gas geben, bremsen, Gas geben. Alle wollen heim. Autos drängen sich aneinander vorbei. Dass das nicht immer gut geht, zeigen die vielen Beulen und Schrammen an den Karosserien. Tut sich eine noch so enge Lücke auf, zwängt sich ein Fahrer hinein. Manchmal geht es nur zentimeterweise voran. Ein Wunder, dass sich überhaupt etwas bewegt. Und mitten in diesem Tohuwabohu aus weißgrauen Taxis, Motorrädern, Kleinlastern und Privatautos trottet ein Bauer neben seinem mit Wassermelonen beladenen Eselskarren. Wie Tier und Mensch diesen Lärm und Abgasgestank aushalten, ist ein Rätsel. Über dem Platz hängt eine von der Sonne aufgeheizte Glocke aus Grobstaub, Stickoxyden und dem Bleidunst der Fahrzeuge, die jeden aufrechten TÜV-Prüfer verzweifeln lassen müssten. Aber in Kairo ist das normal. Ein Alltag ohne Verkehrschaos? Kaum vorstellbar, schon gar nicht rund um den Tahrir-Platz.
Am Rand dieses berühmten Rondells lehnen Polizisten an Absperrgittern und beobachten gelassen das Chaos. Für sie haben andere Dinge Priorität. Der seit kurzem frisch begrünte Tahrir-Platz ist nicht nur wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Metropole, er ist zugleich Symbol. Vor zehn Jahren hatten sich hier Ägypterinnen und Ägypter aus allen Gesellschaftsschichten versammelt, um gegen Präsident Husni Mubarak zu demonstrieren. Hier, weil sie den Namen des Platzes wörtlich nahmen, denn tahrir heißt »Befreiung«. Ausgehend von Protesten in Tunesien und Ägypten, war der Funke in fast die ganze arabische Welt übergesprungen. Ins vermögende Bahrain, in den bettelarmen Jemen, ins Ölland Libyen, dann ins unglückliche Syrien. Selbst in superreichen Ländern wie Kuwait oder Saudi-Arabien mussten sich die Scheichs und Könige freikaufen vom Zorn ihrer Untertanen. Vor allem junge Menschen waren es, die überall versuchten, die alten Herrscher aus ihren Ämtern zu vertreiben. In Tunesien gelang dies mit dauerndem, in Ägypten nur mit zeitweiligem Erfolg. Präsident Mubarak wurde gestürzt. Als neuer Präsident gewählt wird der von der Muslimbruderschaft unterstützte Mohamed Mursi. Zur Ruhe kam das Land dennoch nicht. 2013 kommt es schließlich zum Militärputsch. Seither regiert Präsident al-Sisi mit eiserner Hand, nach alter Manier.
Dass es nicht wieder zu Protesten kommt, das sollen die Polizisten hier am Tahrir-Platz verhindern. Aufstandsversuche im Keim zu ersticken, das ist ihr Auftrag. Deswegen stehen sie an den Absperrgittern des Platzes und beobachten die Passanten. Bleibt jemand auffallend lange stehen, erregt er sofort ihr Misstrauen. Zusammenrottungen sind um jeden Preis zu vermeiden. Beim geringsten Anzeichen schlagen sie Alarm. Dann wird eine Maschinerie in Gang gesetzt, die so präzise abläuft wie sonst kaum etwas in Ägypten. Schwarze Mannschaftswagen mit Polizisten schieben sich erbarmungslos durch den dichtesten Verkehr. Diese aus dickem Stahl zusammengeschweißten Truppentransporter sind vorn mit Schilden armiert, mit denen sie Barrikaden wegräumen können. Vollgas genügt. Allein der Anblick dieser gepanzerten Transporter im Rückspiegel lässt die Autofahrer an den Straßenrand flüchten. In den Seitenwänden dieser Kolosse sind auf halber Höhe faustgroße runde Löcher ausgeschnitten. Keine Luftlöcher, sondern Schießscharten. Die Polizisten schießen mit Tränengas oder mit Gummigeschossen oder scharf, je nach Befehl. Wasserwerfer folgen der Kolonne. Begleitet wird dieser Aufmarsch von ohrenbetäubendem Gejaule der Sirenen. Am Ende weitere gepanzerte Kommandofahrzeuge. Spätestens nach einer halben Stunde ist der Platz rundum besetzt.
Wer sich nicht schnell genug aus dem Staub gemacht hat, hat Pech gehabt. Jeder ist verdächtig.
»Zeig dein Smartphone! Mach Facebook auf!«
Den Befehlen der Polizisten ist Folge zu leisten. Wer sich weigert, wird festgenommen. Der Polizist scrollt durch die Facebook-Seite des potenziellen Staatsfeinds, sucht nach Posts mit politischen Inhalten – und sei es nur eine abfällige Bemerkung über die steigenden Preise. Vielleicht hat der Smartphone-Besitzer kürzlich von einem Freund aber auch eine al-Sisi-Karikatur zugeschickt bekommen und hat vergessen, sie zu löschen. In diesem Fall wird er sofort zum Gefangenentransporter geführt, der immer zum Polizeiaufmarsch gehört. Wahrscheinlich sitzen schon andere Verdächtige in dem stickigen, fensterlosen Innenraum des Lastwagens, verängstigt, verstört. Alles Protestieren hat keinen Zweck: »Ya bascha, ich habe doch nichts getan. Ich weiß nicht, wie das Bild auf meine Facebook-Seite kommt. Da hat mir einer einen bösen Streich gespielt. Ich liebe den Präsidenten. Lange lebe al-Sisi, lange lebe Ägypten!«
Die Polizisten haben klare Befehle. Selbst Kinder sind schon in das Mahlwerk der Justiz geraten.
Die Repressionswelle, die das Land seit 2013 erlebt, ist in der Geschichte Ägyptens beispiellos. Das bestätigt mir bei einem Besuch in Kairo Gamal Eid, Anwalt und Menschenrechtsaktivist seit 1994:
»Al-Sisi ist der Meinung, dass der Arabische Frühling 2011 nur entstehen konnte, weil Mubarak zu wenig Repression eingesetzt hat. Deswegen lässt er seine Polizei viel schärfer gegen Oppositionelle vorgehen, als es Mubarak je getan hat. Er will Angst und Schrecken verbreiten, um für sein Regime Stabilität zu erreichen.«
»Die Ägypter leben in ständiger Angst vor dem Sicherheitsapparat«, so ein anderer Menschenrechtler, der Chef der »Ägyptischen Kommission für Rechte und Freiheiten«, Mohamed Lotfi, »und ich fürchte, er hat einem großen Teil der Bevölkerung erfolgreich eingeimpft, entweder akzeptiert ihr mich und meinen Sicherheitsapparat, oder ihr bekommt das Chaos der Unruhen von 2011 und 2012 zurück. Tatsächlich war diese Zeit für viele eine wirtschaftlich schwierige Zeit.«
Als es Ende September 2019 tatsächlich erneut zu Tumulten auf dem Tahrir-Platz kommt, schlägt die Polizei erbarmungslos zu. Auf der Straße, bei Hausdurchsuchungen oder am Arbeitsplatz nimmt sie innerhalb kürzester Zeit über 4000 Ägypter fest. Ein paar hundert Menschen waren in Kairo wie auch in anderen Städten des Landes auf die Straße gegangen und hatten den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Lang aufgestaute Wut über Korruption und Misswirtschaft hatte sich Luft gemacht. Vorausgegangen war der Aufruf eines ehemaligen Bauunternehmers, der sich aus Angst, verhaftet zu werden, nach Barcelona abgesetzt hatte. Jahrelang hatte er Bauprojekte für das Militär ausgeführt, doch dann hatte er sich mit den Generälen überworfen. Er wechselte die Seite und prangerte, im sicheren Barcelona, die Verschwendungssucht des Militärs an, an der er bis dahin gut verdient hatte.
Für die ägyptischen Sicherheitsbehörden war der Aufruf des Bauunternehmers ein willkommener Anlass, gründlich aufzuräumen unter den bekannten Oppositionellen. Politiker, Menschenrechtler, Rechtsanwälte, so gut wie jeder, der sich in den letzten Monaten kritisch über die Regierung geäußert hatte, wurden festgenommen. Die Anklagen, wenn es überhaupt eine gab, lauteten: Unterstützung und Finanzierung einer Terrororganisation, Verbreitung falscher Nachrichten und Missbrauch der sozialen Medien. In aller Regel entbehrten sie jeder Grundlage.
Diese Geschichte um Mohamed Ali, so der Name des Bauunternehmers, der sich auch als TV-Schauspieler in Szene gesetzt hatte, ist nur eine kleine Episode aus der Zeit nach dem Militärputsch von 2013. Aber sie macht deutlich, wie angreifbar die Generäle und ihre Helfer sind. Mohamed Alis Enthüllungen haben sie kalt erwischt. Irgendwas wird hängen bleiben. Die Suezkanal-Erweiterung zum Beispiel – ein Mammutprojekt zum Ruhme des Landes, so die offizielle Propaganda. Tatsächlich, so Ali, sei die Steigerung der Einnahmen bislang ausgeblieben. Dass sich die Militärs private Paläste bauen lassen, musste sogar der Präsident einräumen, aber, so al-Sisi in grotesker Hilflosigkeit, diese Villen würden doch nur für das Volk gebaut.
Die Mohamed-Ali-Geschichte zeigt außerdem, dass es wieder gärt im ägyptischen Volk. Steht womöglich ein neuer arabischer Frühling ins Haus mit Massendemonstrationen gegen korrupte Politiker und Kämpfen mit Prügelpolizisten? Wohl kaum. Keiner meiner Gesprächspartner in Kairo erwartet eine solche Entwicklung in absehbarer Zeit.
Dazu sei das Spitzelsystem zu engmaschig und die Polizei- und Militärpräsenz zu massiv, sagt mir die Gründerin des »Nadim-Zentrums« für Folteropfer, Dr. Aida Seif al-Dawla, und fügt sogleich hinzu: »Auch dank eurer Hilfe und eurer Waffenexporte.« Dennoch – irgendwann wird es zu einem neuen Aufstand kommen: »Ich weiß natürlich nicht, wann. Aber es wird etwas passieren. So kann es auf Dauer nicht weitergehen. Ich fürchte nur, dass es beim nächsten Mal brutaler zugehen wird. Es wird richtig hässlich werden.«
All das sind Spekulationen. Aber dass es »hässlich werden wird«, wie Aida es formuliert hat, glauben fast alle meine Gesprächspartner. »Es wird radikaler werden. Die Menschen haben gelernt, dass sie 2011 viele Fehler gemacht haben«, so die ägyptische Schriftstellerin Basma Abdel Aziz, die sich als gelernte Psychiaterin intensiv mit den menschenverachtenden Diktaturen im Nahen Osten auseinandergesetzt hat. »Sie werden nicht mehr bereit sein, sich mit dem Militär zu arrangieren. Es wird gewalttätig werden, vermute ich. Die Menschen verarmen immer mehr. Sie sind wütend. Auf der anderen Seite hat das Militär sehr viel zu verlieren, die ganzen Privilegien. Ja, es wird sehr viel gewalttätiger zugehen als beim letzten Mal.«
Was also hat der Arabische Frühling vor zehn Jahren gebracht? Nur diese neue Militärdiktatur? War der Aufstand auf dem Tahrir-Patz 2011 vergeblich gewesen?
Wem immer ich diese Frage stelle, die Antwort lautet: nein. Die Zeit der Freiheit mag nur kurz gewesen sein, aber die Wirkung, die sie auf große Teile der ägyptischen Gesellschaft ausgeübt hat, sie dauert an.
»Der 25. Januar 2011 war ein Weckruf. Wir wollen eine andere Gesellschaft, lautete die Botschaft damals. Den Weckruf haben noch heute viele Menschen im Ohr«, so Mohamed Lotfi.
»Der 25. Januar hat uns Kraft gegeben weiterzumachen«, sagt der Anwalt Gamal Eid, der eigentlich an seinem Beruf verzweifeln müsste, weil »die Urteile, mit denen ich zu tun habe, alle von der Staatssicherheit vorgefertigt sind. Die Richter gehorchen und verkünden, was anderswo entschieden wird.« Die Erinnerung an den 25. Januar 2011 sei ihm aber Ansporn, nicht aufzugeben. »Wir müssen einfach weitermachen!«
»Wir haben die Lähmung der Mubarak-Zeit mit dem 25. Januar überwunden«, so Basma Abdel Aziz. Gleichzeitig gesteht sie: »Den Glauben an einen guten Ausgang dieses Frühlings hatte ich in dem Augenblick verloren, als das Militär eingriff.« Dennoch ist für sie entscheidend: »Wir haben damals unsere Furcht überwunden. Und besonders Frauen spielten dabei eine wichtige Rolle.«
Vorgeschichten
Bis heute herrscht Uneinigkeit darüber, wer oder was die »Arabellion« vor zehn Jahren wirklich ausgelöst hat. Wer hat die Demonstranten am 25. Januar 2011 auf dem Tahrir-Platz zusammengetrommelt, um Mubarak zu stürzen? Waren es, wie man zumeist hört, die jungen, gut ausgebildeten Ägypter, die Studentinnen und Studenten und die vielen arbeitslosen Akademiker? Die Kinder wohlhabender Mittelständler, die Söhne und Töchter der dünnen Schicht des Bildungsbürgertums? Die Aktivisten der ägyptischen Zivilgesellschaft, die Facebook-Freunde und Internetuser, die sich – gut miteinander vernetzt – auf dem Tahrir-Platz versammelten, dem »Platz der Befreiung«, um sich drei Wochen später dann tatsächlich von Mubarak, dem verabscheuten Dauerdespoten, zu befreien?
Nein. So einfach war es nicht. Die Geschichte des Tahrir-Platzes hat viele Vorgeschichten. Und sie beginnen deutlich früher.
Ischak, Bischri und Aswani haben genug
Eine dieser Vorgeschichten beginnt 2004 an einem Abend während des Fastenbrechens im Ramadan. Etliche Mubarak-Gegner hatten sich im Haus des Kairoer Intellektuellen Abul Ela al-Ramadi getroffen, sie diskutierten die alles andere als rosige Lage. Zur Begrüßung nach Sonnenuntergang hatte es erst die obligatorischen Datteln gegeben, dann gegrilltes Hammel- und Hühnerfleisch, Gemüse und Salat und natürlich frisch gebackenes Fladenbrot, dazu trank man Obstsaft, alles auf einem langen Tisch angerichtet. Zum Abschluss bot der Gastgeber den überzuckerten Brotauflauf Umm Ali an, schließlich süßen Tee oder türkischen Kaffee. Ein typisches iftar-Essen am Ende eines Fastentags.
Es war Anfang November. Unter den Mubarak-Kritikern: der ehemalige Lehrer George Ischak, mit dessen Namen Kifaja bis heute untrennbar verbunden ist, außerdem Tariq al-Bischri, bekannt als einer der wenigen unbestechlichen Richter des Landes, und der Nasserist Hamdin Sabahi, der Jahre später zweimal als Präsidentschaftskandidat antreten sollte, einmal gegen den Muslimbruder Mohamed Mursi und zwei Jahre später gegen General Abdel Fattah al-Sisi. Beide Male sollte er verlieren.
In dieser Männerrunde war man sich schnell einig. Wichtig sei es, den Protest zu bündeln, Einzelkämpfer könnten nichts ausrichten. Und vor allem: Man müsse den Protest auf die Straße bringen. In möglichst vielen Städten die Bürger zu zivilem Ungehorsam auffordern. Ein Name für diese Bewegung war schnell gefunden: kifaja – »genug«. Schließlich hatten alle genug von der Herrschaft der Mubarak-Familie.
Mit dem inzwischen einundachtzig Jahre alten George Ischak treffe ich mich im Jahr 2019 im vornehmen Interconti-Hotel Semiramis. Dieser Treffpunkt war sein Wunsch gewesen. Er wohnt gleich um die Ecke, nicht weit vom Tahrir-Platz entfernt.
»Wir haben damals beschlossen, am Tag der Menschenrechte, also am 10. Dezember, eine große Demonstration zu organisieren«, beginnt der rüstige Mann zu erzählen, als wir uns im Hotelcafé gegenübersitzen. »Die Menschen sollten vor dem Obersten Gerichtshof im Zentrum Kairos gegen die Menschenrechtsverletzungen protestieren. Bis zum 10. haben wir es nicht geschafft, aber am 12. Dezember 2004 versammelte sich ein kleines Häuflein von Protestierenden vor dem Gericht und rief: ›Nieder mit Mubarak!‹ oder ›Mubarak, du bist ein Dieb‹, schließlich war den meisten Ägyptern bekannt, dass sich die Familie Mubarak schamlos bereicherte.«
Diese Parolen, die in Ägypten so noch nie gehört worden waren, kamen einer Majestätsbeleidigung gleich. Mubaraks Ansehen war damals bereits im Schwinden, und man beobachtete mit Sorge, dass der Vater seinen Sohn Gamal als neuen Präsidenten aufbauen wollte. Doch »Nieder mit Mubarak«? Das ging vielen zu weit.
»Viele Passanten hielten uns für verrückt. Etwas musste in unseren Köpfen falsch gepolt sein. Aber dann schlossen sich immer mehr Menschen unserer Demonstration an. Am Ende waren wir über tausend.« Diese Demonstration am 12. Dezember 2004 war, so Ischak, die allererste Kundgebung, auf der in der Öffentlichkeit der Rücktritt Mubaraks gefordert wurde. Es war die Geburtsstunde der Protestbewegung in Ägypten, die sechs Jahre später in den Arabischen Frühling mündete.
Später stieß der Schriftsteller Ala al-Aswani zu der Gruppe. In seinem Roman Der Jakubijân-Bau, der 2002 erschienen war, hatte Aswani zum ersten Mal in der ägyptischen Literatur Tabuthemen wie Homosexualität, Vergewaltigung, Radikalisierung und Korruption der Mächtigen thematisiert. Dieser ägyptische Bestseller hat zweifellos mit seiner schonungslosen Offenlegung der ägyptischen Oberschicht-Bigotterie zur Mobilisierung der Jugend mit beigetragen. Tausendfach verkaufte sich das Buch in einem Land, in dem damals fast die Hälfte der Erwachsenen weder lesen noch schreiben konnte. Es war, als hätten die ägyptischen Leser nur auf einen solchen Schlüsselroman gewartet. Endlich hatte einer aufgeschrieben, worunter die Menschen schon lange litten in Ägypten.
Das System Mubarak
Seit 1981 regierte Husni Mubarak dieses Ägypten – ganz offiziell und ohne Unterbrechung im »Ausnahmezustand«. Seine Polizei foltert. Menschen verschwinden in den Gefängnissen, werden ermordet. Das Land ist runtergewirtschaftet durch Korruption und Inkompetenz. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, ebenso die Inflation. Jeder Ruf nach Reform wird sofort zum Verstummen gebracht. Wer Institutionen wie das Scheinparlament oder die Regierung infrage stellt, gilt bereits als Landesverräter. Polizei und Geheimdienste unterdrücken jede Opposition, verbreiten Angst und Schrecken. Das Land ist erstarrt, die Menschen sind gelähmt. Außerdem verlangt der Internationale Währungsfonds für neue Kredite eine immer rigidere Sparpolitik, die in erster Linie jene Ägypter trifft, die ohnehin um ihr täglich Brot kämpfen müssen. Auf der Skala des »Human Development Index« der UNO lag Ägypten 2003 auf dem 119. Platz von 177 Ländern. In Tunesien und Algerien genossen die Menschen einen höheren Lebensstandard. Selbst im besetzten und häufig abgeriegelten Westjordanland ging es diesem Index zufolge den Menschen damals besser als den Ägyptern.
All das schien das Herrschaftssystem der Familie Mubarak nicht zu stören. Wer ihre Gunst gewonnen hatte, lebte in einer Blase, in der Intrigen- und Machtspiele sowie Bereicherung wichtiger waren als politische Programme zum Wohl des Landes.
Ein Beispiel: Der Stahlbaron Ahmed Ezz, Mubarak-Vertrauter und enger Freund von dessen Sohn Gamal, kontrollierte 2008 rund 47 Prozent der Stahlproduktion und 75 Prozent des lokalen Stahlmarktes Ägyptens. Als Generalsekretär der Staatspartei NDP und Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Parlament steuerte er die Wirtschaftspolitik des Landes. In dieser Doppelrolle verhinderte er Kartellgesetze, die seinen Geschäften hätten gefährlich werden können, und manipulierte den Wettbewerb auf dem ägyptischen Stahlmarkt durch Importverbote von billigem Stahl aus dem Ausland, um so seine eigene teurere Produktion zu schützen. Erst der Rücktritt seines Freundes Mubarak machte diesem Treiben ein Ende, das in der ägyptischen Öffentlichkeit schon lange bekannt war.
Auch in einem 274 Seiten dicken Bericht über Korruption in Ägypten, den Kifaja 2006 veröffentlichte, war Ahmed Ezz prominent vertreten. Laut diesem Bericht gab es damals so gut wie keinen korruptionsfreien Bereich im öffentlichen Leben. Egal ob im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Energiewesen oder in den Antikenbehörden, überall versuchten die Verantwortlichen so viel Geld wie möglich abzuschöpfen auf Kosten der Bürger. Zu den gängigen Methoden gehörten Kapitalflucht ins Ausland, Nepotismus und Vorteilsnahme. Es gab den Vorwurf, der Generalsekretär der Regierungspartei und seine Söhne hätten bei einem Prostituiertenring abkassiert. Andere hohe Regierungsbeamte sollen am Drogenschmuggel beteiligt gewesen sein. Aufgedeckt wurde der Einsatz von verbotenen, weil krebserregenden Pestiziden in der Landwirtschaft. Auch Mubaraks Ehefrau und seine beiden Söhne wurden in dem Bericht der Bestechlichkeit, Veruntreuung und Unterschlagung beschuldigt.
Sohn Gamal, von Beruf Investmentbanker, hatte sich mit einer Kamarilla einflussreicher Geschäftsleute umgeben, die alle hofften, durch ihn noch reicher zu werden. Gamal Mubarak und sie waren es, die die Privatisierung der Staatswirtschaft vorantrieben, wobei sie sich die Filetstücke der Staatsbetriebe unter den Nagel rissen. Oft lag der Immobilienwert der Grundstücke dieser Staatsfirmen weit über dem Verkaufswert der Fabrik, den der Käufer bezahlt hatte. Spätestens ab 2010 war den meisten Ägyptern klar, dass Gamal Mubarak der Nachfolger des Dauerdespoten werden sollte. Auch das Militär beobachtet diese Entwicklung misstrauisch. Sohn Gamal an der Spitze des Staates hätte die Macht und den Einfluss des Militärs erheblich geschmälert.
Seit 1952 war es das Militär gewesen, das den Präsidenten stellte. Daran zu rütteln kam in ihren Augen Hochverrat gleich und konnte von den Generälen nicht hingenommen werden. Denn die hohen Offiziere Ägyptens sind mehr als nur tapfere Landesverteidiger, die bislang zwar jeden Krieg verloren, sich aber als eine feste Größe in Politik und Wirtschaft eingerichtet haben – ein von niemandem kontrollierter Staat im Staat. Außer Generalstabsplaner sind sie gewiefte Geschäftsleute und Fabrikbesitzer mit einer breit gestreuten Produktpalette. Sie produzieren Lebensmittel, Olivenöl, Milch, Brot: Für Ägypter wichtige Grundnahrungsmittel, für die Militärs ein lukratives Geschäft. Außerdem gehören Tankstellen und Hotelketten zum Wirtschaftsimperium der Manager in Uniform. Die Zementproduktion des Landes kontrollieren sie fast vollständig. Kein Gebäude, keine Brücke, keine Befestigungsanlage, an denen sie nicht ordentlich mitverdienen. Zwischen 20 und 40 Prozent des ägyptischen Bruttosozialprodukts soll in solchen Militärunternehmen erwirtschaftet werden. So genau weiß das niemand. Aber an dieser Macht zu rühren, hatte bislang noch kein Politiker gewagt. All dies könnte auf dem Spiel stehen, sollte der Zivilist Gamal Mubarak neuer Präsident werden. Daher war die Rebellion auf dem Platz im Januar 2011 auch so etwas wie ein Geschenk für die Generäle.
Nach dem Rücktritt Mubaraks ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Sohn Gamal und die meisten seiner Freunde wegen Korruption. Sie landeten entweder im Gefängnis wie Ahmed Ezz und die Mubarak-Söhne einschließlich ihres Vaters, oder sie flohen ins Ausland, wohin sie schon früher einen großen Teil ihres erschlichenen Vermögens transferiert hatten. Nach der Revolution 2011 haben Finanzbehörden der Schweiz dem Mubarak-Clan gehörende Konten im Gesamtwert von 700 Millionen Dollar ermittelt und eingefroren. Ahmed Ezz konnte sich 2014 für eine Kaution von 10 Millionen Euro freikaufen. Arm ist er dadurch vermutlich nicht geworden. Vater Mubarak durfte schließlich 2016 seine Zelle gegen ein Zimmer seiner Luxusvilla im vornehmen Kairoer Stadtteil Heliopolis eintauschen. Das Gericht sprach ihn frei. Seine beiden Söhne waren schon 2015 freigekommen. Von ihrem unterschlagenen und ins Ausland verschobenen Vermögen, das von einigen Experten auf insgesamt 10 Milliarden Dollar, von anderen auf fast 70 Milliarden geschätzt wird, ist in Ägypten nur ein Bruchteil aufgetaucht.
Auch Mutter Suzanna spielte im System Mubarak eine wichtige Rolle. Um sich die Gunst der First Lady Ägyptens zu sichern, buckelten selbst Minister vor ihr, und dies mitunter in aller Öffentlichkeit. Zum Beispiel die Ministerin für Arbeit und Migration auf einem Regierungsempfang. In einem vom ägyptischen Fernsehen aufgenommenen und später auf YouTube veröffentlichten Film sieht man die Ministerin unter hochrangigen Staatsdienern in schwarzen Anzügen in einem Festsaal. Sie redet auf die gerade angekommene Suzanna Mubarak ein, die ihr höflich lächelnd zuhört, aber nicht weiter interessiert zu sein scheint. Plötzlich greift die Ministerin die linke Hand der Präsidentengattin, zieht sie an sich und küsst sie. Suzanna Mubarak lächelt etwas gequält, lässt es aber über sich ergehen. Keiner der Anzugträger nimmt Notiz von dieser kleinen Szene.
Der Schriftsteller Ala al-Aswani hat in einem Essay erklärt, warum derartige Unterwürfigkeitsgesten normal waren in Mubaraks Ägypten:
»Aischa Abdel Hadi hatte sich nie träumen lassen, dass sie einmal Ministerin wird … Sie hat begriffen, dass sie nicht ernannt wurde wegen ihrer Kompetenz, sondern weil sie dem Präsidenten und seiner Familie genehm war, und um diese Gunst nicht zu verlieren, war sie zu allem bereit, sogar in aller Öffentlichkeit die Hand des Präsidenten, die seiner Gattin oder seiner Söhne zu küssen.« Aswani schließt seinen 2009, also noch zu Mubaraks Zeiten, geschriebenen, aber erst 2011 veröffentlichten Text mit der Frage: »Kann man von Aischa Abdel Hadi tatsächlich erwarten, dass sie die Würde und die Rechte der Ägypter verteidigt?« Eine Antwort erübrigt sich.
Wie die meisten arabischen Länder verfügt auch Ägypten über Institutionen, mit denen sich ein kompromisslos diktatorisches Regime einen demokratischen Anstrich verpasst – ein Parlament zum Beispiel, Wahlen oder eine angeblich unabhängige Justiz. Der jährlich von der UNO herausgegebene Arab Human Development Report von 2004 beschreibt diese schizophrene Situation: »Solche Institutionen sind der Exekutivgewalt unterworfen, sind Teil des Regierungsapparates, sie dienen also nicht zum Schutz der Freiheiten der Bürger.« Ein solches System schaffe »Parlamentarier, die vor der Regierung einen Diener machen, statt deren Arbeit zu überwachen; NGOs, die im Auftrag der korrupten Regierung arbeiten; Medien, die Regierungspropaganda verbreiten, also nichts mehr sind als das Sprachrohr der Herrschenden.«
In der Machtpyramide des Landes nahm der »Pharao«, wie die Ägypter Mubarak heimlich nannten, den obersten Platz ein, zusammen mit seinem Sohn Gamal und dessen korrupten Freunden, gefolgt vom Militär und den Geheimdiensten als den Wächtern und Garanten dieses Systems. Niemand durfte es infrage stellen. Dafür sorgten Polizei und verschiedene Staatsschutzdienste, die ihre Spitzel selbst in den Teehäusern platziert hatten. Offene Diskussionen waren nicht möglich, wussten die Teehausbesucher doch nie, wer Freund war und wer Feind. Die »Nationaldemokratische Partei« (NDP), die Staatspartei, hatte die Aufgabe, für Mehrheiten im Scheinparlament zu sorgen. An den Spitzen der 27 Gouvernements standen ohnehin Mubarak-treue Generäle. Auch von der Justiz konnten die Ägypter keine Hilfe erwarten. Die meisten Richter waren genauso käuflich und abhängig wie alle anderen Beamten auch.
Bleischwer lag dieses System auf dem Land und lähmte es bis zum Stillstand. Und genau aus diesem Grund hatte 2004 die Ramadan-Runde um George Ischak verkündet: Kifaja! Es reicht!
»Wir haben damals in allen Gouvernements Demonstrationen angezettelt«, erzählt Ischak mir im Interconti-Hotel, und seine Augen leuchten, auch jetzt noch, fünfzehn Jahre danach. »Immer vor dem Dienstsitz des Gouverneurs. Für eine Stunde mit Parolen wie ›Mubarak, du bist ein Dieb‹. Dann verschwanden wir wieder.« Schneller als die Polizei vor Ort sein konnte. Das war die Idee, und sie funktionierte. Immer mehr Menschen schlossen sich der Bewegung an.
In jenem Jahr kündigte Mubarak an, sich im kommenden Jahr, 2005, wieder zum Präsidenten wählen lassen zu wollen, wieder mit einem von der Staatspartei NDP dominierten Parlament. Die Väter von Kifaja wussten, was auf das Land zukommen würde – Wahlfälschungen wie bei den Abstimmungen zuvor, gekaufte Stimmen, Schlägertrupps gegen Oppositionskandidaten, Behinderungen im Wahlkampf, Manipulationen der Wahlurnen und der Auszählungsergebnisse. Und all das würden die Staatszeitungen dann als eine freie, demokratische Wahl verkaufen.
Immerhin machte das Ausland Druck: »Bitte etwa mehr Demokratie«, war aus Washington und Brüssel an Mubarak herangetragen worden. Dem obersten Ägypter blieb gar nichts anderes übrig, als sich den Wünschen zu fügen, schließlich sind die USA ein äußerst wichtiger Geldgeber. Doch Mubarak war schlau genug, die USA zufriedenzustellen, ohne seine Macht ernsthaft zu beschneiden. Er sorgte dafür, dass die Hürden für eine Wahlzulassung so hoch gelegt wurden, dass am Ende neben der traditionell zugelassenen »Wafd«-Partei nur wenige Parteien und Kandidaten antreten konnten. Protest gegen diesen schlecht getarnten Wahlbetrug war aus Washington nicht zu vernehmen.
Immerhin zehn Kandidaten durften gegen Mubarak antreten. Eine dieser Alibiparteien war »Al-Ghad« (Der Morgen) mit dem Spitzenkandidaten Aiman Nur. Ihr Wahlergebnis war mit 7,4 Prozent der Wählerstimmen kümmerlich, allerdings bei einer Wahlbeteiligung von gerade einmal 23 Prozent. Doch selbst dieses magere Ergebnis war den Sicherheitsbehörden bereits zu viel. Sie ließen den Parteichef verhaften und vor Gericht stellen. Wegen angeblicher Urkundenfälschung wurde er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt – tatsächlich aber, weil er es gewagt hatte, eine neue Verfassung zu fordern. In Sachen Willkür und Repression war alles beim Alten geblieben in Ägypten.
Eines allerdings überraschte auch die Mubarak-Gegner. Die als unabhängige Kandidaten angetretenen Muslimbrüder errangen auf einen Schlag 88 der 442 Sitze und wurden damit zwar stärkste Oppositionskraft im von der Staatspartei kontrollierten Parlament. Doch mit der Kifaja-Bewegung wollten die Brüder nichts zu tun haben.
»Die Muslimbrüder waren Opportunisten ohne Rücksicht auf andere Oppositionelle. Wenn während einer Demonstration ›Nieder mit Mubarak‹ gerufen wurde, verschwanden die plötzlich«, erinnert sich George Ischak.
Faire Wahlen, keine Korruption und ein Parlament, das die Regierung wirklich kontrolliert – diesen Kifaja-Forderungen schlossen sich im Frühjahr 2005 immerhin mehrere Richtervereinigungen an. Mutig verlangten sie eine Garantie uneingeschränkter Unabhängigkeit. Doch anders als sechs Jahre später stießen sich 2005 die Aktivisten von Kifaja die Stirn blutig an den Betonmauern des Regimes.
Wael Abbas geht online
Einer, der später auf dem Tahrir-Platz eine wichtige Rolle spielen sollte, war schon damals dabei – der Blogger und Journalist Wael Abbas. 2005 war für ihn das Schlüsseljahr. Seine erste Demo mit Kifaja, seine ersten »Nieder mit Mubarak«-Rufe, seine erste Konfrontation mit der Polizei. Das war am 20. Mai 2005. »Bei dieser von Kifaja initiierten Demonstration habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Polizeibrutalität am eigenen Leib erlebt«, erzählt er mir im April 2011 auf der Nil-Insel Zamalek, in der dortigen Buchhandlung Diwan. »Die Funktionäre der Staatspartei NDP und die Staatssicherheit hetzten Schlägertrupps und Gangster auf uns. Die droschen mit Knüppeln auf uns ein. Sie zerrten die Frauen an den Haaren und rissen ihnen die Kleider vom Leib. Sie stahlen alles, was wir dabeihatten, Telefone, Kleider, Geld. Ich habe damals so viel wie möglich fotografiert, aber niemand wollte meine Bilder veröffentlichen. Alle hatten Angst.«
Nach dieser Erfahrung beschloss Wael Abbas, sich auf die Dokumentation von Polizeiwillkür zu spezialisieren, ging mit seiner kleinen Videokamera zu Demonstrationen, drehte die Prügelpolizisten und veröffentlichte die Videos in seinem Blog »Misr Digital« (Ägypten Digital). »Wir haben uns damals überlegt, was wir machen können. Die Medien waren ja alle in der Hand des Staates. Und gegen die Polizei hatten wir ohnehin keine Chance. Also war das Bloggen im Internet unsere einzige Chance.«
Dass die Regierung ihn hasste und immer wieder verhaftete, versteht sich schon fast von selbst. »Gefoltert worden bin ich Gott sei Dank nie. Aber ich habe die Schreie gehört.« Sein Arbeitgeber, eine renommierte Tageszeitung in Kairo, entließ ihn. »Von da an war ich offiziell geächtet. Freunde, mit denen ich am Telefon gesprochen hatte, bekamen anschließend Schwierigkeiten mit der Staatssicherheit.« Er zuckt die Schultern bei unserem Gespräch zwei Monate nach dem Sturz des Dauerdespoten, als wolle er sagen: alles normal, nichts Besonderes in Mubaraks Ägypten.
Doch dann bekam er Schwierigkeiten von einer ganz anderen Seite. 2007 schloss YouTube seinen Account, seine Videos wurden gelöscht. »Ich war schockiert«, erzählt er fassungslos. »Damit hatten wir nicht gerechnet.« Vermutlich hatte das Innenministerium bei YouTube interveniert. Gegenüber CNN erklärte das Videoportal, etliche der Videos verstießen gegen die Richtlinien der Firma, weil sie gewalttätige oder blutige Inhalte zeigten. Tatsächlich sah man in einem Film, wie ein Polizist einem verhafteten Taxifahrer bei einem Verhör den Polizeiknüppel in den After stieß. Dessen Schmerzensschreie schienen den Polizisten nur noch anzuspornen. »Ich dachte immer, die sozialen Medien seien unsere Verbündeten, sie würden all das zeigen, was die Mächtigen im Verborgenen taten. Aber davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Es ist, als hätten YouTube oder Facebook die Folterbilder von Abu Ghraib gelöscht, weil die zu grausam sind.« Auch mit seiner E-Mail-Adresse bei Yahoo bekam er damals bald Schwierigkeiten.
Trotz solcher Rückschläge hatte Wael Abbas weitergemacht. »Ich bin kein Pyjamahidin«, sagte er in unserem Gespräch, kein Mudschahidin im Pyjama, kein Kämpfer im Schlafanzug also, kein radikaler Stubenhocker. »Ich muss mich einmischen, unter die Leute gehen.« Selbst nach dem Putsch des heutigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi am 30. Juni 2013 blieb Wael Abbas bei seiner selbst gestellten Aufgabe. Er dokumentiert die unter dem Putsch-Präsidenten wieder zunehmende Polizeiwillkür und veröffentlicht sie auf Facebook, Twitter oder YouTube – so lange, bis 2017 Twitter sein Benutzerkonto abschaltete. Vermutlich fürchtete die Firma Schwierigkeiten für ihr Ägyptengeschäft.
Dass er nach dem Putsch 2013 mit seiner Kamera mehr aufzunehmen hatte als zu Mubaraks Zeiten, kann jede Menschenrechtsorganisation bestätigen. In ägyptischen Gefängnissen wird wieder gefoltert, auf Polizeistationen zu Tode geprügelt. Experten sprechen von mindestens 60000 politischen Gefangenen. Das geringste Vergehen, die kleinste Auffälligkeit in der Öffentlichkeit kann zur Verhaftung führen. Wieder verschwinden Menschen hinter den Mauern von Gefängnissen, manche für Jahre, andere, wenn sie mehr Glück haben, nur für Wochen – ohne Anklage, ohne Rechtsbeistand. »Es ist schlimmer als unter Mubarak«, sagen mir Freunde.
Am 23. Mai 2018 sollte dies auch Wael Abbas zu spüren bekommen. Ziemlich genau dreizehn Jahre war es her, dass er mit seiner Arbeit begonnen hatte. Doch das, was er an diesem Mittwoch erlebte, sollte alles übertreffen, was ihm bislang widerfahren war. Im Morgengrauen dringt das schwer bewaffnete Rollkommando einer Spezialeinheit in seine Wohnung ein und verhaftet ihn. Man legt ihm Handschellen an, verbindet seine Augen und verschleppt ihn. Erst sehr viel später erfahren seine Freunde, dass er im berüchtigte Tora-Gefängnis festgehalten wird. Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden: »Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe«, »Verbreitung falscher Nachrichten« und »Missbrauch der sozialen Medien«. Die Standardanklage für solche Fälle.
Sieben Monate lang saß Ägyptens berühmtester Blogger im Gefängnis und wartete auf seinen Prozess. Dann, endlich, am 12. Dezember 2018, entschied das Kriminalgericht Gizeh, ihn aus dem Gefängnis zu entlassen mit der Auflage, sich zweimal in der Woche bei der Polizei zu melden. Alle fünfundvierzig Tage prüft ein Gericht nun, ob die bedingte Freilassung weiterhin gilt. Kein Wunder, dass Abbas das Risiko nicht eingehen möchte, mit einem ausländischen Journalisten zu sprechen. Verbreitung falscher Nachrichten an die ausländische Presse, Verschwörung gegen den Staat wären noch die geringsten Vergehen, die ein Staatsanwalt aus einer solchen Begegnung konstruieren könnte.
Kifaja war für Ägypter wie Wael Abbas und für viele andere so etwas wie die Schule des Widerstands. Was ist aus ihr geworden? Gibt es sie noch? 2011 hatte sich die lose Bewegung mit anderen Protestgruppen zusammengeschlossen. Heute ist es um Aktive wie George Ischak still geworden, ebenso um den mutigen Richter Tariq al-Bischri, der 2011 noch eine Verfassungskommission geleitet hatte. Braucht das Land nicht gerade heute wieder eine solche Bewegung?
George Ischak, danach gefragt, zögert mit der Antwort. Dann: »Heute ist die Angst zu groß. Keiner hat den Mut, sich zu bewegen. Man wird schnell als angeblicher Terrorist angeklagt. Wir haben uns zwar wieder zusammengeschlossen, aber wir werden ständig überwacht. Auch wir können uns so gut wie nicht bewegen. Ich hoffe, dass die Regierung die Tür ein wenig öffnet, sonst sehe ich schwarz.«
Die Bewegung ist heute handlungsunfähiger als zur Zeit von Mubarak, doch ihr großes Verdienst bleibt: Kifaja hat als erste Bewegung den Bürgern in Ägypten gezeigt, dass Kritik und Widerstand möglich sind, auch gegen despotische Mächte und trotz aller berechtigten Angst vor Repression und Folter.
Einer ihrer Wortführer, der Erfolgsschriftsteller Ala al-Aswani, schreibt auf jeden Fall weiter streitbare kritische Zeitromane, auch wenn er den Putsch des Generals und Verteidigungsministers Abdel Fattah al-Sisi gegen den gewählten Präsidenten und Muslimbruder Mohamed Mursi lange verteidigt hatte. Er sei notwendig gewesen, sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Qantara. Mursi und seine Muslimbrüder hätten zuletzt wie Terroristen gehandelt, die die demokratischen Errungenschaften des Landes zerstören wollten. Zu einem blutigen Bürgerkrieg hätten sie aufgerufen, der Armee sei gar nichts anderes übrig geblieben als einzugreifen. Diese Haltung: eine unter ägyptischen Intellektuellen weit verbreitete Muslimbruder-Phobie. Allerdings gehört er schon lange nicht mehr zu den Sympathisanten des neuen Präsidenten al-Sisi. Der Hauptfehler von Kifaja und all der anderen Tahrir-Platz-Aktivisten sei es gewesen, »dass wir nach dem Rücktritt Mubaraks den Tahrir-Platz verlassen haben, ohne eine Kommission mit Vertretern der Revolution zu bilden. Man hätte zunächst solche Komitees in allen ägyptischen Regionen wählen sollen, dann erst hätten wir den Platz räumen dürfen«. Man habe sich, so Aswani, die Revolution vom Militär aus der Hand nehmen lassen und dadurch den Aufstieg al-Sisis ermöglicht.
In seinem neuen, bisher nur auf Arabisch erschienenen Roman Gomhorija kanu (Die Republik als ob) rechnet er mit der neuen Zeit in Ägypten ab. In Diktaturen sei alles nur »als ob«, alles nur Fake, die Wahlen, die Demokratieversprechen, die Politiker, das Leben bis tief in das Private hinein. Erscheinen musste das Buch in einem Beiruter Verlag, in Ägypten hatte sich kein Verleger gefunden. Ob der Roman in absehbarer Zeit in ägyptischen Buchhandlungen ausliegen wird, ist unwahrscheinlich. In seinem eigenen Land darf Ala al-Aswani seit 2014 nicht mehr publizieren. Ein Gericht in Kairo hat ihn wegen Beleidigung des Präsidenten, des Militärs und der Jurisdiktion angeklagt. Grund genug, das Land zu verlassen. Der bekannteste zeitgenössische ägyptische Schriftsteller lebt heute in den USA.
Ahmed Maher und die Bewegung »6. April«
Zu den Bewegungen, die die Vorgeschichte der »Arabellion« entscheidend mitgeprägt haben, gehört auch jene Facebook-Gruppe, die sich »6. April« nannte und die heute nur noch im Untergrund operieren kann.
Als ich 2011 den Ingenieur Ahmed Maher, einen der Gründer des »6. April«, zum ersten Mal traf, saß ein junger Mann vor mir mit einem freundlichen runden Gesicht, der eigentlich keine Lust hatte, einem ausländischen Fernsehsender ein Interview zu geben. »Warum soll ich? Von euch kommt doch nichts. Wir sind auf uns gestellt.« Es dauerte eine Weile, bis ich ihn zu dem Interview überreden konnte. Dann aber erzählte er von seiner Bewegung, seinen Plänen und seinen Vorstellungen von einem neuen Ägypten.
Auch seine Geschichte beginnt mit den Wahlen von 2005. Ahmed schloss sich 2004 zunächst der Kifaja-Bewegung an. Er arbeitete in der Parteizentrale der »Al-Ghad«-Partei, einer jener Parteien, die Mubarak aus Gründen der politischen Kosmetik zu den Wahlen zugelassen hatte und deren Spitzenkandidat nach den Wahlen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Für Ahmed Maher und seine Freunde war nach diesem Willkürakt klar, dass mit diesem Staat keine Zusammenarbeit möglich ist. Von innen war das System nicht zu reformieren. Sie beschlossen, andere Wege zu suchen, um Reformen in ihrem Land zu erzwingen.
»Wir wollten als eine völlig unabhängige Bewegung starten. Wir wollten mit keiner der bekannten Parteien etwas zu tun haben«, erklärte Ahmed mir 2011