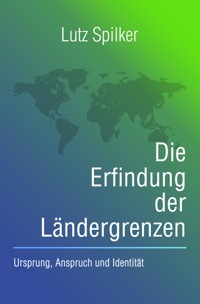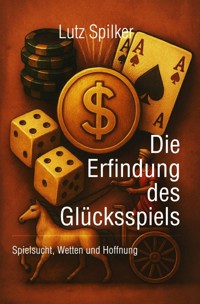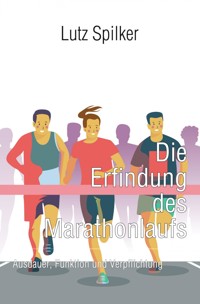1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schlank zu sein gilt heute als Ideal – als Zeichen von Disziplin, Schönheit, Gesundheit und Erfolg. Doch dieser vermeintliche Maßstab ist keine naturgegebene Wahrheit, sondern ein kulturelles Konstrukt mit langer Geschichte und weitreichenden Folgen. Dieses Buch spürt dem Ursprung des Schlankheitswahns nach: von ersten Schönheitsidealen über Modeextreme wie die Wespentaille bis hin zur modernen Fitness- und Diätindustrie. Es zeigt, wie sich Körperbilder verändern, wie soziale Normen entstehen und wie sich der Wunsch nach Anerkennung in Zwang verwandelt. Dabei geht es nicht nur um Äußerlichkeiten – sondern um gesellschaftliche Machtverhältnisse, ökonomische Interessen und psychologische Abhängigkeiten. Wer bestimmt, was als schön gilt? Wer profitiert vom Schlankheitsideal? Und wie krank kann dieses Ideal tatsächlich machen? ›Die Erfindung des Schlankheitswahns‹ ist eine kritische Kulturgeschichte des Körpers – faktenreich, vielschichtig und entlarvend. Es macht sichtbar, wie aus einem ästhetischen Wunsch ein gesellschaftlicher Imperativ wurde – und warum es Zeit ist, diesen zu hinterfragen. Ein Buch für alle, die sich nicht länger von Zahlen auf der Waage definieren lassen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DES SCHLANKHEITSWAHNS
SCHLANK, DÜNN UND MANGELERSCHEINUNGEN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio-nalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Softcover ISBN: 978-3-384-59789-2
E-Book ISBN: 978-3-384-59790-8
© 2025 by Lutz Spilker
https://www.webbstar.de
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lutz Spilker, Römerstraße 54, 56130 Bad Ems, Germany .
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Keine Zeit für Eitelkeit
Fruchtbarkeit statt Schlankheit
Schwere als Würde
Fasten als Gottesdienst
Von der Leibesfülle zur Leibeszucht
Die Geburt der Korsage
Wespentaille und Repräsentation
Körperzucht und Tugend
Der Leib als Projekt der Vernunft
Bürgerliche Distanz zum Adel
Diätetik als pädagogisches Prinzip
Der Körper als Spiegel der Seele
Diät als soziales Unterscheidungsmerkmal
Der Schlankheitswahn in seinen bürgerlichen Wurzeln
Körper im Korsett der Aufklärung
Der medizinische Blick
Der Kalorienbegriff und die Entzauberung des Essens
Schlankheit als Moral
Das viktorianische Ideal
Ernährungsschriften, Ratgeber und Hausfrauenideale um 1900
Hollywoods Einfluss
Der flache Bauch der 1920er
Fleisch auf den Rippen
Nachkriegshunger und Wiederaufbaukörper
Der Bikini-Effekt
Twiggy und die Wendung ins Magere
Jane Fonda und der Aerobic-Wahn
Essstörungen im Schatten des Ideals
Modelmaße als globale Norm
Digitaler Spiegel
Appetitzügler, Diätpillen und die Pharmaindustrie
Der vermessene Körper
Die asketische Eleganz
Zwischen Asphalt und Ackerboden
Die Rückeroberung des Körpers
Der Körper als Bühne gesellschaftlicher Zwänge
Wenn das Ideal zur Krankheit wird
Die Pathologisierung des Normalen
Die Wirtschaft der Unzufriedenheit
Zwischen Rebellion und Resignation
Fazit: Das Maß aller Dinge neu denken
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Die wichtigste Schlankheitsregel: Alles Gute ist schlecht.
Anna Nym
Anna Nym (auch: Nühm) eigentlich Klaus Klages, (1938 - 2022), deutscher
Gebrauchsphilosoph und Abreißkalenderverleger
Das Prinzip der Erfindung
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch sesshaft zu werden. Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Schlank zu sein gilt heute als ein Zeichen von Selbstdisziplin, Gesundheit, Attraktivität und Erfolg. Dieses Ideal hat sich tief in das kollektive Bewusstsein moderner Gesellschaften eingegraben – so tief, dass es kaum mehr hinterfragt wird. Doch woher kommt dieses Ideal? Wer hat es definiert, etabliert, aufrechterhalten? Und vor allem: Wieso hat sich aus einem ästhetischen Vorzug ein allgegenwärtiger Zwang entwickelt – ein Wahn, der Millionen von Menschen ihr Leben, ihre Selbstwahrnehmung und letztlich auch ihre Gesundheit diktiert?
Dieses Buch versteht sich als Spurensuche. Es fragt nach den historischen, gesellschaftlichen und symbolischen Ursprüngen eines Phänomens, das in seiner Wirkmächtigkeit kaum überschätzt werden kann – des Schlankheitswahns. Dabei geht es weder um Diäten noch um Ernährungstipps, weder um Sportprogramme noch um moralische Wertungen, sondern um eine präzise, aufklärende und zugleich kritische Rekonstruktion eines menschengemachten Ideals, das längst zum kulturellen Dogma geworden ist.
Die Reise beginnt weit zurück – nicht, um in der Steinzeit bereits eine Erklärung zu finden, sondern um aufzuzeigen, dass der Schlankheitswahn keineswegs ein anthropologisches Grundmotiv darstellt. Im Gegenteil: In der frühmenschlichen Lebenswelt existierte kein Begriff von Übergewicht, weil es keinen Überfluss gab. Nahrungsverzicht war keine Tugend, sondern eine Notwendigkeit, wenn das Jagen oder Sammeln erfolglos blieb. Fettreserven galten als Zeichen von Stärke, Vorrat und Überlebensfähigkeit – nicht als Makel.
Der eigentliche kulturelle Nährboden für den Schlankheitswahn entstand erst mit der Sesshaftwerdung, mit gesellschaftlicher Differenzierung, mit der Entstehung von Machtstrukturen, von Besitz, von Mode und vor allem: von Beobachtung. Erst in einer Welt, in der Menschen einander bewerten konnten – und mussten –, entwickelten sich Maßstäbe für das äußere Erscheinungsbild. Diese Maßstäbe waren nie statisch, sondern unterlagen starken kulturellen Schwankungen: Während in der Antike kräftige Körper vielfach als Ausdruck von Wohlstand galten, setzte sich spätestens im 19. Jahrhundert ein neues Paradigma durch – die Reduktion des Körpers auf ein Idealbild, das zunehmend mit Askese, Verzicht und Kontrolle assoziiert wurde.
Mit der Wespentaille, der Korsage und später der Kalorientabelle wurde der weibliche Körper systematisch reglementiert – und in der Folge auch der männliche. Die Industrialisierung, die Verstädterung und die zunehmende Sichtbarkeit von Körpern im öffentlichen Raum – ob in der Mode, in der Kunst, in der Werbung oder auf der Straße – trugen dazu bei, dass körperliche Normen nicht nur formuliert, sondern auch durchgesetzt wurden. Wer diesen Normen nicht entsprach, galt nicht nur als unattraktiv, sondern mitunter als charakterlich mangelhaft, willensschwach, ungebildet oder gar krank.
Diese Entwicklung ist eng verwoben mit anderen Phänomenen der Moderne: mit der Entstehung von Schönheitsindustrien, mit dem Aufstieg von Massendruckerzeugnissen und Bildmedien, mit dem Siegeszug von Fitnesskulturen und Selbstoptimierungsstrategien. Der Körper wurde zum Projekt, das zu disziplinieren war – und Abweichungen von der Norm galten zunehmend als persönliche Niederlagen. Der Schlankheitswahn, so zeigt sich, ist keine Laune der Natur und keine neutrale Modeerscheinung, sondern ein sozial konstruierter Mechanismus mit enormer psychologischer, medizinischer und ökonomischer Reichweite.
Dieses Buch verfolgt den Weg dieses Wahns von seinen kulturgeschichtlichen Anfängen bis in die Gegenwart. Es beleuchtet seine vielfältigen Erscheinungsformen, seine ideologischen Hintergründe und seine fatalen Auswirkungen. Es dokumentiert, wie aus einem ästhetischen Wunsch eine kollektive Obsession wurde – eine Obsession, die nicht nur Körper, sondern auch Identitäten formt. Dabei wird sichtbar, dass ›Schlanksein‹ mehr ist als eine äußere Form: Es ist ein Symbol geworden – für Disziplin, für Zugehörigkeit, für gesellschaftlichen Status. Und doch bleibt es ein Symbol, das ständig Gefahr läuft, in sich selbst zu kippen: Was einst ›rank und schlank‹ hieß, droht heute immer öfter zu ›krank und schlank‹ zu werden.
›Die Erfindung des Schlankheitswahns‹ will aufklären, ohne zu belehren. Es will enthüllen, ohne zu entlarven. Es will zeigen, dass der Wahn nicht alternativlos ist – und dass ein Blick hinter seine Fassade mehr über unsere Zeit aussagt als jede Diätanleitung. Wer dieses Buch liest, wird nicht schlanker, aber vielleicht klarer sehen.
Keine Zeit für Eitelkeit
Körper im Überlebensmodus der Vorzeit
In einer Welt, in der der Mensch kaum mehr als ein Bestandteil der natürlichen Nahrungskette war, in der es keine Spiegel, keine Mode und keine sozialen Netzwerke gab, war der menschliche Körper ein reines Werkzeug – ein Instrument des Überlebens. Schönheit, im heutigen Sinne, war weder definiert noch von Bedeutung. Der Körper musste funktionieren, nicht gefallen. Sein Daseinszweck war nicht Repräsentation, sondern Effizienz. Das war die Realität der Vorzeit – einer Ära, in der Eitelkeit keinen Platz hatte.
In jenen Jahrtausenden, bevor der Mensch sesshaft wurde, war sein Leben geprägt von ständiger Bewegung, unvorhersehbarem Nahrungsangebot, klimatischen Extremen und dem andauernden Risiko, zum Opfer eines größeren, schnelleren oder listigeren Tieres zu werden. Der menschliche Körper war auf Leistung und Anpassungsfähigkeit ausgelegt. Muskeln, Fettdepots, Hautbeschaffenheit und Stoffwechsel waren keine Ausdrucksformen ästhetischer Vorlieben, sondern Produkte einer natürlichen Selektion, die kompromisslos nach dem Prinzip des ›Survival of the Fittest‹ arbeitete. Die ›Fitness‹, um die es hier ging, war eine biologische Überlebenskompetenz – nicht zu verwechseln mit dem heutigen Begriff, der oftmals bloß einen gestählten Körper meint, dem man ansieht, dass er Zeit im Fitnessstudio verbracht hat.
Das Körperbild, das sich aus dieser Zeit rekonstruieren lässt, war funktional. Ein kräftiger Körper konnte lange Strecken zurücklegen, sich gegen Angreifer wehren, klettern, schwimmen, jagen und tragen. Fett war ein Überlebensvorrat, nicht ein Makel. In klimatisch unwirtlichen Regionen bedeuteten Fettpolster Wärme und Energie. Besonders bei Frauen war ein gewisser Fettanteil essenziell, um Fruchtbarkeit zu sichern und eine Schwangerschaft trotz knapper Nahrungslage zu ermöglichen. Die vielzitierte ›Venus von Willendorf›, eine kleine Steinfigur aus der Altsteinzeit, die mit übertriebenen weiblichen Rundungen dargestellt wird, ist kein Beweis für ein frühzeitliches Schönheitsideal im modernen Sinne, sondern vielmehr ein Symbol für Fruchtbarkeit, Überleben und die Verehrung jener Eigenschaften, die Leben sichern konnten.
Der vorzeitliche Mensch lebte in Gruppen, in denen soziale Rollen primär durch Fähigkeiten definiert wurden – der schnelle Läufer, die geschickte Sammlerin, der kräftige Jäger oder die weise Alte. Die Bewertung von Körpern erfolgte in Relation zur Aufgabe, nicht zum Ideal. Es gab keine Werbung, keine Kleidung zur Zierde, keine vorgeschriebenen Maße. Jeder Körper war das, was er war – ein Spiegel des Lebenswandels, nicht des persönlichen Geschmacks oder gesellschaftlicher Erwartung.
Das Ideal des ›Schlankseins‹ im heutigen Sinn – als Zeichen von Disziplin, Attraktivität oder Erfolg – war vollkommen bedeutungslos. Schlankheit konnte sogar ein Risiko darstellen: Wer zu wenig Reserven hatte, war in Hungerperioden gefährdet. Mangel an Fett bedeutete Kälteempfindlichkeit, Energiemangel und bei Frauen Unfruchtbarkeit. Der Körper war ein Speicherorgan, ein wandelndes Archiv vergangener Nahrungszufuhr und zukünftiger Sicherheit. Man verzichtete nicht freiwillig auf Essen, schon gar nicht aus ästhetischen Gründen. Nahrung war kostbar, schwer zu beschaffen und niemals garantiert. Wer Zugriff auf Nahrung hatte, aß – und wurde nicht getadelt, sondern beneidet.
Es gab auch keine ständige Verfügbarkeit von Nahrung, keine Lagerhäuser, keine Kühlketten. Die tägliche Nahrungsaufnahme war abhängig vom Jagdglück, vom Sammelerfolg oder vom Wetter. Hungerperioden waren normal, keine Ausnahme. Der menschliche Organismus entwickelte sich unter diesen Bedingungen zu einem Meister der Anpassung: mit einem Stoffwechsel, der Reserven effizient speicherte, mit Hormonsystemen, die den Appetit regulierten, und mit einem Belohnungssystem, das Nahrungsaufnahme als lustvoll erscheinen ließ – all das diente nur einem Zweck: dem Überleben in einer Welt, in der Essen eine Frage des Zufalls war.
Auch Kleidung hatte in dieser Zeit keinen modischen Aspekt. Sie diente ausschließlich dem Schutz – vor Kälte, Hitze, Insekten, Verletzungen. Kleidung war funktional und entstand aus Tierhäuten, Pflanzenfasern oder anderen verfügbaren Materialien. Wer mehr Kleidung hatte, war nicht eleganter, sondern besser geschützt. Das Konzept, durch Kleidung Figur zu formen oder gar zu verschlanken, war nicht existent. Korsette, Taillenformer, Mieder – all diese Utensilien würden erst Jahrtausende später auftauchen, als die Nützlichkeit des Körpers vom Ideal des Körpers abgelöst wurde.
Ein weiteres Merkmal der vorzeitlichen Körperkultur war die Unmittelbarkeit zwischen Tun und Wirkung. Bewegung war kein freiwilliges Freizeitprogramm, sondern alltägliche Notwendigkeit. Wer Wasser brauchte, ging kilometerweit. Wer Nahrung wollte, sammelte oder jagte. Der Bewegungsradius eines Menschen war oft der einzige Garant für sein Überleben. Stillstand bedeutete Gefahr – durch Raubtiere, durch Feinde, durch Verhungern. Der Körper war in ständiger Benutzung – nicht weil man ihn trainieren wollte, sondern weil er als Arbeitsgerät gebraucht wurde. Muskeln entstanden nicht durch gezieltes Training, sondern durch Notwendigkeit.
Die Vorstellung, man könne oder solle den Körper optimieren, wäre einem Menschen der Vorzeit fremd gewesen. Es gab kein Ideal, auf das man hinarbeiten konnte, und keine Freizeit, in der man daran hätte arbeiten können. Die Verbesserung des Körpers ergab sich durch Erfahrung, nicht durch Planung: Wer oft kletterte, wurde besser darin. Wer lange lief, hielt länger durch. Der Körper war kein Objekt, sondern ein Subjekt – kein Werkstück, das geformt wird, sondern ein Akteur im täglichen Existenzkampf.
Selbst der Begriff ›Körperbild‹ ist in Bezug auf die Vorzeit nur mit äußerster Vorsicht zu verwenden. Ohne Spiegel, ohne standardisierte Darstellungen, ohne massenmediale Vergleichsgrößen entwickelte sich kein abstraktes Bild vom eigenen Körper. Die Selbsteinschätzung beruhte auf direkter Rückmeldung – auf körperlicher Leistungsfähigkeit, auf Reaktionen anderer Gruppenmitglieder, auf der erfolgreichen Bewältigung von Herausforderungen. Was zählte, war Funktion, nicht Form. Und Funktion war relativ – angepasst an Umwelt, Klima, Aufgaben.
Erst mit der Sesshaftwerdung des Menschen, der Entstehung von Vorratshaltung, von geregeltem Alltag und von sozialen Hierarchien begann sich das Verhältnis zum eigenen Körper zu verändern. Plötzlich konnten Menschen mit weniger Bewegung überleben, konnten sich spezialisieren, sich vergleichen, beurteilen – und beurteilt werden. Die Sesshaftigkeit war die Voraussetzung für die Entstehung von Muße, und mit der Muße kam das Nachdenken über sich selbst – auch über den eigenen Körper. Doch diese Entwicklung sollte erst viele Jahrhunderte nach der ersten Sesshaftwerdung in konkrete Körpernormen münden.
In der Vorzeit hingegen war kein Raum für Selbstinszenierung, kein Bedarf an ästhetischer Selbstkontrolle. Der Körper war nicht Feindbild, nicht Projektionsfläche, nicht Zielscheibe gesellschaftlicher Erwartungen. Er war ein Instrument des Überlebens. Es war eine Epoche der Unschuld des Körpers – eine Zeit, in der niemand sich zu dick, zu dünn, zu schön oder zu unattraktiv fühlte. Es zählte nur eines: zu leben.
Diese Vorzeit – archaisch, roh, aber ehrlich – markiert den Ausgangspunkt für eine Jahrtausende währende Entwicklung, an deren Ende eine Welt steht, in der der Körper nicht mehr Ausdruck des Lebens, sondern oft sein Ersatz ist. Eine Welt, in der nicht mehr das Überleben zählt, sondern das Abbild. Die Erfindung des Schlankheitswahns beginnt mit dem Ende dieser Unschuld – und damit mit dem Moment, in dem der Körper zum Gegenstand eines Vergleichs wird.
Dieses Kapitel ist der notwendige Kontrapunkt zu allem, was folgen wird. Es erinnert an eine Zeit, in der der Körper noch sich selbst gehörte. Eine Erinnerung, die nicht verklärt, sondern den Blick schärfen soll für das, was wir verloren haben – und was es vielleicht wiederzugewinnen gilt. Nicht in der Rückkehr zur Wildnis, sondern im Bewusstsein darüber, dass der Körper kein Feind ist. Sondern ein Überlebender.
Fruchtbarkeit statt Schlankheit
Körperideale in frühen Hochkulturen
Bevor sich der Schlankheitswahn in das kollektive Bewusstsein moderner Gesellschaften einprägte, existierte über Jahrtausende hinweg ein völlig anderes Verhältnis zum menschlichen Körper. Die Hochkulturen der Frühzeit – ob in Mesopotamien, Ägypten, Indien oder später in Mesoamerika – verstanden den Körper nicht als Projektionsfläche für asketische Ideale oder kontrollierte Ästhetik. Vielmehr war er Ausdruck von Lebenskraft, Fruchtbarkeit und göttlicher Ordnung. Das Ideal war nicht mager, sondern mächtig, nicht schmal, sondern rund, nicht enthaltsam, sondern lebensbejahend.
Diese frühen Zivilisationen, entstanden auf der Grundlage von Ackerbau, Viehzucht und wachsender Urbanisierung, kannten bereits differenzierte Vorstellungen von Schönheit. Doch diese Vorstellungen standen in engem Zusammenhang mit zyklischen Naturerfahrungen: Fruchtbarkeit der Erde, der Tiere und der Menschen war ein zentrales Thema. In einer Welt, in der Mangel, Hunger und Tod keine abstrakten Möglichkeiten, sondern alltägliche Begleiter waren, galten körperliche Fülle und sichtbare Vitalität als Garant für Überleben, Wohlstand und Kontinuität.
Ein herausragendes Beispiel bietet die berühmte ›Venus von Willendorf‹, auch wenn sie aus einer noch früheren, prä-zivilisatorischen Epoche stammt. Die etwa 29.000 Jahre alte Figur zeigt eine kleinwüchsige Frauenstatue mit überdimensionierten Brüsten, Hüften und Gesäß – Attribute, die Fruchtbarkeit, Geburt und mütterliche Versorgung symbolisieren. Auch wenn diese Figur nicht aus einer Hochkultur im engeren Sinne stammt, wirft sie ein Schlaglicht auf eine bis weit in die Antike getragene Vorstellung: der weibliche Körper als Lebensspenderin, als Sinnbild des Zyklischen, des Werdens und Vergehens.
In Mesopotamien, der ›Wiege der Zivilisation‹, wurden Göttinnen wie Inanna oder Ischtar mit Sinnlichkeit, Fruchtbarkeit, aber auch mit Macht assoziiert. Ihre Darstellungen zeigen oft üppige Formen, ein starker Kontrast zur späteren Vorstellung von Zurückhaltung und Askese. Die weibliche Fülle war kein Makel, sondern ein Zeichen göttlicher Kraft. Die Vorstellung, dass der menschliche Körper der Spiegel einer kosmischen Ordnung ist, bestimmte auch in Ägypten die künstlerische und soziale Wahrnehmung. Wandmalereien, Statuen und Grabbeigaben zeigen Frauen mit weichen, harmonisch gerundeten Körpern – weder übergewichtig noch hager, sondern symbolisch balanciert. Schlankheit im Sinne von Reduktion oder Kalorienzählen war hier schlichtweg unbekannt, ja undenkbar.
Auch in Indien war das weibliche Ideal eng an Fruchtbarkeit, Tanz und Bewegung gekoppelt. In den klassischen Skulpturen hinduistischer Tempel, etwa in Khajuraho oder Konarak, werden Göttinnen und mythische Tänzerinnen mit geschwungenen Hüften, vollen Brüsten und weichen Bäuchen dargestellt. Der Körper war Ausdruck einer sakralen Erotik, einer Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen. Die Vorstellung, dass man den Körper zügeln müsse, um gesellschaftlichen Erwartungen zu genügen, findet sich hier nicht – im Gegenteil: Sinnlichkeit wurde als spirituelle Kraft verstanden.
Selbst in den frühen Hochkulturen Mittelamerikas – bei den Olmeken, den Maya oder den Azteken – spielte die symbolische Darstellung körperlicher Vitalität eine große Rolle. Die oft anthropomorphen Darstellungen von Göttern und Göttinnen weisen Merkmale auf, die deutlich von Lebensfülle sprechen: kräftige Gliedmaßen, betonte Gesichter, runde Körperpartien. Hier war der Körper nicht Objekt einer Mode oder eines Trends, sondern Instrument eines rituellen Verständnisses vom Menschsein. Die Verbindung von Ernährung, Körperbau und sozialer Rolle war organisch – nicht ideologisch oder medizinisch überformt.
Die antiken Körperideale, so sehr sie auch kulturell variieren mochten, hatten eines gemein: Sie anerkannten den Körper als Träger von Lebensfähigkeit und sozialer Wirksamkeit. Ein gut genährter Mensch war nicht nur kräftig und gesund, sondern auch sozial integriert – und dies bedeutete Sicherheit. Wer füllig war, hatte genug zu essen, war gut verheiratet oder entstammte einer geachteten Familie. Fülle war Prestige. In einer Zeit, in der Nahrungsmangel jederzeit drohte, war es keineswegs sinnvoll, Kalorien zu meiden oder Gewicht zu verlieren. Ein schmaler Körper konnte auf Armut, Krankheit oder soziale Ausgrenzung hindeuten – keine Attribute, die mit Schönheit oder Ideal in Verbindung gebracht wurden.
Auch Männerkörper wurden unter funktionalen Gesichtspunkten bewertet. Der muskulöse, kräftige Körper war Ausdruck von Arbeitsfähigkeit, Wehrhaftigkeit und Schutzpotenzial. Körperlichkeit war nützlich, nicht dekorativ. Das, was heute unter ›Schlankheitswahn‹ firmiert – der Wunsch, sich von allem Überflüssigen zu befreien und nur noch eine möglichst ästhetische Hülle zu präsentieren – hätte in diesen Gesellschaften wenig Sinn ergeben. Es gab keinen ökonomischen oder sozialen Gewinn, sich herunterzuhungern. Im Gegenteil: Der Verzicht auf Nahrung war religiösen Spezialisten vorbehalten – Mönchen, Asketen, Eingeweihten. Sie standen außerhalb der Ordnung, nicht in ihrer Mitte.
Man muss diese historischen Körperbilder nicht idealisieren, um ihre Bedeutung zu erkennen. Sie waren nicht frei von Zwängen, keineswegs. Doch der Zwang richtete sich nicht gegen die körperliche Präsenz, sondern vielmehr auf die Rolle innerhalb der Gemeinschaft. Körperideale dienten der sozialen Stabilität, nicht der persönlichen Selbstoptimierung. Der Körper war kein Feind, den es zu disziplinieren galt, sondern ein Medium, durch das Leben, Status und Kontinuität sichtbar wurden.
Erst mit dem Aufkommen einer urbanen Elite, deren gesellschaftliche Bedeutung sich zunehmend von physischer Arbeit und körperlicher Robustheit abkoppelte, begann sich das Verhältnis zum Körper zu verändern. Der Beginn dieses Wandels – etwa mit der höfischen Kultur im alten China oder im Europa des Spätmittelalters – war noch nicht von Schlankheit geprägt, wohl aber von einer beginnenden Entfremdung des Körpers von seiner ursprünglichen Funktion. Der Weg zum modernen Schlankheitswahn war vorbereitet, aber noch nicht beschritten.
Was bleibt, ist die Erkenntnis: Die frühen Hochkulturen hatten ein Körperideal, das tief mit der Erfahrung von Fruchtbarkeit, Leben und zyklischem Denken verknüpft war. Der Körper war kein Ziel, sondern ein Mittel – ein Ausdruck von Verbundenheit mit der Natur, mit den Göttern und mit der Gemeinschaft. In diesem Sinn ist das Kapitel ein Rückblick auf eine Zeit, in der Körperlichkeit nicht ideologisch vereinnahmt wurde, sondern im Einklang mit dem Verständnis menschlicher Existenz stand. Ein Gleichgewicht, das die Moderne, bei all ihrem Fortschritt, scheinbar verloren hat.
Möchten Sie im nächsten Kapitel an die beginnende höfische Körperkultur anschließen oder die gesellschaftliche Abgrenzung durch Kleidung und Maß weiterverfolgen?
Schwere als Würde
Wohlstandsbäuche in Antike und Mittelalter
In einer Zeit, da das Körperbild von Mangel geprägt war und das tägliche Brot weder gesichert noch selbstverständlich, galt der wohlgenährte Leib als seltenes und begehrtes Zeichen von Souveränität. In Antike und Mittelalter war die Vorstellung, sich freiwillig zu beschränken oder einem Ideal der Schlankheit zu folgen, so fremd wie das stille Wasser eines goldgerahmten Pools in der Wüste. Der Bauch – heute oft verschämt eingezogen oder durch Fitnessroutinen bekämpft – war einst ein Symbol für Würde, Wohlstand und Überlegenheit.
Die Geschichte des sogenannten ›Wohlstandsbauches‹ beginnt nicht mit dem Überfluss, sondern mit dem Mangel. In einer Welt, in der das Hungern zur Normalität zählte und Nahrung keine Selbstverständlichkeit war, markierte das sichtbare Körpervolumen eine stille, aber unmissverständliche Aussage: Ich muss nicht darben. Ich kann es mir leisten, satt zu sein. Ich bin eingebettet in Netzwerke von Besitz, Macht oder zumindest Versorgungssicherheit. Der runde Bauch war ein sichtbares Kapital, ein soziales Zeichen – mitunter sogar ein Schutzschild gegen die soziale Unsichtbarkeit.
Schon in der Antike, etwa im Griechenland des 5. Jahrhunderts v.Chr., lassen sich Spuren dieser Körpersemantik finden. Zwar werden im klassischen Ideal der Polis muskulöse, athletisch proportionierte Männer verehrt – sichtbar in Skulpturen wie dem ›Diskuswerfer‹ oder dem ›Doryphoros‹. Doch diese Bildsprache war weniger Realität als Idealisierung. Der Alltag der griechischen Gesellschaft kannte auch andere Körper. In Komödien von Aristophanes etwa werden rundliche Bürger verspottet – nicht, weil sie unmoralisch wären, sondern weil ihre Leibesfülle als Ausdruck von Faulheit und Luxus durchgeht. Schon hier zeigt sich: Fülle war ein Diskursobjekt. Sie konnte bewundert oder karikiert werden, doch blieb sie immer ein Zeichen sozialer Stellung.