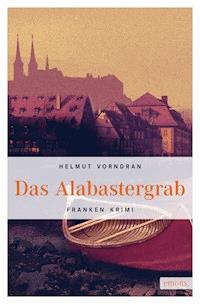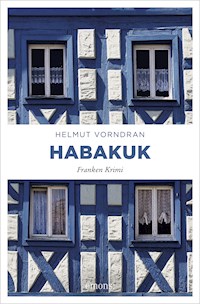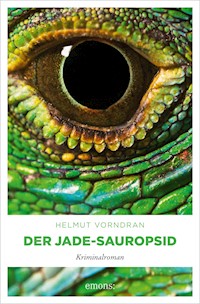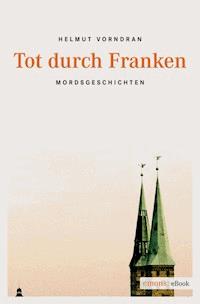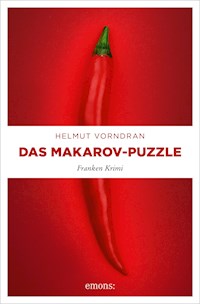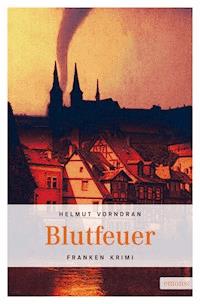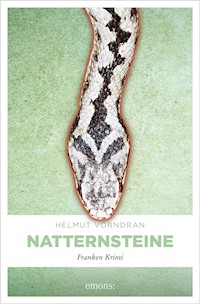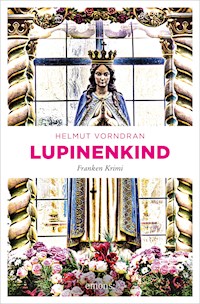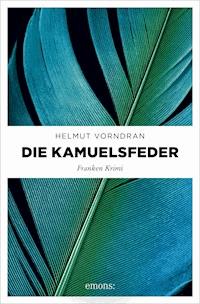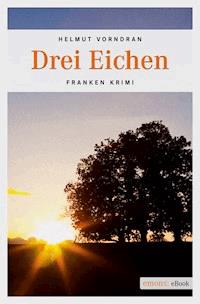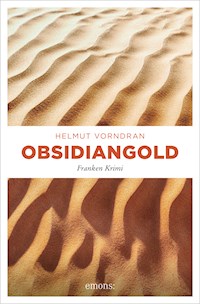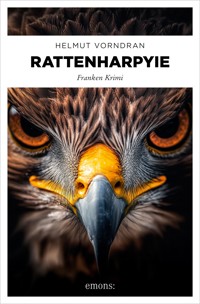Die ersten zwei Krimis des Kultkommissars Haderlein: »Das Alabastergrab« und »Blutfeuer« (2in1-Bundle) E-Book
Helmut Vorndran
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Band 1 und 2 des Kultkommissars in einem Band Das AlabastergrabIm Main nördlich von Bamberg wird ein Fischer tot aufgefunden, gefesselt an einen Betonpfeiler im Fluss. Wenig später gibt es den nächsten grausigen Fund. Währenddessen gehen auf Kloster Banz bei der CSU merkwürdige Dinge vor. Kriminalhauptkommissar Haderlein und sein junger Kollege stoßen auf undurchsichtige, verwirrende Fakten um Politik und Kirche und schließlich auch auf immer mehr Leichen. Ein Wettlauf mit dem Mörder und gegen die Zeit durch ganz Nordbayern beginnt. Die Suche nach der Wahrheit konfrontiert die beiden Ermittler schließlich mit einer alptraumhaften Erkenntnis ... BlutfeuerDie Klimakatastrophe hat Franken im "heißen Griff", und der erste Hurrikan der Mittelmeergeschichte zieht über die Alpen. Im Gefolge dieser stürmischen Ereignisse sterben immer mehr Menschen oberfränkischer Herkunft an einer rätselhaften Krankheit. Zeitgleich werden scheinbar ohne Zusammenhang fünf Rentner in einem Bamberger Altenheim ermordet. Die Bamberger Polizei unter Kommissar Haderlein und Kollege Lagerfeld stößt auf geheimnisvolle und immer schockierendere Zusammenhänge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt ins oberfränkische Bamberger Land verlegt und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayrische Fernsehen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
Angelehnt an wahre Begebenheiten. © 2009 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch, Berlin eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-014-8 Franken Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
»Unsere Mängel sind die Augen, mit denen wir das Ideal sehen.«
Prolog
Während im Hintergrund eine männliche Stimme Dinge erklärte, die ihm schon längst bekannt waren, machte er sich daran, das Buch in das speckige Papier einzuwickeln, sodass von dem hellen Ledereinband nichts mehr zu sehen war.
Hastig knotete er das kleine Paket kreuzförmig mit einer Schnur zusammen, die er in weiser Vorahnung mitgenommen hatte.
Er blickte sich vorsichtig um.
Die anderen waren schon ein ganzes Stück vorausgegangen und konnten ihn nicht mehr sehen. Ihm blutete das Herz bei dem Gedanken, sein Buch aus der Hand zu geben, aber es musste sein. Schließlich war es seine Lebensversicherung. Dann begann er zu klettern …
Fisherman’s End
Edwin Rast war zufrieden – nein, er war mehr als das: Er war erfüllt von einem einzigartigen, finalen Gefühl des sicheren Triumphs. Die schier endlose Zeit des zähen Kampfes sollte nun bald ein Ende finden. Und zwar das gerechte Ende einer gerechten Sache. Seiner Sache. Das Ziel war fast erreicht. Die letzten Stunden vor dem Showdown wollte er mit seiner Lieblingsbeschäftigung verbringen, dem Angeln. Denn dabei, bei der Ausübung seines alles umfassenden Lebensinhaltes, konnte er sich am besten der Wollust des sicheren Siegens hingeben. Sein Blick fiel auf den ruhigen Strom des Mains und die federnde Angelrutenspitze. Das war die Grundlage allen Denkens und Handelns in seinem Leben. An seinem Angelplatz hatte er sämtliche wichtigen Entscheidungen getroffen, er war die Brutstätte seines Masterplans fürs Leben, der nun kurz vor seiner Vollendung stand. Edwin Rast erschauerte. Wenn er angelte, vergaß er die Welt um sich herum. Dann gab es nur noch ihn und den Fluss und den Fisch.
Genauso war es schon in seiner Kindheit gewesen. Bereits als achtjähriger Rotzlöffel hatte er sich aus Weidenruten und zähem Garn der elterlichen Metzgerei Angelruten gebastelt und sich dann heimlich fortgeschlichen, um am Main zu fischen. Nicht selten nachts – und im Gegensatz zu später auch nicht selten erfolglos. Aber das war ihm egal gewesen. Als ungeliebtes Kind musste man sich seine Zuneigung eben dort suchen, wo man sie bekam, und für den kleinen Edwin waren es die Fische gewesen, bei denen er sich geborgen gefühlt hatte. Bald schienen sie seine Gefühle zu erwidern, denn Rotauge, Barbe und Co. begannen, sich sehr gern und bereitwillig seinen Ködern zuzuwenden. Woran das lag, konnte niemand so genau sagen, er am allerwenigsten. Später sollte es kein Wettfischen geben, wo er nicht auf den vorderen Plätzen landete, keinen rekordgewichtigen Fisch in fränkischen Anglerhitlisten, über dem nicht sein strahlendes Konterfei prangte.
Obwohl sein Ableben noch in ferner Zukunft zu liegen schien, war Edwin Rast bereits ein Mythos. Mit seinen fünfundvierzig Jahren eilte ihm bereits der Ruf der Übersinnlichkeit voraus. Es hieß, er könne denken wie ein Fisch. Neben ihm zu angeln, hatte keinen Sinn, so die allgemeine Überzeugung. Wer nahe Edwin Rast geruhte, seinen Wurm zu baden, wurde nur milde belächelt, da der gemeine Fisch, gleich welcher Art oder Herkunft, im übertragenen Sinn bereits an der Edwin’schen Angel Schlange stand, um von ihm – und nur von ihm – erbeutet zu werden. Wenn am Baggerloch nichts mehr ging, hatte Edwin natürlich noch einen Biss. Selbst in der dreckigsten Brühe, bei Hochwasser und zwanzig Grad minus würde er noch einen Dreißigpfünder aus den Fluten holen. Dessen war sich jeder sicher. Und Edwin Rast am allermeisten. Jede verdammte Fischgattung, die es am Oberen Main gab, hatte er schon mit Weltrekordgewicht auf seiner Trophäenliste stehen. Sogar einen Wels. Nur einer fehlte ihm noch: der Zander.
Ausgerechnet sein Lieblingsfisch. Ausgerechnet beim Zander war er nur auf Platz zwei! Eine Hobbyanglerin aus Nedensdorf, einem lächerlichen Kaff ein paar Kilometer flussaufwärts, hatte einen Neunzig-Zentimeter-Zander mit sechs Komma acht Kilo Lebendgewicht im letzten Jahr beim Dorffest aus dem Wasser gezogen. Unglaublich. Am liebsten hätte Edwin dem Zander einen nächtlichen, unangemeldeten Besuch abgestattet und ihm ob seiner erwiesenen Blödheit einen sauberen Anpfiff verpasst, um ihn anschließend wieder zurück ins nasse Element zu verfrachten, denn der unverdiente neue Rekordhalter war erstens eine Frau und zweitens eine Anfängerin. Zwei unerträgliche Komponenten für eine Bestleistung in der Angelwelt. Das Weibsbild hatte den kapitalen Fang ja noch nicht einmal selbst hochheben, geschweige denn wiegen können, schimpfte Edwin stets den versammelten Kollegen vor. Wahrscheinlich kannte sie nicht mal die Fischart, die da an ihrem Haken gehangen hatte. Was für eine Schande. Aber auch das würde bald nur noch Fischereigeschichte sein. Denn ganz in seiner Nähe schwamm bereits der Königsfisch herum, das Meisterstück. Der Ottfried Fischer unter den Schuppenträgern. Zwei Mal schon hatte er ihn springen sehen. Ein Zander wie aus dem Bilderbuch, wie für einen Ewigkeitsrekord zusammengebastelt. Allerdings schien er ziemlich alt zu sein und verhielt sich dementsprechend gerissen und extrem vorsichtig. Als Mensch hätte dem Vieh wahrscheinlich noch eine große politische Karriere bevorgestanden, doch seine Laufbahn als Fisch würde heute abrupt beendet werden. Denn heute war Edwin Rasts Tag, heute würden sich für ihn gleich zwei Masterpläne erfüllen. Mit einem breiten, siegessicheren Lächeln warf er in einem kurzen Bogen den Blinker der Abendsonne entgegen.
*
http://www.rast-los.com
User-ID: xxxx User online: 3
Glühwurm: Also ich glaube es is höchste Eisenbahn. Wir können nicht mehr länger warten. Was meint ihr?
Peter 69: Ich hab auch ein ganz blödes Gefühl. Da is was im Busch. Das läuft bald aus dem Ruder.
Rosenstolz: Und was soll das jetzt heißen?
Peter 69: Dass wir handeln sollten bevor es zu spät ist. Der Drecksack is jetzt fällig.
Glühwurm: Ganz deiner Meinung. Wir haben schon viel zu lange gewartet. Ist das okay für dich Rosenstolz?
Rosenstolz: Ich hab ja keine Wahl oder?
Glühwurm: Man hat immer eine Wahl. Aber entweder oder! Wenn du aussteigen willst dann tu es jetzt gleich.
Peter 69: Also was is jetzt? Wir haben keine Zeit mehr Herrschaften!!!
Rosenstolz: Okay. Bin dabei. Muss wohl sein verdammte Scheiße.
Glühwurm: Dann isses beschlossen und verkündet. Peter 69 du kannst loslegen. Aber sei bloß vorsichtig.
Peter 69: (Logout)
Rosenstolz: (Logout)
Glühwurm: (Logout)
*
Das Hausener Wehr war das letzte Stauwerk am Obermain. Von hier aus schlängelte sich der Lauf die restlichen vierzig Kilometer bis zu seiner Mündung in den Main-Donau-Kanal bei Bamberg. Inzwischen wurde fleißig an der Strecke herumnaturiert, um dem Obermain wieder etwas von seiner verlorenen Ursprünglichkeit zurückzugeben. Immerhin waren im Lauf der letzten hundert Jahre fast zwanzig Prozent der Mainschleifen weggekürzt worden. Hauptsächlich waren die Flussstücke der Flößerei zum Opfer gefallen, die um die Jahrhundertwende noch den Stellenwert eines wichtigen Arbeitgebers besaß und das Holz aus dem Fichtelgebirge und dem Frankenwald auf dem schnellsten Weg nach Holland transportiert hatte.
Doch davon war natürlich mittlerweile keine Rede mehr. Im Gegenteil: Inzwischen stand eine größere Anzahl an thüringischen Wohnwagen inklusive Bewohnern am Mainufer herum, als jemals fränkische Holzstämme den Main heruntergeschwommen waren. Aber, dachte sich der Wehrbeauftragte Fritz Lohneis, dafür lassen sie immerhin auch viele Euro in fränkischen Wirtschaften bei fränkischem Bier, Essen und Schnaps. Von den Spezialitäten gab es am Obermain mehr als genug. Er schmunzelte in sich hinein.
Wie auch immer, gleich hatte Lohneis Feierabend. Die Sonne ging bald unter, und er musste nur noch ein letztes Mal die Anlage überprüfen. Danach konnte er heim in sein kleines Reundorfer Fachwerkhäuschen gehen, das er mit Frau und seinem Berner Sennenhund bewohnte. Er warf einen letzten Blick hinauf auf den Banzberg, wo das gleichnamige Kloster bald wie jeden Abend den Nachthimmel erleuchten würde, und auf die massiven Schützentore des Hausener Wehres. Der Main hatte für die Jahreszeit einen niedrigen, aber gleichmäßigen Wasserstand, und auf Kloster Banz war wie so häufig die CSU am Konferieren. Im Obermaintal war also alles, wie es sein sollte. Jetzt musste Lohneis nur noch kurz die Anzeigen im Inneren des Schleusenhauses kontrollieren, für einen Moment dem beruhigenden Summen der Generatoren lauschen, abschließen und den Heimweg mit seinem Hund antreten, dann war seine Arbeitswoche zu Ende.
Der gestandene Franke mit ebensolchem Stammbaum ging zurück ins Schleusenhaus. Kurz, knapp, aber präzise streifte sein Blick die Instrumentenanzeige. Er stutzte. Etwas irritierte ihn. Irgendetwas war falsch. Der Ton stimmte nicht. Aus der Geräuschkulisse seiner Wehranlage war ein kleiner, doch signifikanter Missklang herauszuhören. Pro Jahr führte der Wehrbeauftragte bestimmt mehrere hundert Besucher durch die Betriebsräume der Wehranlage, darunter Ingenieure, Architekten, Professoren und – natürlich – viele Thüringer, aber keiner der Besucher, und zwar egal welcher Spezies, hätte in diesem Moment eine akustische Veränderung bemerkt. Es war einfach zu laut. Aber nicht etwa laut im Sinne von Air-Force-One- oder Presslufthammerlärm. Nein, es war das intensive Summen und Brummen der riesigen Generatoren, Wasserturbinen und sonstigen Aggregate, das sich mit dem alternierenden Klackediklack von Ketten und Hebewerken der stählernen Schützen mischte. Trotzdem hatte jeder Ton, jedes Geräusch, jeder noch so kleine akustische Effekt seinen Platz und seinen Moment. Doch die seit Jahren ehern bestehende Ordnung hatte nun einen Fehler bekommen. Beinahe unmerklich und dennoch im sensiblen Mittelohr von Fritz Lohneis durchaus deutlich fand hier gerade eine Rebellion statt. Den Kopf wie eine Radaranlage schwenkend bewegte er sich langsam so lange in die Tiefen seiner Maschinerie hinab, bis sich in seinem Ortungssystem ein feines, schleifendes Geräusch herauskristallisierte. Aus der Kakophonie von Turbinengeräuschen versuchte Lohneis nun zielgerichtet den Ursprung der akustischen Anomalie auszumachen.
Und dann sah er es. Die Antriebseinheit des rechten Schützentores. Ganz langsam, fast unheimlich bewegte sie sich. Aber das war doch unmöglich! Die Schützensteuerung konnte nur er allein über die Hebel und Knöpfe oben im Haus bedienen. Konnte es sein, dass ein dreifach gesichertes System von alleine loslief?
Über sich hörte er neues Ungemach. Der Hund schlug an. Was zum Teufel war da los? Lohneis hastete die Leitern wieder nach oben und sprang mit einem großen Schritt nach draußen. Links war der Steg über den Main in den Schatten des Banzberges getaucht. Obwohl keine Menschenseele zu sehen war, zerrte Murat, der Berner Sennenhund, wütend an seiner Kette und bellte, als würde er eine Herde Gemsen verfolgen wollen.
Dann hörte Lohneis das Rauschen. Die Schützen des rechten Wehrtores hatten in ihrer Abwärtsbewegung die Wasserlinie des Überlaufs erreicht und senkten sich noch weiter ab. Der Main begann sich in sein Bett zu ergießen, und die Wassermassen verwirbelten sich dampfend am unteren Ende des betonierten Auslaufs.
Mit wenigen Schritten stand Lohneis wieder vor seinen Anzeigen. Die Schützen fuhren unaufhaltsam nach unten. War es ein technischer Defekt, oder lag eine ernst zu nehmende Fehlschaltung in den Tiefen der elektronischen Bauteile vor? Er überlegte nur kurz, dann zertrümmerte er entschlossen den ferrariroten Schutzdeckel des Notschalters und legte den schmiedeeisernen Nothebel mit der großen, fetten Aufschrift »NOTAUS« um. Zum ersten Mal in seinem Leben.
Doch nichts passierte. Die Ketten ächzten zwar hörbar unter dem gewaltigen Wasserdruck, doch sie verrichteten unverdrossen und konsequent ihre ihnen zugedachte Arbeit weiter. Das Rauschen mutierte langsam in ein tosendes Brüllen. Fritz Lohneis war verzweifelt. Das durfte doch wohl nicht wahr sein! Siebenundzwanzig Jahre lang passierte hier überhaupt nichts, kein Blitzschlag, kein Kamikazeflieger, nicht mal ein Tourist, der die Treppe hinuntergestürzt wäre, und nun das. Darauf war er 1980 nicht vorbereitet worden, als er seinen Dienst angetreten hatte.
Dann fiel sein Blick auf die Axt an der Wand. Eigentlich war sie dazu gedacht, Schwemmgut, das sich im Wehr verhakt hatte, zu zerteilen und zu entfernen. Sie war schön und schwer, ihr blanker Eschenholzstiel glänzte. Das letzte Mal hatte er sie vor einundzwanzig Jahren benutzt, als die alte Weide vom gegenüberliegenden Ufer auf ein Auto gefallen war. Obwohl er den Baum in kürzester Zeit zerteilt hatte, war dem Landtagsabgeordneten der CSU und seiner Gespielin damit freilich nur wenig geholfen gewesen. Die beiden hatten sich einfach entschieden, zur falschen Zeit unter dem falschen Baum einem Techtelmechtel nachzugehen, das kein gutes Ende nehmen sollte. Um die Weide hatte es ihm damals wirklich leidgetan.
Jetzt nahm er mit einer flüssigen Handbewegung die Axt von der Wand und stürmte zum grauen Verteilerkasten am Ende des Steges. Hastig fingerte er den Hauptschlüssel aus seinem umfangreichen Schlüsselbund heraus und öffnete zum ersten Mal in seinem Arbeitsleben den Verteilerkasten des Überlandwerks. Schon die zweite Premiere an diesem Abend! Zwar konnte er vier armdicke Kabelstränge ausmachen, die sich aus dem Boden des Kastens nach oben schlängelten, um dann in großen, keramischen Verbindungseinheiten zu verschwinden, zuordnen konnte er sie jedoch nicht. Es gab weder typische Farben noch aufschlussreiche Beschriftung – nichts. Lohneis war mit seinem Handwerkerlatein am Ende.
Hinter ihm verschwand der Wehrsteg bereits in der aufgewirbelten Gischt. Es half alles nichts. Er hob die Axt hoch über seinen Kopf, und mit einem »Leckt mich doch alle am Arsch!« rammte er das Lieblingsgerät aller Holzfäller mitten in die undefinierte Kabelansammlung hinein. Ein blauer Blitz zuckte, ein Funkenregen sprühte, dann sprang ihm die Axt aus den Händen.
Schlagartig wurde es ruhiger im Turbinenhaus. Der gleichmäßig hohe Ton der Generatoren wurde tiefer, die großen Maschinen begannen auszulaufen und würden in ein paar Momenten stillstehen. Die Reißleine war gezogen.
Lohneis atmete erleichtert auf. Wenigstens das hatte funktioniert. Er sah sich um. Nicht nur die Stegbeleuchtung war erloschen, auch Kloster Banz lag im Dunkeln, genauso wie Reundorf und das nahe Hausen. Soweit er sehen konnte, war die gesamte Zivilisationsbeleuchtung im Obermaintal nicht mehr existent. »Leckt mich doch alle am Arsch!«, wiederholte er noch einmal leise, bevor er zitternd auf die Knie sank. Sogleich gesellte sich sein Hund zu ihm und leckte ihm aufmunternd übers Gesicht.
»Ach, Murat, ich glaube, wir haben gerade ganz Oberfranken stillgelegt«, seufzte Lohneis, während sich hinter ihm der befreite Main hemmungslos in sein enges Bett ergoss.
*
Edwin Rast fühlte sich wie ein Feldherr, dem eine siegreiche Schlacht bevorstand. Einerseits würde heute Nacht der letzte Rekord fallen, andererseits würde er morgen den totalen Triumph, den Endsieg feiern können. Aber bis dahin waren es noch vierundzwanzig Stunden, jetzt hatte er noch eine letzte Etappe zu gewinnen, eine Lücke im Puzzle zu schließen. Seinen ganz persönlichen Missing Link. Ein orgastischer Moment stand ihm bevor. Langsam und gefühlvoll kurbelte er den Blinker zu sich heran. Er konnte den Zander schon regelrecht spüren. Er zog ihn an wie ein Magnet. Es war, als besäße er hypnotische Kräfte, die jeder Anakonda zur Ehre gereicht hätten. Gleich war es so weit …
Plötzlich hörte er hinter sich ein Geräusch. Er ignorierte es, nein, er musste es ignorieren. Selbst wenn sich hinter ihm in diesem Moment ein Grizzly aufgebaut hätte, um Geschlechtsverkehr mit und von ihm einzufordern, hätte er ihn nicht beachtet. Er war Angler, und vor ihm schwamm der wichtigste Fang seines Lebens. In diesem Moment hätte er alles riskiert. Scheidung, Aktienverluste, sogar den Diebstahl seines Wagens. Er hatte den Tunnelblick aufgesetzt, außer dem Fisch war jetzt nichts mehr wichtig. Es ruckelte an der Rute.
Jetzt!, dachte er voller Vorfreude.
»Petri Heil, Edwin!«, tönte es von hinten.
»Moment!«, konnte er noch rufen, dann verschwand die Rute, der Fisch und auch der letzte Rest der Abendsonne. Edwin Rast spürte dem kurzen, heftigen Schmerz in seinem Kopf noch einen Moment lang nach – dann wurde es dunkel um ihn herum.
*
Kommissar Haderlein saß allein im Biergarten, in Bamberg nicht selten auch Keller genannt, da der gemeine Bamberger Bierkonsument sein flüssiges Brot bei, in oder auf durchbohrten Erdhügeln einzunehmen pflegt, welche in grauer Vorzeit als Bierlagerstätten genutzt wurden. Auf diese natürlichen Bierlagerstätten hatte man kurzerhand ein paar Tische mit Ausschank gebaut, und fertig war das Zentrum des oberfränkischen Seins. Im Laufe der Jahrzehnte waren in Bamberg und Umgebung so viele Menschen auf diese schlaue Idee des alkoholischen Unternehmertums gekommen, dass die Stadt mit ihrem Umland mittlerweile als brauerei- und biergartenreichste Gegend der Welt galt. Heute unternahm Franz Haderlein jedenfalls alles, um dem Ruhm der fränkischen Bierstadt einen weiteren Stein in sein Fundament zu fügen. Drei Seidla waren schon erledigt, und nun hatte er beschlossen, den Abend mit einem Schnitt abzurunden, der im Prinzip nichts weiter als ein drei viertel volles Seidla zum halben Preis ist. Allerdings darf im Fränkischen ein Schnitt nur ein einziges Mal am Abend bestellt werden, ansonsten droht Ärger. Fränkische Wirte können rechnen – jedenfalls die erfolgreichen.
Kommissar Haderlein zumindest würde dieser Schnitt für heute reichen. Schließlich war August, es herrschten laue siebenundzwanzig Grad, und Bamberg bierduselte seit Wochen ohne größere kriminelle Vorfälle vor sich hin. Fast hätte man meinen können, der gemeine fränkische Verbrecher würde im Sommer eine Bierpause einlegen. Ein bierbedingter Waffenstillstand, sozusagen der Ramadan der fränkischen Welt. Franz Haderlein hob seinen Krug, grüßte im Stillen die Silhouette der Altenburg, die sich vor dem Nachthimmel abzeichnete, und begab sich dann auf den langen Weg zum Boden des Kollegen Seidla.
*
Edwin Rast erwachte. Langsam, aber stetig kam er wieder zu seinem verblüfften, aber auch zunehmend verärgerten Anglerbewusstsein. Wo war der Fisch geblieben? Wieso hatte er geschlafen? Hatte er den Zander gefangen? Vor ihm leuchtete der Mond in seiner ganzen Pracht, und Edwin Rast quälte das dringende Bedürfnis, seine Blase zu entleeren.
Beim Angeln gab es eine eiserne Regel: Wenn nichts mehr ging, wenn die Fische schmollten und lieber unter ihresgleichen bleiben wollten, hieß es, erst einmal einen Strahl in die Ecke zu stellen. Das half immer. Deswegen konnten Frauen auch so schlecht angeln, wurde in Anglerkreisen gerne gemunkelt, schließlich würde ihnen dieser alles entscheidende Moment der Meditation und des Neuanfangs auf immer und ewig versagt bleiben. Festzementierte Anglerwahrheit.
Wo war bloß das nächste Gebüsch? Edwin Rast drehte seinen Kopf und spürte sogleich harten Beton an seiner Backe. Merkwürdig, dachte er. Aber vielleicht konnte man sich ja auch gleich an Ort und Stelle erleichtern? Während er die Möglichkeit noch reichlich benommen überdachte, schaute er nach unten. Prompt berührte seine Nase das Wasser. Verblüfft schreckte er wieder hoch. Wieso Wasser? Er stand doch. Er versuchte den Arm zu heben. Ging nicht. Das Bein? Fehlanzeige. Außerdem war alles an ihm nass und ihm arschkalt. Edwin Rast konzentrierte sich. Langsam, aber sicher vermutete er eine fremdbestimmte Einschränkung seiner momentanen Lebensqualität. Die Schlussfolgerung lag vor allem deshalb nahe, weil sein Kinn das Wasser berührte, Arme wie Beine gefesselt waren und sein Schädel dröhnte, als hätte ein islamistischer Selbstmordattentäter in seinem Kleinhirn einen Sprengstoffgürtel gezündet. Schräg gegenüber konnte er das andere Ufer, die Brückenpfeiler und die Sandsteinumrandung einer Friedhofsmauer erkennen. Schlagartig war er hellwach. Er wusste, wo er war.
*
In den letzten Jahren waren am Obermain immer häufiger Kajak- und Kanufahrer gesichtet worden. Genauso wie Angler und sonstige Ufertouristen. Als der eine oder andere dann auch noch auf die Idee gekommen war, Boote gewerblich zu vermieten, gab es die ersten Reibereien mit der angelnden Zunft und den Naturschützern. Die einen zauberten den vom Aussterben bedrohten grau karierten Kieselpfeifer aus dem besagten Hut, die anderen wollten Biber und Quastenflosser wieder ansiedeln. Da der gleiche Konflikt an diversen anderen deutschen Flüssen nicht selten mit größeren Differenzen vor Gericht oder sonst wo zu enden drohte, beschloss man am Main, einen runden Tisch einzuberufen, um mit sämtlichen beteiligten Interessengruppen eine freiwillige Selbstvereinbarung zu entwerfen. Diese sah letztendlich vor, das Befahren durch Boote zeitlich einzuschränken und auch einen Mindestpegel des Wasserstandes festzulegen, damit bei Niedrigwasser nicht mehr eingebootet werden durfte. Zu diesem Zweck wurden große, runde Betonpfeiler an den Einstiegsstellen in den Main gerammt, die oben grün und unten rot gestrichen waren. Tauchte die rote Farbe am Pfeiler auf, hatte jedem Bootsfahrer klar zu sein, dass das Ende der Saison gekommen war. Zumindest bis zum nächsten Niederschlag. So stand es nun schwarz auf weiß geschrieben, und jedem einzelnen Punkt waren harte Verhandlungen der versammelten Outdoor-Lobbyisten vorangegangen. Aber die Vereinbarung war ausgearbeitet und wurde auch tatsächlich mit mehr oder weniger Überzeugung von den jeweiligen Vertretern in einem freiwilligen Akt unterzeichnet. Selbst der bayerische Umweltminister ließ sich schließlich zu einer werbeträchtigen Bootsfahrt auf dem neu geschaffenen Bootswanderweg auf dem Obermain hinreißen.
Trotzdem gab es in den Hinterzimmern noch immer Reibereien mit den Extremisten der jeweiligen Interessenverbände. Die militanten Verfechter absoluter Standpunkte, die durch nichts von ihren am Stammtisch generierten Meinungen abzubringen waren, diskutierten lauthals weiter. Doch Edwin Rast war kein Stammtisch-Gebildeter, er war der Agitator. Er hatte keine Meinung, er machte sie. An den Anglertischen, an denen er auftauchte, waren seine Worte für die meisten Gesetz. Unverrückbare Dogmen. Edwin Rast hatte das Abkommen bis aufs Blut bekämpft. Bootsfahrer waren für ihn das Ungeziefer der Gewässer, eine vom Antlitz der Erde zu tilgende Fehlentwicklung der Natur. Jeder Kompromiss war ihm in der Angelegenheit zuwider. Er war so lange von Pontius zu Pilatus, von Behörde zu Anwalt und Landrat gerannt, bis er bei jedem maßgeblichen Entscheidungsträger Hausverbot erhalten hatte. Aber trotz aller Steine, die ihm in den Weg gelegt wurden, gab Edwin Rast nicht auf und bohrte weiter im subversiven Angleruntergrund. Nur in letzter Zeit war es etwas stiller um ihn geworden.
*
http://www.rast-los.com
User-ID: xxxx User online: 2
Peter 69: Okay. Is alles gelaufen wie geschmiert. Sind im Plan. Wie siehts bei euch aus?
Rosenstolz: Das mach ich einmal und nie wieder. Nur damit das gleich klar ist!!!!!!!!!
Peter 69: Was is mit Glühwurm?
Rosenstolz: Keine Ahnung. Aber du weißt ja dass er lieber alles 1000prozentig macht. Ich versuch jetzt zu schlafen. Kann nicht mehr.
Rosenstolz: (Logout)
Peter 69: Glühwurm bist du da? Hallo?
Peter 69: (Logout)
*
Edwin Rast war fassungslos. Sie hatten es tatsächlich gewagt und Hand an ihn gelegt. An ihn, den allmächtigen dunklen Fürsten des Anglerimperiums. Sie hatten ihn, Edwin Rast, an den nagelneuen Pegelpfeiler unter der Kemmerner Brücke gebunden. Weit weg von seinem Angelplatz in der Ebinger Flur. Sein Kopf war genau auf Höhe der rot-grünen Markierung angesiedelt, das Wasser reichte ihm bis zur Brust, und ihm war vollkommen klar, was sie mit ihm vorhatten. Über ihm thronte die Kemmerner Mainbrücke, die zu zwei der beliebtesten Biergärten im Landkreis führte, die heute, an einem lauen Sommerabend, mit Sicherheit mit Biertrinkern und Brotzeitessern nur so vollgestopft waren, welche wiederum permanent über die Brücke heimwärts torkelten. Er bräuchte also nur zu rufen, und irgendjemand käme zu ihm herunter, würde nachfragen, was hier los sei, und ihn befreien. Aber erstens wäre das kein leichtes Unterfangen, da der Pfeiler mitten im Wasser stand, und zweitens würde er mit einem Hilferuf seiner eigenen Blamage nur Vorschub leisten. Binnen kürzester Zeit würde eine Volksversammlung im Gange sein, Scheinwerfer würden ihn ins rechte Licht setzen, Zeitungsfritzen ihn interviewen, irgendein Schlaumeier würde kurzfristig einen Bratwurststand eröffnen, er wäre der König der Idioten und würde übermorgen die Titelseite der Bamberger Zeitung zieren. Oh nein. Damit würde ihn der gesamte Landkreis nicht mehr ernst nehmen. Überall, wo er später dann auftauchte, würde man ihm ein Badetuch reichen und sich vor Lachen wiehernd am Boden wälzen. Sein Mythos als Anglergott wäre vernichtet, sein imagetechnisches Lebenswerk zerstört. So nicht, Brüder der Sonne! Er musste die Zähne zusammenbeißen und noch ein, zwei Stunden durchhalten. Dann erst würde er sich bemerkbar machen, und ein später, mitleidiger Biergartenheimgänger könnte klammheimlich und ohne großes Aufsehen zu erregen, die Nachbarn oder die Frau rufen. Alles halb so wild. Nach vollbrachter Rettung würde er dem Mann großzügig für den nächsten Kelleraufenthalt zwanzig Euro in die Hand drücken und Schwamm drüber. Nur noch ein paar Stunden. Auch wenn der Main sommerlich angewärmt war, kroch ihm die Kälte nun doch unter seine gummierte Anglerausrüstung und in die Knochen. Aber er würde durchhalten. Nicht mit mir, Kameraden! Er musste nur seine brodelnde Wut aufrechterhalten, und keine Wasserkälte der Welt würde ihm irgendetwas anhaben können. Zum Glück tat sich Edwin Rast mit dem Wütendsein sehr leicht.
Aber irgendetwas an seinem wohldurchdachten Zeitplan schien nicht ganz zu stimmen. Bis jetzt hatte er noch keinen einzigen Kellergänger gehört, und das war mehr als merkwürdig. Normalerweise machten die Heimkehrer immer Lärm. Und wenn sie schon nicht zu hören waren, dann doch wenigstens zu riechen. Aber auch das ferne, unbestimmte Gelächter und Parkplatzgetue der Biergärten war nicht zu vernehmen. Sollte es schon so spät sein? Aber er war doch relativ früh am Abend, um neunzehn Uhr, an seinem Angelplatz gewesen. Verdammt, war es vielleicht doch schon weit nach Mitternacht? Die wärmende Wut verließ ihn. An ihrer statt machte sich ein kaltes Gefühl der Angst in seiner Magengegend breit. »Hilfe!«, schrie er jetzt, ohne nachzudenken. »Hilfe, ich bin hier unten! Hört mich denn keiner?« Aber seine Rufe verhallten ungehört in der Nacht. Nichts rührte sich. Keine Lichter gingen an, keine Menschen eilten zu seiner Rettung herbei. Die Ortschaft Kemmern lag im Tiefschlaf, und jede Art von Krawall, falls er denn bemerkt worden wäre, wäre den Biergärten und damit der Normalität zugeschrieben worden. Schreiende Spinner gab’s im Sommer schließlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Edwin Rast wurde panisch. Zwar war er es als Angler gewohnt, stundenlang stur auf das Wasser zu starren, aber a) konnte er dann bestimmen, wann er das Gehirn wieder hochfuhr, und b) war normalerweise ein Fisch an dem Ende der Nahrungskette, an dem er sich gerade befand.
*
Kriminalhauptkommissar Franz Haderlein hatte seine bierologische Bodenbildung erreicht. Das war’s. Der restliche Abend stand unter der Devise »Zahlen und gehen«. Noch ein Blick auf den vollen Mond und in die sternenklare Nacht, dann winkte er der Bedienung, die auch gleich an seinen Tisch trat, ihn warmherzig anschaute und ihm ein »Darf’s noch was sein, Herr Kommissar?« ins romantisierte Gemüt flötete. Haderlein schaute warmherzig zurück, beschied spontan, auch seinen restlichen Körperteilen eine Erwärmung zukommen zu lassen, und bestellte noch einen fränkischen Zwetschgenschnaps und einen Williams. Hier gab es die besten Destillate weit und breit, und der Kommissar kannte sich aus. Schließlich brannte er seit Jahren selbst und hatte sich schon einen gewissen Ruf in der fränkischen Brennerszene erarbeitet. Dieser Abend war geradezu prädestiniert für einen Schnaps – oder auch zwei. Was für ein Leben, was für eine Nacht! Er seufzte. Dieser Tag hatte es verdient, ohne Verbrechen beendet zu werden, denn das war nicht nur gut für Bamberg, sondern auch für seinen Schlaf: Haderlein war ein glühender Verfechter des natürlichen Erwachens. In seinem Beruf ein eher exotisches Ansinnen, aber am kommenden Morgen könnte es klappen. Genüsslich langsam ließ er die erste Köstlichkeit die Kehle hinunterrinnen.
*
Edwin, bleib cool, ermahnte er sich und versuchte, seine aufgewühlten Gedanken etwas zu beruhigen. Denk nach, denk verdammt noch mal nach! Gerade hatten sich seine Gefühle wieder einigermaßen im grünen Bereich eingependelt, da hörte er ein Geräusch. Ganz eindeutig. Es näherte sich von links auf dem Fluss. Sofort erkannte er, was es damit auf sich hatte. Auf der ganzen Welt würde er diesen Lärm erkennen, den es eigentlich auf diesem Planeten auszurotten galt. Nie hätte er gedacht, dass er ihm eines Tages hochwillkommen sein würde. Monotone und gleichmäßige Paddelschläge durchbrachen die Stille. Ganz eindeutig näherte sich ihm ein Kanu, seine Rettung. Ha, unverhofft kam also doch oft. Schon öffnete er seinen Mund zum finalen Hilfeschrei, doch dann durchfuhr es den Großmeister der Anglerschaft wie ein Blitz, und er klappte ihn stumm wieder zu. Das Boot fuhr außerhalb der genehmigten Zeit! Nach achtzehn Uhr war das Kanufahren auf dem Main definitiv verboten. Und außerdem, er zwang den Kopf so weit nach rechts unten, dass er mit letzter Anstrengung den Pegel an seinem Pfeiler im Mondlicht erkennen konnte, außerdem stand der mindestens sieben Zentimeter im roten Bereich. Das Kanufahren war gefälligst einzustellen. Diese Arschlöcher waren illegal unterwegs! Das Adrenalin pumpte sofort und ohne Voranmeldung durch seinen Körper. Statt dem angedachten »Hilfe!« entrang sich ein »Ihr verdammten illegalen Verbrecher!« seiner unterkühlten Kehle. »Wenn ich euch erwische, bohr ich euch ein Loch in euren Dreckskahn!«, krächzte er den Paddlern entgegen. Doch die Fahrer schienen mitnichten beeindruckt zu sein, sondern steuerten direkt auf ihn zu.
*
Im Wasserwirtschaftsamt Kronach begann ein Lichtlein zu blinken: die Hochwasserwarnleuchte der Pegelstelle Ebensfeld. Der diensthabende Flussmeister hob den Blick von seinem Taschenbuch und starrte die Lampe entgeistert an. Hochwasser am Pegel Ebensfeld? Aber der Main konnte doch kein Hochwasser führen! Seit über zwei Monaten hatte es quasi keinen Tropfen mehr geregnet. Der Fluss war schon längst im Niedrigwasserbereich. Was sollte also der Quatsch? Vielleicht war es ja nur wieder ein blöder Witz seiner Kollegen. An seinem ersten Arbeitstag hatten sie die wahnsinnig witzige Idee gehabt, ihn zu einem Hochwasseralarm an den Leiterbach zu schicken. Dort hatte er dann ein Bier und viele belustigte Kollegen vorgefunden. Flussmeister Goppert lachte zwar sehr gerne und auch über sich selbst, aber Mitternacht, kurz vor Schichtwechsel, war wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für solch einen Scherz. Er checkte das Programm, aber alles war in Ordnung. Er prüfte die Webcam, auf der um die Uhrzeit logischerweise nichts zu sehen war. Nur das Mikrofon rauschte auffällig. Das sollte man auch mal erneuern, dachte er beiläufig.
Was sollte schon groß passiert sein? Morgen würde er mit einem Techniker zum Pegelhäuschen marschieren und sich den Pseudoalarm aus der Nähe anschauen. Erneut betrachtete er die grafische Darstellung des Computers: zwei Meter über Normalstand, Tendenz steigend. Das wäre ja Meldestufe vier und damit extremes Hochwasser! Aber das war ja absolut lächerlich. Flussmeister Goppert hängte seinen linken Schuh über die blinkende Warnlampe und entschied selbstverantwortlich, die Angelegenheit auf den nächsten Tag zu verlegen. Verarschen konnte er sich schließlich auch selber. Leise schimpfend setzte er sich wieder bequem auf seinen Stuhl und suchte in seinem spannenden Kriminalroman nach der Seite, auf der ihn das blinkende Licht unterbrochen hatte.
*
Den Williams noch, und dann ist aber wirklich Schluss, mahnte sich Franz Haderlein in einem Anflug von Selbstdisziplin. Sprach’s, ließ langsam, aber konsequent die Aromen und den Alkohol seine Geschmacksnerven beglücken und erhob sich. »Komm, Riemenschneider, wir gehen«, sagte er zu dem kleinen Ferkel, das neben seiner Bank vor sich hin gedöst hatte. »Es wird Zeit.«
Riemenschneider grunzte verschlafen etwas Unverständliches vor sich hin und erhob sich unbeholfen. Haderlein nahm die Leine und verließ leicht schwankend, aber im Geiste zielstrebig den Greifenklau-Keller, seines Zeichens Biergarten seines Vertrauens. Als er noch studiert hatte, war er um diese Zeit erst richtig zu Hochform aufgelaufen, aber damit war es nun vorbei. Aus dem Hasardeur von damals war ein Genussmensch geworden, und außerdem musste Riemenschneider allmählich ins Bett. Schließlich war sie noch minderjährig. Bis zu seiner Wohnstatt in der Judenstraße waren es nur noch wenige Schritte. Ein perfekter Abend näherte sich seinem Ende. Auch Riemenschneider machte einen durchaus zufriedenen Eindruck, der sicher auch daher rührte, dass für sie wie meistens bei solchen Gelegenheiten eine Tasse voll Rauchbier abgefallen war. So ein Schwein ist schließlich ein Allesfresser, dachte Haderlein jedes Mal, und Riemenschneider war mit den Schlüssen, die er daraus zog, durchaus einverstanden.
Als die Haustür ins Schloss gefallen war, rollte sich Riemenschneider im Eingang auf ihrem Teppich zusammen, und der Hauptkommissar strich ihr kurz über die rosa Ohren.
»Gute Nacht, Große«, murmelte er noch, bevor er selbst sein Bett aufsuchte. Was für ein wunderbarer Tag war das gewesen. Wenn’s nach ihm ginge, könnte der Sommer so bleiben. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief die Belegschaft der Judenstraße 4 ein.
*
Das Boot kam näher, und Edwin Rasts Wut war noch nicht verraucht. »Kommt nur her, wenn ihr den Mut habt. Ich hab’s ja immer gewusst, dass man euch nicht trauen kann, ihr Paddelpack!«, belferte er dem herannahenden Bug entgegen.
Das Boot stoppte direkt vor seinem Gesicht und ging längsseits. Der sich auf Rasts Dreiviertelglatze spiegelnde Mond warf Lichtvariationen auf die kleine Wasserfläche zwischen Boot und Pegelpfeiler. Der Frontmann des Kanus beugte sich vorwärts und schaute Rast ausdruckslos an.
»Du? Was … Was soll das?« Rasts Verblüffung war unbeschreiblich. »Was macht ihr hier? Binde mich sofort los, verdammt!«
Aber das Gesicht grinste nur breit. »Keine Panik, Fischerkönig. Wir hatten nur was vergessen.« Und damit kleisterte der Mann dem völlig verdatterten Guru der Anglerzunft einen silbernen Klebestreifen über den offenen Mund.
»Das war’s. Und jetzt nix wie weg«, kam die ruhige Anweisung aus dem hinteren Teil des Bootes. Wenige Sekunden später verschwand das Kanu lautlos in der Dunkelheit.
Verzweifelt stierte Edwin Rast dem letzten Eindruck des Bootes noch mehrere Minuten hinterher. Er konnte es einfach nicht glauben. Er hatte ja mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Außerdem beschlich ihn langsam das Gefühl, den Pfeiler hinunterzurutschen. Oder aber das Wasser stieg, doch das war eigentlich unmöglich, schließlich führte der Main Niedrigwasser, und es hatte seit zwei Monaten keinen Niederschlag mehr gegeben.
*
Das Notfalltelefon unterbrach seinen Lesefluss. Goppert hob den Blick aus seinem Buch und betrachtete es skeptisch. Dann die Decke, dann seine Fingernägel. Entweder würde er jetzt rangehen und somit das Spiel mitspielen, oder er hätte zu beschließen, nicht da zu sein. In zwanzig Minuten wäre er sowieso weg. Aber dann hatten sie ihn am Haken.
Na gut. Wie die Herren Kollegen es wünschten. Er biss die Zähne zusammen und klappte das Buch zu. Dann nahm er seinen Schuh von der Warnlampe, die immer noch blinkte, und sah spaßeshalber nochmals auf den Pegelstand. Er musste lachen: drei Meter zehn über Normalstand. Jetzt übertrieben sie es aber! Schmunzelnd hob er endlich ab. »Wasserwirtschaftsamt Kronach, Flussmeister Goppert«, säuselte er so korrekt wie möglich in den Hörer. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ja, hier is Demmel aus Nedensdorf. Sach amal, was treibt ihr da obe in Kronich eichentlich? Ich wollt bloß Bescheid stoßen, dass mir aufm Dachboden stehn, weil der Maa neis Wohnzimmer geloffen is. Könnt ihr des vielleicht amal a weng unterbinden, uns gehen nämlich die ganzen Möbel verreckt.«
Flussmeister Goppert war nur einen kurzen Moment lang verunsichert, fasste sich dann aber sofort und stellte grimmig die Gegenfrage, ob sie denn keine Eimer, Becher und Lappen im Hause hätten, um das selbst zu erledigen. Außerdem sollten sie sich mal nicht so anstellen.
Was dann kam, war ein einziger, großer Anschiss aus tiefstem Herzen, der sich gewaschen hatte und mit den Worten endete: »Fick dich nei die Knie, du unfähiger Beamtenarsch!«
Verdattert ließ Goppert den Hörer fallen, als wäre er eine heiße Kartoffel. Das war mit Sicherheit keiner seiner Kollegen gewesen. Dann klingelte es.
Froh, sich vom Telefon wegzubewegen, eilte er zur Tür, öffnete und starrte verdutzt in das wutverzerrte Gesicht des Katastrophenbeauftragten des Bezirks Oberfranken. Noch ehe er etwas sagen konnte, packte der ihn am Kragen und brüllte aus vollem Hals: »Was zum Teufel treibt ihr hier eigentlich, ihr Penner? Wir haben Hochwasser!«
*
Im weißen Dämmerlicht des Mondscheins blickte Edwin Rast einem so großen und schäumenden Wellenberg entgegen, wie er ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Das war doch alles nicht wahr, das war ja ein Tsunami! »Wo kommt denn das Wasser her? Verdammt!«, schrie er innerlich den näher kommenden Wellen entgegen. Er fühlte sich wie in einem schlechten Traum. Die Antwort auf diese Frage blieb ihm schlussendlich leider für immer versagt. Der Main erhob sich und verschluckte binnen Sekunden nicht nur ihn, sondern auch das gesamte Ufer bis hinauf zur Friedhofsmauer. Edwin Rast hielt noch instinktiv und panisch die Luft an, was aber nicht wirklich seinen Aufenthalt unter den Lebenden verlängerte. Verzweifelt versuchte sein Gehirn zu verstehen, was gerade geschah. Mithin – vergeblich. Als er die verbrauchte Atemluft schließlich langsam aus den schmerzenden Lungen entleeren musste, schwamm plötzlich ein Zander an ihm vorbei. Mindestens einen Meter lang und locker zehn Kilo schwer. Fast hatte es den Eindruck, als würde der Fisch ihm kurz zulächeln, bevor er mit zwei schnellen Schlägen seiner Flosse in den Tiefen des Tsunamis verschwand. Das wäre der Rekord gewesen, dachte er noch völlig verblüfft, dann atmete er ein letztes Mal ein. Drei Minuten später war Edwin Rast der größte unter den Fischen im Main.
*
http://www.rast-los.com
User-ID: xxxx User online: 1
Glühwurm: Das wars.
Glühwurm: (Logout)
*
Umweltminister Schleycher stand auf und ging gemessenen Schrittes zum Rednerpult. Äußerlich ruhig und gefasst, innerlich aber mit einer nicht unerheblichen Spannung. Immerhin war das eine der wichtigsten Reden in seiner noch jungen Amtszeit, die er dem CSU-Vorstand präsentieren wollte. Auf Kloster Banz war er zwar schon oft gewesen, bislang aber immer nur in der zweiten Reihe als Staatssekretär, obwohl, das musste er zugeben, selbst dieser Posten bereits mit einem gewissen Grad an Entscheidungsbefugnis gesegnet gewesen war. Dennoch war der Unterschied zum Ministersessel gewaltig. Plötzlich stand Kolonat Schleycher im Rampenlicht des öffentlichen Interesses und musste seinen grauhaarigen Kopf für das Amt hinhalten. Als Staatssekretär war man zu dieser Zeit schon lange im Biergarten des Klosters verschwunden, während drinnen noch die Paparazzi den Vorgesetzten Herrn Minister plus politischen Anhang zur Weißglut trieben. Sein Vorgänger konnte ein Liedchen vom gnadenlosen Spiel der Presse singen. Hier ein Gammelfleischskandal, dort eine Vogelgrippe, und schon drehte sich das Kabinettskarussell ein bisschen schneller. Mit dem Ausscheiden des langjährigen Ministerpräsidenten war auch der Abgang des Umweltministers als dessen persönlichem Zögling besiegelt worden. Und da der neue Chef aller Bayern nicht ausschließlich junge Kräfte aufbieten wollte und der Proporz der Regionen in Bayern natürlich auch gewahrt werden musste, kam der neue Ministerpräsident und Parteichef der CSU nicht um ihn, um Kolonat Schleycher, herum. »Du bist mein unterfränkischer Turm in der Schlacht«, hatte er noch kurz vor der alles entscheidenden Fraktionssitzung zu ihm gesagt. Und nach jahrzehntelanger Übung in stromlinienförmigem Verhalten war auch niemandem in der Fraktion etwas gegen ihn eingefallen. Im Gegenteil. In der Zeit von Gegenkandidaten, Intrigen und unehelichem Nachwuchs der Parteielite war Kolonat Schleycher ein Paradebeispiel von vorbildlicher CSU-Karriere.
Eigentlich war er gelernter Dorfpfarrer einer kleinen Gemeinde in der bayerischen Rhön gewesen, doch dann hatte er sich bald durch die Kommunalpolitik einen Namen in der CSU gemacht. Kurz darauf folgte der Aufstieg in mittlere und auch höhere Parteiämter, und das, ohne groß aufzufallen, was in der CSU keine leichte Übung darstellte. Neider gab es natürlich trotzdem. Aber wie wollte man einem ehemaligen Geistlichen, der noch dazu eine geradezu seelsorgerische und einnehmende Öffentlichkeitsarbeit hinlegte, am Lack kratzen? Kaum im Amt des Ministers eingeschworen war Kolonat Schleycher schon der beliebteste Minister beim Volk. Ein »Everybody’s Darling«, der nach Wahlstimmen geradezu stank. Da musste man schon auf einen gewaltigen Skandal hoffen, um so jemanden noch vom Sockel zu stoßen. Kolonat Schleycher wusste um die Haifische, die ihn von der Basis her treuherzig und falsch anlächelten. Er hatte seine Pfründe zu sichern und Unbill in der Öffentlichkeitsarbeit zu vermeiden. Und deswegen war er hier.
Er atmete noch ein letztes Mal tief durch und begann seine erste Rede in Banz. »Probleme sind da, um bewältigt zu werden!«, rief er ins Auditorium. »Die CSU kann und will es nicht jedem recht machen, besonders nicht in der Umweltpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stehe hier, um Ihnen unbequeme und unpopuläre Entscheidungen vorzulegen. Entscheidungen, die …«
In diesem Moment fiel das Licht aus. Dann versagte die Tonanlage. Nach einem kurzen Moment des Erschreckens machte sich verunsichertes Kichern im Raum breit.
»Der Herr selbst hat dir wohl den Saft abgedreht, was?«, rief ein potenzieller Missgünstling aus den hinteren Reihen, und damit war der Bann gebrochen. Die CSU-Fraktion lachte sich tot. Es wurde entschieden, eine Sitzungspause einzulegen, und Kolonat Schleycher hoffte, dass dieser Stromausfall nicht ein böses Omen für seine Amtszeit war.
*
In Nedensdorf war Volksfeststimmung. Kanu- und Kajakfahrer aus ganz Bayern hatten sich zur finalen Großkundgebung an der Einstiegsstelle versammelt, um gegen die angeblichen üblen Machenschaften der Fischerei zu demonstrieren. Am morgigen Sonntag wollte man im Zuge eines »Widerstandspaddelns« auf dem Main bei der Öffentlichkeit und vor allem bei der Regierung auf dem Banzberg für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Die Auseinandersetzungen zwischen Anglern und Bootsfahrern hatten im letzten halben Jahr dramatisch an Schärfe zugenommen. Geschichten von Prügeleien auf Kiesbänken, angebohrten Booten bis hin zu vergifteten Fischen waren im Umlauf.
Das Fass zum letztendlichen Überlaufen aber hatte der Fischereibevollmächtigte Rast gebracht. Der hatte sich vergangenen Juli groß für die Lokalzeitung ablichten lassen und verkündet, dass das Paddeln auf dem Main ja quasi schon erledigt war und diese bootfahrenden Umweltverbrecher im Prinzip bereits Flussgeschichte darstellten. Die Fischerei und seine Person im Speziellen hätten dafür schon alle erforderlichen Mehrheiten beisammen et cetera. Das Interview hatte mit dem unglücklichen Vergleich geendet, dass ein Bootsfahrer für den Main auch nicht besser sei als eine Heuschreckenplage für Äthiopien.
Daraufhin war ein kollektiver Aufschrei durch die fränkische Paddlergemeinschaft gegangen. Der Deutsche Kanuverband schrieb eine offizielle Protestnote an das Bayerische Umweltministerium, in der oberen Fischereifachbehörde in Bayreuth stapelten sich die Anträge auf Gutachten, und beim Bamberger Landrat gaben sich die entsprechenden Parteifunktionäre der Kampfhähne die Klinke in die Hand. Schließlich hörte man in der Szene das Gerücht, dass der neue Umweltminister in einer seiner ersten großen Amtshandlungen den ganzen Streit unterbinden wolle und eine Verordnung erlassen werde. Ob diese zugunsten der Bootsfahrer oder der Anglerschaft ausfallen werde, war aus seinen Äußerungen jedoch nicht ersichtlich. Da hielt sich das Umweltministerium ziemlich bedeckt. Kolonat Schleycher ging offensichtlich wesentlich bedachter vor als sein Amtsvorgänger, dem man eine natürliche Affinität mit der Paddlerei angemerkt hatte. Aber es lag etwas in der Luft, das spürte jeder, der in diesen Zank involviert war. Deshalb war für den morgigen Sonntag auch die erste Paddlergroßkundgebung und -demonstration in der Geschichte des Bayerischen Kanuverbands geplant. Die Beteiligung war immens, die Stimmung war gut und ausgelassen. Mehrere hundert Paddler aller Couleur hatten in Nedensdorf und am gegenüberliegenden Ufer ihre Lager aufgeschlagen. Bis zum Wasser standen die Zelte dicht an dicht. Die ersten Feuer brannten bereits, die eine oder andere Gitarre konnte man auch schon hören, und etliche Wassersportler waren noch auf dem Fluss unterwegs, um das Spektakel von dort aus zu betrachten.
Im einzigen Gasthof von Nedensdorf hatten sich die oberen Zehntausend der Protestbewegung zum konspirativen Treff versammelt. Der Reblitz lag einhundert Meter den Berg hinauf mitten im Ort, den ansonsten ein eher beschauliches Treiben mit Einheimischen und ein paar Sommergästen auszeichnete. Jetzt aber war hier der Teufel los. Die Gaststube platzte fast aus allen Nähten, wer keinen Stuhl mehr ergattert hatte, musste stehen – und das taten die meisten. Der Gang zur Toilette erinnerte stark an eine Nahkampfübung der Bundeswehr, und das Bier floss in Strömen, und zwar nicht nur in der Wirtschaft.
Auch draußen auf dem Hof drängelten sich die Menschen bis zur Einstiegsstelle hinunter und verlangten nach flüssigem Brot. Der Wirt war bereits dazu übergegangen, das Bier fässerweise zu verkaufen, um der Lage einigermaßen Herr zu werden. Die Bierfässer mussten dann über Kopf zum Flussufer geschleppt werden, weil an ein Durchkommen auf eine andere Art nicht einmal zu denken war. Das größte Bamberger Volksfest, die Sandkerwa, war ein Dreck dagegen. Ganz Nedensdorf ähnelte einem Piratentreffen auf einer Karibikinsel. Die Stimmung musste damals ähnlich gewesen sein.
Im Reblitz saßen die Rädelsführer derweil in trauter Runde beisammen, um sich auf den morgigen Tag einzustimmen. Beflügelt von der Woodstockatmosphäre draußen war man drinnen fleißig am Mut- und Überzeugungantrinken.
Fritz Helmreich, Bootsverleiher aus Kemmern, hielt gerade eine Rede zur Lage der Paddlernation. Schon leicht beduselt beendete er unter begeistertem Beifall seinen Vortrag gegen die dunklen Mächte der Fischerei um den finsteren Rast und gab anschließend den Abend zur freien Gestaltung frei. Was nichts weiter hieß, als dass der Bierkonsum sich noch etwas beschleunigte, sofern dies überhaupt noch möglich war. Der Zapfhahn des Wirtes glühte genauso wie die Augen des Brauereibesitzers. Der Reblitz machte in einer Nacht so viel Umsatz wie sonst im ganzen Sommer.
»Du, Fritz, sach amal«, wurde Helmreich von der rechten Seite angesprochen. »Du, Fritz, sach amal: Maanst du, die wollen des Bootfahrn aufm obera Maa echt verbieten? Jetzt, wo mer doch alle Aastiegsstelln gemacht ham? Bloß wecha dem Rast sei Spinnerei.«
»Naaa. Jetzt mach dir amal kaan Stress«, beruhigte ihn der Bootsverleiher.
»Wenn die morchen sehn, was aufm Maa los is, dann wern die sich des gleich zwaamol überlechen, was se da machen. Und der Rast tut, glaab ich, schlimmer, als wie er is. Des is a großer Dampfplauderer vorm Herrn. Prost, und jetzt trinke mer noch a Seidla!«
Helmreich war sich sicher, dass die ganze Geschichte in ihrem Sinne ausgehen würde. Als ortsansässiger Bootsverleiher hatte ihn das Schicksal in die Gegenspielerrolle der Angler hineinmanövriert. Trotzdem hatte er immer wieder versucht, beschwichtigend auf seine Partei einzuwirken, was jedoch einfacher gesagt als getan war. Die Fischerei war ein straff durchorganisierter Verband, der sich bis hinunter in den kleinsten Angelverein erstreckte. Da herrschten noch deutsche Zucht und Detailkenntnis. Die Bootsfahrer hingegen glichen einem chaotischen Hühnerhaufen. Als junge Sportart waren sie dementsprechend schlecht organisiert und, was Lobbyarbeit anbelangte, völlig unbedarft. Das musste man erst lernen, aber Helmreich war auf einem guten Weg. Immerhin war sein Vater Bürgermeister von Kemmern gewesen, und als Heranwachsender hatte er mit großem Interesse die Klüngel und Abmachungen in der Heimlichkeit des Helmreich’schen Wohnzimmers mitverfolgt. Nach dem Willen seines Vaters hätte er Lehrer werden und in der Politik mitarbeiten sollen. Dafür wäre jedoch der CSU-Beitritt unausweichlich gewesen wäre, und so weit ging die Vaterliebe dann doch nicht. Dann eben keine Politikerkarriere. Denn in Franken war man seit jeher entweder in der CSU oder in der Opposition. Entweder man arrangierte sich und akzeptierte die faktische Monarchie im größten Bundesland, oder man verdingte sich mit ehrlicher Arbeit. Fritz Helmreich entschied sich für Letzteres. Ein Bootsverleih war schließlich weitab von jeglicher Wahrscheinlichkeit, je von der Politik belästigt zu werden. Tja, da hatte er wohl danebengelegen. Jetzt jedenfalls steckte er mittendrin im Politsumpf – und auch noch an vorderster Front. Nicht dass er sich darum gerissen hätte. Aber es lag ihm einfach, zu reden und zu argumentieren. Er konnte ja auch nichts für seine Gene und kam vor allem nicht gegen sie an. Also war er nun mal hier mit dieser Aufgabe gelandet. Auch gut.
Er hob seinen Krug, um auf dessen fatale Leere aufmerksam zu machen, als von draußen hektische Rufe zu ihm hereindrangen. Wahrscheinlich war bei denen das Bier auch alle. Er schwenkte weiter sein Seidla mit dringendem Wunsch nach erneuter Befüllung, doch die Stimmen von draußen wurden immer lauter.
Plötzlich stürzte der Vertreter des Deutschen Kanuverbands aus München in den Gastraum und rief mit panisch weit aufgerissenen Augen: »Fritz, Fritz, komm sofort! Da ist was mit dem Main. Ich glaube, wir kriegen Hochwasser. Und zwar schnell!«
Helmreich glaubte, sich verhört zu haben. Hochwasser? Völlig unmöglich. Die Pegelstände wurden von ihm jeden Tag abgefragt, und eigentlich war das Wasser schon seit drei Tagen so niedrig, dass gar nicht mehr Kanu gefahren werden durfte. Hochwasser war so was von unrealistisch, vor allem bei der andauernden Trockenheit. Verwirrt ging er mit nach draußen.
»Da, schau dir die Schweinerei an!«, rief ihm der Vorsitzende vom Faltboot-Club Bamberg zu. »Die schrecken vor nichts zurück! Egal wie se des gemacht ham, aber sie hams gemacht. Jetzt musste was unternehma, Fritz! Es langt!«
Ungläubig betrachtete Helmreich die Szenerie. Er traute seinen Augen nicht.
Das Ufer war verschwunden. Und mit ihm Zelte, Boote und Bootsfahrer. Wer konnte, hatte sein Boot noch schnell den Hang hinauf Richtung Ortsmitte gezerrt. Die meisten allerdings hatten nur noch sich selbst retten können und standen nun wie alle anderen wortlos aneinandergedrängt am neuen Ufer, der Dorfstraße. Der Main hatte die Einstiegsstelle gefressen, die Zelte waren weg, die meisten Boote verschwunden und die bierselige Piratenstimmung auch. Fassungslosigkeit machte sich breit. Wie konnte das passieren? Hochwasser ohne Regen? Wie auch immer, der Main hatte die größte Paddlerdemo, die Franken je zu sehen bekommen hätte, ohne Wenn und Aber aufgelöst.
*
Der Mann hielt eine doppelläufige Schrotflinte in der Hand und war offensichtlich zu allem entschlossen. Sein Gesicht leuchtete vor Erregung puterrot.
»So, jetzert hab ich dich«, zischte er durch seine gelben Zähne.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Ihr letztes Stündlein hatte geschlagen. Der Mann schien es offensichtlich bitterernst zu meinen.
»Des wars, Mylady. Jetzert ist endlich dei Linie ausgelöscht. Unner Schuld is gedilchd. Gleich wirscht du in der Hölln schmoren, du Schlambe.« Der große Unbekannte mit der verschlissenen Cordhose und den braunen Gummistiefeln legte das Gewehr an die Backe. Da ertönte eine ferne Melodie. Beethovens Neunte. Sie wiederholte sich in einer unendlichen Schleife.
»Was solln der Scheiß?«, maulte der Mann und hielt noch schnell zwei Finger an die Nase, um kurz und gründlich auf die Seite zu rotzen. Der eitergelbe Treffer floss träge tropfend die strahlend weiße Fliese hinunter.
Sie sah sich verzweifelt um, aber weit und breit war niemand zu sehen, der ihr hätte helfen können. Nur geflieste Wände überall. Und der Mann stand genau zwischen ihr und der einzigen Tür, die nach draußen führte. Es war kalt, sie zitterte, und sie saß in der Falle.
»Da spielt dir noch aaner a Abschiedslied, Maadla«, kicherte der Typ. Dann irrlichterte sein unsteter Blick zurück zu seinem auserkorenen Ziel. »Na, vo mir aus. Aber mir langts etzerd. Adela!«
Er drehte sich um. Der Gewehrlauf schwebte nur etwa zehn Zentimeter vor ihr in der Luft. Noch nie in ihrem erst kurzen Leben hatte sie so panische Angst gehabt. Beethoven tönte immer lauter durch den gefliesten Kerker, aber der Mann schien wild entschlossen zu sein. Er zielte kurz und drückte ohne weitere Verzögerung ab. Es gab einen dumpfen Knall, Pulverdampf quoll in Zeitlupe aus dem Lauf – und Riemenschneider wachte quiekend auf.
Sie war nicht tot. Ein Glück, alles war nur ein schweinischer Alptraum gewesen. Riemenschneider grunzte erleichtert und legte den verschwitzten rosa Kopf wieder auf ihre ausgestreckten Vorderfüße. Mit einem Mal ertönte eine laute Melodie. Beethovens Neunte. War alles vielleicht doch kein Traum gewesen?
Behände sprang sie auf und drückte sich bebend gegen die eichene Eingangstür. Das kleine Herz klopfte ihr bis zum Hals. Verdammt. Hastig warf sie Blicke in sämtliche Ecken des Flurs, aber nirgendwo war ein Mann mit gelben Zähnen und Flinte zu entdecken. Doch wo kam dann die Musik her? Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und schlich mit kurzen Trippelschritten der Quelle der Sinfonie entgegen. Vorsichtig lugte sie ins Wohnzimmer und grunzte. Gott sei Dank. Es war nur das Telefon. Der Kommissar hatte offensichtlich mal wieder den Rufton geändert. So eine Schweinerei. Seit er einen Computer und Internet besaß, machte er sich an langen Sommerabenden anscheinend einen Spaß daraus, Klingeltöne runterzuladen. An sich eine Vorliebe von verpickelten Teenagern, aber wenn man ein gelangweilter Single war …
Einerseits war Riemenschneider ob dieser Entdeckung wieder beruhigt, andererseits bemächtigte sich des Schweins plötzlich ein ziemlich unangenehmer Druck auf die kleine, aber wohlgefüllte Blase. Das Greifenklau-Bier verlangte unaufschiebbar nach Ausgang. Als gut erzogenes fränkisches Ferkel lehnte das kleine Schwein es natürlich kategorisch ab, verdautes Bier an Möbelstücken zu entsorgen, also musste sie unbedingt raus. Vorsichtig nahm sie das neue Handy zwischen die spitzen Zähne und kletterte die Stufen zum kommissarischen Schlafzimmer hinauf. Dort legte sie das Telefon neben das Nachtkästchen in der Hoffnung auf den Boden, dass die inzwischen sehr laut abgesonderte neunte Sinfonie zum Erwachen des Herrn und Meisters führen würde. Aber nichts da. Kommissar Haderlein schlief den Schlaf des Gerechten und harrte konsequent des natürlichen Erwachens. Die Melodie hatte aufgehört und Beethoven versagt.
Riemenschneider griff zum letzten ihr bekannten Mittel, stellte die kurzen Vorderfüße auf die Oberkante des original japanischen Futonbetts und zerrte langsam, aber beharrlich die leichte Sommerdecke auf den Boden. Sie hatte das in einem dieser alten Schwarz-Weiß-Filme im Fernsehen gesehen, die ihr Kommissar so liebte. Da hatte es einen Hund namens Lassie gegeben, der das andauernd gemacht hatte. Sie war ziemlich beeindruckt gewesen, und da Riemenschneider schließlich weitaus intelligenter als so ein blöder Hund war, stellte das Nachahmen für sie kein Problem dar.
Sie wartete. Alles Weitere lag nun nicht mehr in ihrer Hand, allerdings bald in Form einer gelblichen Pfütze auf dem gedielten Schlafzimmerboden, wenn nicht schnell etwas passieren würde. Bellen wäre jetzt nicht schlecht, überlegte sie, aber da! Es tat sich etwas. Ein Fuß bewegte sich.
*
Kommissar Haderlein fiel die plötzliche Kühle unangenehm auf. Außerdem hatte anscheinend jemand das Radio angedreht, denn Beethoven dudelte in Endlosschleife durch sein Gehör. Ziemlich nervig, das Ganze. Er fingerte verzweifelt nach der Decke, um die Temperatur wieder zu erhöhen. Weg. Was sollte das? So konnte er jedenfalls nicht weiterschlafen. Es war doch Sonntag, Sommer, und er hatte dienstfrei. Aber so würde er nie weiterträumen. Es war zu laut und zu kalt. Kommissar Haderlein beschloss notgedrungen, aufzuwachen.
*
»So, hier machen wir Pause«, bestimmte ihr Vater, der Expeditionsleiter, kurz entschlossen. Er hatte von der ganzen Hektik dieses Urlaubs bereits die Nase gestrichen voll. Seit sie vor drei Tagen aus dem Zelt gekrochen waren, ging irgendwie alles schief. Der Main führte nun endgültig Niedrigwasser, der Pegel leuchtete rot und deutlich, und damit durften sie mit dem Boot nicht weiterfahren und saßen auf dem Campingplatz in Ebensfeld fest.
Seine dreizehnjährige Tochter fand das alles natürlich gar nicht lustig. Schon im Vorhinein hatte sie keine wirkliche Lust auf Bootfahren gehabt, doch jetzt wollte sie nur noch heim. Eigentlich am liebsten in einen Ferienclub auf die Kanaren so wie ihre beste Freundin und deren Eltern. Denn so ein Boot hatte kein Internet, es gab keine Disco in der Nähe, und zu guter Letzt hatte ihr ihr Vater auch noch das Handy verboten. Super!
»Wir verbringen eine Woche in der Natur. Ganz ohne diese verdammte Zivilisation«, hatte er verkündet.
Mama hatte auch gewollt, dass sie mal aus dem Haus verschwanden, und fand die Idee mit der Bootstour ziemlich gut. Keine Unterstützung in der ganzen Familie. Und jetzt saß sie hier allein mit ihrem Erzeuger rum, ohne Handy, dafür mit einem Boot, das nicht fahren durfte, auf einem ekelhaft langweiligen Campingplatz. Schrecklich.
Zur Krönung hatte heute Nacht auch noch eine Schnake ihren Weg ins Innere des Zeltes gefunden und alles zerstochen, was ihr vor den Rüssel gekommen war. Vater und Tochter sahen aus wie zwei fränkische Streuselkuchen. Aber am Morgen war endlich das Wunder geschehen. Der Main führte wieder Wasser, und zwar mehr als genug. Völlig unverhofft. Selbst das untere Ufer war überschwemmt, und in der Nacht sollte der Wasserstand sogar noch eine ganze Ecke höher gewesen sein. Aber das konnte ihnen nun so was von egal sein. Hauptsache, sie mussten nicht mehr hierbleiben und Heuschrecken zählen oder überlegen, ob sie Mama anrufen sollten, damit sie sie holen käme. Endlich konnten sie weiterfahren.
Tatsächlich löste der Wasserstand etwas in Amelie aus, was sie vorher nie für möglich gehalten hätte. Sie freute sich aufs Bootfahren. Also packten sie schleunigst ihre Sachen zusammen und begaben sich flugs mit dem Kanu aufs Wasser, bevor es sich der Main noch mal anders überlegen konnte.
Kurz danach bemerkten sie, dass sie in der Aufbruchshektik die Flusskarte, die ihnen der Bootsverleiher mitgegeben hatte, auf dem Campingplatz liegen gelassen hatten. Mist. Sie waren, ohne nachzudenken, losgepaddelt und hatten jetzt schon keine Ahnung mehr, wo sie überhaupt waren. Aber auch das würde sich schon irgendwie regeln. Der Main floss schnell, und sie kamen gut voran. Interessanterweise überholten sie des Öfteren Treibgut wie Zelte, Paddel oder Kleidungsstücke. Da musste das steigende Wasser jemanden ziemlich überrascht haben.
Aber das war nicht ihr Problem. Ihr Problem war die totale Unkenntnis der geografischen Situation. Also bestimmte der Vater und Bootsführer, an der nächsten Ausbootstelle erst mal haltzumachen und die Lage zu überdenken. Außerdem quengelte Amelie schon seit geraumer Zeit, weil sie Hunger hatte. Sie waren ohne Frühstück aufgebrochen. Nun gut, auch er konnte ein paar Kalorien vertragen.
An der Ausbootstelle lag eine Ortschaft, in der man sicherlich einen Laden oder eine Wirtschaft aufstöbern konnte, in der man was zu essen bekam. Er selbst würde ja am liebsten allein in der Wildnis Würmer und Nüsse zubereiten, aber seine Tochter hatte zu dem Thema leider eine gänzlich andere Meinung. Und mittlerweile konnte er die Diskussionen zum Thema Urlaub in der Natur auch nicht mehr hören.
Sanft glitt das Boot auf die neu angelegte Kiesbank neben der Brücke. Alles war noch feucht und rutschig. Der Main musste in der Nacht tatsächlich wesentlich mehr Wasser geführt haben. Auch jetzt befand sich der Wasserstand noch rapide im Fallen. Amelie sprang sofort aus dem Boot und wollte Richtung Dorf laufen.
»Halt, erst mal wird das Kanu gesichert, und das Geld muss ich dir auch noch raussuchen!«, rief er ihr zu. Der wasserdichte kleine Beutel, in dem sich ihr Ferienvermögen befand, war irgendwo tief unten im Equipment vergraben. Das konnte dauern.
Amelie setzte sich neben das Boot auf einen dicken, quer liegenden Baumstamm, betrachtete erst ungeduldig die Suchaktion ihres Vaters und richtete ihren Blick dann abwartend auf den schmutzig braunen Main. Nach ein paar Minuten begann sie das Treibgut auf dem Wasser zu zählen. So etliches kam da angeschwommen. Gerade trieb eine Gitarre vorbei.
Ihr Vater hatte inzwischen seinen halben Oberkörper in einem wasserdichten Sack vergraben. Wo zum Teufel hatte er bloß das Geld verstaut? Hoffentlich war das nicht zusammen mit der Karte auf dem Campingplatz geblieben. Das würde jetzt gerade noch fehlen. Ohne Geld gab es kein Essen, dafür aber mit Sicherheit eine ausgerastete Tochter. Er war genervt.
»Papa«, hörte er Amelies Stimme von irgendwo links durch den Sack dringen.
»Ja, mein Engel?«, flötete er leicht abwesend zurück.
»Papa, wie lange kann man eigentlich die Luft unter Wasser anhalten?«
Was? Wollte seine Tochter jetzt auch noch baden? »Keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten, wenn man gut ist. Du springst mir jetzt aber nicht in den Fluss. Das ist viel zu gefährlich, und das Wasser ist ziemlich schmutzig. Und nass zu frühstücken, das kommt gar nicht in die Tüte.« Im unpassendsten Moment kam seine Tochter aber auch wirklich auf die blödesten Ideen. »Warum willst du das überhaupt wissen?«, erkundigte er sich.
»Och, nur so. Fünf Minuten, meinst du also? Dann muss der Mann da drüben aber reichlich lange trainiert haben. Der hält jetzt schon die Luft an, seit wir hier sind. Und auf meiner Uhr ist das schon mehr als das Vierfache.«
*
Kommissar Haderlein öffnete die Augen und sah an die Decke. Kein Zweifel. Er war zu Hause, und jemand dudelte Beethoven neben seinem Bett. Zudem war seine Decke verschwunden. Beethoven? Verdammt, das war doch sein Handy! Blitzschnell rollte er sich auf die Seite und tastete den Boden nach dem Telefon ab. Aus den Augenwinkeln sah er sein kleines Ferkel am Fußende des Bettes neben der Decke sitzen. Er zögerte nur einen Moment ob der etwas unwirklichen Situation, aber dieser Moment war einer zu viel, denn Beethoven verstummte, und das Handy wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben.
»Was soll denn der Blödsinn, Riemenschneider?«, rief er seinem Hausschwein zu. »Es ist Sonntag, und ich habe das Recht, auszuschlafen. Wenn ich mich überhaupt am Tag des Herrn aus dem Bett erhebe, dann nur, um die Toilette aufzusuchen, ist das klar?«
Aber Riemenschneider rührte sich nicht, sondern schaute ihn weiterhin unverwandt und starr an.
Haderleins Blick fiel auf die Uhr. Halb acht. Mitten in der Nacht wurde man also von seinem Schwein und einem Handy aus dem Schlaf gerissen. Er seufzte. Da hatte er sich und seinem Leben eine Frau und Kinder sozusagen erspart, aber dafür offensichtlich gegen ein Ferkel und Handy eingetauscht. Tolle Alternative.
»Riemenschneider, ich geh jetzt aufs Klo, und dann sehen wir weiter«, stellte er das kleine Schwein vor vollendete Tatsachen und trollte sich Richtung Bad davon. Er ließ sich auf der Schüssel nieder, gähnte und durchdachte seine momentane häusliche Situation. Das mit Riemenschneider konnte so nicht weitergehen. Aber wohin mit ihr? Im Tierheim wollte man sie nicht nehmen, und bei einem Bauern würde sie bloß als Spanferkel enden. Das konnte er ihr nun auch nicht antun.
Er stöhnte laut auf. Vorletzte Woche hatten seine Kollegen ihm das Ferkel als Geschenk zum fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläum überreicht. Damit er weiterhin so viel Schwein mit seinen Fällen habe, stand auf der Glückwunschkarte, die sie der armen Riemenschneiderin um den Hals gebunden hatten. Inzwischen hatte er herausgefunden, dass das Ferkel bei irgendeinem mysteriösen Einsatz übrig geblieben war, während er Urlaub gehabt hatte. Den Rest des feuchtfröhlichen Jubiläumsabends hatte er dann in seiner Wohnung mit der Diskussion darüber verbracht, wie das Ferkel heißen sollte. Kommissar Lagerfeld, sein Kollege, war auf die glorreiche Idee gekommen, im »Deutschen Buch der Vornamen« nachzuschlagen, das bei Haderlein im Schrank stand. Allerdings war besagter Kollege schon so benebelt, dass er danebengriff und stattdessen die »Enzyklopädie der deutschen Kunstgeschichte« in seinen Händen hielt. Einer rief: »Los!«, Haderlein rief: »Stopp!«, und Lagerfeld tippte blind in die Mitte des Buchs auf den Kunstschnitzer Tilman Riemenschneider. Und da niemand mehr Lust verspürte, noch länger über den Taufnamen eines weiblichen Ferkels zu brüten, wurde es beschlossen und verkündet. Das Schwein wurde in einem feierlichen Akt mit Bier getauft, und Haderlein wurde eine Taufurkunde überreicht. Am nächsten Tag, als der Hauptkommissar mit schwerem Kopf erwachte, hatte er eine neue Mitbewohnerin namens Riemenschneider am Bein, die grunzte und von nun an jeden Morgen Gassi geführt werden musste. Das war vor gut zwei Wochen gewesen.
Gassi! Ihm fiel es wie Schuppen von den Augen. Deswegen saß Riemenschneider vor dem Bett! Nun gut. Haderlein würde sich die Morgentoilette schenken und erst mal mit dem Schwein um die Ecke gehen, bevor noch Schlimmeres passieren konnte. Er warf sich seinen Bademantel über, schlüpfte in die Hausschuhe, schnappte sich Riemenschneiders Leine, ging zur Haustür und öffnete sie.
Draußen stand Kommissarkollege Lagerfeld, die Hand erhoben, um die Klingel zu betätigen.
»Guden Morchen, Chef. Gud, dass Sie scho wach sin. Aber wieso gehn denn Sie net ans Handy? Ich hab fei ewich klingeln gelassd.«
Lagerfeld also. Lagerfeld bedeutete Unheil. Haderlein sah seinen heiligen Sonntag in weite Ferne rücken. Er musste das drohende Unheil unbedingt abwenden.
»Was wollen Sie, Lagerfeld? Es ist Sonntag, und ich habe eigentlich frei.« Ihm schwante Übles. Aus purer Freundlichkeit kam Lagerfeld bestimmt nicht vorbei.
»Mir ham an Fall, Chef. Wie geht’s denn der Riemenschneiderin?« Grinsend tätschelte er das kleine Schwein.
Das durfte doch alles nicht wahr sein. Ein Fall? Heute am heiligen Sonntag? Bitte nicht. Wahrscheinlich hatte wieder eine Katze eine andere vergewaltigt, und der Besitzer stellte Strafanzeige. Das war bis jetzt das Kriminellste gewesen, was dieser August zu bieten gehabt hatte. »Um was geht’s denn, Lagerfeld, können Sie das denn nicht alleine?«, stöhnte er.
»Naa, Chef. Mir ham a dode Leiche im Maa mit unnadürlicher Dodesfolge. Des is Chefsache, Chef.«
Manchmal nervte ihn das breite Fränkisch seines jungen Kollegen unsäglich. Aber Lagerfeld war auch durch bisheriges Bitten nicht zu bewegen gewesen, sich kontinuierlich dem hochdeutschen Idiom zuzuwenden. Wenigstens im Dienst. »Woher wollen Sie denn wissen, dass die Person umgebracht wurde, Lagerfeld? Sie dürfen nicht immer so vorschnell urteilen.«
Lagerfeld blätterte kurz in seinem Notizblock und las dann vor: »Na ja, die Berson is männlich und ziemlich dod. Außerdem is das arme Schwein«, hier horchte die Riemenschneiderin interessiert auf, »under Wasser festgebunden worn, und des wird der ja wohl kaum selber gemacht ham. Dann war ihm die Goschn mit am Glebeband zugebabbd. Des macht mer aa net selber, wenn mer fesd aagebunden is, Chef. Außerdem gab’s an Sabodaschefall am Wehr in Hausen und dadurch ausgelöst so a Ard Dsunami den Ma nunner mit haufenweise Sachschaden. Wenn Sie mich frachen, Chef, dann is da am Maa grad irchendwie der Deufel los.«
Riemenschneider beschloss, die weitere Entwicklung der Ausführungen nicht länger abzuwarten, und entleerte sich an der Wand des Haderlein’schen Anwesens. Resigniert betrachtete der Hauptkommissar erst sein Ferkel, dann Lagerfeld, bevor er sich entschied, sich seinem Schicksal zu ergeben und sich besser mal was anzuziehen.
Leich-Zeit
http://www.rast-los.com
User-ID: xxxx User online: 2
Glühwurm: Herrschaften da is irgendwas ziemlich schiefgelaufen!!!
Peter 69: Wir sitzen richtig in der Scheiße!
Glühwurm: Was denn für Scheiße?
Peter 69: ganz grosse scheisse!!!
*
Kolonat Schleycher startete seinen zweiten Versuch. Nachdem gestern Abend das Licht und der Ton ausgefallen waren und er sich erst mal zum Affen der Partei gemacht hatte, würde heute hoffentlich nichts mehr schiefgehen. Mit dem Manuskript seiner Rede fest in der Hand schritt er zum Rednerpult. Die Fraktion war noch immer ziemlich erheitert, und er hatte heute Morgen beim Frühstück mehr als genügend dumme Sprüche zum Thema »Herrgott und die plötzliche Dunkelheit« über sich ergehen lassen müssen. Aber er ertrug sie mit Fassung. Schließlich war er jetzt Minister und mit einer gewissen Gelassenheit gesegnet. Zumindest erwartete man das von ihm, und er hatte nicht vor, sich von einem lächerlichen Stromausfall aus der Fassung bringen zu lassen. Dass es mit seinem Nervenkostüm im Moment nicht zum Besten stand, brauchte ja keiner zu wissen.
Am Rednerpult klopfte er lieber noch mal gegen das Mikrofon, was sofortiges allgemeines Gelächter auslöste. Schleycher konzentrierte sich. Der Boden war bereitet, nun konnte er mit dem Säen beginnen. Das biblische Bild gefiel ihm gut, und mit ihm kehrten die Ruhe und das Selbstbewusstsein wieder in ihn zurück.
»Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen der Fraktion. Ich hoffe, dass mit Gottes Hilfe diese Rede ohne Energieausfälle gehalten werden kann.« Wieder Lacher. Die Fraktion war wirklich ein Kindergarten. »Ich möchte deswegen auch ohne weitere Umschweife mit dem Kern und wichtigsten Punkt meiner Legislaturperiode beginnen. Wie ich gestern schon kurz erwähnte, ist es oft nicht möglich, in der Politik allen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden und ihre Wünsche zu befriedigen.«
An der rückwärtigen Seite des Saals hatte sich die Tür geöffnet, und die Staatssekretärin aus dem Umweltministerium huschte herein. So unauffällig wie möglich drückte sie sich an der Seite der aufgestellten Stuhlreihen vorbei. Schleycher bemerkte, dass sie ziemlich blass aussah. Trotzdem fuhr er unbeirrt fort: »Deswegen, liebe Freunde, werde ich heute etwas vorstellen, das …«