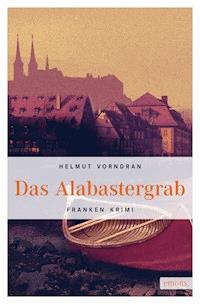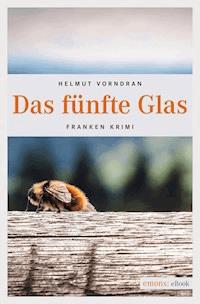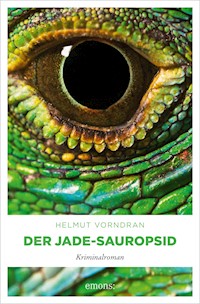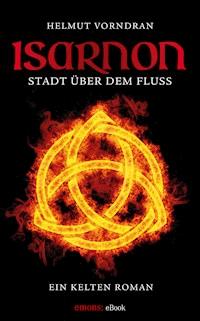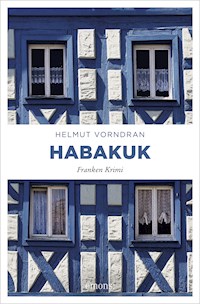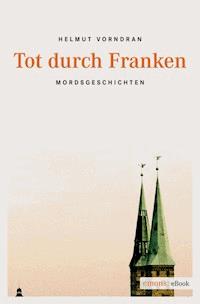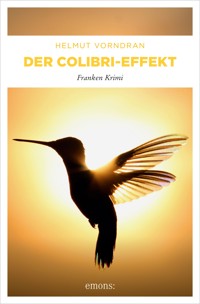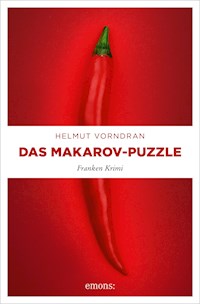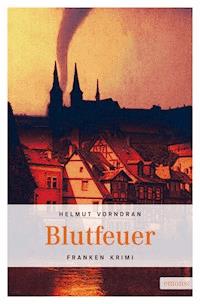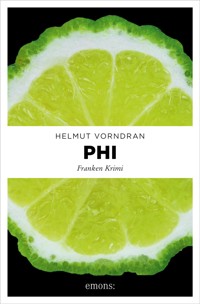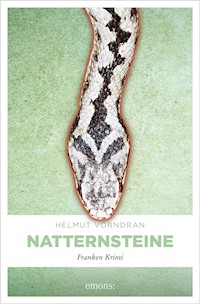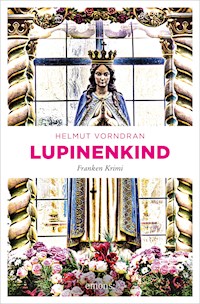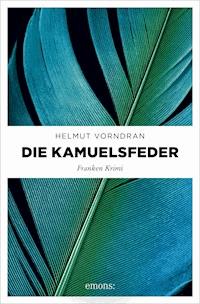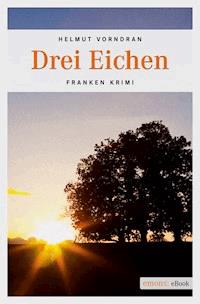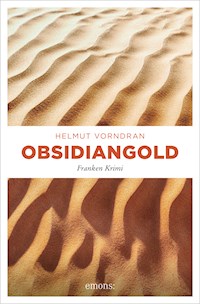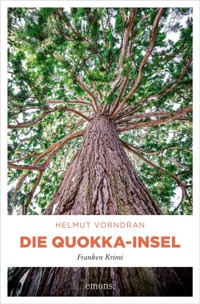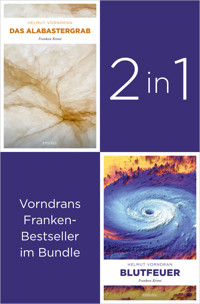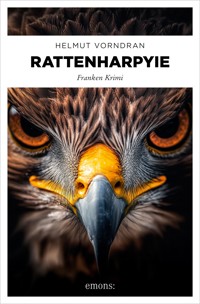
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Haderlein
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Helmut Vorndran präsentiert einen neuen, abgründig bösen Franken-Krimi voller unerwarteter Wendungen. Ein Mann überrascht in seiner Wohnung eine Einbrecherin und wird von ihr erschossen. Kurz darauf stirbt in einem Altersheim der Großvater des Opfers, auch er kaltblütig ermordet. Doch welche Feinde kann ein Hundertjähriger haben? Von der Täterin fehlt jede Spur, die wenigen Hinweise führen ins Nirgendwo. Lagerfeld, Kira, Haderlein und Ermittlerferkel Presssack stehen vor einem Rätsel, das nur durch eine Reise weit in die Vergangenheit gelöst werden kann. In »Rattenharpyie« entführt Helmut Vorndran, der Meister des Frankenkrimis, seine Leser in die dunklen Abgründe der deutschen Nachkriegszeit. Basierend auf wahren Begebenheiten, verknüpft dieser Roman ein lange zurückliegendes Verbrechen mit einem aktuellen Mordfall und schickt das Ermittlerteam aus Bamberg auf eine gefährliche Spurensuche. Skurrile Charaktere, bissiger Humor und messerscharfer Spürsinn prägen diesen außergewöhnlichen Kriminalroman, der von Oberfranken bis in die Schweiz und nach England führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt im oberfränkischen Bamberger Land und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman, basierend auf realen Geschehnissen. Handlungen und Namen sind frei erfunden, mit Ausnahme von einigen bezeugten oder belegten Personen der Zeitgeschichte aus dem April 1945. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Gestaltung Innenteil: DÜDE Satz und Grafik, Odenthal
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: XXX
ISBN 978-3-98707-323-6
Franken Krimi
Originalausgabe
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Harpyie
In der griechischen Mythologie ist die Harpyie eine Sagengestalt, ein Mischwesen. Lateinisch Harpeia, hat sie den Kopf einer Frau und den Körper eines Vogels.
Harpyien verkörpern die Sturmwinde, sie sind so schnell wie der Wind und unverwundbar. Die Töchter des Meerestitanen Thauma und der Okeanide Elektra werden in manchen Erzählungen als schöne Frauen mit gelocktem Haar, oft aber auch als hässliche, hellhaarige Dämonen dargestellt.
Ursprünglich majestätisch, großartig, wurden sie in der Mythologie im Laufe der Jahrhunderte zu Dämonen und sollen viel Unheil in der Welt angerichtet haben. Man kann die Harpyien auch als den Tod ansehen – erhaben, tröstlich und letztlich der Höhepunkt des Lebens, aber auch beängstigend. Etwas, das wir bekämpfen wollen, aber langfristig nicht bekämpfen können. Die Harpyien zeigen uns unerbittlich, dass wir mit dem Tod leben müssen.
Flugzeuggedanken
Dort unten ist die Erde mein
Mit Bauten und Feldern des Fleißes.
Wenn ich einmal werde nicht mehr sein,
Dann graben sie mich dort unten hinein,
Ich weiß es.
Dort unten ist viel Mühe und Not
Und wenig wahre Liebe. –
Nun stelle ich mir sekundenlang
Vor, dass ich oben hier bliebe,
Ewig, und lebte und wäre doch tot –
Oh, macht mich der Gedanke bang.
Mein Herz und mein Gewissen schlägt
Lauter als der Propeller.
Du Flugzeug, das so schnell mich trägt,
Flieg schneller!
Joachim Ringelnatz (1883–1934)
Teil 1
Der Brief
Das Päckchen
Melissa Stafford hatte ihre Aktentasche auf den Tisch gelegt und sich erst einmal einen Kaffee gemacht. Es war ein anstrengender Tag gewesen. Draußen waren eindeutige Vorboten des Winters zu erkennen. Es schneite zwar noch nicht, aber von Kanada her drückte die erste Kaltfront nach Süden, sodass die Temperaturen in Sugar Grove bald auch tagsüber in den Dauerfrostbereich rutschen würden. Die kleine Stadt im Kane County im Nordosten des US-amerikanischen Bundesstaates Illinois hatte knapp zehntausend Einwohner. Die orientierten sich aber allesamt am nahe gelegenen Chicago, welches das Leben ringsherum bestimmte. Die »Windy City«, wie Chicago gerne genannt wurde, war auch der Ort, an dem sie arbeitete und im Grunde ihr ganzes Leben verbracht hatte. Sugar Grove war eigentlich immer nur zum Wohnen da gewesen, ihr Leben spielte sich in Chicago ab.
Melissa Stafford lebte nun schon seit über einem Jahr wieder in dem Haus, in dem sie geboren wurde und in dem ihre verkorksten Eltern sie in dieser verkorksten Familie aufgezogen hatten. Wenn sie sah, wie friedlich und harmonisch es in manch anderen Familien in ihrem Freundeskreis zuging, hätte sie schon des Öfteren einfach nur heulen können. Aber sie wollte ihren Eltern keinen Vorwurf machen, denn erstens waren beide schon tot, und zweitens konnte beispielsweise ihr Vater ja nichts für seine eigene durchgeknallte Mutter, eine griesgrämige Kriegswitwe, die aus lauter Verbitterung über den frühen Tod ihres Mannes ihrem Sohn das Leben schwer gemacht hatte. Ihre »Erziehung« hatte bei Melissa Staffords Vater tiefe Spuren hinterlassen. Das wirkte sich sowohl auf seine Ehe als auch auf seine Tochter aus. Melissa hatte ihre Großmutter immer gehasst. Wie konnte ein einziger Mensch nur so böse und niederträchtig sein? Wenn sie als Kind Märchenbücher las, musste sie bei den darin vorkommenden Hexen immer sofort an ihre Oma denken, die hätte diese Rolle wunderbar ausgefüllt. Nein, ihre Großmutter hatte sie in keiner guten Erinnerung, und so war die Trauer bei ihrem Tod auch nur sehr begrenzt ausgefallen.
Erst mit vierzig hatte ihr Vater geheiratet, äußerst spät für die damalige Zeit. Vielleicht war es für ihren Vater überhaupt die letzte Chance gewesen, sich in einer Beziehung zu binden. Und genau das hatte er womöglich für den Rest seines Lebens bereut – genauso wie seine Frau, Melissas Mutter. Depressionen, Wutanfälle, Alkoholismus, Tablettenmissbrauch und den ganzen Tag Geschrei im Haus. Das volle Programm einer zutiefst zerrütteten Ehe. Das alles hatte sie als kleines Mädchen abbekommen, und zwar nicht zu knapp, bis zum endgültigen großen Schweigen ihrer Eltern.
Nach dem Verkehrsunfall, den ihr Vater in betrunkenem Zustand verursacht hatte, war es kurzzeitig besser geworden, nicht für sie, aber ihre Eltern, insbesondere der Vater, hatten zumindest eine Zeit lang eingesehen, was sein Lebenswandel, ausgelöst von seinen psychischen Untiefen, bewirkte. Fast zwei Jahre lang hatte das kollektive Schuldgefühl der gemeinsamen Tochter gegenüber, die nun für den Rest ihres Lebens mit einer radikalen körperlichen Einschränkung leben musste, zu einem halbwegs friedlichen Miteinander geführt. So verrückt es sich für Außenstehende vielleicht anhörte, Melissa hatte diese Zeit trotz ihrer Querschnittslähmung genossen, sie badete regelrecht in der plötzlichen, vorher nie zu spürenden Harmonie in der Familie, inständig hoffend, dass dieser Zustand, diese für sie fast idyllischen Verhältnisse, nach denen sie sich ihre ganze Kindheit lang gesehnt hatte, anhalten würde. Aber dann, allmählich und schleichend, ergriffen die Dämonen ihres Vaters wieder Besitz von ihm, und alles war so wie zuvor. Die schwarze, dunkle Stimmung kehrte zurück. Zusammen mit ihrem Rollstuhl bestimmte sie nun Melissas weiteres Leben.
Endlich volljährig, war sie mit knapp zweiundzwanzig Jahren nach Chicago geflohen, um dem depressiven Vater und der alkoholabhängigen Mutter zu entkommen. Jetzt, da sie nach dem frühen Tod ihrer Eltern und ihrer eigenen Scheidung in dieses Haus zurückgekehrt war, verstand sie vieles besser und hätte ihren Eltern, vor allem ihrem Vater, so gerne in seiner seelischen Not geholfen. Aber dafür war es nun zu spät. Vielleicht war der Beruf, den sie ergriffen hatte, eine logische Konsequenz dieses Desasters ihrer Jugend. Das Psychologiestudium hatte ihr neutrale Blickwinkel eröffnet und rationale Erklärungen angeboten. Gegen die innere Wut über ihre verhunzte Kindheit hatte nur der Leistungssport helfen können. Mit Letzterem war es aber auch schon lange vorbei, obwohl sie noch immer fünfmal die Woche in der Basketballhalle mit ihren ehemaligen Teamkolleginnen trainierte, um sich fit zu halten. Der Behindertensport dämpfte ihre innere Zerrissenheit, die sie das ganze Leben begleitet hatte, zumindest ein wenig.
Sie stellte die dampfende Kaffeetasse zur Seite und rollte durch die Tür hinaus, die flache Rampe hinunter und den Weg entlang bis zum Briefkasten an der Einfahrt. Ein paar Briefe waren dabei und ein kleines Päckchen, mehr nicht. Sie nahm die Post und beeilte sich, wieder ins Haus zurückzukommen. Es schien zwar die Sonne, und die Umgebung wirkte immer noch ein wenig spätsommerlich, aber das änderte nichts an den niedrigen Außentemperaturen. Sorgsam schloss sie die Tür hinter sich und nahm sich vor, heute auf jeden Fall noch die Heizung anzuwerfen, bevor sie noch frierend vor dem Fernseher sitzen musste.
Während sie ihren Kaffee trank, sah sie die Post durch. Die Briefe waren allesamt nur Werbung, mit Ausnahme einer Mitteilung ihres Stromversorgers, der wieder einmal die Tarife erhöhen wollte. Sie nahm das kleine Päckchen und studierte den Absender. K.A. Carpenter. Der Name sagte ihr absolut nichts. Sie öffnete das Päckchen, und zum Vorschein kamen ein kleines, ziemlich alt wirkendes Notizbüchlein und ein zusammengefaltetes Stück Papier. Das Büchlein schien in seinem langen Leben schon einiges mitgemacht zu haben, denn der Einband war in einem gotterbärmlichen Zustand. Natürlich war sie neugierig, was es damit auf sich hatte, dennoch entfaltete sie erst einmal das dem Päckchen beigelegte Blatt Papier, das sich als ein an sie gerichteter Brief entpuppte.
Liebe Frau Stafford,
es hat jetzt einige Zeit gedauert, bis ich Sie ausfindig machen konnte. Sie werden mich nicht kennen, jedoch verbindet uns anscheinend eine sehr lange zurückliegende Geschichte. Sie ist in diesem kleinen Notizbuch nachzulesen. Ich habe es im Nachlass meines Großvaters gefunden, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Ich überlasse Ihnen das Notizbuch, weil ich glaube, dass der Inhalt Sie mindestens genauso betrifft, vor allem aber berühren wird wie mich. Wenn sie nach dem Lesen dieser Zeilen das Bedürfnis verspüren, mich zu treffen, damit wir reden können, so melden Sie sich bitte bei mir. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Ich wollte nur, dass sie das wissen.
Mit herzlichem Gruß
Karen Anne Carpenter
12087 Herring Road
Norwood, New York City
Wolfgang Zurbriggens Auslandsreise in die USA hatte länger gedauert als geplant, was aber durchaus erfreuliche Gründe hatte. Die Geschäfte entwickelten sich besser als gedacht, genauer gesagt, es lief blendend. Seitdem vor Jahren der Vinyl-Boom ausgebrochen war, konnte er sich vor Aufträgen eigentlich gar nicht mehr retten. Eine halbe Ewigkeit hatte er sich in seiner fränkischen Heimat mit der Reparatur von Plattenspielern aus den Siebzigern und Achtzigern durchgeschlagen, der absoluten Hochzeit der Dreher, bevor die CD ihnen vorerst den Garaus machte. Dann kam irgendwann nach der Jahrtausendwende die große Renaissance der schwarzen Scheiben, und eine ganze Generation entdeckte die Schallplatte neu, nannte sie nun allerdings »Vinyl«. Musikfreaks, Fans und Sammler begeisterten sich wieder für die gute, alte Schallplatte, und die kam inzwischen längst nicht mehr nur schwarz, sondern auch ziemlich bunt daher. Musiker brachten heute deutlich häufiger als früher neben einer schwarzen Standardausgabe auch limitierte Sonderpressungen in farbigem Vinyl heraus, teils in verschiedenen Farbversionen oder mit speziellen Effekten, was das Angebot noch einmal verbreiterte. Nach Angaben des Bundesverbandes Musikindustrie hatte sich der Umsatz im Vinyl-Segment denn auch seit 2010 praktisch verzehnfacht.
Die Möglichkeiten waren beachtlich. Neben pinken, gelben oder grünen Schallplatten gab es Pressungen mit eingesprengten Farbtupfern, mit auf der Oberfläche eingearbeiteten Abbildungen, mit Graffiti, Goldstaub oder gar mit farbiger Flüssigkeit befüllt. Und für all diese bunten Schätze, dazu nicht zu vergessen die ganzen alten Platten diverser Musikgrößen vergangener Jahre, brauchte man die entsprechenden Abspielgeräte. Entweder kaufte man sich einen der neuen analogen Plattenspieler, wie sie im Angebot diverser bekannter Firmen inzwischen wieder zu finden waren, oder man holte die alten Vintage-Schätzchen von Dual, Denon oder Pioneer aus dem Keller beziehungsweise besorgte sich ein solches Gebrauchtgerät auf einer Onlineplattform. Und egal ob alt oder neu, genau hier kam er mit seiner Firma ins Spiel.
Er kümmerte sich nämlich längst nicht mehr nur um die Reparatur ramponierter Vintage-Geräte aus längst vergangenen Zeiten, die natürlich einen gewissen Charme und nicht selten einen im Vergleich zu heutigen Plattenspielern unerreichten Klang besaßen, sondern verkaufte seinen anspruchsvolleren Kunden einen sündhaft teuren Plattenspieler aus eigener Produktion. Der »Meggen Perpetuum« hatte sich weltweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet und verkaufte sich im Moment besonders gut in den USA. Weshalb Zurbriggens Firma »Meggen Turntables«, benannt nach dem kleinen Ort am Vierwaldstättersee nahe Luzern, gerade zwei edle Läden in den USA eröffnet hatte. Einen in New York und einen in Los Angeles.
Der kleine Wolfgang aus dem oberfränkischen Weißenbrunn vorm Wald, der einst im Keller seines Großvaters an kaputten Plattenspielern geschraubt und getüftelt hatte, war zum weltweit operierenden Unternehmer aufgestiegen, der ein Haus in der Schweiz mit bombastischem Blick auf den Vierwaldstättersee bewohnte. Upcycling war das Zauberwort, ein neuer Trend, der ihm genau im richtigen Moment untergekommen war. Er hatte aus einem alten Scheibendreher einfach einen modernen Plattenspieler im alten Look gemacht. Von Lo-Fi zu Hi-Fi.
Der vollelektrische Macan glitt nahezu lautlos in die Garage, wo er das Gefährt nach dem Aussteigen sogleich an die heimische Wallbox anstöpselte. Er war vom internationalen Flughafen Genf aus geflogen, was hin und zurück schon eine beträchtliche Strecke darstellte. Da war es selbst bei einem hochmodernen Boliden wie diesem besser, den Akku direkt wieder aufzuladen. Anschließend holte er seine Reiseutensilien aus dem Kofferraum, verließ die Garage und wandte sich in Richtung Eingangstür. Sein Blick schweifte dankbar über sein kleines Grundstück, die abfallende Wiese zum See hinunter und die Bäume unten am Ufer, die bereits jetzt, Ende September, die beginnende Herbstfärbung zeigten. Er war gerne erfolgreicher Geschäftsmann und ebenso gerne geschäftlich auf Reisen, er kam aber auch gerne wieder zurück in seine neue Wahlheimat Meggen.
In südlicher Hanglage, eingebettet zwischen der voralpinen Hügellandschaft des Meggerbergs und dem See, bot dieser Ort seinen Bewohnern eine hohe Lebensqualität, selbst nach dem Maßstab der verwöhnten Schweizer Bürger: vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, leistungsstarke Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, eine hervorragende Infrastruktur für den individuellen und öffentlichen Verkehr mit Bahn, Schiff und Bus sowie attraktive Schul-, Kultur- und Freizeitangebote.
Aufgrund der überzeugenden Wohnanreize und einer umsichtigen Finanzpolitik hatte Meggen zudem den niedrigsten Steuersatz im Kanton Luzern, was den Ort für Unternehmer besonders attraktiv machte. Und so war das Völkchen, das sich hier niedergelassen hatte, extrem zufrieden. Es war einfach ruhig und schön hier zwischen den ganzen Millionären. Eine Stimmung, die auch Zurbriggens Grundstück am Ufer des Vierwaldstättersees ausstrahlte.
Der kurze, romantische Moment seiner Heimkunft verstrich, und ihm gingen sogleich wieder Geschäftszahlen, Bestellungen und Pläne für ein neues Plattenspielermodell durch den Kopf. Er steckte seinen Schlüssel in das Schloss der Haustür und erstarrte. Die Tür war nicht etwa abgeschlossen, sondern stand ganze drei Zentimeter offen. Es gab keine Einbruchsspuren, die Tür wirkte angelehnt. War seine Ex-Frau etwa hier gewesen? Lara hatte zwar ihre Eigenheiten, aber das war nun überhaupt nicht ihre Art. Sein Geld brauchte sie nicht, und sie war auch ansonsten immer megakorrekt, wie es ihr Schweizer Naturell eben mit sich brachte. Das war ja in ihrer Ehe das Problem gewesen. Ordentlich bis zum Gehtnichtmehr, aber ein Temperament wie ein toter Fisch. Immerhin hatte ihm die kurze Ehe die Schweizer Staatsbürgerschaft eingebracht. Aber wenn Lara hier gewesen wäre, dann hätte sie ganz sicher die Tür abgeschlossen, das hätte sie niemals vergessen, ganz sicher nicht. Nein, es war offensichtlich jemand in sein Haus eingedrungen. Jemand, der hier absolut nicht hingehörte.
Wolfgang Zurbriggen realisierte mit Schrecken, dass seine Rückkehr aus Übersee nicht so entspannt und reibungslos ablaufen würde, wie er sich das ursprünglich gedacht hatte.
Einhundert Lenze zu erreichen, war im Seniorenheim zwar keine absolute Seltenheit mehr, aber immer noch etwas Besonderes. Vor allem, wenn dieser runde Geburtstag vom mit Abstand prominentesten Bewohner der Einrichtung begangen wurde. Davon zeugten sowohl das äußere Erscheinungsbild der anberaumten Festivität in der aufwendig dekorierten Seniorenresidenz als auch die auserlesenen Honoratioren, die Renatus an diesem seinem Ehrentag ihre Aufwartung machten. Von Bürgermeister und Landrat über wichtige Landtagsabgeordnete bis hin zum stellvertretenden fränkischen Ministerpräsidenten waren sie alle gekommen, um dem Jubilar zu gratulieren. Wobei Renatus selbst bestimmt hatte, wer ihn besuchen sollte und wer nicht. Er hatte die Einladungen persönlich geschrieben und verschickt, schließlich wussten außerhalb dieser ehrwürdigen Mauern nur die wenigsten, dass er dieses Schloss als seinen Altersruhesitz auserkoren hatte.
Der ehemalige Anwalt hatte sich von seiner einstigen Klientel völlig zurückgezogen und beinahe komplett von der Außenwelt abgeschottet. Fast hätte man meinen können, der alte Mann wolle mit niemandem mehr in Kontakt treten. Doch dem war nicht so, wie sowohl die Zahl der Einladungen als auch der Gratulanten erkennen ließ. Renatus war ja nicht irgendwer gewesen, also bekam der Mann keinen Besuch, sondern hielt Hof, getreu dem Motto barocker Vorbilder: »Das Heim bin ich.«
Nach diesem Vorbild hatte er die Seniorenresidenz, in der er seinen Lebensabend verbringen wollte, ausgesucht. Und Schloss Gleusdorf, der Altersruhesitz für den großen Geldbeutel, war dafür quasi wie gemacht. Feudal, sicher und abgeschieden.
Erstmals 1151 urkundlich erwähnt, gehörte Schloss Gleusdorf im Hochmittelalter dem Kloster Banz, einer ehemaligen Benediktinerabtei nördlich von Bamberg, und wurde als Lehen an klösterliche Gefolgsleute vergeben. Das Adelsgeschlecht derer von Fulbach, dem die Verwaltung der ausgedehnten Güter des Klosters Banz im unteren Itzgrund im 14. Jahrhundert übertragen wurde, residierte hier, bis die Linie im 16. Jahrhundert ausstarb und Schloss Gleusdorf an das Kloster Banz zurückfiel, woraufhin es in eine Vogtei umgewandelt wurde. Nach der Säkularisation war im Schloss für kurze Zeit das Landgericht untergebracht, ehe man es zu Beginn des 19. Jahrhunderts an fortan wechselnde Eigentümer veräußerte. 1990 kam es schließlich zur Umwidmung der Anlage zu einer Seniorenresidenz und zur Nutzung als geschlossenes Pflegeheim.
Da das Schloss zwischen Bamberg, Bad Staffelstein und Coburg inmitten der idyllischen Wiesen des Itzgrundes lag, profitierte die Residenz von einem ziemlich großen Einzugsbereich. Zum Altbestand wurden einige Neubauten hinzufügt, Modernisierungsarbeiten und eine Dachsanierung durchgeführt. Im Jahr 2016 ermittelte dann allerdings die Staatsanwaltschaft gegen die Heimleitung, unter anderem wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Wieder wechselte Schloss Gleusdorf den Besitzer, und der neue Eigentümer wandelte das Anwesen in eine Altersresidenz für gut betuchte Ruheständler um, die sich einen Monatssatz von über siebentausend Euro leisten konnten. Für einen wie Renatus kein Problem, als ehemaliger Star-Anwalt waren solche Beträge für ihn seit jeher Peanuts. Er hatte in seinem bewegten Leben nicht nur viel Reputation, sondern auch einiges an Vermögen angehäuft, was ihm aktuell einen ziemlich angenehmen Lebensabend bescherte. Generös ließ er auch die anderen Bewohner daran teilhaben und konnte daher als nunmehr Hundertjähriger auf eine illustre Fangemeinde innerhalb wie auch außerhalb der Schlossmauern blicken.
Als einer derjenigen von außerhalb machte sich zu eher später Stunde der Landrat des Landkreises Lichtenfels, Konrad Meißner, auf den Weg zum Jubelfest. Das noble Rentnerresort lag zwar im Gemeindegebiet von Untermerzbach und damit nicht mehr in seinem Landkreis, Renatus hatte sich im Laufe seines langen Lebens jedoch so außerordentlich um die Stadt Bad Staffelstein sowie den gesamten Altlandkreis Staffelstein verdient gemacht, dass er als aktueller Landrat, der ja selbst auch ein Jurastudium hinter sich gebracht hatte, nicht umhinkonnte, seinem alten Förderer einen Besuch abzustatten.
Konrad Meißner hatte nicht etwa deswegen mit seinem Besuch gewartet, weil er nicht mit den ganzen anderen Affen aus Landtag, Bürgermeisterstuben oder von der Presse zusammentreffen wollte, nein, wie immer hatte sein vorheriger Termin viel länger gedauert als geplant. So war das eben im politischen Geschäft. Lieber einmal zu viel ins Bierzelt gelächelt als einmal zu wenig. Sonst konnten einem mit dem Vorwurf der Arroganz plötzlich komplette Ortschaften abhandenkommen, so was ging ganz schnell. Also lieber noch ein überflüssiges Bier plus ein sinnloses Gespräch, bevor man noch des Desinteresses an den Problemchen einer Dreiundvierzig-Seelen-Gemeinde bezichtigt wurde.
Mit Renatus wollte er sich heute aber allen Gesetzen der politischen PR zum Trotz tatsächlich nur auf einen kurzen persönlichen Plausch treffen, ohne die üblichen Reden in der Öffentlichkeit schwingen zu müssen, zumal er die politischen Ansichten, die Renatus in letzter Zeit vertrat, nicht mehr teilte. Was wollte man sich mit einem Hundertjährigen noch streiten, sollte er doch seinen Frieden mit der politischen Gegenwart machen. Jedenfalls war so ein politisches Streitgespräch allemal besser nur zu zweit zu führen, insofern erwies sich seine massive Verspätung unter diesem Gesichtspunkt betrachtet als nicht ganz so schlimm.
Die Dämmerung brach bereits herein, als er sich von seinem Fahrer verabschiedete, die Tür zur Seniorenresidenz in Gleusdorf öffnete und sich in den ersten Stock begab, wo sich das Zimmer von Renatus befand. Er kannte den Weg von seinen zahlreichen früheren Besuchen und musste daher niemanden fragen. Anscheinend hatte er die richtige Zeit abgepasst, denn es waren keine Gäste mehr zu sehen, und alle hier schienen schon intensiv mit Aufräumen und Putzen beschäftigt zu sein, weshalb er gänzlich unbehelligt die Treppe nach oben schreiten und wenig später an die Tür des Jubilars klopfen konnte. Wartend rückte er noch kurz die Bierflaschen in der Holztrage zurecht, die er zum »Umtrunk« mitgebracht hatte. Offiziell war Alkohol in diesem Heim verboten, an diese lächerliche und vor allem frankenfeindliche Regel hielt sich aber sowieso keiner, weder angestellt noch wohnend.
Aus dem Zimmer drang Musik, also war Renatus da. Konrad Meißner klopfte ein weiteres Mal, aber noch immer passierte nichts. Weder hörte er ein fröhliches »Herein«, wie man es von dem stets gut aufgelegten Renatus hätte erwarten können, noch zeigte sich das Gesicht eines anderen Besuchers, der gerade im Gehen begriffen war. Hatte Renatus, diese Variante lag natürlich im Bereich des Denkbaren, sich womöglich schon schlafen gelegt? Immerhin war so eine monströse Feierlichkeit für einen Hundertjährigen ja auch anstrengend, und vielleicht hatten ihm die ganze Lobhudelei und das Händeschütteln mehr zugesetzt, als der alte Kämpfer zugeben wollte. Dann hatten ihm Wein und Musik im Zusammenspiel vielleicht den Rest gegeben.
Leicht verunsichert blickte Meißner auf seine Armbanduhr und stellte fest, dass der Zeiger unerbittlich auf zwanzig Uhr vorrückte, es konnte also gut sein, dass Renatus schon den Schlaf des Gerechten schlief. Aber der alte Knochen würde es ihm mit Sicherheit verzeihen, wenn er ihn in seinen Rentnerträumen unterbrach. Man wurde ja schließlich nicht alle Tage hundert.
Noch einmal klopfte der Landrat, dann drückte er entschlossen die Klinke nach unten und schob die Tür ein Stück weit auf. Ihm schlug amerikanische Swingmusik in voller Lautstärke entgegen, allerdings kam sie aus einem gänzlich unbeleuchteten Zimmer.
»Renatus, bist du da?«, rief Konrad Meißner erwartungsfroh in das Dunkel hinein, er bekam jedoch keine Antwort, was ihn dazu veranlasste, die Zimmertür vollständig zu öffnen. Dabei trat er mit seinem linken Fuß in eine etwas klebrige Substanz. In der Dunkelheit war er absolut nicht in der Lage, zu erkennen, um was es sich dabei handelte. Er brauchte Licht. Mit der rechten Hand fuhr er suchend an der Wand neben der Türzarge entlang, bis er schließlich den Lichtschalter fand und, ohne zu zögern, betätigte. Die Deckenleuchte flammte auf und erhellte eine Szenerie, die der Landrat des Landkreises Lichtenfels so schnell nicht mehr vergessen würde.
Die gute Nachricht war schnell erzählt: Renatus war tatsächlich anwesend, nicht eingeschlafen, beim Essen oder etwa ausgestreckt auf einer Liege zum Zwecke des Erhalts einer geburtstäglichen Wellnessmassage. Nein, der Jubilar saß wie erwartet in seinem von ihm über alles geliebten lederbezogenen Schaukelstuhl und schaute seinen Besucher direkt an. Fast wirkte es so, als würde er in großer Ergriffenheit der lauten Musik lauschen, die der Plattenspieler abspielte. Damit war das mit dem positiven Teil der Geschichte aber auch erledigt, denn der Hundertjährige würde mit Sicherheit keinen Tag älter werden, so viel war Konrad Meißner auf Anhieb klar. Wie zur Salzsäule erstarrt stand er da, gefangen von dem grausigen Anblick, während die Trage mit den mitgebrachten Bierflaschen langsam, aber konsequent seiner linken Hand entglitt. Polternd landeten die mitgebrachten Flaschen »Nothelfertrunk« auf dem Fußboden des Zimmers und besudelten die schwarzen Hosen des Landrats mit aufspritzendem Blut, das sich in einer weiten Fläche rings um den Schaukelstuhl ausbreitete, in dem Renatus saß. Wobei »Sitzen« vielleicht eine eher unpassende Bezeichnung für das groteske Bild war, das sich dem Konrad Meißner bot. Der säuberlich abgetrennte Kopf von Renatus weilte nämlich allein auf der Sitzfläche. Vom Körper war in dem blutbesudelten Zimmer nichts zu sehen. In Renatus’ Stirn war das Einschussloch einer Kugel zu erkennen, die am Hinterkopf mit brachialer Gewalt wieder ausgetreten war, bevor man ihn seines Körpers beraubt hatte, denn Teile der hinteren Schädelplatte sowie blutige Fetzen des Gehirns hatten sich über die Rückwand des Zimmers verteilt. Rings um das Einschussloch schien jemand mit scharfer Klinge irgendwelche blutigen Linien in die Haut geschnitten zu haben, was den Anblick des körperlosen Getöteten nicht gerade verschönerte.
Fakt war, Renatus war tot, ermordet an seinem einhundertsten Geburtstag. Ein abruptes, brutales Ende der mutmaßlich sowieso nur mehr kurzen Restlaufzeit des Jubilars. Der Landrat war indes immer noch unfähig, seinen Blick von dem grausigen Anblick zu lösen, als plötzlich, gedämpft von den fröhlichen Klängen einer Bigband, ein gellender Schrei im Zimmer zu hören war. Konrad Meißner fuhr herum und blickte in die panischen Augen einer Altenpflegerin, die voller Entsetzen die Hände vors Gesicht schlug.
»Rufen Sie die Polizei, sofort«, wies Konrad Meißner, zu neuem Leben erwacht, die Pflegekraft an, dann griff er zu seinem Handy. Er hatte seine Fassung wiedergefunden und zog die ersten, unausweichlichen Konsequenzen: Er informierte seinen Fahrer, der unten im Hof auf ihn wartete. Was auch immer hier geschehen war, sein Aufenthalt in Schloss Gleusdorf würde länger dauern als geplant.
Melissa Stafford war beim Lesen des Briefes ein kalter Schauer den Rücken hinuntergelaufen, obwohl sie sich nicht erklären konnte, warum. Ein ganz seltsames Gefühl erfasste sie wie eine kalte Hand und löste regelrechte Beklemmungen in ihr aus. Das Thema Großvater war in ihrer Familie immer ein ziemlich heikles gewesen. Ihr Opa, der Mann ihrer Großmutter, war nie aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt, und dieser Umstand hatte seine Witwe Holly offenbar so sehr getroffen, dass sie ihre Trauer und Wut über den Tod ihres geliebten Mannes an ihrem einzigen Kind, Melissas Vater Doug, ausgelassen hatte. Vielleicht, weil er ihrem Mann so verdammt ähnlich gesehen hatte. Welchen Grund sie auch gehabt haben mochte, er hatte die Kriegswitwe Holly in ein gefühlskaltes, bösartiges Wesen verwandelt, das den eigenen Sohn zugrunde richtete, genau wie dieser dann letztendlich seine Familie und Beziehung. An den Auswirkungen dieser gestörten Familiengeschichte litt bis heute sie, Melissa, obwohl sie dafür am allerwenigsten konnte.
Und nun dieser Brief. Das kalte Wetter, der Rollstuhl, ihre Heizung, all das, was ihr Leben betraf, war mit einem Schlag vergessen, und sie ahnte, dass die Ursache für das Unglück ihrer Familie womöglich in diesem kleinen Büchlein zu finden war.
Endlich war sie in der Lage, die Kaffeetasse, die sie die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, auf dem Küchentisch abzustellen und sich neu zu sortieren. Eine ganze Weile saß sie einfach nur da und starrte das kleine, ausgefranste Notizbuch an, bevor sie es schließlich in die Hand nahm, die von einem seltsamen, unerklärlichen Zittern befallen war, es mit mulmigem Gefühl aufschlug und den Blick auf die ersten Zeilen des darin Geschriebenen richtete.
Auf der Innenseite des Buchdeckels stand der Name des Eigentümers, und zwar mit Adresse. Ein Umstand, der das Zittern ihrer Hände noch einmal verstärkte.
»Ted E. Hohmann, Sugar Grove, Illinois«.
Dieses Notizbuch hatte also tatsächlich ihrem Großvater gehört, den sie nie kennenlernen durfte. Sie musste einmal kurz durchatmen, dann fasste sie sich und blätterte um. Der erste Eintrag war datiert auf den 5. April 1945 in Sudbury, England. Er war also vor genau achtzig Jahren, kurz vor Kriegsende, verfasst worden. Diese Erkenntnis setzte Melissa Stafford so dermaßen zu, dass sie das Notizbuch noch einmal kurz zur Seite legen musste. Sie versuchte, sich zu beruhigen und das Herz, das ihr bis zum Hals schlug, einigermaßen in den Griff zu bekommen.
Warum, zum Teufel, nahm die Existenz dieses Büchleins sie so mit? Sie wusste ja noch nicht einmal, was drinstand, verdammt noch mal. Sie schnäuzte sich die Nase, dann nahm sie ihre leere Kaffeetasse, rollte zum Wohnzimmerschrank und holte mit fahrigen Bewegungen eine Flasche Bourbon heraus. Der Whiskey stand locker schon fünfzehn Jahre ungeöffnet im Schrank, er war ein Geschenk gewesen, das sie nie angefasst hatte. Dem Alkohol hatte sie seit ihren Erlebnissen in der eigenen Familie prinzipiell abgeschworen, aber jetzt war der Moment gekommen, dieses so lange verfolgte Prinzip aufzugeben. Sie wusste zwar aus leidiger Erfahrung, dass jegliches Desaster mit dem ersten kleinen Schluck beginnen konnte, trotzdem war es jetzt so weit. Mit einem leisen Glucksen lief der teure Whiskey in die Kaffeetasse, dann stellte sie den Bourbon wieder zurück auf seinen angestammten Platz in den Schrank. Sie nahm die halb volle Tasse, warf sich einen dicken Poncho von ihrem Winterklamottenständer über und begab sich zurück an den Küchentisch. Draußen wurde es langsam dunkel, weshalb sie die kleine, funzelige Lampe anmachte, die schon seit ewigen Zeiten auf dem Küchentisch stand, dann starrte sie wieder das abgewetzte Notizbuch ihres Großvaters an. Sie nahm einen kräftigen Schluck aus der Tasse, spürte, wie der Bourbon sich wärmend in ihrem Magen ausbreitete, und begann zu lesen.
Der Wind blies, wenn überhaupt, ganz leicht von vorne. Die Frühlingsluft im südenglischen Sudbury zeigte sich heute einmal ausnahmsweise von ihrer sanften Seite. Für die Landung eines so großen Flugzeuges fast ideale Bedingungen. Die Landevolte der B-17 verlief entsprechend problemlos, nahezu bilderbuchmäßig steuerte der Bomberpilot exakt auf die Mitte der Landebahn zu, wo das Flugzeug dann mit einem kurzen Quietschen der dicken Reifen aufsetzte.
»Willkommen zu Hause«, meinte Steve Loreen, Flight Officer und Teds Co-Pilot.
Ted Hohmann lächelte ihn erleichtert an, während er die Maschine am Ende der Landebahn ausrollen ließ und eine leichte Rechtskurve zu ihrem Standplatz einschlug, wo ihre Bodencrew schon mit freudigem Winken auf sie wartete. »Ja, willkommen zu Hause«, murmelte er mehr zu sich selbst. Auch wenn es nicht jeder zeigte, alle an Bord waren froh, wieder sicher auf ihrem Stützpunkt in England gelandet zu sein. Der Anblick der heimischen Landebahn war jedes Mal der Moment, an dem die immense Anspannung von den Soldaten abfiel. Denn eine Rückkehr der Crew, noch dazu vollständig und unverletzt, war nicht selbstverständlich. Zwar gab es im deutschen Luftraum kaum noch einsatzbereite Abfangjäger, geschweige denn Piloten, die sie fliegen konnten, weshalb die Besatzung in den amerikanischen Bombern um einen Bordschützen auf neun Personen reduziert worden war. Die deutsche Flugabwehr mit dem bei den alliierten Bomberpiloten extrem gefürchteten Flakgeschütz »Flugabwehrkanone 8.8« war jedoch noch weitestgehend intakt und ziemlich gut in ihrem Job. Es wurden bei nahezu jedem Einsatz Kameraden von den Deutschen vom Himmel geholt, die in Kriegsgefangenschaft gerieten, sofern sie den Abschuss ihres Bombers überhaupt überlebten, und ihren Heimatflughafen nie wiedersahen. Aber die Besatzung der »Lonesome Polecat«, wie sie ihre B-17 in einer feierlichen Zeremonie liebevoll getauft hatten, »Einsames Stinktier«, hatte Glück; sie hatten bei ihrem zwölften Einsatz nicht die kleinste Schramme abbekommen und durften heute ausgiebig feiern.
Das Gelände der Royal Air Force in Sudbury war erst 1944 eröffnet worden. Man hatte den Standardflugplatz für schwere Bomber der Klasse A mit fünfzig Feststellplätzen und zwei Hangars einfach in eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Freifläche im südwestlichen England hineingebaut, um den Anforderungen der Bomber der 8. Luftflotte der United States Army Air Forces gerecht zu werden. Er hatte ein leichtes Gefälle nach Nordosten sowie drei sich kreuzende Betonpisten. Der Großteil der provisorisch errichteten Gebäude zur Unterbringung der rund dreitausend Soldaten des Stützpunktes lag entlang der Dorfstraße von Great Waldingfield östlich des Flugplatzes und war über die Straße von Sudbury nach Lavenham erreichbar, auf der man bis nach Colchester oder Cambridge weiterfahren konnte.
Die Besatzungen der 486. Bombardment Group, der auch Ted Hohmann und seine Crew angehörten, flogen sowohl die Consolidated B-24 Liberator als auch zunehmend die neue Flugzeugklasse Boeing B-17 Flying Fortress. Die Bombenkampagne der Gruppe richtete sich dabei hauptsächlich gegen strategische Ziele in Deutschland.
Ted Hohmann und seine Crew waren erst seit Anfang des Jahres hier stationiert, mussten in dieser Zeit aber schon einige Einsätze überstehen. Niemand verstand, warum die Deutschen immer noch kämpften, es war offensichtlich, dass sie den Krieg nicht mehr gewinnen konnten. Aber diese Nazis waren ein zähes Pack, wahrscheinlich mussten sie jeden einzelnen finden und persönlich totschlagen, bevor sie ihre Zelte hier abbrechen konnten, hatte Dan Robbins, einer der Bordschützen in Hohmanns Crew, neulich einmal zynisch geäußert. Aber das war nun einmal nicht ihr Job. Ihr Job war es, mit ihren Bomben die Infrastruktur in Deutschland, also Straßen, Bahnstrecken und Industrieanlagen, so umfassend zu zerstören, dass die Jungs unten am Boden mit möglichst wenig Verlusten vorrücken und weiter feindliches Gebiet erobern konnten. Im Gegensatz zu den Engländern, die unter ihrem Oberkommandierenden Harris ihre Einsätze nur noch nachts flogen und sich auf die Bombardierung ganzer Städte und deren Zivilbevölkerung verlegt hatten, sollten die amerikanischen Piloten ausschließlich kriegswichtige Ziele treffen und dabei keine Zivilisten töten.
Für Ted Hohmann waren diese Einsätze mit seiner B-17 G – dem allerneuesten Modell, welches zurzeit produziert wurde, und somit dem Besten, was die US Air Force in diesem Krieg am Himmel über Deutschland aufbieten konnte – so manches Mal von einem merkwürdigen Gefühl begleitet, da er väterlicherseits selbst deutsche Wurzeln hatte. Sein Großvater war im 19. Jahrhundert aus Nordbayern in die USA ausgewandert. Es war also nicht ausgeschlossen, dass er dort drüben in Deutschland einen entfernten Verwandten bombardierte. Aber er hatte sich das schließlich nicht ausgesucht, die Nazis hatten damit angefangen.
In der Bamberger Polizeidienststelle verstummten allmählich die angeregten Gespräche, und die gespannten, aufmerksamen Blicke der Mitarbeitenden richteten sich auf ihren Chef, Robert Suckfüll, der nach eigener Aussage etwas sehr Wichtiges bekannt zu geben hatte. Das war bei Fidibus nichts Ungewöhnliches, aus seiner Sicht war so ziemlich jede Mitteilung, die er zu machen hatte, von beeindruckender Einzigartigkeit, weshalb die Bamberger Kriminalisten derartigen Ankündigungen grundsätzlich mit Gelassenheit gegenüberstanden. Sollte als Gegenstand der heutigen Einberufung bloß wieder die sensationelle Bekanntgabe der Genehmigung bedruckten Klopapiers auf der Agenda stehen, würde das kaum einen der Anwesenden überraschen. Und so standen die Bamberger Kriminalisten inklusive einer Kriminalistin plus Chefsekretärin Honigbrote kauend vor ihrem Chef, der sich die süße Köstlichkeit, die wie immer von Marina Hoffmann alias »Honeypenny« geschmiert worden war, ausnahmsweise als einziger verkniffen hatte, und erwarteten schweigend dessen Ansprache. Lediglich das kleine Ermittlerferkel namens »Presssack«, das heute ebenfalls Dienst hatte, machte sich mit lautem Schmatzen bemerkbar. Nicht dass es irgendjemanden von den anwesenden Kommissaren gestört hätte. Ein schmatzendes Schwein gehörte bei der Bamberger Kripo ja mittlerweile zum akustischen Inventar.
Einzig Robert Suckfüll sah mit einem missbilligenden Stirnrunzeln zu seinem schweinischen Angestellten hinunter, der sich durch die optische Rüge seines Chefs aber nicht von seiner Honigbrotvernichtung abhalten ließ. Fidibus erkannte die Sinnlosigkeit seiner blicklichen Missbilligung denn auch sofort, hob mahnend seinen Finger, um die Bedeutung der nun folgenden Botschaft zu unterstreichen, und konzentrierte sich auf den Text seiner akribisch vorbereiteten Ansprache, die er jetzt an seine Untergebenen zu richten gedachte. Ein kurzes Atemholen, dann legte er voller Elan los.
»Meine lieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie Sie alle wissen, hat es ja im Frühjahr einen Wechsel an der Spitze unseres deutschen Landes gegeben. Eine neue Kollaboration mit einem Regierungsvorstand, der gänzlich verändert wirkt. Eine Auswechslung, welche einhergeht mit direkten Konsequenzen für unser geliebtes fränkisches buntes Land … äh, Bundesland meine ich natürlich.« Er hielt kurz inne und schien gedanklich ein paar Satzbausteine hin und her zu schieben, um sie dann neu geordnet zu präsentieren. »Nun, also Franken, unser Land, ist natürlich tatsächlich bunt, das hat aber für die Politik keine direkte Relevanz, für uns, also die arbeitende Basis von Recht und Gesetz, natürlich schon, in der Tat, da ja erstaunliche Beschlüsse beschlossen worden sind, die für unsere Dienststelle der Kriminalpolizei hier in … also hier … mobile Konsequenzen haben. Ähem, so hängt unser buntes Bundesland Franken also völlig unerwartet an der finanziellen Zitze der bunten Förderpolitik … äh, Bundespolitik, die ja nun wie schon gesagt eine neue Zitzenspitze aufweist, an der sich der fränkische Welpe der Exekutive … nun, äh, laben darf.«
Mit einem nicht unerheblichen inneren Seufzer beendete Robert Suckfüll seine einleitenden Worte, während die versammelten Kommissare dem Geschwurbel nachspürten, um den in seltsamer Grammatik verwinkelt versteckten Sinn des Gesagten zu ergründen. Selbst Presssack hatte seinen Honigbrotschmaus unterbrochen und blickte, den Kopf leicht schiefgelegt, zu seinem Dienststellenleiter hoch, da dieser Prolog selbst nach schweinischen Maßstäben semantisch völlig ungenießbar war. Immerhin führte die Verwirrung des tierischen Angestellten zu endgültiger Geräuschlosigkeit im versammelten Auditorium, was Fidibus mit großer Befriedigung zur Kenntnis nahm. Seine in langer Detailarbeit ersonnenen Formulierungen schienen tatsächlich die gewünschten Früchte zu tragen, weshalb er umgehend mit seiner Rede fortfuhr.
»Nun, im Zuge des neuen Wirbelwindes aus Berlin, der außerdem durch diesen amerikanischen Präsidenten noch bunterer Herkunft angefacht … geworden … sollte … ähem, ist es nun der Bundeslade Franken vergönnt, die zusätzlichen finanziellen Verschüttungen des Kandesbunzlers zur Kurbelung der deutschen Autobauer direkt zu unterstützen.« Das war jetzt ein sehr anstrengender Satz gewesen, weshalb sich Robert Suckfüll kurz mit seinem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn wischte.
Mit frischem Eifer hob er sodann aufs Neue an, seine Botschaft an Mann, Frau und Ferkel zu bringen. »Kurz und gut, was ich damit sagen will, ist, dass unser Fuhrpark der Bamberger Polizei jetzt, im Herbst unseres jährlichen Daseins, ab sofort auf Elektrikautos umgestellt wird. Die fränkische Regierung hat uns hier zwei nagelneue Elektrikautos der Firma Volkswagen zur Verfügung … die von unseren Führern in Berlin, also, ähm, umsonst gefördert hingestellt werden, um den Umsatz und den Verkauf dieser Vehikel zu, also … Sie wissen schon. Das Innenministerium hat mich, also uns, mich und Sie, darum gebeten, in der Dienstausfahrt vorrangig diese beiden Elektrikautos zu benutzen. Wir sind ja als Staatspolizei gewissermaßen, wie soll ich mich da ausdrücken, na … ich bin aber heute auch wieder ein verstreuter Professor … Vorbilder sind wir, genau, jawoll. Das hat also für die Landesregierung einen hohen Stellungswert, weshalb ich Sie, meine lieben Mitarbeiter, bitte, im Dienst, wann immer es geht, diese Elektrikautos zu benutzen und in Zukunft auf private Mobile zu verzichten. Es wird also nicht mehr getankt, sondern befüllt … mit Strom in die Batterie. Ich selbst habe das noch nie gemacht, für mich ist so ein Elektrikmobil nicht gerade die Welterfüllung, aber Sie, meine jungen Mitarbeiter, werden sich mit diesem neuartigen …« Fidibus fuchtelte einen Moment lang hilflos mit beiden Händen in der Luft herum, »Dings, also, Technik schon anfreunden können. Bitte enttäuschen Sie mich nicht, die deutsche Industrie braucht unsere Unterstützung, wir stehen bei diesem Trump in Amerika sowieso schon auf der Abschussrampe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.« Der Leiter der Bamberger Dienststelle schnaufte tief durch, dann sackte er ein wenig in sich zusammen und legte zwei Autoschlüssel plus dazugehörende Ladekarten auf den am nächsten stehenden Schreibtisch und wollte sich eben zum Gehen wenden, als Kommissar Bernd Schmitt, der zwischenzeitlich das Honigbrotkauen wieder aufgenommen hatte, seinen Finger hob, um mit vollem Mund eine Frage zu stellen.
»Entschuldigung, VW? Wieso kriegen wir denn kein richtiges Auto?«
Der Chef schaute Lagerfeld regungslos an, und der schaute kauend zurück. Man konnte den Rädchen und Schaltern in Suckfülls Gehirn förmlich bei ihrer Arbeit zusehen. Diese mechanischen Vorgänge führten aber offenbar zu keinem befriedigenden Ergebnis, denn Fidibus beschloss, den Einwurf seines Mitarbeiters, der sich mit seinen unorthodoxen Wortbeiträgen längst einen gewissen Ruf in der Dienststelle erarbeitet hatte, zu ignorieren. »Das war’s, ich wünsche einen frohen und entspannten Arbeitsvollzug«, beendete er seine Ansprache, drehte sich quasi auf der Hacke um und stolzierte hocherhobenen Hauptes zurück in sein gläsernes Büro. Dort wollte er sich nach dieser anstrengenden verbalen Dienstanweisung erst einmal eine gepflegte Rollzigarre gönnen.
Die leicht irritiert dreinschauende Belegschaft der Bamberger Kriminalpolizei ergab sich in ein kurzes, bedeutungsvolles Schweigen, bis Fidibus seine Bürotür hinter sich geschlossen hatte. Dann war jeglicher Diskussion Tür und Tor geöffnet, und es gab haufenweise Klärungsbedarf.
Wolfgang Zurbriggen öffnete vorsichtig die Tür und horchte. Im Haus war es mucksmäuschenstill, kein Laut war zu hören. Langsam schob er die Tür so weit auf, dass er in den Flur hineinsehen konnte. Das Bild, das sich ihm bot, war schockierend, geradezu desaströs. Die kleine, antike Kommode, die er für teures Geld ersteigert hatte, stand zwar noch an Ort und Stelle, die Schubladen aber lagen auf dem gefliesten Boden, und ihr Inhalt, Unterlagen und Schreibpapier, bedeckten große Teile des Flurs. Er blickte prüfend zur Wand, wo sich das Bedienfeld der Alarmanlage befand, aber das Blinken, welches signalisierte, dass sie eingeschaltet war und aktiv ihren Dienst versah, fehlte. Die Alarmanlage war tot. Hier waren keine Anfänger am Werk gewesen, die Einbrecher kannten sich aus.
Wolfgang Zurbriggen holte einmal tief Luft, um sich etwas zu beruhigen, dann stellte er seine beiden Koffer resigniert im Flur ab. Es half ja nichts, sich aufzuregen, an der Situation würde es eh nichts ändern. Es waren Einbrecher in seinem Haus gewesen, na und? Wahrscheinlich hatten sie es auf seine Plattenspielersammlung abgesehen und die teuren Stücke mitgenommen. Der Wert der Dreher erreichte zwar nicht ganz den des entwendeten Geschmeides aus dem Grünen Gewölbe in Dresden, aber es kamen schon ein paar tausend Euro zusammen. Ihn schmerzte auch gar nicht das Scheiß-Geld, sondern der Umstand, dass ein paar von den Dingern besondere Einzelstücke gewesen waren, die er nie mehr bekommen konnte. Das waren ideelle Verluste, die der Liebhaberseele wehtaten. Geld konnte man ersetzen, einen Dereneville VPM nicht. Die Lippstädter High-End-Manufaktur in Deutschland war bekannt für ihre edlen Hi-Fi-Komponenten, darunter außergewöhnlich leise Laufwerke und meisterhaft konstruierte Antriebe. Als Synthese und Höhepunkt ihres gesamten fachlichen Könnens kündigte die Firma schon vor vielen Jahren den Dereneville VPM-2010 an. Es fanden sich auch schnell Kaufinteressierte, trotz eines vorläufig aufgerufenen Preises von mehreren hunderttausend Euro.
Diese exklusive Klangmaschine, die, obwohl nur eine Studie und noch nicht ein einziges Mal ausgeliefert, seither den Titel »teuerster Plattenspieler der Welt« trug, hatte sich selbst Wolfgang Zurbriggen nicht leisten können, aber sein Dereneville hatte immerhin auch schlappe neunzigtausend Schweizer Franken gekostet. Den musste er jetzt wohl abschreiben.
Deprimiert machte er sich auf den Weg ins Wohnzimmer und war innerlich auf das Schlimmste gefasst. Als er den Wohnbereich betrat, stellte er jedoch fest, dass dieser nicht so schlimm in Mitleidenschaft gezogen worden war, wie er dachte. Zwar lagen auch hier ein paar Schubladen und Unterlagen auf dem Boden, aber so viele Dokumente in Papierform hatte er hier gar nicht aufbewahrt. Weitaus mehr überraschte ihn jedoch, dass seine geliebten Plattenspieler alle noch da waren. Die fünf Edelspieler, die er kreisförmig in dem runden Raum platziert hatte, standen alle völlig unversehrt samt den dazugehörenden Stereoanlagen an ihrem Platz. Der Thorens REFERENCE Nr. 026 aus der Schweiz wurde flankiert von einem Linn Klimax Sondek LP12 in Vollausstattung. Einen Technics SL-1000R-Direktantrieb Plattenspieler gab es hier ebenso wie den berühmten Acoustic Signature Hurricane NEO High-End. Selbst der Dereneville thronte ohne jeden Makel auf seinem Sockel aus Granit, so als würde ihn der ganze Aufstand hier im Haus überhaupt nicht tangieren. Und der schwere Drehsessel, in dem er sich in entspannten Momenten seine Platten zuführte, stand ebenfalls noch dort, wo er hingehörte, nämlich genau in der Mitte des Raumes.
Fast ein wenig beleidigt, jedoch auch unendlich erleichtert realisierte Wolfgang Zurbriggen, dass es die Einbrecher mitnichten auf seine Plattenspieler abgesehen hatten. Aber auf was denn dann, was hatten die hier gewollt?
Entschlossen ging er zur Tür an der gegenüberliegenden Wand, die in sein Arbeitszimmer führte. Dort war sein Safe, und auch die Geschäftsunterlagen bewahrte er hier auf. Er stürmte in sein Büro und schaute sich um. Zwar lagen auch hier etliche Unterlagen auf dem Boden, es hätte aber alles in allem schlimmer sein können. Auf den ersten Blick war auch hier nichts entwendet worden, was ihn einerseits beruhigte, andererseits aber auch irritierte. Eine Sache passte außerdem nicht ins Bild. An der Wand hinter seinem Schreibtisch hing sonst eine gerahmte Fotografie, Glas lag zersplittert auf dem Boden, der Rahmen war zerbrochen – aber der Inhalt fehlte. Er lag auch nicht etwa daneben, im Papierkorb oder sonst wo, das Familienfoto war einfach nicht mehr da.
Jetzt verstand er überhaupt nichts mehr. Wer machte sich denn die Mühe, in sein hochgesichertes Haus einzubrechen, nur um dann ein albernes Foto zu klauen? Was sollte der Scheiß? So was hatte rein persönlichen Wert. Der Verlust dieser Fotografie war für ihn besonders bitter, denn sie zeigte ihn als Dreizehnjährigen zusammen mit seinen Eltern und den Großeltern. Es war das letzte Mal gewesen, dass sie zusammen waren, kurz darauf war erst seine Mutter an Krebs gestorben und wenig später sein Vater bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Er wurde dann von seinen Großeltern in Weißenbrunn großgezogen, eigentlich Weißenbrunn vorm Wald, wie die Ortschaft korrekt hieß. In der Kellerwerkstatt seines Opas hatte er schließlich seine Leidenschaft für Plattenspieler entdeckt. Diese Wunderwerke der Technik und deren Reparatur waren jahrelang sein Ein und Alles gewesen. Als Erwachsener hatte er es dadurch zu einem blühenden Gewerbe gebracht.
Sein Großvater war kein schlechter Mensch, aber streng und nicht besonders liebevoll. Er hatte ihn permanent auf die Härten des Lebens vorbereiten wollen. Im Gegensatz dazu war seine Oma Roswitha ein regelrechter Engel gewesen. Sie hatte die Familie zusammengehalten und war ihm ein fürsorglicher Mutterersatz. Gebürtig aus dem nahen Thüringen stammend, hatte sie für sie häufig »Würzfleisch« gekocht. Eine Spezialität aus der DDR, die sie nach ihrer Flucht aus dem Osten weiterhin zubereitete und mit der sie ihren Enkel sehr gerne verwöhnte. Wenn er irgendetwas aus der Zeit in Weißenbrunn vermisste, dann waren es der schwere Duft von Opas Zigarren im Wohnzimmer und das Würzfleisch seiner Oma, das gab es nämlich hier in der Schweiz nicht, nicht einmal auf Bestellung.
Als seine Oma dann starb, war ihm sofort klar gewesen, dass er aus diesem Haus verschwinden musste, denn allein mit seinem Großvater wollte er dort nicht bleiben, das wäre niemals gut gegangen. Wie gesagt, er mochte seinen Opa auf eine gewisse Art, der alte Mann hatte ihn niemals schlecht behandelt und sich immer um ihn gekümmert. Aber ohne die Großmutter gab es niemanden mehr, der zwischen ihnen schlichtete, da war es wirklich besser, wenn er ging. Sein Großvater blieb in Weißenbrunn, während er sein Leben in die Schweiz verlagerte, um seine Firma dort aufzubauen, bis er sich schließlich entschloss, ebenfalls von dort wegzuziehen. Das Haus in Weißenbrunn vorm Wald gab es zwar noch, es stand jetzt aber schon seit Jahren leer, während der Alte dem Sensenmann immer noch zu trotzen wusste. Sobald er das Zeitliche segnete, was in Anbetracht seines hohen Alters nicht mehr allzu lange dauern konnte, würde er das Haus aber verkaufen. Noch konnte er das nicht, das hatte er seinem Großvater versprochen.
Er hob den zerbrochenen Bilderrahmen kurz vom Boden auf, betrachtete ihn ratlos, legte ihn dann aber wieder zurück. In einer Mischung aus Ärger und Ratlosigkeit ging er nachdenklich zurück ins Wohnzimmer, wo erneut eine Überraschung auf ihn wartete, dieses Mal jedoch eine äußerst unangenehme. In seinem heiß geliebten Drehsessel saß eine ganz in Schwarz gekleidete Frau und lächelte ihn an. Dabei richtete sie allerdings eine Art Rohr mit aufgeschraubtem Schalldämpfer direkt auf ihn. Das Teil sah zwar echt, aber mindestens so futuristisch aus wie manch einer seiner Plattenspieler. Wolfgang Zurbriggen hob vor Schreck beide Hände, während die Frau ihm mit ihrer freien Hand einen kleinen Schreibblock entgegenstreckte, in dessen Ringbindung ein kleiner Stift klemmte.
»Lesen«, befahl sie mit drohender Stimme, und der geschockte Hausbesitzer tat umgehend wie ihm geheißen. Er nahm den ihm gereichten Schreibblock mit zitternden Händen entgegen und richtete seinen Blick auf die knappe Botschaft, die groß und deutlich darauf geschrieben stand.
Krupp – Adresse, aufschreiben
Wolfgang Zurbriggen verstand die Welt nicht mehr. Was zur Hölle war denn das jetzt wieder? Diese Frau brach in sein Haus ein, klaute ein Familienfoto und richtete eine Waffe auf ihn, nur um an eine Adresse zu kommen? Krupp? Wer sollte das denn sein? Er hatte den Namen noch nie im Leben gehört, außer natürlich im Zusammenhang mit der bekannten Stahlfirma Thyssenkrupp in Deutschland. Aber mit der hatte er überhaupt nichts zu tun. Wie verrückt war denn das? Hier musste ein riesiger Irrtum vorliegen. Hatte vielleicht irgendjemand ein Problem mit einem Geschäft bezüglich seiner Plattenspieler? Aber das gab ja wohl niemandem das Recht, hierher in die Schweiz, in sein Haus zu kommen, um die Herausgabe einer Adresse von ihm zu verlangen, die er überhaupt nicht kannte. Dieses Spiel würde er ganz bestimmt nicht mitspielen. Sein erster Schreck war verflogen, sein Standing als erfolgreicher Geschäftsmann, der sich nicht übers Ohr hauen ließ, feierte dagegen fröhliche Urständ.
»Was soll der Scheiß? Ich werde das nicht tun. Ich rufe die Polizei, wenn Sie nicht sofort von hier verschwinden, Sie haben schon genug Unheil angerichtet. Also, wer auch immer Sie sind, gehen Sie, sofort!«
Die unbekannte Frau blieb mit unbewegtem Gesicht in seinem Sessel sitzen und schaute ihn leicht spöttisch an.
»Aufschreiben«, wiederholte sie ruhig und vollkommen emotionslos, während sie ihre Waffe weiterhin zielgenau auf Wolfgang Zurbriggens Kopf gerichtet hielt. Aber der dachte überhaupt nicht daran, klein beizugeben. Mit einer entschlossenen Geste warf er den kleinen Schreibblock auf den teuren Teppich des Wohnzimmerbodens, den er extra zur Verbesserung der Raumakustik hatte verlegen lassen, und stellte sich mit verschränkten Armen trotzig in Positur.
»Nein«, entgegnete er fest und blickte der Einbrecherin geradewegs in die Augen. Die zeigte zuerst keinerlei Reaktion, nur der spöttische Zug um ihren Mund intensivierte sich. Dann ruckte der Lauf ihrer Waffe leicht zur Seite, und das leise »Plopp« einer schallgedämpften Handfeuerwaffe war in Wolfgang Zurbriggens Wohnzimmer zu hören.
Die fränkische Landesregierung hatte der Kriminalpolizei in Bamberg tatsächlich einen nagelneuen ID-3 sowie einen ID-Buzz, den elektrischen Kleinbus der Firma Volkswagen, auf den Hof gestellt. Da die neue Kommissarin Kira Sünkel einen elektrischen Fiat 500 ihr Eigen nannte, hatte sich Franz Haderlein seine dienstjüngste Kollegin sofort nach Fidibus’ Ankündigung geschnappt, um mit ihr während einer kleinen abendlichen Dienstfahrt das Terrain der Elektromobilität etwas näher zu erkunden. Wenn er ehrlich war, hatte er zwar schon viel darüber gehört, aber wie so eine Fahrt genau ablief und was es eigentlich bedeutete, mit einem E-Auto unterwegs zu sein, das wollte er sich doch lieber von einer kompetenten Person zeigen und erklären lassen, was wirklich nicht lange gedauert hatte. Letztendlich war das Fahren mit einem E-Auto einfacher, bequemer und vor allem viel leiser als mit einem Verbrenner. Kurz gesagt, komfortabler. Zusätzlich hatte die radikale Beschleunigung, wenn man das Gaspedal durchdrückte, einen nicht unerheblichen Fun-Faktor. Jetzt aber hatte sich die Batterie ordentlich entleert, und der spannende Moment, dieses Fahrzeug an einer Ladesäule aufzuladen, war gekommen. Auf Anweisung seiner Beifahrerin lenkte Franz Haderlein den ID-Buzz also an der Autobahnausfahrt in Breitengüßbach zurück auf die Landstraße, bis sie schließlich im dortigen Gewerbepark an einer Tankstelle mit Schnellladesäulen anhielten. Die Kollegin Kira Sünkel kannte inzwischen sämtliche Ladesäulen in und um Bamberg herum, sodass sie nie in Verlegenheit kommen konnte, mit leer gefahrener Energie in der Gegend herumzustehen.
Sie stiegen aus, und Kira Sünkel erläuterte ihrem dienstälteren Kollegen in aller Kürze das eigentlich relativ einfache Prozedere eines Ladevorgangs.
Direkt neben den beiden Bamberger Kommissaren hatte an einer der regulären Tanksäulen ein großer schwarzer Pick-up angehalten. Die besonders grobstolligen Reifen des Gefährts passten stilecht zu der exorbitanten Fahrwerkserhöhung des ohnehin schon nicht wirklich stromlinienförmigen Monsters. Auf der Bordwand der Ladefläche prangte ein etwa handgroßer Aufkleber, der eine kurze, wenn auch martialische Botschaft verkündete:
Fuck you Greta
Der kräftige, gedrungene Fahrer des Gefährts öffnete die Tür und begab sich mit Hilfe zweier extrabreiter Trittbretter aus Edelstahl zum um einiges tiefer liegenden Asphalt des Tankstellenbodens hinab, um sein Colt-Seavers-Gedächtnismobil mit testosterongerechtem Diesel zu befüllen. Die spezialangefertigten Cowboystiefel aus argentinischem Rindsleder zeigten von heißem Stahl eingeprägte Szenen berittener, Zigarette rauchender Kuhhirten, welche Lasso schwingend ebensolchen Nutztieren nachstellten, mutmaßlich um sie zeitnah in amerikanisches Corned Beef umarbeiten zu können. Betont lässig stopfte der Pick-up-Besitzer seinen Tankstutzen in die edelstahlumrahmte Tanköffnung seines schwarzen Vehikels und blickte energisch um sich. Seine von der täglichen Arbeit als Bürokraft in einer großen Spedition gestählte Hand zwang den Dieseltreibstoff unerbittlich in sein künftiges Zuhause, als sein schweifender Blick an dem seltsamen Pärchen hängen blieb, das sich neben ihm mit einer dieser neuen Stromladesäulen abmühte. Sofort verfinsterte sich sein Antlitz, und die mittels Computertastaturen und Bleistiftspitzern austrainierte rechte Hand fasste den Griff der Tankpistole, die für ihn auch eine Art Waffe um die Deutungshoheit im Kampf gegen den Klimawahn darstellte, noch etwas fester.
Mit immer düsterer werdender Grundstimmung betrachtete er das seltsame Gefährt, das wohl eine Art VW-Bus darstellen sollte, mit einem Bulli, wie er ihn kannte, aber wirklich nichts mehr zu tun hatte. Eine kalte Wut über dieses aus seiner Sicht elitäre Fortbewegungsmittel mit offensichtlich zum Scheitern verurteilter Motorentechnologie kochte in ihm hoch. Kurz taxierte er prüfend das Zählwerk der Tanksäule. Es würde noch eine Weile dauern, bis sein extragroßer Tank voll und aufs Neue bereit für einen Verbrauch von siebzehn Litern Diesel pro hundert Meter war. Also stellte er die Tankpistole auf Dauerbetrieb, rückte seinen schwarzen Stetson etwas nach hinten und stapfte so breitbeinig wie angriffslustig zu den beiden Spinnern an der Stromladesäule hinüber.
Kira Sünkel bemerkte den Asphaltcowboy erst, als er unmittelbar neben ihr stand und sie mit spöttischem Blick musterte. Franz Haderlein war er schon früher aufgefallen, doch er sagte erst einmal nichts, sondern wartete schweigend ab, was der Typ von ihnen wollte.
»Howdy, Schätzchen«, eröffnete der Mann seine breit angelegte Belehrungsoffensive und steckte sich lässig eine Zigarette in den Mund.
Kira Sünkel reagierte umgehend und gemäß der adäquaten Schlussfolgerung einer streng logisch orientierten Aspergerin. So schnell konnte der Cowboy nicht schauen, wie ihre Hand nach oben ruckte und ihm den Glimmstängel der Marke »Marlboro« aus dem Mund rupfte. Sie warf die noch nicht angezündete Zigarette auf den Boden und zertrat sie mit ihren Springerstiefeln zu sehr feinen Krümeln. »Wir sind hier auf einer Tankstelle, also keine Zigaretten«, erklärte sie unmissverständlich, verschränkte ihre Arme vor der Brust und schaute den als Cowboy verkleideten Mann in rot kariertem Hemd und mit Westernhut herausfordernd an.
Der war erst einmal kolossal verblüfft, dann wallte erneut die Wut in ihm hoch. Am liebsten hätte er dieser dämlichen Schnecke mit dem Bürstenhaarschnitt eine geschallert, dass es krachte, aber er konnte sich gerade noch zusammenreißen – körperlich, allerdings nicht verbal. »Weißt du was, du grünes Stück, wenn ich rauchen will, dann rauche ich, kapiert? Ich lasse mir von niemandem was vorschreiben.« Er reckte das Kinn nach vorne, griff demonstrativ langsam nach der Zigarettenschachtel in der hinteren Hosentasche seiner extra engen Jeans.
Aber sein weibliches Gegenüber ließ sich davon nicht beeindrucken, sondern antwortete stoisch: »Meinetwegen, trotzdem ist das hier immer noch eine Tankstelle, und da ist Rauchen verboten. Also lass deine Zigaretten, wo sie sind, denn beim nächsten Versuch mach ich Ernst. Dann kannst du dir ein Schild mit der Aufschrift ›Baustelle‹ an deine Finger binden.«
Der Cowboy zuckte zusammen, focht sekundenlang einen unsichtbaren Kampf mit seinem Ego, während er wütend zwischen der Bürstenhaarschnecke und ihrem großen, drahtigen, grimmig dreinblickenden Begleiter hin- und hersah. Schließlich erkannte er das womöglich ungewisse Ende einer körperlichen Auseinandersetzung und beschloss, stattdessen alles, was er an argumentativer Säure aufzubieten hatte, über den beiden auszuschütten. »Ihr wisst schon, dass ihr mit zukünftigem Elektroschrott durch die Gegend fahrt, oder? Diese E-Autos taugen doch einen Scheiß. Weißt du was, Schwester, wenn ich elektrisch fahren will, dann steige ich in einen Autoscooter. Im Übrigen haben E-Auto-Fahrer und Durchfall ja eines gemeinsam, nämlich die Angst, es nicht mehr bis nach Hause zu schaffen, haha. Bei euch E-Auto-Fahrern ist es wie mit den Bananen, niemand mag die grünen, haha. Die einzigen Grünen, denen ich noch über den Weg traue, sind die Ampelmännchen, kapiert, hihihi. Und jetzt mal Spaß beiseite. Spätestens in drei Jahren, wenn deine Batterie kaputt ist, die im Übrigen von kobaltschürfenden Kindern im Kongo zusammengeschraubt wurde, wirst du wieder Verbrenner fahren, Schnecke, das verspreche ich dir. Diese hirnverbrannte Elektroscheiße wird sich niemals durchsetzen, niemals!«
Wutentbrannt hatte sich der Mann vor Kira Sünkel aufgebaut, der erzwungene Nikotinentzug setzte ihm sichtlich zu. Franz Haderlein machte Anstalten, dem impertinenten Aufdringling mal richtig die Meinung zu sagen, aber Kira hielt ihn mit einer unmerklichen Handbewegung zurück. Diesem ungebetenen Lautsprecher hier würde sie es auf eine ganz andere Art und Weise besorgen. Im Übrigen erklärte dessen Dialekt für sich genommen schon so einiges. Eine andere Erklärung schien aber ebenso möglich zu sein. »Bist du aus Haßfurt?«, fragte sie darum interessiert, was der Möchtegern-Cowboy mit einem höhnischen Zug um den Mund beantwortete.
»Nein, bin ich nicht, ich kann Auto fahren. Ich komme aus dem Land, in dem die aufrechte Mehrheit bald die Macht übernimmt. Dann könnt ihr euch eure Windräder, E-Autos und eure Solarscheiße sonst wohin stecken. Wart’s nur ab!« Überlegen grinsend feixte er.
Kira Sünkel hob die rechte Hand und tippte ihm mit ihrem Zeigefinger auffordernd auf die rot karierte Brust. »Sag mal, wer bist denn du, wie heißt du eigentlich?«, wollte sie unverblümt von ihrem Kontrahenten wissen, der die Frage auch ohne Scheu beantwortete.
»Dieter. Dieter aus Eisfeld, warum willst denn du des wissen?«
»Also gut, Diesel-Dieter aus Eisfeld. Ich hab da mal eine Frage an dich, wo du ja anscheinend ein großer Spezialist in Sachen Autos bist. Ganz ehrlich, vielleicht hast du ja sogar recht. Ich überlege tatsächlich, mein Elektroauto hier durch ein anderes, das fossilen Brennstoff nutzt, zu ersetzen. Ich habe aber noch nie so einen Verbrenner gefahren, ich kenn mich mit den Dingern also nicht aus.«
»Was, echt jetzt? Nur elektrisch?« Diesel-Dieter wurde hellhörig und sprach auf einmal geradezu leise, denn als kompetent war er in diesen unerquicklichen Diskussionen bisher noch nicht eingestuft worden. Das verwirrte ihn ein wenig, und so beschloss er, vorerst die Klappe zu halten und abzuwarten, was die Ökotante von ihm wissen wollte. Selbstverständlich würde er ihr behilflich sein, auf den Weg des Herrn, also den des Verbrenners, zurückzukehren. Alle Argumente pro E-Auto konnte er im Handumdrehen entkräften, schließlich hatte er sich ja zur Genüge im Internet informiert.
»Ich habe mir zum Beispiel sagen lassen«, hob Kira Sünkel an, »dass man Benzinautos nicht nachts, während man schläft, zu Hause auftanken kann, stimmt das? Wie oft muss man denn dann woanders tanken? Wird es irgendwann eine Lösung für das Tanken zu Hause geben? Ich meine, ich tanke ja meinen Strom immer daheim, während ich schlafe. Ich bin ja jetzt auch nur hier, weil ich meinem Kollegen einmal zeigen möchte, wie das Laden an einer öffentlichen Ladesäule funktioniert. Ansonsten bräuchte ich Tankstellen oder Ladesäulen ja gar nicht.« Es folgte eine kurze Pause, in der sie Diesel-Dieter mit fragendem Blick fixierte, der war ob der unerwarteten Fragestellung aber erst einmal abgemeldet. Also machte Kira nahtlos weiter. »Dann die Frage des Unterhalts, Dieter. Welche Teile müssen bei einem Verbrenner denn so gewartet werden und wie oft? Der Mann im Autohaus erwähnte literweise Öl im Motor und irgendwelche Zahnriemen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, sowie einen Kasten mit Zahnrädern drin, damit man zwischen irgendwelchen Gängen schalten kann. Was für Öl, was für Gänge, was für Zahnräder? Was ist das für ein Zeug? Wie viel wird denn so ein Ölwechsel überhaupt kosten? Und was passiert danach mit dem alten Öl? Wenn ich mir deine klobige Kiste dort drüben anschaue, kostet dich ein Ölwechsel doch bestimmt eineinhalb Monatsgehälter oder mehr, sehe ich das richtig?«
Diesel-Dieter schaute zu seinem Pick-up und wusste nicht, wie ihm geschah. Er brachte nur ein hilfloses »Äh … na ja … schon« zustande. Dann überschlug er sicherheitshalber, was der Ölwechsel bei seinem Pick-up das letzte Mal gekostet hatte. Das verbrauchte ein Gros seiner verfügbaren Rechenleistung – und Zeit, die Kira nutzte, um im gleichen Duktus fortzufahren.
»Außerdem halten diese Benzinautos angeblich nur durch die Bremsen an. Also nicht durch Rekuperation, in der der Motor bremst und Energie zurückgewinnt. Die Bremsen verschleißen dadurch viel schneller. Wie lange halten die denn so bei deiner schwarzen Schachtel im Vergleich zu unserem Auto hier, wo die Bremsscheiben mindestens hundertzwanzigtausend Kilometer lang nicht gewechselt werden müssen? Bekommst du bei deinem schwarzen Schlitten eigentlich Kraftstoff zurück, wenn du bremst oder bergab fährst? Mein Auto lädt sich von selbst wieder voll, wenn ich den Berg runterfahre.«
Der Cowboy kam jetzt gar nicht mehr mit und hatte größte Schwierigkeiten, seine Verbrennergedanken zu sortieren, was sich in einem aggressiven, aber gleichzeitig hilflosen »Äh … laden? Berg? Was redest du da für eine Scheiße?« entlud.
»Scheiße? Ich rede Scheiße? Das Verbrennerauto, das ich Probe gefahren habe, schien außerdem so eine seltsame Verzögerung zu haben. Immer wenn ich das Gaspedal durchgetreten habe, dauerte es, bis es anfing zu beschleunigen. Das war wirklich total bescheuert, vor allem beim Überholen. Ist das bei Verbrennern normal? Außerdem zahle ich zurzeit etwa drei Euro auf hundert Kilometer für die Fahrt mit diesem Elektroauto hier. Jetzt habe ich kürzlich gehört, dass Benzin bis zu achtmal so viel kosten kann. Stimmt das?«
Diesel-Dieter war völlig überfordert. Der Wucht einer solchen Faktenflut war er nicht gewachsen. Wo hatte die Tussi den ganzen Scheiß überhaupt her? Die Mechanik seines Denkapparates schaltete wegen Überlastung auf Stand-by, und seine Hand, deren Impulskontrolle bislang vom präfrontalen Kortex aufrechterhalten worden war, verschwand in der Gesäßtasche und holte die Marlboro-Zigarettenschachtel hervor. Entnervt steckte er sich eine davon, es war die letzte ihrer Art, ins Gesicht. Dort verblieb sie ungefähr eins Komma acht Sekunden lang, bis Kira Sünkel, die jetzt so richtig in Fahrt war, die Marlboro dem Mundwinkel wieder entrupfte und gnadenlos in den Teer trat.